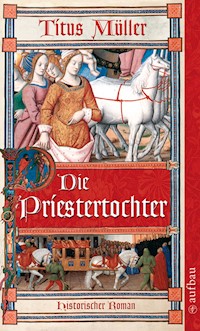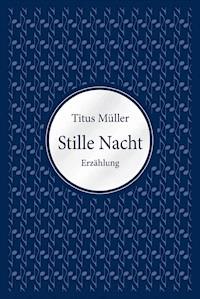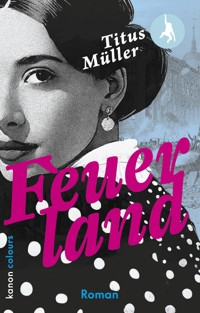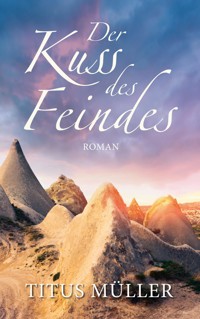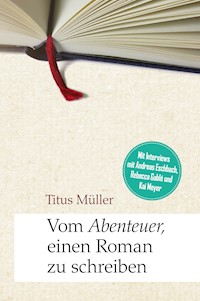
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Nach zwölf Romanen gibt Erfolgsautor Titus Müller in diesem Band die Essenz seiner eigenen Schreiberfahrungen wieder, mit Leidenschaft, einem Augenzwinkern und vielen anschaulichen Beispielen aus der eigenen Schreibpraxis. Ein Buch sowohl für Schreibanfänger als auch für fortgeschrittene Autoren, die sich ihrer Fähigkeiten wieder versichern wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Vom Abenteuer, einen Roman zu schreiben
Stimmen zum BuchEinen wilden Roman einfangen und zähmen Trotz Selbstzweifeln produktiv zu sein Warum brauche ich so lange, bis ich »drin« bin? Wie verhindere ich, dass mich der innere Kritiker lähmt? Wie erzeuge ich Spannung?Das Überarbeiten Erzeugen einer fiktionalen Realität Die SpracheFigur und Identifikation Was ist zuerst da: Die Figuren oder der Plot? Identifikation Wie Fragen einen auf die Fährte bringen Der Name Am Ende ein anderer Mensch Das VeröffentlichenSelbstmarketing TV, Radio und Zeitungen Kinowerbung Lesungen Interview mit Andreas EschbachInterview mit Rebecca GabléInterview mit Kai MeyerAnhang I: Kann man das Schreiben lernen?Anhang II: Sonderfall historischer RomanQuellenImpressumStimmen zum Buch
»Weit mehr als nur ein Leitfaden zum Schreiben. Titus Müller versteht es auf meisterhafte Weise, seine Tipps und Erfahrungen in Geschichten zu packen. So liest sich das Buch nicht wie ein Ratgeber, sondern eher wie ein Roman.«
Birgit-Cathrin Duval
»Hätte ich diesen Ratgeber vor all den anderen gelesen, wer weiß, womöglich säße ich inzwischen am siebten Bestseller.«
Birgit Jennerjahn-Hakenes
»Locker, leicht lesbar und oft auch witzig. Eine ebenso vergnügliche wie lehrreiche Lektüre für angehende Autoren.«
Hans-Peter Roentgen
»Beim Lesen merkt man schnell: Das Buch ist jeden Penny wert.«
Jörg S. Gustmann
Autor
Titus Müller, geboren 1977, studierte in Berlin Literatur, Mittelalterliche Geschichte und Publizistik. Mit 21 Jahren gründete er die Literaturzeitschrift ›Federwelt‹. Seine zeithistorischen Romane wie ›Tanz unter Sternen‹ (2011), ›Nachtauge‹ (2013) und ›Der Tag X‹ (2017) begeisterten viele Leser. Titus Müller lebt heute mit seiner Familie bei München, ist Mitglied des PEN-Clubs und wurde u.a. mit dem C.S. Lewis-Preis und dem Sir Walter Scott-Preis ausgezeichnet. Im Herbst 2016 erhielt er den Homer-Preis. »Titus Müller ist der Meister der spannenden Verbindung geschichtsträchtiger Themen mit fiktiven Schicksalen«, urteilte der Wiesbadener Kurier, und der NDR 4 bezeichnete 2015 Titus Müllers vorletzten Roman als »eine historische Momentaufnahme voller Leuchtkraft«. Weitere Informationen unter www.titusmueller.de.
Einen wilden Roman einfangen und zähmen
Ein Autor muss wissen, was er mit seinem Buch will. Ob das erkannt wird, ist eine andere Frage, aber er muss es wissen.
Klaus Wagenbach
Sportstunde in der sechsten Klasse. Unser Lehrer hat eine Neuerung eingeführt: Zu Beginn jeder Stunde sollen zwei Schüler Gymnastikübungen zu Musik vorführen, die alle anderen mitzumachen haben.
Ich besitze kein gutes Verhältnis zu meinem Körper. Wegen meines Rundrückens und der seitlich verkrümmten Wirbelsäule fühle ich mich als Krüppel. Aber es ist unausweichlich: Die Reihe kommt an meinen Freund Thomas und mich. Ich überrede ihn, die Übungen allein vorzumachen, während ich im Gegenzug die Musik auswähle. Dem Sportlehrer leuchtet unser Geschäft nicht ein. Er sieht nur, dass ich mich nach dem Auflegen der Schallplatte weiter bei der Musikanlage herumdrücke. Ich werde angewiesen, gefälligst mitzumachen. Mir bricht der Schweiß aus. Mit hochrotem Kopf verrenke ich mich vor den anderen, während mir das Turnzeug am Leib klebt.
Alles Körperliche ist mir damals verhasst. Ich schäme mich im Schwimmbad, weil man meine Rippen zählen kann und ich dünne Arme habe. Wenn irgendwo getanzt wird, haue ich ab. Selbst Umarmungen erschrecken mich.
So hätte es weitergehen können, mein Leben lang. Aber ich bin dabei nicht glücklich. Als Student nehme ich mir vor, diese verlorenen Lebensbereiche zurückzuerobern. Ich gründe mit Freunden eine Theatergruppe und übe, auf der Bühne nicht nur zu reden – das konnte ich schon immer –, sondern auch zu spielen und meinen Körper einzusetzen. Außerdem beschließe ich, Tanzen zu lernen. Ich werde ausgelacht. »Du und Tanzen? Nicht in hundert Jahren!«
Vor der ersten Tanzstunde, auf dem Weg in den Tanzsaal, stolpere ich und falle meinem Vordermann in den Rücken. »Das fängt ja gut an«, stoße ich zwischen den Zähnen hervor. Ich habe gehörig die Hosen voll. Die Tanzlehrerin beginnt, den Langsamen Walzer zu erklären, und fordert uns zu einer einfachen Schrittfolge auf. Mir bricht der Schweiß aus wie in der Sportstunde damals. Ich habe das Gefühl, dass mich alle beobachten, dass ich auffalle, weil ich besonders ungelenk bin und eine Lachnummer abgebe beim Versuch, ihre Schritte nachzuahmen.
Trotzdem bleibe ich dabei. Ich beende den Anfängerkurs, den Fortgeschrittenenkurs, mache Bronze, Silber, Gold, Gold Star. Heute ist Tanzen für mich ein Vergnügen. Ich habe mit meinem Körper Frieden geschlossen.
Mit dem Schreiben muss ich denselben Weg gehen: Anfangs fühle ich mich ungelenk und bin vom eigenen Text peinlich berührt – auch nach zwölf mit Erfolg veröffentlichten Romanen geht es mir nicht anders, ich schreibe und will das Geschriebene sofort wieder einstampfen. Aber ich tue es nicht. Ich fange mir den wilden Hengst, und er darf wild sein zu Beginn, es ist seine Natur, ich akzeptiere sie. Ist der Rohentwurf zu Papier gebracht, zähme ich ihn mit viel Geduld und Zeitaufwand. Darum geht es in diesem Buch: Wie man einen wilden Roman einfängt und zähmt.
Eine gute Portion Abenteuerlust gehört dazu. Wer mit dem Schreiben vorankommen will, darf nicht einfach bei dem stehenbleiben, was er schon kann. Er muss sich ausprobieren. Als Vierzehnjähriger habe ich mit der Schreibmaschine Abenteuergeschichten geschrieben. Zwei davon habe ich kürzlich wiedergefunden. Eine Kostprobe:
Du siehst dich in der Hütte nach der Truhe um, von der die Alte gesprochen hatte. Und wirklich, in einer dunklen Ecke siehst du eine mit hübschen Schnitzereien verzierte, alte und eingestaubte Truhe stehen. Sie sieht richtig geheimnisvoll aus. Als du das alte Dachsfell, was auf ihr liegt, hinunternimmst, blickt dich mit scharfen Augen ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln an, welcher auf die Truhe gezeichnet ist. Unter ihm siehst du ein reichverziertes Wappen mit einem Wolf darauf und eine Fahne mit dem selben Zeichen. Vor der Truhe hängt ein dickes, altes Schloss.
Als Siebzehnjähriger begann ich, Gedichte zu schreiben. Mit den Jahren wurden es Hunderte. Ich hatte Ahnung von Versmaß und Enjambement, von Hebungsprall und Sonettformen. Aber ich stellte fest, dass kaum jemand Gedichte liest. Und ich wollte gelesen werden. (Eines der Gedichte, Potsdamer Platz, hatte doch noch Erfolg: Es steht heute in einigen Bundesländern im Deutschbuch für Achtklässler.)
Also habe ich mich an Kurzgeschichten probiert. Im Warteraum beim Arzt sah ich, dass die Zeitschrift ›Funk Uhr‹ Kurzkrimis abdruckte. Ich kaufte ein Exemplar, zählte die Zeichen aus und schrieb einen Krimi mit exakt derselben Zeichenzahl. Es war mein erster Krimi und eine meiner ersten Kurzgeschichten. In der Redaktion der ›Funk Uhr‹ war man zufrieden (vor allem, vermutlich, weil ich die Zeichenzahl so gut getroffen hatte) und gab mir 200 Mark.
Ich war zwanzig, und ich wurde für mein Schreiben bezahlt! Ich war im siebten Himmel.
Nun wollte ich den Marathonlauf versuchen. Ich wollte einen Roman schreiben. Jeden Tag schrieb ich mindestens eine Stunde. Ich wollte herausfinden, ob ich in der Lage war, einen umfangreichen Stoff zu überschauen und die Geschichte auch zu Ende zu bringen.
Während ich noch daran schrieb, etwa ein Jahr nach meiner ›Funk Uhr‹-Veröffentlichung, fand in der Literaturwerkstatt Berlin der »Open Mike« statt. Bei diesem Wettbewerb werden Talente entdeckt. Im Zuschauerraum sitzen Lektoren, Agenten, Journalisten. Fünfzehn Nachwuchsautoren dürfen jeweils fünfzehn Minuten lang auf die Bühne, um einen Text vorzustellen. Ich bewarb mich mit einer meiner Kurzgeschichten und wurde eingeladen.
Es war Sonntagvormittag, und ich sollte als Erster lesen. Heinrich Vogler – ein Literaturredakteur des Schweizer Radiosenders DRS, der mich als Mitglied der Vorjury eingeladen hatte – erklärte mir: »Sie gehen da nach vorn, setzen sich an den Tisch und lesen, bis der Wecker schrillt. Übrigens, in Ihrem Text haben Sie ›striff‹ geschrieben, es heißt aber ›streifte‹.«
Ich bekam weiche Knie.
Rasch korrigierte ich das falsche Wort, ging nach vorn und las. Ich musste an den Wecker denken, ständig, und hoffte, diesen Absatz noch zu schaffen, und dann den nächsten. Schließlich klingelte der Wecker. Damit endete der gute Teil des Tages.
Als nach mir andere Autoren lasen, begriff ich, dass ich überhaupt nicht hierher gehörte. Ich meine nicht, dass ich keine Chance hatte, den Preis zu gewinnen. Ich meine, dass ich ungefähr so deplaziert war wie ein Mann mit einer E-Gitarre im Orchestergraben der Bayreuther Festspiele. Meine Nachfolger brachten anspruchsvolle moderne Literatur zu Gehör. Sie trugen schwarze Rollkragenpullover, und die Stimmlage, in der sie ihre Texte vortrugen, drückte Würde aus.
(Am nächsten Tag stand in der ›FAZ‹ ein Bericht über den »Open Mike«. Die drei Preisträger wurden ausführlich vorgestellt. Von allen anderen Autoren wurde nur einer erwähnt, und zwar deshalb, weil er seltsam gewesen war. Er habe ausgesehen »wie ein Start-up-Unternehmer am Neuen Markt« und habe über »die mit Honigfässchen und Wildschweinferkeln ausgestattete Märchenwelt eines Feinholzschnitzers der Grafschaft Neiße« geschrieben. Sie meinten mich.)
Sie verstehen, dass ich eine trockene Kehle bekam, oder? In der Pause ging ich auf die Toilette. Ich stellte meinen Fuß gegen die Tür, damit niemand hereinkam und mich erwischte, und dann beugte ich mich hinunter zum Waschbecken, um meinen Mund unter den Wasserhahn zu halten. Ich drehte das kalte Wasser auf und trank. In diesem Moment stieß die Tür gegen meinen Fuß. Ich gab dem Druck nach, und ein Mann kam herein. Ich wischte mir das Wasser vom Kinn. Der Mann sagte: »Hat mir gefallen, was Sie da gelesen haben. Ich werde Ihnen schreiben.«
Mir lag eine Erwiderung auf der Zunge. Haben Sie überhaupt meine Adresse? Aber ich sagte höflich danke und verließ die Toilette. Später wurde mir heiß und kalt, als meine Toilettenbekanntschaft auf die Bühne stieg, um das Fazit der Jury bekanntzugeben. Es war Alexander Fest. Er leitete damals den Alexander Fest Verlag und den Kindler Verlag. Kurze Zeit später wurde er der Chef von Rowohlt.
Ich erhielt tatsächlich Post. Meine Kurzgeschichten seien toll, aber ob ich nicht ein Romanmanuskript hätte? Ich reichte meinen erst zur Hälfte fertiggestellten Roman ein und bekam einen Vertrag zugeschickt.
Sie denken, das ist das Happy End? Alexander Fest wollte zwar mit mir zusammenarbeiten und nahm mich unter Vertrag – das Romanmanuskript aber gefiel ihm nicht. Er schlug mir vor, ich solle mit dem Roman noch einmal von vorn beginnen.
Von vorn.
Wir sprachen über die Ausrichtung des Romans, konnten uns nicht einigen, und schließlich wurde der Vertrag aufgelöst. Ich ging beim Aufbau Verlag an Bord. Gunnar Cynybulk, mein Lektor, pflügte genauso streng durch das Manuskript – als ich es wiederbekam, war es rot von unzähligen Anmerkungen. Ich schrieb um, ich schrieb neu, ich suchte andere Wörter. Und allmählich hörte der Roman auf, wild den Kopf zu werfen und auszuschlagen. Er lernte, zur richtigen Zeit zu galoppieren, zu traben, Schritt zu gehen.
Kein Zweifel, es ist gut, mutig voranzugehen und etwas auszuprobieren, auch wenn man es noch nicht beherrscht. Auf dem Weg lernt man dazu. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass jeder Roman zu Anfang ungezähmt und bissig ist, und dass ich nie ohne blaue Flecken davonkomme. Aber ich habe auch gelernt, dass sich die Mühe lohnt. Wenn der Mond scheint und auf ihrem Fell glänzt, freue ich mich über meine schönen Pferde auf der Weide.
Meine Co-Romanzähmer heißen heute Edgar Bracht (Blessing Verlag), Nicole Schol (Adeo Verlag) und Helga Preugschat (Fischer KJB), und auch nach vierzehn Jahren als hauptberuflicher Autor malen sie mir die Manuskripte rot. Was bin ich froh darüber! Jeder Roman stellt mich vor andere Herausforderungen. Das eine Pferd mag nicht angebunden werden, das andere scheut beim Anblick von Rehen, dieses verträgt keine Zügel und jenes büxt regelmäßig aus. Ich zähme sie gemeinsam mit den Lektoren, mit Geduld und Zähigkeit bringen wir ihnen Kunststücke bei.
Trotz Selbstzweifeln produktiv zu sein
Ich schweige und starre wütend vor mich hin. Lena fragt mich, was los ist, und ich erkläre ihr, dass aus dem aktuellen Romanprojekt nichts werden wird, niemals, und dass ich eigentlich gar nicht schreiben kann. Ich weiß genau: Jetzt ist es zu Ende mit dem Autorenberuf. Die ganze Zeit habe ich mich durchgemogelt und so getan, als könne ich Geschichten erzählen, aber damit ist nun Schluss. Ich werde mir einen anderen Job suchen müssen.
Lena sagt: »Das hast du bei jedem Roman.«
Verblüfft sehe ich auf. Ich kann mich nicht daran erinnern. »Wirklich?«, frage ich.
»Ja, wirklich.« Sie erinnert mich an die Tage, an denen ich ›Berlin Feuerland‹ hinschmeißen wollte, und an die, an denen ich dachte, aus ›Nachtauge‹ würde nie etwas werden.
Also ist das ganz normal bei mir? Damals habe ich’s auch geschafft. Nachdem die schwierige Phase überwunden war, hat es sogar wieder Spaß gemacht, das Schreiben, und ich mag die Bücher jetzt sehr. ›Nachtauge‹ wurde im Fernsehen und im Radio gelobt, die WAZ und etliche andere Zeitungen brachten positive Rezensionen. Auch ›Berlin Feuerland‹ ist ein gelungener, erfolgreicher Roman. Wieso war der Weg dahin so schwer?
Und geht es den richtigen Autoren nicht anders?, frage ich mich. Fließen die Geschichten nicht aus ihnen heraus, und sie tippen fröhlich Seite um Seite? So lesen sich ihre Bücher jedenfalls. Ich stelle mir vor, wie sich ein guter Autor morgens an den Schreibtisch setzt, die Finger lockert, und dann geht es los. Er tippt vergnügt los, holt sich zwischendrin einen Kaffee, tippt weiter, und am Ende des Tages hat er zehn bis zwanzig fabelhafte Seiten geschrieben, die nur noch minimaler Korrekturen bedürfen.
Erleichtert erfahre ich, was Michael Chabon in einem Interview über seine Arbeit an ›Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier und Clay‹ erzählt, dem Roman, der ihm den Pulitzer-Preis einbrachte:
Ich bin durch einige sehr schwierige Phasen gegangen, in denen ich das Gefühl hatte, die Richtung verloren zu haben. Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen wollte, (...) oder warum ich überhaupt in einer Million Jahre auf den Gedanken gekommen bin, ich könnte in der Lage sein, so ein Buch zu schreiben.
Aber das ist ja anspruchsvolle Literatur, wendet meine schlechte Laune ein. Ich schreibe Unterhaltungsromane. Den Autoren, die Unterhaltungsromane schreiben, geht die Arbeit sicher ohne größere Mühe von der Hand.
Rebecca Gablé, deren Bücher ich schätze, mailt mir:
Die meisten Arbeitstage beginnen damit, dass ich um den Schreibtisch herumschleiche und zuerst andere Dinge tue, weil mir davor graut, mit dem Schreiben anzufangen. Wenn ich dann aber einmal dabei bin, ändert sich meine Stimmung meistens recht schnell, und ich habe Spaß am Schreiben. Trotzdem wiederholt sich die quälende Einstiegsphase am nächsten Tag.
Und Kai Meyer, dessen Bücher in 30 Sprachen erschienen sind, erklärt:
Diese Hemmschwelle muss ich auch heute noch oft überwinden, meist gar nicht so sehr vor der ersten Seite des Tages, sondern nach der zweiten oder dritten. Dann fallen mir tausend Sachen ein, die ich gerade lieber tun würde, und ich fange an, E-Mails zu beantworten, im Internet zu surfen, in Zeitschriften zu blättern usw.
O ja, das kenne ich. Zuerst rufe ich E-Mails ab, lese sie aber nur – zum Beantworten habe ich schließlich keine Zeit, ich muss ja schreiben. Dann lese ich die Branchenmeldungen auf Buchmarkt.de, anschließend schaue ich bei Buchreport.de vorbei. Wichtig ist, jede Stunde auf ›Zeit online‹ zu prüfen, ob etwas Entscheidendes in der Weltgeschichte passiert. Und könnte nicht eine weitere Mail gekommen sein?
Wie verkauft sich eigentlich mein Hörbuch? Und sind die neuen Verlagsvorschauen schon online? Dieses Herumsurfen fühlt sich wie Arbeit an – schließlich hat es irgendwie mit der Bücherwelt zu tun. Aber es ist leider gänzlich unproduktiv.
Die Wahrheit ist: Das Schreiben ist harte Arbeit. Es gibt keine Tricks, diese Arbeit leicht zu machen. Ein Autor muss seinen Schreibtisch einer Menge anderer Dinge vorziehen. Und die Sache ist es wert!
Wie fühlen Sie sich nach stundenlangem Schreiben? Ich bin am Abend nach einem anstrengenden Schreibtag glücklich – und ausgelaugt, als wäre ich einen Marathon gelaufen.
Wer auf Autoren herabschaut, weil sie »nur« schreiben, hat keine Ahnung davon, was das bedeutet. Und manchmal helfen wir diesen Verachtern noch, indem wir vor Scham unseren Beruf selbst niedermachen: »Ich bin so ein Schreiberling«, sagen wir im Flüsterton, als hätte es für keinen anderen Beruf gereicht.
Respektieren Sie Ihre Arbeit! Dann werden auch die anderen lernen, sie zu respektieren. Unsere Art der Kunst ist mit nichts zu vergleichen. Wir können zu Hause formulieren, feilen, Texte reifen lassen, und dann, eines Tages, haben sie ihren Auftritt in den Buchläden. Wir können anderen Menschen die Augen für die Welt öffnen, für ihre Schönheit, für ihren Schmerz. Wir schreiben über Liebe, über Geborenwerden und Sterben, und berühren damit Tausende Leser.
»Das Schreiben wurde mir immer schwerer als anderen«, erzählte Thomas Mann dem Kollegen Gottfried Kölwel, »alle Leichtigkeit ist da Schein.« Wenn ich mir die Autorinnen und Autoren ansehe, denen ich bisher begegnet bin, fällt mir bei aller Verschiedenheit auf, dass sie sich in einem ähneln: Sie besitzen eine außergewöhnliche Zähigkeit. Sie verfolgen mit Wut, mit Leidenschaft, mit Zärtlichkeit ihr Ziel, bis das Buch fertiggestellt ist.
Seltsamerweise sind bei mir oft die Stellen, die mich viel Kraft gekostet haben und fürchterlich anstrengend zu schreiben waren, am Ende diejenigen, die flüssig zu lesen sind und nach einem vergnüglichen Sonntagnachmittag aussehen.
Warum brauche ich so lange, bis ich »drin« bin?
Die meisten Tätigkeiten lassen sich in Blöcke von einzelnen Stunden aufteilen. Entsprechend vereinbart man Termine. Wenn ich schreibe, zählt meine Uhr aber halbe Tage. Ich kann nicht kurz mal eben zwei, drei Mails beantworten und danach weiterschreiben wie vorher. Die Mails befinden sich in einer anderen Welt, und die Reise dorthin und die Reise zurück in die Romanwelt kosten mich Kraft und Zeit.
Wenn ich in 20 Minuten zu einem Termin aufbrechen muss, kann ich zwar rasch den Computer hochfahren, kann die 20 Minuten aber nicht nutzen, um eine halbe Seite am Roman zu schreiben, weil ich allein schon so lange brauche, um mir zu vergegenwärtigen: Wo bin ich? Wie riecht es, wie fühlt sich Sprühregen auf der Haut an? Warum liebt mein Protagonist diese Frau und hat doch Angst vor ihr? Was ist auf den letzten zwanzig Seiten passiert, und was geschieht auf den nächsten drei? Ich muss in die Geschichte eintauchen. Das ist ein Prozess, der länger dauert.