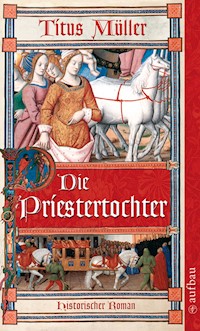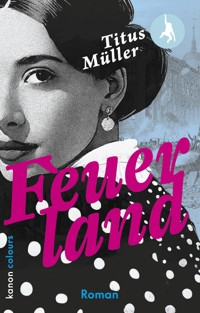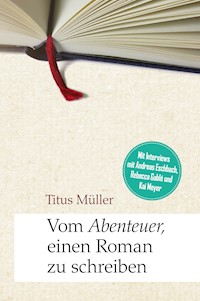9,99 €
Mehr erfahren.
"Papa, ich habe auch etwas geschrieben ...", ertönt ein zartes Stimmchen draußen im Flur. "Ja, aber nicht wie Papa am PC, sondern mit Wachsmalstift an der Tapete", ergänzt Titus Müller den Satz in Gedanken, während er rasch aufspringt und nachsieht, was sein Sohn wieder treibt. Wer Vater oder Mutter ist, weiß, wie viele nette Überraschungen jeder neue Tag mit sich bringt. Mit Kindern vergehen Jahre wie im Flug und Augenblicke werden zu Ewigkeiten. Titus Müller gelingt es meisterhaft, die besonderen Momente einzufangen, die Eltern manchmal an den Rand der Verzweiflung treiben - und bei anderen Gelegenheiten mit einem herzhaften Lachen oder Tränen der Rührung in den Augen zurücklassen. Zum Beispiel, wenn Titus und seine Frau Lena morgens viel zu spät wach werden, weil nun auch der dritte Wecker seinen Geist aufgegeben hat. Wer hatte da seine kleinen Schokofinger im Spiel? Na? Wer wohl! Das pure Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Baby-Shampoo
Ich würde für ihn sterben
Der erste Spaziergang
Steine können reden
Auf dem Erdbeerfeld
Ein Schneckengehege
Zärtlich kleine Punkte zeichnen
Die Freiheit, vom Leben alles zu erwarten
Nicht die Pflanze ärgern
Selbstzweifel
Älter werden
Die Wand bemalen
Das Entzücken an den Dingen
Das Leben ist jetzt
Wie dünnes Glas
„Bin ich auch mal tot?“
„Der Körper ist lieb“
Löwen mögen keine Kartoffeln
Forscherdrang
„Ich beschütze dich, Papa, wenn Tiger kommen“
Felix nascht Butter
Er lässt sich ein auf die große fremde Welt
Die Würde, selbst aufstehen zu können
Arbeit
Der Schrei nach Freizeit
Felix erzieht die Regenwürmer
Ungebremste Kreativität
Im Restaurant
Abschied nehmen
Über den Autor
Für Jona und Felix Amadeus,die besten Söhne, die man sich nur wünschen kann
Frankfurter Buchmesse. In den Hallen wimmelt es von Menschen. Verlagsleiter Stefan Wiesner und ich haben uns ins Restaurant zurückgezogen, dort ist es etwas ruhiger. Wir bestellen beide den Zander und plaudern über zukünftige Buchprojekte. Stefan weiß, dass ich zwei kleine Jungs habe. Er sagt: „Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug – und Augenblicke werden zu Ewigkeiten.“ Was ich davon hielte, darüber ein Buch zu schreiben?
Der Satz klingt gut. Aber die Wahrheit ist: Meine Kraftreserven sind aufgebraucht. Ständig sind die Kinder krank, wir bekommen als Eltern zu wenig Schlaf, und Freizeit gibt es auch kaum noch. „Ich weiß nicht, ob ich über das Jammern schon hinaus bin“, sage ich.
Stefan nickt. „Genau so muss das Buch beginnen.“
Baby-Shampoo
Wir sind beim Frauenarzt. Die Arzthelferin lächelt uns an. Sie sagt: „Kinder nerven. Meine zumindest. Sind Sie sicher, dass Sie welche wollen?“ Wir lachen. Sie sieht uns verschwörerisch an, als würden wir ein Geheimnis teilen, und tatsächlich wissen nur wir von diesem neuen Wesen, das in Lenas Bauch zu leben begonnen hat. Wir machen einen Termin aus, sie sagt, zu diesem Zeitpunkt werden schon die Herztöne zu hören sein. Ich weiß, wenn ich diese Töne höre, wird sich für mich alles verändern.
In den Kalender schreibe ich für den 18. Januar 2013: „Herztöne XXX.“ Ich weiß ja den Namen noch nicht.
Später kommt Lena verzweifelt zu mir ins Arbeitszimmer. „Ich hab Hunger, aber ich weiß nicht, was ich essen soll. Auf nichts habe ich Appetit.“ Ich mache ihr Vorschläge. „Zu fettig, jetzt bloß nichts Fettiges“, sagt sie oder: „Das schmeckt mir nicht, da wird mir übel.“
Am Ende finden wir eine Lösung: Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Ich gehe das Nötige einkaufen. Als ich nach Hause komme, kochen wir gemeinsam Kartoffelauflauf mit Blumenkohl.
Der Nudelsalat im Kühlschrank ist schlecht geworden. Lena sagt, sie könne ihn nicht wegwerfen, dabei müsse sie sich übergeben. Also übernehme ich es, die Schüssel auszuleeren. Ist die Übelkeit nur ein Vorwand? Oder stimmt es wirklich jedes Mal, wenn sie darüber klagt?
Wir zeigen uns beim Spazierengehen gegenseitig Kinder, die wir süß finden. Die Eltern finde ich meistens überhaupt nicht süß. Als ich einmal in der Kinderecke eines Restaurants Eltern sehe, werfe ich ihnen im Stillen vor, bloß noch ihren Nachwuchs im Kopf zu haben, und sage leise zu Lena: „Hoffentlich werde ich nicht so.“
Überhaupt sehe ich plötzlich an jeder Straßenecke Mütter mit Kinderwagen. Waren die vorher auch schon da? Das muss der Brautkleid-Effekt sein: Lena wünscht sich einen Schrank voller Brautkleider, hat sie mir gesagt. Und sie möchte noch mal heiraten. Keinen anderen, beteuert sie, auf jeden Fall mich! Aber eben noch mal. Weil sie so gerne heiratet.
Vor jedem Brautladen bleibt sie stehen. Sie deutet auf die Kleider und will wissen, wie ich sie finde, und wenn ich sie schön finde, fragt sie drohend: „Schöner als mein Brautkleid?“ Lena war eine wunderschöne Braut. Natürlich ist kein Kleid schöner als ihres.
Früher wusste ich gar nicht, dass es so etwas wie Brautläden gibt. Und ich hatte keine Ahnung, dass sie überall sind! Lenas sicherer Blick entdeckt sie in jeder Stadt.
Und jetzt sehe ich Kinderwagen. Sie stehen in jedem Hauseingang, biegen um jede Ecke.
Lena ist im Bad und ruft aufgeregt nach mir. Sie steht vor dem Spiegel und begutachtet ihren Bauch. „Sieht man schon was? Oder bin ich einfach nur dick?“ Sie drückt ihr Kreuz durch, damit der Bauch sich mehr wölbt. Wie sehr sie sich diesen Babybauch wünscht!
Weil ihr die Hosen langsam zu eng werden, will sie sich neue kaufen. Ich kriege Panik. Wird das jetzt neun Monate so weitergehen? Dann wird das ein teures Dreivierteljahr.
Sie tyrannisiert mich auch mit Namensvorschlägen. Immer wieder fragt sie dieselben Namen durch, die ihr gefallen. Lucia. Simon. Elisabeth. Elisabeth! Doch bloß, weil sie das Musical über Kaiserin Sissi so mag. Ich wünsche mir andere Namen, aber meine Vorschläge findet sie zu exotisch.
Lena erfindet Spiele wie: Man muss von A bis Z zu jedem Buchstaben seinen Lieblingsnamen sagen.
Dass wir uns bisher nicht auf einen Namen einigen können, hat sein Gutes. Ich mache mir nämlich insgeheim Sorgen: Was, wenn etwas schiefgeht, wenn wir das Kind verlieren? In den ersten drei Monaten ist das Risiko hoch. Ich habe gehört, dass jedes dritte Kind nicht das Licht der Welt erblickt. Hatte es schon einen Namen, ist der Schmerz größer, denke ich.
Dabei ist das absurd. Der Schmerz wird auch dann kaum zu ertragen sein, wenn unser Kind noch keinen Namen hatte.
Endlich ist es so weit. Der 18. Januar ist da. XXX wird zum ersten Mal zu uns sprechen. Beide konnten wir in dieser Nacht nicht schlafen. Auch aus Angst. Was, wenn man keinen Herzschlag hört? Wenn es doch nichts wird mit dem Kind?
Müde und überdreht gehen wir zum Frauenarzt. Die Praxis ist überfüllt und wir müssen lange warten. Endlich werden wir aufgerufen. Die Arzthelferin sagt: „Nur Ihre Frau, bitte. Wir nehmen ihr Blut ab, und im Labor ist kein Platz für Sie.“ Enttäuscht setze ich mich wieder hin.
Als Vater spielt man bei der ganzen Angelegenheit bloß eine geduldete Nebenrolle. Im Wartezimmer gibt es ausschließlich Frauenzeitschriften. Ich höre Lena lachen, ich höre, wie sie mit der Arzthelferin redet. Nach einer halben Stunde – keiner gefühlten halben Stunde, sondern tatsächlichen 30 Minuten, die Lena schon in den hinteren Zimmern verschwunden ist – platzt mir der Kragen. Ich will auch hören, was die Arzthelferin Lena erklärt! Ich bin einer von den zwei Menschen, die hier Eltern werden. Ich habe ein Recht darauf, mein Kind kennenzulernen! Wer weiß, vielleicht gucken sie sich schon die Ultraschallbilder an und hören die Herztöne, ohne mich?
Ich verlasse das Wartezimmer. Auf der Suche nach der richtigen Tür folge ich dem Klang der Stimmen. Da kommt mir im Flur die Ärztin entgegen und fragt mich, wo ich hinwill. „Zu meiner Frau“, sage ich. „Ich möchte auch die Herztöne hören.“
Sie weist mich streng zurück. Da sei kein Platz. Ich müsse warten.
Ich setze mich nicht zurück in den Warteraum, sondern bleibe auf der Bank beim Empfang, weil ich von dort aus alle Türen im Blick habe und Lenas Stimme und die der Arzthelferin besser hören kann. Leider klingelt dauernd das Telefon, und die Frau am Empfang macht Termine aus, das übertönt alles.
Endlich kommt Lena aus einem der Zimmer. Sie strahlt mich an. Wehe, denke ich, wehe ihr habt schon … Zu meiner Beruhigung sagt sie, die Ultraschalluntersuchung komme noch.
Wir warten wieder. Ich blättere in einer Frauenzeitschrift. Diäten, Kleider, Pflegetipps. Ich finde nichts, das mich ablenken könnte.
Wir werden ins Zimmer der Ärztin gerufen. Sie bietet Lena den Stuhl an und setzt sich gegenüber hinter den Schreibtisch. Für mich gibt es keinen Stuhl und die Ärztin entschuldigt sich nicht mal dafür. Das scheint ganz normal zu sein, wir Männer sind hier nicht so wichtig. Ich stelle mich hinter Lena.
Die Ärztin beginnt zu reden, und ich begreife, wie sehr ich mich getäuscht habe. Sie himmelt mich an. Sie sagt, solche Väter seien etwas Besonderes, die sich ins Behandlungszimmer vorkämpfen wollen. Ich hätte es ja gar nicht erwarten können, das Kind zu sehen! Das finde sie toll.
Trotzdem muss ich wieder warten, während sie Lena hinter einem Sichtschirm untersucht. Dann endlich ruft sie: „Jetzt kann der Papa kommen.“
So hat mich noch nie jemand genannt.
Mit wild pochendem Herzen gehe ich um den Sichtschirm herum. Mein Blick bleibt am großen Bildschirm hängen, auf dem ein Kind zu sehen ist, mit Armen, Beinen, Kopf und Bauch, und es bewegt sich, sein Herz schlägt. Meine Güte, so groß ist unser Kind schon!
Das findet die Ärztin auch. Sie habe geglaubt, wir wären in der achten Woche, dabei seien wir schon in der zwölften. Sie misst das Kind vom Kopf bis zum Po, schimpft ein bisschen, dass wir nicht früher gekommen sind, und trägt Lena auf, Magnesium und Folsäure einzunehmen. Von heute an sage ich immer zwei Menschen gute Nacht, nicht mehr nur einem.
Sechs Wochen später spürt Lena das Kind zum ersten Mal. Es zupft an ihr, innerlich, so fühlt es sich an. Ich lege meine Hand auf ihren Bauch und will auch etwas spüren, aber nach draußen dringt nichts davon. Lena sagt: „Als würde es denken, dass es das nicht darf, ganz vorsichtig stupst es mich nur an.“
Vor lauter Ungeduld lassen wir bei der Frauenärztin für 40 Euro einen außerplanmäßigen Ultraschall machen. Es ist ein Junge! Und er ist „sehr aktiv“, sagt die Ärztin, als er sich während der Untersuchung umdreht und ständig bewegt. Ich bin stolz auf ihn.
Lena kauft kleine blaue Strampler, kleine blaue Hosen, Baby-Sweatshirts, und, was ich kaum fassen kann, sie kauft Monate vor der Geburt Baby-Shampoo. Also, erstens ist unser Kind noch lange in ihrem Bauch. Und zweitens wird es, soweit ich weiß, nicht gerade mit einer langen Mähne zur Welt kommen. Wozu brauchen wir jetzt schon Baby-Shampoo? Ich erkenne Lena kaum wieder, sie ist doch sonst die Spontaneitätskönigin! Jetzt aber ist sie wie im Kaufrausch. Ich vermute, sie möchte das Gefühl haben, „bereit zu sein“.
Ich würde für ihn sterben
Lena bekommt einfach keine Wehen. Weil der Kleine überfällig ist, werden wir ins Krankenhaus einbestellt. Wir fahren mit der Straßenbahn hin. Lena wird ein Medikament verabreicht, aber die Ärztin glaubt selbst nicht daran, dass es etwas bringen wird. Wir sollen uns nicht zu viel erhoffen, sagt sie, bei manchen Frauen wirke es nicht. Möglicherweise zeige es nach einigen Stunden Wirkung, und falls gar nichts passiere, hätte sie noch andere Ideen.
Wir verlassen das Gebäude und setzen uns auf eine Parkbank. In einer Plastikbox habe ich Wassermelone dabei, schon fertig geschnitten, nie werde ich diese Wassermelonenstückchen und die Plastikbox vergessen. Wir haben gerade angefangen zu essen, da sagt Lena: „Wir müssen wieder rein.“
„Warum?“, frage ich und stecke mir ein weiteres Stück in den Mund.
„Wir müssen rein!“, sagt sie eindringlicher und steht auf.
Plötzlich hat sie so starke Wehen, dass sie kaum noch gehen kann. Immer wieder müssen wir stehen bleiben, und ich muss Lena stützen und ihr gut zureden, während sie vor Schmerzen keucht. Wären wir doch bloß nicht so weit gelaufen! Von wegen, es dauert Stunden.
Vielleicht hätten wir doch einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen sollen. Leider gab es keine Plätze mehr, in München sind nicht nur Wohnungen und Kindergartenplätze schwer zu ergattern.
Wir sind mit dem Atmen und Keuchen völlig überfordert, und ich weiß nicht, wie ich Lena helfen kann. Wir haben auf dem Weg zur Parkbank das gesamte Krankenhaus durchquert, diese Strecke müssen wir jetzt im Kriechtempo wieder zurücklegen.
Auf der Station wird Lena in ein Bett gelegt, und Instrumente werden an sie angeschlossen, auch auf den Bauch kleben die Hebammen etwas, das den Herzschlag unseres Jungen misst. Sie haben so etwas scheinbar schon öfter erlebt, weshalb sie ruhig bleiben, was mir weniger gelingt. Zu sehen, welche Schmerzen Lena leidet und wie schwer es ihr fällt, zwischen den Wehen überhaupt noch Luft zu holen, bestürzt mich. Ein „Wehensturm“, wie sie ihn erlebt, drängt das, was sonst Stunden dauert, zu Minuten zusammen.
Als der Herzschlag des Kindes verstummt, stürze ich panisch hinaus und rufe die Hebamme, die uns für einen Moment verlassen hat. Sie sagt, dass bestimmt nur die kleinen Saugnäpfe auf dem Bauch verrutscht sind. Wie kann sie das wissen? Man hört den Herzschlag unseres Kindes nicht mehr! Ich sehe sie so eindringlich an, dass sie doch nachsieht.
Väter wie ich sind auf Geburtsstationen bestimmt sehr beliebt. Um diesen Eindruck zu verstärken, bitte ich erneut panisch um Hilfe, als nach fünf Minuten ein weiteres Mal der Herzschlag verstummt. Warum passiert das immer, wenn gerade keine Hebamme im Zimmer ist?
Im Vergleich zu mir, dessen Leben gerade wie im Zeitraffer abläuft, bewegen sich die Hebammen mit entnervender Bedächtigkeit. Sie belächeln mich, so kommt es mir vor. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen.
Schließlich dürfen wir in den Kreißsaal. Was dort geschieht und was Lena leistet, erscheint mir wie ein Ringen um Leben und Tod. Die Hebamme merkt, wie das Kind im Bauch auf die verschiedenen Haltungen reagiert, manchmal wird der Herzschlag schwächer, deshalb gibt sie Lena entsprechende Anweisungen. Die Nabelschnur hat sich um den Hals des Kindes gewickelt, im Bauch, wo man ihm kaum helfen kann. Um Lena nicht zu beunruhigen, lasse ich mir nicht anmerken, was ich auf den Monitoren sehe, und halte ihre Hand. Noch Tage später wird mir diese Hand wehtun.
Endlich Geschrei, ein kleines nasses Wesen, viel kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, man würde es Lena auf den Bauch legen, aber weil sie genäht werden muss, gibt man mir das Wesen. Es schreit. Mir ist auch nach Weinen zumute, vor Aufregung und Erleichterung und vor Angst um das kleine Geschöpf.
Wie hält man ein Baby? Das habe ich nie geübt. Ich ahne schon, ich bin als Vater überfordert für die nächsten achtzehn Jahre.
„Hallo, kleiner Jona“, sage ich. Mit dem Kind im Arm setze ich mich in eine Plexiglaskugel, die im Kreißsaal wie eine Schaukel von der Decke hängt, und lasse ihn an meinem kleinen Finger nuckeln. Das gefällt ihm. Er wird ruhig.
„Abide with me“, singe ich, „fast falls the even tide.“ Dieses Lied verbinde ich mit Wärme und Fürsorge, mein Vater hat es für meine Brüder und mich gesungen, als wir klein waren. Jetzt bin ich selbst Vater und möchte meinen kleinen Sohn beschützen, wie mein Vater mich beschützt hat.
Lena wird genäht und auf meinem Arm liegt mit zartem, kaum spürbarem Gewicht ein neuer Mensch. Ich singe leise. Die Würde dieser Aufgabe, Vater für das Wesen in meinem Arm zu sein, überwältigt mich.
Dieser Junge, Jona, wird für den Rest meines Lebens eine der wichtigsten Personen sein, die es für mich auf der Welt gibt. Ich würde für ihn sterben.
Weil der Kreißsaal in den nächsten Stunden nicht mehr gebraucht wird, dürfen wir hierbleiben. Die Hebammen und Ärzte lassen uns allein. Im gedämpften Licht lege ich Jona auf Lenas Bauch und er trinkt zum ersten Mal in seinem Leben von ihrer Brust. Dass er das kann, ohne dass wir es ihm erklärt haben! Anschließend schläft er ein, und wir reden leise bis in die Nacht. Das Glück ist mit Händen greifbar.
Irgendwann muss ich die beiden zurücklassen und nach Hause fahren, ein „Familienzimmer“ ist im Krankenhaus nicht frei. Als ich am nächsten Morgen erwache, das Bett neben mir leer, stürzen märchenhafte Gefühle auf mich ein.
Wir haben einen Sohn.
Ich hole Lena und den Kleinen vom Krankenhaus ab. Auf dem Weg durch die Flure lächelt uns jeder an, die Patienten freuen sich, dass es hier nicht nur Schmerzen und Krankheit gibt, sondern auch neues Leben. An der Rezeption bitte ich darum, uns ein Taxi zu rufen. Aber der eintreffende Taxifahrer weiß nicht, wie man eine Babyschale auf der Rückbank befestigt. Ich weiß es genauso wenig. Ein freundlicher Patient, der gerade aus dem Krankenhaus tritt, hilft uns. Auf der Fahrt fürchte ich bei jedem Schlagloch, dass der Stoß Jona das Genick bricht. Er ist noch so ein zartes Geschöpf.
Zu Hause legen wir ihn in den Stubenwagen. Er füllt mit seinem kleinen Körper nicht mal die Hälfte davon aus. Über sich hat er jetzt einen Himmel aus weißem Stoff. Ich finde, er sollte im Nachbarzimmer schlafen, damit er sich gleich daran gewöhnt. Lena sieht mich entsetzt an, als hätte ich vorgeschlagen, ihn für die Nacht draußen vor das Haus zu stellen. Sie gewinnt die Diskussion nach kurzem Wortwechsel und er schläft in seinem Bettchen neben unserem Bett.
Mitten in der Nacht schrecken wir hoch. Jona hat pfeifend geatmet. Wir sind hellwach, schleichen besorgt um den Stubenwagen herum. Aber er schläft weiter. Also legen wir uns hin, starren in die Dunkelheit und lauschen auf seine unregelmäßigen Atemzüge. Wie kann man so lange Pausen beim Atmen machen? Endlich schlafen wir wieder ein. Nur für Minuten, scheint es. Jona weckt uns, weil er Hunger hat. Ich ahne, dass die Nächte in Zukunft anders verlaufen werden als bisher.
Am nächsten Tag kaufe ich in der Apotheke so viel Verbandsmaterial, dass der Apotheker mich misstrauisch ansieht und fragt: „Das ist aber unter ärztlicher Betreuung, oder?“ Er denkt wohl, ich habe einen Kriminellen mit einer Schusswunde bei mir zu Hause versteckt. Dabei ist es nur meine Frau, die sich vorzeitig selbst aus der Klinik entlassen hat.
Nachts wieder ein Schock. Jonas Atem rasselt. Die erste Lungenentzündung? Wir klingeln eine befreundete Kinderkrankenschwester aus dem Schlaf. Sie besänftigt uns. Das könne ein kleiner Rest Milch in seinem Hals sein. Jedenfalls kein Grund, einen Krankenwagen zu rufen.
Was sind wir froh über Erfahrene wie sie, auch über die Nachsorgehebamme, die uns regelmäßig besucht und Jona wiegt und begutachtet und unsere Fragen beantwortet. Es kommt mir so vor, als hätte man mich unvorbereitet in einen Hubschrauber gesetzt und ich müsste das Ding jetzt nach Berlin fliegen.
Jona wächst. Er trinkt und schaut und schläft und lauscht. Die Lichtflecken, die von der Sonne durch das Fenster geworfen werden, faszinieren ihn genauso wie das Tschilpen der Spatzen draußen im Gebüsch. Als er groß genug ist, fängt er an, sich selbst Aufgaben zu stellen. Er wirft ein Spielzeug so weit von sich weg, dass er es nicht mehr erreichen kann, streckt dann das Ärmchen danach aus und versucht hinzukommen. Was nicht leicht ist angesichts der Tatsache, dass er nur zentimeterweise kriechen kann, und das auch nur rückwärts. Also bleibt ihm bloß eines übrig: Er muss die Aufgabe delegieren. An uns. Er schreit, als habe er schreckliche Schmerzen, bis wir ihm das Spielzeug bringen. Sofort ist er ruhig und denkt entzückt darüber nach, wo er es als Nächstes hinwerfen könnte.
Schließlich kann er etwas Neues. Nein, nicht Krabbeln oder Sprechen oder so etwas. Er presst die Lippen zusammen und pustet Luft hindurch. Das ist eine wichtige Fähigkeit! Wenn er später mal etwas Schweres anhebt, kann er sie gut gebrauchen. Oder falls er Trompete spielen will. Oder wenn er einmal in der Wohnung steht und sich fragt, in welchem Bücherregal das gesuchte Buch steht. Für alle diese Zwecke übt er fleißig und pustet mir ins Gesicht.
Alles, was wir wie selbstverständlich mit unserem Körper anstellen, haben wir auf diese Weise gelernt. Zu greifen. Die Lippen zu spitzen. Gegen helles Licht anzublinzeln. Vertraute Stimmen wiederzuerkennen.
Je lebhafter Jona wird, je mehr Bewegungsfreiheit er sich erobert, desto deutlicher wird uns, dass unser Leben nicht weitergehen kann wie bisher. Noch versuchen wir, den Alltag so fortzuführen wie vor seiner Geburt, aber meist muss einer von uns seine Arbeit unterbrechen, und dann heißt es: „Hältst du ihn mal kurz?“
„Geht nicht, ich muss gerade …“
Neulich hatte Lena einen Einfall, sie fragte: „Würdest du bitte Jona beschützen?“
Gleich ging mir das Herz auf. Ich nahm ihn und drückte ihn an mich und sagte ihm: „Ich beschütze dich, mein Kleiner.“ Es machte mich stolz und stark. Was Worte ausmachen! Im Grunde tat ich nichts anderes als vorher, ich hielt ihn „mal kurz“, wobei „mal kurz“ meist eine Untertreibung ist, das sagen wir nur, um den anderen herumzukriegen und uns eine halbe Stunde Freiraum zu verschaffen.
Mit neun Monaten übt Jona etwas Entscheidendes: Er hustet bemüht, und dann grinst er, als habe er etwas Großes vollbracht und erwarte unser Lob.
Kurz darauf gelingt es ihm, freihändig zu stehen. Er guckt dabei ungläubig, wankt kurz und steht dann noch ein paar Sekunden, bevor er wieder auf seinen Hintern plumpst.