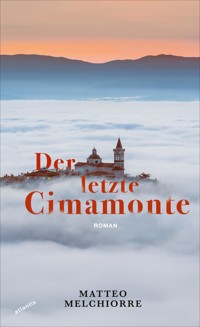
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Er ist der letzte Nachkomme einer untergehenden Adelsdynastie. Sein Anwesen, seit Jahrhunderten im Besitz der Familie, erhebt sich über dem Dorf in den Bergen, wo man ihn scherzhaft den »Duca« nennt. Ganz allein in der Villa, die viel zu viele Zimmer hat, versenkt sich der junge Mann am liebsten in alte Familienschriftstücke – ein Leben außerhalb der Zeit und in seliger Ruhe. Bis eines Tages Nelso aus den Bergen herunterkommt und ihm die Nachricht überbringt: Oben im Val Fonda ist jemand dabei, seinen Wald abzuholzen. Unerwartet beginnt sein Cimamonte-Blut zu kochen ... Der letzte Cimamonte erzählt von einem uner bittlichen Kampf um 60 Kubikmeter Holz mit dem Emporkömmling des Orts, dessen Vater nur zwei Kühe besaß. Unversehens stehen sich in dem kleinen Bergdorf aristokratische Werte und Moderne gegenüber. Die geheimnisvolle junge Frau aber, die eines Tages im Garten der Villa auftaucht, sorgt für eine über raschende Wendung, und der Duca beginnt zu erkennen, dass das, was für die Ewigkeit zu gelten schien, einmal zu Ende gehen muss. Matteo Melchiorres Roman, klassisch und doch ganz neu, episch und politisch, stürmisch und philosophisch, bringt die mächtige Vergangenheit in einer drängenden Gegenwart zutage und zieht mit einer ausgesuchten, schwingenden Sprache in den Bann. Ein Buch, das man nur schwer aus der Hand legen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matteo Melchiorre
Der letzte Cimamonte
Roman
Aus dem Italienischen von Julika Brandestini
Atlantis
Motto
»Diese alten, beinahe verlassenen Palazzi betrachte ich immer aus der Ferne, wie ein Trugbild des Trostes, der Vertrautheit, des Wohlgefühls: von Stabilität im Leben.«
Antonio José Branquinho da Fonseca, »Der Baron«
I.Der Rücken des Drachen
Erstes Kapitel
Es waren etwa zehn Krähen. Sie schimpften. Kreischten.Flatterten herum. Blindwütig, zornig. Sie flogen wild kreisend in einem wütenden Gedränge hoch, sich aufeinanderstürzend. Dann plötzlich zerstreuten sie sich, stoben in verschiedene Richtungen davon, und im leer gefegten Himmel blieb ein einziges wirres Flügelschlagen zurück, ein zankendes Bündel, das sich drehte, herumwirbelte und schließlich, wie von einem Gewehrschuss getroffen, Schnabel voran ins Leere stürzte.
Doch kaum war dieses Bündel auf dem Boden gelandet, genau im Hof der Villa, erkannte ich einen Mäusebussard: offener Schnabel, grausamer Blick, gesenkte Flügel. Er drückte mit den Krallen eine schwarze junge Krähe zu Boden; die schlug mit den Flügeln, verdrehte den Kopf, wand sich in Qualen, zuckend, um sich zu befreien.
Ich fand es richtig, einzuschreiten. Ich hob eine Handvoll Kies auf und ließ ihn in Richtung dieses dramatischen Kampfs regnen, in der Hoffnung, er würde sich so ohne Blutvergießen auflösen. Der Mäusebussard war davon kaum beeindruckt. Er schlug zweimal mit den Flügeln, flog auf, schleppte die Krähe mit sich fort, einen Halbkreis über den Häusern von Vallorgàna beschreibend, und kurz darauf war er in der Ferne verschwunden, mit den kahlen Wäldern der Berge verschmolzen.
Der Fall schien mir ungewöhnlich, geradezu wundersam. Üblicherweise ist der Ausgang der nicht selten stattfindenden Gemetzel zwischen Bussarden und Krähen im Himmel über Vallorgàna ein anderer, grausame Auseinandersetzungen, die einen althergebrachten Groll vermuten ließen. Sobald die Krähen den Ruf des Mäusebussards am Himmel hören, steigen sie wie von der Leine gelassen auf. Sie umkreisen den Bussard, schreiend und Volten drehend, attackieren ihn mit dem Schnabel, der Reihe nach, in einem fort. Der überraschte, ungläubige Raubvogel, in der Linie seines Fluges für einen Augenblick gestört, schlägt ungeschickt mit den Flügeln. Doch schließlich kommt der Augenblick, in dem sich eine Lücke auftut und er nach oben schießt; denn dort oben, im freien Himmel, gibt es eine Grenze, die der Bussard überfliegt, der die Krähen sich nicht einmal zu nähern wagen. Ist diese Grenze erreicht, steigt er mit gespannten Flügeln auf, schwebend, während die Krähen sich zerstreuen. Sie ziehen Siegeskreise und sinken langsam wieder herab, zufrieden, in ihre alltäglichen Lagen.
Das ist die Regel, weshalb man im Himmel über der Villa, auf den Wiesen rund um Vallorgàna und in den Wäldern, die im gesamten Val Fonda wuchern und die Berge hinaufklettern, die Krähen inzwischen nicht mehr zählen kann. Darüber hinaus sind sie unverschämt und anmaßend. Spielen sich als Herren auf. Sie kreuzen den Himmel in Scharen. Flitzen im Tiefflug dahin, dicht über der Wiese oder um die Häuserecken. Sie gleiten dahin, wo es ihnen gefällt. Sie picken auf den Feldern. Sitzen aufgereiht auf Zäunen. Rufen sich etwas zu. Wühlen unter den Hecken. Setzen Posten auf Dächer und die höchsten Bäume. Kurz, sie überwachen das Gelände, und jede Grenzüberschreitung wird gnadenlos geahndet.
Ich dachte also, wie die Dinge lagen, dass die vornehme Gleichgültigkeit der Mäusebussarde sich an diesem Tag, bei diesem aufsehenerregenden Zwischenfall in Rebellion verkehrt hatte, weil auch sie, die Mäusebussarde, und das ist verständlich, das herrische Gebaren der Krähen satthaben mussten. Die Auflehnung ist plausibel, sagte ich mir, doch ein Mäusebussard, der im Flug eine Krähe greift, sie mit sich in die Tiefe reißt, sie an den Boden nagelt und schließlich mit sich fortschleppt, bleibt dennoch eine außerordentliche Tatsache: Nie zuvor gesehen, noch nie davon gehört.
Deshalb schien mir, dass in einem solch ungewöhnlichen Vorkommnis auch etwas wie eine Weissagung liegen konnte; doch natürlich maß ich dem keinerlei Bedeutung bei. Ich nahm einen Armvoll Zweige und dickere Holzstücke vom Stapel, ging zurück in die Villa, befüllte den Kamin in der Küche, das heißt den ältesten all der alten Kamine der Villa, und wartete, bis die Flammen aufschlugen.
Doch wie es häufig in den Wochen der Unentschlossenheit zwischen Herbst und Winter geschieht, blieb mein Feuer schwach, zögernd. In der schwarzen Öffnung des Kamins erblickte ich nicht das behagliche häusliche Inferno des Winters. Stattdessen wehte mich ein Hauch Melancholie an.
Da hörte ich, wie es an einer der Fensterscheiben klopfte. Und dort, hinter dem Glas, stand Nelso Tabióna. Er betrachtete mich schweigend, einem gewissen Prinzip der Diskretion folgend, das er sich selbst auferlegte. Er fand tatsächlich, dass es angemessen wäre, so auf sich aufmerksam zu machen. Er kommt in den Hof, späht in die Fenster im Erdgeschoss, eins nach dem anderen, methodisch, und wenn er mich endlich entdeckt, bleibt er da stehen und wartet schweigend. Wenn ich ihn bemerke, gut. Wenn nicht, dann klopft er eben mit den Knöcheln an die Scheibe. Einmal habe ich Nelson mit gebührendem Respekt zu sagen versucht, dass diese Methode vielleicht ein wenig fragwürdig sei. Er war beleidigt. Seiner Meinung nach lag hier keineswegs Dreistigkeit vor, sondern lobenswerte Rücksichtnahme, ausnehmende Diskretion.
Nelso, und in Vallorgàna sagt man, dass dies in der Natur aller Tabiónas liege, ist kein Mann, der in Erwägung zöge, er könne sich irren, der an sich zweifeln würde, an den eigenen Einstellungen oder Handlungen. Demzufolge neigt er sowohl zu großen Taten als auch dazu, sensationelle Geschichten über sie zum Besten zu geben; und auch das wird im Dorf den ererbten, charaktereigenen Instinkten der Tabiónas zugeschrieben. Wenn Nelso erzählt, er habe einen Hirsch gesehen, ist es ein Hirsch mit einem Geweih, das an Größe diejenigen aller anderen Hirsche der Welt übertrifft. Wenn er einen Baum gefällt hat, ist er so groß, dass niemand außer ihm, dem König der Holzfäller, sich träumen ließe, es mit ihm aufzunehmen. Es kann vorkommen, dass er in die Berge fährt, im Jeep, ohne Schneeketten, bei dichtem Schneefall, und mit dem Anhänger voller Holz an einer Stelle wendet, wo nicht einmal eine Schubkarre hätte umdrehen können.
So einem Mann, im Übrigen der Mensch, der mir im Dorf am vertrautesten ist und der noch dazu, als genüge diese Aura der großen Taten nicht, ein Alter erreicht hat, dass er mein Vater sein könnte, wie er gern betont, so einem Mann, sagte ich, muss man bereit sein zuzuhören und die eigene Bedeutungslosigkeit einzugestehen. Einerseits, und andererseits sollte man doch auch Standhaftigkeit, Entschlossenheit und Nützlichkeit demonstrieren, denn ein nicht standhafter, nicht entschlossener, nutzloser Mann ist in Nelsos moralischem System die schlimmste aller Schanden.
Deshalb bedeutete ich ihm an diesem Tag, nachdem er an die Scheibe geklopft hatte, einzutreten und stellte dabei eine gewisse herrische Forschheit zur Schau. Nelso deutete auf seine schmutzigen Bergschuhe, die Wollmütze, die Militärjacke, die Zigarette in der Hand. Er schüttelte den Kopf. »Reinkommen!«, sagte ich zu ihm. Also drückte er die Zigarette an der Schuhsohle aus, steckte den Stummel in eine seiner Jackentaschen und trat ein.
In seinen Augen lag ein Hauch von Streitlust und Ärger. Offensichtlich erwartete er, dass ich ihn zahm und scheu dazu befragen würde, was ihn bewegte. Doch ich wollte ihn herausfordern. Kaum hatte er sich an den Tisch gesetzt, erzählte ich ihm, dass ich, der ich hier vor ihm stand, obgleich seiner Gegenwart unwürdig, kurz zuvor etwas gesehen hatte, das er nicht nur niemals erlebt hatte, sondern sich auch nie hätte träumen lassen. Und nachdem solcherlei Provokationen Nelsos Blut wie nichts anderes in Wallung brachten, schloss er die Augen und schüttelte den Kopf. »Von wegen!«, sagte er.
Ich erzählte ihm von dem Krähentumult oben am Himmel, wie das Bündel aus Krähe und Mäusebussard zu Boden stürzte; wie der Mäusebussard die Krähe im Hof zur Erde drückte, wie ich eine Handvoll Kies warf und der Mäusebussard mit der Krähe in den Krallen davonflog.
Konnte Nelso Tabióna mir vielleicht einen, wenngleich minimalen, Erfolg zugestehen? Sicher nicht. Er sagte, das sei unmöglich: Zehn Krähen gegen einen Mäusebussard, daraus gingen die Krähen als sichere Sieger hervor; und gewänne aus Versehen einmal der Bussard, wäre es doch undenkbar, dass ein Bussard, zugegeben ein starker Vogel, einen schweren Vogel wie eine Krähe in die Luft hebt und sie fortträgt wie eine Maus.
Doch ich beharrte darauf, sagte zu Nelso, dass ich sicher sei, gesehen zu haben, was ich gesehen hatte, und fügte auch meine Erklärung an: Der Mäusebussard hatte sich rechtmäßig gegen die sich allzu herrisch gebärdenden Krähen an unseren Himmeln erhoben.
Zu meiner Überraschung erklärte Nelso da, wenn es einen einheimischen Vogel gäbe, der sich gegen die Krähen auflehnen könne, wäre es sicher nicht der Mäusebussard; weiterhin gab er zu, dass ich nicht irrte, wenn ich sagte, dass die Krähen sich herrisch gebärden, denn die zahlenmäßige Zunahme der Krähen sei unübersehbar. Und die sei, so Nelso, eine Neuigkeit der letzten Jahre, eine der vielen Folgen, die ihm natürlich im Einzelnen bekannt waren, der schlimmen Zeiten, in denen wir lebten. »Auch du wirst bemerken«, sagte er zu mir, »dass in Vallorgàna eine Beerdigung die andere jagt. Wir gehen. Die Krähen kommen. So sieht es aus.«
Dann fügte er hinzu, dass wir es in diesen schlimmen Zeiten mit Krähen zu tun hätten, die darüber hinaus ganz anders seien als die früheren. Unsere seien mutiger, listiger, verwegener, Krähen, in deren schwarzen Augen die Flamme einer verächtlichen Intelligenz loderte und in deren Flügelschlag sich eine neue Boshaftigkeit zeigte. Aus diesem Grund sollten wir es, laut Nelso, so machen »wie unsere Alten«.
Ich fragte ihn darauf, was unsere Alten denn getan hatten. »Sie stellten sich gut versteckt mit dem Gewehr auf«, sagte er, »und im richtigen Augenblick zogen sie eine aus dem Verkehr; oder sie fingen sie mit Krähenfallen, Käfige, in die sie eine Locktaube setzten.« Nelsos Erzählung davon war detaillierter denn je. Er erklärte mir, dass unsere Alten die Krähe, wenn sie sie getötet hatten, nach Art eines Erhängten zur Schau stellten oder, noch häufiger, mit ausgebreiteten Flügeln kreuzigten. Sie befestigten diese Banner des Todes an Zweigen oder Stangen und brachten sie auf die Felder oder in die Weinberge. Und so standen diese gekreuzigten Krähen in der Landschaft, geschmückt mit Rollen aus Stanniolpapier, die im Wind wehten, in denen die Sonne reflektierte.
Als ich sagte, dies seien inakzeptable Grausamkeiten, Rohheiten, Brutalitäten, entgegnete Nelso, dass sich damit erstens die Krähen wenigstens von den Feldern und Weinbergen fernhielten und dass dies zweitens Bedingung zum Überleben sei in einer Welt, wie sie früher einmal war, wo, wer Skrupel hatte, vor Hunger starb.
Nachdem dieses Urteil gesprochen war, schaute Nelso auf die Uhr und warf die Mütze auf den Tisch: »Du hast mich über Nebensächlichkeiten palavern lassen«, sagte er. »Doch ich habe dir Wichtiges zu sagen. Machen wir es kurz. Man hat dich bestohlen, Duca. Oben in den Bergen, in deinem Wald. Man hat dich bestohlen.«
Zweites Kapitel
Ich lebte inzwischen seit zehn Jahren hier oben in Vallor-gàna, ganz allein, im Dorf meiner Großeltern, und widmete einen großen Teil meiner Tage dieser Art Beschäftigungen, die ein ziemlich beachtlicher Besitz nun einmal mit sich bringt; eines Besitzes jedenfalls, dessen Unterhaltung mir nie große Besonnenheit oder Wirtschaftlichkeit abverlangt hat. Tatsächlich verfüge ich ohne jegliches Zutun über mehr als ausreichende Ressourcen, die mir durch das außerordentliche Glück im Leben meiner Vorfahren im Laufe der Jahrhunderte in die Hände gefallen sind.
An jenem inzwischen fernen Tag, an dem ich, entschlossen zu bleiben, diese unbewohnte und kalte Behausung betreten habe, betrachtete ich lange Zeit das Wappen der Cimamontes, das als Fresko einen Saal im Erdgeschoss ziert, denn dies ist der Name meiner Familie: Cimamonte. Mir kam der Eifer des aufsteigenden Greifs, der auf dem Schild dieses Wappens abgebildet ist, unverzeihlich aufdringlich vor, obgleich es doch der Eifer war, der meine Vorfahren zu dem gemacht hatte, was sie waren, und Grund für meine Lage als überwältigter Erbe. Nicht weniger auffällig als der Jagdeifer des Greifs schienen mir auch, über dem Schild schwebend, der aufgeputzte Helm und die Verzierung mit dem zweiköpfigen Adler.
Diese Verzierung ist tatsächlich ein Beweis von großem Prestige: eine Lizenz echten Adels, die meine Vorfahren seit jenen Tagen zur Schau stellten, in denen ihnen das Wohlwollen des Kaisers Sigismund zuteilgeworden war. Das alles ist in einem echten kaiserlichen Privileg dargelegt, das in meiner Familie seit Generationen weitergegeben wird. Dort steht geschrieben, dass am 21. Mai 1412 in der Stadt Buda rex Romanorum Sigismund von Ungarn meinem Vorfahren Iohannes Antonius Cimamontius den Titel des Grafen verlieh, im Tausch gegen nicht näher bezeichnete Dienste, die jener ferne Cimamonte dem Herrscher auf Böhmischer Erde erwiesen hatte. Und so, mit dem Zeugnis von Sigismunds Privileg, konnten sich meine Vorfahren mit dem Grafentitel schmücken.
Hier in Vallorgàna jedoch nennen sie mich nicht Graf, was korrekt wäre, wenn man sich an den Brief des inzwischen vollkommen nutzlosen Privilegs Sigismunds halten wollte. Ebenso wie Nelso ziehen sie es im Dorf vor, mich Duca, Herzog, zu nennen, mir einen Titel zuschreibend, der vollkommen unangemessen ist.
Diese Höherstellung, wenn man es so nennen will, ist meinem Großvater Ausilio Cimamonte zuzuschreiben. Jener, ein Mann von außerordentlicher Vornehmheit, trat üblicherweise bei seinen Aufenthalten in der Villa in Vallorgàna mit dem Gebaren und den Ansprüchen eines Großfürsten auf. Er sprach mit den Dorfbewohnern mit derselben Zungenfertigkeit, die er auch in der Stadt bemühte, in Berua, unter seinesgleichen. Er verwaltete die Ländereien der Villa mit feudaler Härte. Er akzeptierte nicht, dass die Pächter ihm gegenüber irgendwelche Vertraulichkeiten an den Tag legten. Er hielt mit schon damals anachronistischer Hartnäckigkeit völlig veraltete, unsinnige Rituale und Anstandsregeln aufrecht.
Doch dann, mit dem Alter, wurde mein Großvater Ausilio verschroben und schwatzhaft. Er machte es sich zur Gewohnheit, zwei verschiedene Schuhe zu tragen. Er begann Osterien zu besuchen, spielte Karten mit den Dorfbewohnern. Man sagt, er wurde auch indiskret gegenüber den jungen Mädchen. Und an jedem 21. Mai, dem Jahrestag der Verleihung des Grafentitels an unsere Familie, trug er stets einen uralten Dreiteiler nach französischer Mode, den ich noch immer besitze und von dem Experten mir versichert haben, er sei typisch für die Mode des Spätbarock. Mein Großvater verbrachte diesen hochheiligen Gedenktag in Kniehose, langem Sakko und bestickter Weste.
Angesichts dieser fürstlichen Verschrobenheit fanden die Leute aus Vallorgàna, dass der Titel des Grafen einer solch großen Vornehmheit nicht entsprach. Und nachdem Marchese zu wenig und Fürst vielleicht zu viel war, erachteten sie »Herzog« für geeignet. Und so wurde mein Großvater Ausilio für die Dorfbewohner »il Duca«.
Diese Verspottung, die möglich wurde durch das allmähliche Verschwinden der Welt, in der mein Großvater gelebt hatte, war natürlich streng geheim. Sie ging von Mund zu Mund in den Höfen von Vallorgàna, in den Osterien und zwischen unseren Pächtern, doch als dies, Gott weiß wie, meinem Großvater zu Ohren kam, brach er nicht nur jeglichen Kontakt zu den Dorfbewohnern ab, sondern schrieb auch an die Kurie und gab, sich auf gewisse Artikel des Kirchenrechts berufend, seinen Verzicht auf die Schirmherrschaft über den Altar von San Pietro in der Pfarrkirche bekannt, was ganz konkret den Widerruf der Summe bedeutete, die er zuvor jährlich ebenjener Pfarrgemeinde zukommen ließ.
Nachdem mein Großvater gestorben war, setzte sein einziger Sohn, also mein Vater Achille, nur ein- oder zweimal im Jahr einen Fuß nach Vallorgàna, zu einem kurzen und absichtslosen Aufenthalt in der Villa. Im Übrigen hatte mein Vater keinerlei Interesse daran, ein Cimamonte zu sein. Die Bankannuitäten und Immobilienrendite waren mehr als ausreichend, um in der Stadt, in Berua, ein sehr respektables Auskommen zu haben und großzügig die Studien meiner Mutter zu unterstützen; und auch sie, Anna Brunner, eine österreichische Bürgerliche, die nach Charakter und Philosophie kaum zu adeliger Affektiertheit neigte, hatte keinerlei Interesse an den Cimamontes. Sie dachte an nichts anderes als ihre Bestrebungen als Ethnografin, an bestimmte afrikanische Stämme, über die sie schrieb, und an lange Studienaufenthalte in Kenia.
Und als beide, mein Vater und meine Mutter, ebendort vor fünfzehn Jahren dieses Flugzeug bestiegen, das ins Bodenlose stürzte, fand ich mich mit nicht einmal fünfundzwanzig Jahren als letzter Cimamonte in direkter männlicher Linie und Erbe eines mehr als ansehnlichen Vermögens und eines Geschlechts, das kurz vor dem Aussterben stand.
Ich war jung, orientierungslos, und darum stellte ich, wie es die Unentschlossenen häufiger tun, meinen Entschluss auf die Probe und erlegte mir einen klaren Schnitt auf. Als Erstes wollte ich mich vom Palazzo Cimamonte befreien, also unserem Wohnhaus in Berua. Ich verkaufte dieses Anwesen, das prunkvoll und riesig war, aber bedrückend und schwer zu verwalten, für eine außerordentliche Summe. Wegen gewisser Skrupel behielt ich ein kleines pied-à-terre.
Danach setzte ich meinen Plan in die Tat um: Ich verließ Berua und richtete mich hier ein, am Fuß der Berge, in der seit über dreißig Jahren unbewohnten Villa meiner Großeltern.
Ich hielt sie für den idealen Ort, um wie in der Schwebe zu bleiben und mich allmählich in den Kreislauf der alltäglichen Aufgaben hineinzubegeben, die die Villa und ihre Ländereien erforderten.
Ich hatte keinen anderen Plan, als morgens aufzuwachen und das zu tun, was jeden Tag zu erledigen war. Ich nahm das Grundstück wieder in Besitz. Ich schnitt das Unterholz, das um den Hof der Villa herum gewachsen war. Ich versuchte, wenn auch ohne großen Erfolg, einen Weinberg meiner Vorfahren wiederzubeleben. Ich fand jemanden, der sich um die Mahd meiner Wiesen kümmerte. Natürlich investierte ich das Nötige für die Instandhaltung der Villa und passte sie so weit wie möglich meinen Bedürfnissen an.
Nach den ersten legitimen Zweifeln waren die Dorfbewohner mir nicht feindlich gesinnt, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ich sie von Anfang an stets fragte, wie man die Dinge tat, welches die beste Jahreszeit sei und so weiter. Kurz, ich versuchte, von allen etwas zu lernen, und als eines Tages, seit meiner Ankunft war vielleicht ein Jahr vergangen, jemand bemerkte, dass ich inzwischen zerkratzte Hände und verhärtete Fingernägel hatte, bekam ich das Gefühl, meinen Platz gefunden zu haben. Da ließen die Dorfbewohner, die, so glaube ich, in mir eine Art seltsamen heruntergekommenen, handzahmen Adeligen sahen, den Titel wieder aufleben, den sie viele Jahre zuvor für meinen Großvater Ausilio ersonnen hatten. Ich wurde »il Duca«.
In Vallorgàna einen Spitznamen zu besitzen, ist gleichzeitig Zeugnis von Zugehörigkeit und ironische Zusammenfassung der Vorstellung, die die Gemeinschaft sich von dem Einzelnen gemacht hat; weiterhin soll er, wenn der Spitzname sich wie in meinem Fall mit dem eines Vorfahren deckt, deutlich machen, dass die Gemeinschaft nicht vergisst und dass es unmöglich ist, der Vergangenheit zu entkommen.
Indem sie mich Duca nannten, gaben die Dorfbewohner entweder zu verstehen, dass sie mich für ebenso verrückt hielten wie meinen Großvater, wenn auch von einer zwangsläufig ganz anderen Verrücktheit, oder sie verhöhnten den Niedergang meiner Familie. Ein Niedergang, der im Übrigen unübersehbar war und infolge dessen sie einen Cimamonte ohne Bedienstete und ohne Pächter zu sehen bekamen, mit zerkratzten Händen und verhärteten Fingernägeln.
Mir war jedoch vollkommen gleich, was man über mich unten im Dorf sagen oder denken mochte. Ich war überzeugt, am besten Ort zu sein, den ich mir wünschen konnte. Nichts Bedeutungsvolles geschah in meinen Tagen. Nichts Komplexes trübte meinen Blick. Nichts durchbrach meine Alltäglichkeit. Keine zu treffende Entscheidung hemmte meinen Schritt. Ich lebte in den besten Umständen, die ein Mann von meiner Natur sich vorstellen konnte: der perfekte Zustand, der Idealzustand.
Doch heute, an einem Nachmittag wie jedem anderen, kam Nelso Tabióna und klopfte an mein Fenster, um mir zu sagen, dass ich oben in den Bergen, in meinem Wald, bestohlen worden sei.
Drittes Kapitel
Fast auf dem Gipfel des Berges, der über Vallorgàna undüber der Villa thront, befinden sich mehrere Hektar Wald, der seit undenklichen Zeiten meiner Familie gehört. Der Letzte, der sich darum gekümmert und ab und an den einen oder anderen Erlös daraus gewonnen hat, war mein Großvater Ausilio. Doch nachdem er alt geworden und dann gestorben war, blieb der Wald sich selbst überlassen, und so wäre es auch geblieben, wenn Nelso Tabióna ihn nicht einige Zeit nach meinem Umzug in die Villa in Augenschein genommen hätte.
Er überschlug die Doppelzentner Buchenholz, die aus diesen Flächen zu schlagen wären, entdeckte nicht wenige Tannen und Lärchen, die reif für das Sägewerk waren, und er argumentierte, dass die alten Pflanzen, die die jungen erstickten, den Fortbestand des Waldes bedrohten. Kurzum, Nelso ahnte, dass ein stattliches Geschäft daraus erwachsen könnte. Und so taten wir uns zusammen und begannen ihn umsichtig zu lichten. Im Laufe von etwa zehn Jahren würde Nelso neuntausend Doppelzentner Brennholz und mehrere Kubikmeter Lärchen- und Tannenholz als Bauholz herunterholen, was er mir mit dem vereinbarten Anteil am Gewinn und meinem persönlichen Bedarf an Brennholz vergalt.
In Bezug auf dieses Unternehmen waren die Dinge glattgelaufen, bis zu dem Tag vor einigen Wochen, an dem der Albanese, ein albanischer Waldarbeiter, den Nelso stundenweise beschäftigt, einen Anfängerfehler beging. Während Nelso an der Seilwinde einen Tannenstamm festmachte, um ihn auf den Ladeplatz zu schleppen, hatte der Albanese die Winde in Gang gesetzt, ohne das ausgemachte Zeichen abzuwarten. Der Stamm hatte einen Ruck getan, sich von dem Stahlseil gelöst, sich wie eine Kompassnadel gedreht und ein Loch in Nelsos Schienbein geschlagen. Eine so tiefe Wunde, dass ein Stück vom Knochen abgesplittert war.
Nelso wollte den Beweis seines Unglücks erbringen. Er zog die Hose bis zum Knie hoch und sagte, dass man, wenn man mit der Hand darüberfuhr, das Loch im Schienbein noch immer fühle. Weiterhin ließ er mich feststellen, indem er die verschlossene Kerbe vorzeigte, dass die Wunde inzwischen vollkommen verheilt war; das Loch würde bleiben, da konnte man nichts machen. Ich durfte es ihm also nicht anlasten, fuhr er fort, wenn er drei Wochen lang nicht auf den Berg gestiegen war und demnach auch nicht hatte wissen können, was dort in seiner Abwesenheit geschah.
Ich sagte Nelso, er solle zum Punkt kommen, und er erzählte mir schließlich, wie er an jenem Morgen, nachdem er sich wieder in der Lage fühlte, zurück ans Werk zu gehen, hinaufgefahren war. Er erreicht den Wald. Er lädt seine Sachen aus dem Jeep und hört sofort, dass jenseits des steinigen Grats, hinter dem sich meine Wälder noch einige Hektar weit ausdehnen, fremde Motorsägen bei der Arbeit sind.
In dem Augenblick maß Nelso dem keine weitere Bedeutung bei, denn in den Bergen, wie er sagt, geschehen solche Täuschungen häufig: Durch Luftströmungen, Echos und die große Stille hat es den Anschein, als wäre die fremde Säge ganz in der Nähe, doch stattdessen kann sie in Wirklichkeit ziemlich weit entfernt sein. Und im Übrigen, fügte Nelso hinzu, wusste er wohl, dass das Forstunternehmen der Cimín nach Absprache mit mehreren Eigentümern eine substanzielle Abholzung von Buchen jenseits der Grenzlinie vornahm.
Allerdings schwiegen die Motorsägen der Cimín, sobald Nelso seine eigene eingeschaltet hatte. Er ließ eine halbe Stunde verstreichen, während der kein Geräusch mehr zu vernehmen war, und schließlich, argwöhnisch geworden von dieser plötzlichen Stille, ging er nachsehen. Er überquerte den steinigen Kamm und sah einen ganzen Streifen frisch gerodeten Wald.
Nelso wunderte sich. Er zog den Katasterplan heraus und stellte fest, wie er sagte, dass die Brüder Cimín und ihr Unternehmen gut hundert Meter in mein Gebiet eingedrungen waren, über eine Länge von mindestens vierhundert Metern. Nach Nelsos Berechnungen lagen dort mindestens sechshundert Doppelzentner Holz aufgestapelt und bereit zum Abtransport.
Obwohl ich bis dahin nicht besonders sorgfältig in der Verwaltung meiner so fernen und eher unbequemen Besitztümer gewesen war, traf mich die Neuigkeit über alle Maßen. So sehr, dass mich eine herrschaftliche Anwandlung überkam und ich Nelso auftrug, hoch in die Berge zu gehen und mir hier, in den Hof der Villa, alle sechshundert Doppelzentner zu bringen, derer ich im Begriff war beraubt zu werden.
Nelso verspottete mich. »Nein, Duca«, sagte er. »Nein, wo denkst du hin! Wo denkst du hin! Du würdest gar nichts erreichen und einen Krieg vom Zaun brechen. Und wer einen Krieg anfängt, hör mir gut zu, der ist immer im Unrecht.«
»Und was dann?«, fragte ich ihn.
»Sie bestehlen dich, nicht mich«, sagte Nelso. »Ich habe dir Bescheid gesagt. Du wirst wissen, was zu tun ist. Ich wüsste, was ich tun würde, wenn ich der Eigentümer dieser Wälder wäre. Doch da ich das nicht bin, halte ich mich raus.«
Um ihn zum Reden zu bringen, muss Nelso Tabióna hofiert und verlockt, ich würde fast sagen, verführt werden. Also hofierte ich ihn, mit sanften Worten, schmeichelte ihm, indem ich meine Unerfahrenheit betonte, verführte ihn, indem ich sein Ego streichelte. Und nach ein paar weiteren Bemühungen diktierte Nelso seine Instruktionen: »Wenn ich der Eigentümer des Waldes wäre?«, sagte er. »Ich würde zu den Brüdern Cimín gehen und die Dinge klarstellen. Ich würde sagen, kein einziger Doppelzentner dürfe den Wald verlassen. Und wenn ihnen das nicht gefällt, sollen sie die Gutachter rufen, die Landvermesser, Förster oder wen immer sie wollen. Wenn sie selbst die Grenzen nicht kennen, sollen sie sie sich zeigen lassen. Das würde ich tun.«
Ich sagte Nelso, dass ich seinem Rat folgen würde und dass die Brüder Cimín morgen von mir hören würden, und ob. Doch das Wort »morgen« klang für Nelso wie Gotteslästerung. Er sagte, morgen sei zu spät. Man müsse sich beeilen. Die Dinge sofort ins rechte Licht rücken. Jetzt.
Noch am selben Nachmittag fuhr ich also, ein wenig widerstrebend und ein wenig verbittert, zum Lagerhaus des Forstunternehmens Cimín, in ein Dorf nahe der Einmündung des Val Fonda. Ich parkte außerhalb einer Einfriedung und ging zu Fuß hinein, umrundete Holzhaufen, Berge von Zweigen, verklebte Planen und Klumpen lockerer Erde. Ein paar alte Container, Traktoren, Holzspalter aus verschiedenen Epochen und Kreissägen waren in größter Unordnung und anscheinend ohne jegliche Logik um eine windschiefe Baracke herum verteilt, von deren Schornstein Rauch aufstieg.
Und aus dieser Baracke kamen, nachdem sie mich gesehen hatten, die Brüder Cimín, zwei Männer um die dreißig, zerzaust, mit olivfarbener Haut, finster und misstrauisch. Sie traten hinaus, und sofort kam aus der Baracke auch eine freundliche, beinahe lächelnde Hündin; das musste die Kreatur sein, der die Brüder die gesamte Freundlichkeit zuteilwerden ließen, derer sie fähig waren. Während der ganzen Zeit unserer Unterredung streichelten sie ihr tatsächlich abwechselnd den Kopf, mal indem sie sich zu ihr herabbeugten, mal indem sie sie an ihre Beine hochspringen ließen.
Ich stellte mich vor. Ich gab vor, persönlich die Abholzung begutachtet zu haben, die sie am Berg vorgenommen hatten. Ich beklagte die Grenzüberschreitung. Ich sagte, es handle sich sicher um ein Versehen, das man dennoch wiedergutmachen müsse. Die beiden Brüder wirkten ehrlich erstaunt. Sie entschuldigten sich. Sie gaben an, gewissenhafte Menschen zu sein, die es nicht gewohnt seien, Fuß auf fremdes Gebiet zu setzen. Ich antwortete ihnen, dass dennoch genau dies passiert war: Sie hatten die Füße, und nicht nur die Füße, sondern auch die Motorsägen in meines gesetzt.
Die beiden Brüder sahen sich an, bis der schroffere von beiden behauptete, ich müsse mich irren. Sie waren sich ihrer Sache sicher. Sie hatten keine Grenze verletzt. Allerdings, fuhr der schroffere Cimín fort, da sie keine Lust hatten, wegen so einer Lappalie »zu streiten«, würden sie das beanstandete Holz vollständig an seinem Platz lassen; wäre ich mir meiner Behauptungen wirklich sicher, solle ich doch einen Landvermesser rufen, der die exakten Grenzlinien aufzeige.
Ich redete mich in Hitze. Selbstverständlich würde ich einen Vermesser beauftragen, sagte ich. Woraufhin der andere Bruder, der schweigsamer und verträumter war, die kleine Hündin auf den Arm nahm, ihr mit Fistelstimme irgendwelche Liebkosungen zuraunte, ihr in die Augen schaute und schließlich einen Kuss auf ihrem Kopf platzierte. Und ausgerechnet er, der Bruder, der zu solcher Zärtlichkeit fähig war, hatte schließlich das letzte Wort. Während er weiterhin seine Nina hätschelte, denn so musste das Hündchen heißen, sein »Liebling«, seine »Schmeichlerin«, sein »Sternchen«, sagte er, ich hätte wenig Grund zur Klage.
Warum? Weil die Grenzen, die sie während des Schlags zu beachten hatten, ihnen von einem Mann gezeigt worden waren, der alle Wälder des Berges kennt wie die eigene Hosentasche.
Ich fragte also, wer denn dieser große Meister sei, dieser Erleuchtete. Der schroffere Bruder lächelte und sagte kein Wort, doch der andere sprach, indem er seine Nina auf den Boden setzte, den gefährlichsten aller Namen: »Mario Fastréda«, sagte er. »Er war es, der uns die Grenzlinie gezeigt hat.«
Viertes Kapitel
Da der Name Mario Fastrédas mich sofort alarmierthatte, hielt ich es bei der Rückkehr von den Brüdern Cimín für angemessen, im Dorf in Rubinos Bar haltzumachen, wo man alles weiß, gehört hat oder wenigstens ahnt. Ich wollte Rubino zur Seite nehmen und ihn mit der gebührenden Diskretion fragen, ob er in diesem seinem Panoptikum von gewissen Rodungen oben auf dem Berg durch die Brüder Cimín hatte reden hören.
Ich konnte jedoch nicht ahnen, dass ich, sofern ich sie zu nutzen wusste, in der Bar die Gelegenheit haben würde, die Antwort auf all meine Fragen zu bekommen. Der gefährlichste aller Namen, ich spreche von Mario Fastréda, war da, er stand höchstpersönlich am Tresen. Für einen Augenblick geriet mein Blut in Wallung, doch er, Fastréda, lächelte strahlend und fragte, seiner Gewohnheit treu bleibend, mit mir nur über vollkommen Belangloses oder vorgeschobene Albernheiten zu reden, ob ich zufällig sagen könne, wie lange es wohl nicht geregnet habe.
Und da meine Antworten, auch die auf dergleichen unwichtige Fragen, seine Aufmerksamkeit nicht verdienten, ließ Fastréda mir keine Zeit und sagte nur »Wer weiß«. Er nahm die Zeitung, die auf der Theke lag, und setzte sich an einen Tisch im hinteren Teil der Bar. Als er an mir vorbeiging, roch ich sein alt gewordenes, süßliches, in gewisser Weise sonntägliches Kölnischwasser.
Nachdem ich bei Rubino einen Kaffee bestellt hatte, wartete ich also darauf, den Schwung wiederzufinden, den ich bei Fastrédas Anblick verloren hatte; ich meine den Schwung, der nötig war, um ihn, Mario Fastréda, direkt zu fragen, ob er eine Ahnung hatte, was in meinen Wäldern vor sich ging. Während ich meinen Kaffee trank, behielt ich ihn im Auge. Ich wartete darauf, dass er seinen Blick von der Zeitung hob; sobald er die Augen von seiner Lektüre abwandte, würde ich ihm mit geradem Rücken entgegentreten.
Doch Fastréda las mit großer Konzentration die Zeitung, flüsternd mit den Lippen jedes einzelne Wort formend, diese ernste Übung von Zeit zu Zeit unterbrechend, um den Zeigefinger zum Mund zu führen und mit episkopaler Erhabenheit die Seite umzublättern. Dieses eingehende Studium der Zeitung, auf das manchmal auch ein kurzer Kommentar der Nachrichten in Richtung der übrigen Gästen folgte, war die tägliche Zurschaustellung von Fastrédas Intelligenz. Intelligenz: ein charismatisches Wort für Mario Fastréda, das er bei seinen nüchternen Diskursen nicht vergaß wenigstens einmal, wenigstens am Rande zu erwähnen, wobei er sich auf sie als höchste Tugend, als größtes Machtmittel bezog. Er behauptete, selbst nicht mit dieser außergewöhnlichen, heiligen Gabe gesegnet zu sein, doch im Grunde seines Herzens war er überzeugt, sehr wohl mit Intelligenz gesegnet zu sein, und wie, mehr als alle anderen.
Diese heimliche Annahme bekam darüber hinaus durch die Tatsache ihre Berechtigung, dass Fastréda, so die einhellige Meinung aller Bewohner von Vallorgàna, eine »gebildete« Person sei. Sein Vater, Checo Fastréda, der nicht mehr besaß als zwei Milchkühe und eine Handvoll magerer Felder, hatte es tatsächlich geschafft, dem Sohn ein Studium der Maschinenbautechnik zu ermöglichen. Damals hatte ein solch verblüffender cursus studiorum auf Fastrédas Haupt geleuchtet wie eine Krone, aus ihm einen Mann von Welt gemacht, einen Prinzen der Wissenschaft. Als er seinen Abschluss in der Hand hatte, man von ihm bereits eine leuchtende Zukunft fern von Vallorgàna erwartete, kehrte Mario Fastréda, der Jahre in der Stadt verbracht hatte, zu den zwei Kühen und dem spärlichen Land seines Vaters zurück, bis er eines schönen Tages alle überraschte. Er schiffte sich an unbekanntem Ort ein und zog in die Ferne. Er segelte bis ans andere Ende der Welt und ging in Venezuela von Bord.
Das sind Dinge, von denen man in Vallorgàna noch heute spricht wie über geheime und grandiose Legenden. Jemand sagt, Fastréda sei dort Chef einer Werft geworden. Jemand anderes, dass er Gold im Schlamm irgendeines Wildbaches fand. Andere, dass er Tag und Nacht in einer von Italienern geführten Firma arbeitete. Tatsache ist, dass Fastréda nach fünf Jahren in Venezuela mit einem Koffer voll Geld ins Dorf zurückkehrte. Er war scheu und schweigsam aufgebrochen und kam selbstsicher und voller Ambitionen zurück.
Er begann zu kaufen. Ein Stück Land. Ein weiteres Stück Land. Einen Weinberg. Die Weiden oben am Berg. Etwas Wald. Er kaufte dies und das, immer nur wenig auf einmal, aber immer mit Sinn und Verstand, häufte einen mehr als ansehnlichen Besitz an. Er baute den ersten Stall. Dann den zweiten. Aus den beiden Kühen seines Vaters waren nach und nach zwanzig Tiere geworden, dann sechzig, hundert, hundertfünfzig. Dies wenigstens ist die Geschichte, die in Vallorgàna über den außergewöhnlichen Aufstieg Mario Fastrédas erzählt wird.
Während ich ihn anschaute, dachte ich daran, wie er seit meiner Ankunft in Vallorgàna vor zehn Jahren der Einzige gewesen war, der sich keinerlei Vertraulichkeiten mit mir erlaubt hatte. Soviel ich dem Geschwätz der Dorfbewohner entnehmen konnte, hielt er mich für einen »studierten und bedächtigen« Menschen, doch damit meinte er, dass ich von nichts eine Ahnung hatte und dass ich besser daran täte, da ich die Mittel dazu hatte, woanders ein Leben voller Müßiggang zu genießen als an einem hoffnungslosen Ort wie Vallorgàna.
Doch an diesem Abend, als ich ihn weiter beobachtete, ihn da sitzen sah, die Zeitung vor der Nase, sagte ich mir, dass man sich im Grunde nicht darüber wundern musste, dass ausgerechnet er, Fastréda, sich dem Abholzen von Wäldern, die nicht ihm gehörten, zuwandte. Die Berufung auf seine Einschätzung, seine Vermittlung, war für die Einwohner von Vallorgàna oder diejenigen, die wie beispielsweise die Brüder Cimín Interessen am Berg verfolgten, übliche Praxis angesichts der Vertrautheit Fastrédas mit »den Plänen« und der geschickten Milde, mit der er auf gewinnbringende Weise die Büros der Genossenschaften, der Gemeinden, der Anwälte und Landvermesser zu betreten und zu verlassen verstand.
Außerdem war Fastréda noch immer Vorsitzender der Genossenschaft, derjenige, der vor vielen Jahren die Bergstraße planen und bauen ließ und der weiterhin, in der Funktion als lebenslänglicher Alleinherrscher, über ihre Instandhaltung wachte und für sie eintrat. Es bleibt jedoch die Tatsache, dachte ich weiterhin, dass Fastréda sicher kein Mensch ist, der ohne Nutzen einen Finger rührt oder der uneigennützige Beratungen gewährt.
Er dachte wie die Bauern vor hundert Jahren, traute niemandem, gab in der Öffentlichkeit nur die allgemein vertretene Meinung zum Besten und kultivierte jenes wortkarge, einfache Wesen, das sich gut eignet, in jeder Angelegenheit ungestört und nach eigener Willkür zu agieren. Auch deshalb genoss Fastréda im Dorf und ein wenig im ganzen Val Fonda unzweifelhaften Respekt und die einzigartige und furchtsame Verehrung, die man einem Mann entgegenbringt, den man als verschlagen und stets bereit ansieht, seinen eigenen Vorteil aus jeder Situation zu ziehen.
Beweis dafür war das Unternehmen, das Fastréda mit seinen achtzig Jahren immer noch mit äußerst profitabler Diskretion selbst leitete: zwei riesige Ställe und nicht wenige Hektar vollständig eingezäunter Landbesitz, auf dem um die hundertfünfzig Stiere, Färsen und Stierkälber der Rasse »Limousin« und »Pezzata Rossa« weideten. Kurz gesagt, Fleischvieh, und aus diesem Grund sah man in regelmäßigen Abständen diese schrecklich traurigen Deportationswagen ins Dorf und auf Fastrédas Gelände fahren, diese Lieferwagen, die leer ankamen und voll wieder abfuhren, voller Färsen, Kälber und Rinder, die unausweichlich ihrem vorherbestimmten Schicksal zugeführt wurden.
Außerdem erinnerte ich mich daran, während ich ihn weiterhin im Auge behielt, dass ich mehrfach hatte sagen hören, dass man achtgeben musste, wenn es um Fastréda ging. Nicht einmal davon träumen, ihm auf die Füße zu treten, ihn nicht provozieren, ihm keine Erklärungen abverlangen, nicht zu verstehen geben, dass man glaubt, er sei im Unrecht, denn dann konnte sein produktives, nachdenkliches Schweigen sich in tödliche Bosheit wandeln.
Vielleicht war das der Grund, dass schließlich, als der erwartete Moment kam und er sein gründlich rasiertes und in gewisser Weise noch immer jugendliches Gesicht mit den schwarzen Augenbrauen und den gerade einmal grau melierten Haaren hob, mir die Augen, mit denen er mich ansah, Augen grau wie der Regen, so angriffslustig schienen, dass ich derjenige war, der den Blick abwandte. Und so verpuffte mein Vorsatz, die Dinge sofort mit dem direkten Betroffenen zu klären, ein für alle Mal.
Ich bezahlte den Kaffee, verabschiedete mich von Rubino und Fastréda. Doch Letzterer ließ sich nicht einmal zu einem Nicken herab. Seine gesamte unermessliche Intelligenz war wieder drauf gerichtet, die Silben zu murmeln, die er in der Zeitung las.
Als ich aus der Bar trat, hatte sich bereits die Dunkelheit gesenkt, schnell, wie sie Ende Oktober kommt. Ein Wind, der vom Berg herunterwehte, trug unvermittelt das Geräusch sich verkeilender Ziegenhörner in die Stille hinein, das immer deutlicher wurde, bis ich den Wettstreit aus Hörnern und Köpfen in einem Winkel der Piazza entdeckte. Die beiden Ziegen, eine weiße und eine braune, nahmen Anlauf, stellten sich auf die Hinterbeine, um sich gegenseitig, hochmütig und unbarmherzig, den nächsten Schlag zu versetzen.
Da sind sie, sagte ich mir, die heiligen Tiere Don Attilios, die von ihm Palestina und Galilea getauft worden waren. Doch man soll nicht denken, dass die beiden Ziegen unseres Herrn Pastors einzig und allein eine Schwäche mit biblischem Beigeschmack waren. Tatsächlich dienten sie Don Attilio dazu, den Streifen um das Pfarrhaus ordentlich zu halten, eine steil ansteigende Wiese, trocken und unwegsam, gerade gut für die Ziegen. Wenn diese Palestina und diese Galilea nur nicht so häufig und gern aus ihrem Gethsemane ausbrechen und durch das Dorf irren würden, was einige geflüsterte Proteste hinsichtlich ihrer Haltung provoziert, die von den meisten für zu frei und tolerant befunden wird.
Als sie meine Schritte hörte, löste Palestina, die weiße Ziege, ihre Hörner von Galilea, der braunen, und trat die Flucht in Richtung Pfarrhaus an. Galilea blieb verdattert ob dieser plötzlichen Feigheit zurück, woraufhin sie sich, als ich in mein Auto gestiegen war und davonfuhr, auf meine Spur setzte und mich ein ganzes Stück verfolgte. Sie gab erst auf, als ich die steil ansteigende Straße erreichte, die aus dem Dorf zur Villa hinaufführt.
Ich erinnere mich, dass ich an diesem Abend an der Brüstung des Hofes stehen blieb, um das nächtliche Panorama zu betrachten. Vallorgàna, am Fuße des grasbewachsenen Bergrückens, wo auf halber Höhe die Villa meiner Vorfahren liegt, war wie eine schwach beleuchtete Insel. Ansonsten rundum Dunkelheit. Das Val Fonda, ein lang gestreckter Fjord, der sich von Vallorgàna zum offenen Land hin erstreckt, war dunkel. Dunkel war das Kiesbett, in dem das wenige Wasser des Flusses Fragolfo fließt, der im Laufe der Zeitalter ebenjenes Val Fonda gegraben hatte. Und auch der Himmel, versteht sich, war dunkel, denn man sah keinen einzigen Stern. Nur dort, wo, wie ich wusste, das Val Fonda schließlich in die Ebene überging, konnte ich einen orangen Schimmer ausmachen, der hoch in den Himmel strahlte; einen dichteren, kräftigeren Schimmer, doch beinahe am Rand des Wahrnehmbaren, ganz anders als der leuchtende Atem der glücklicherweise weit entfernten, in einer anderen Welt existierenden Stadt Berua.
Doch die dichteste Dunkelheit lag wie immer in meinem Rücken, hinter der Villa, wo die pechschwarze, dräuende Masse des Berges abrupt zwischen Graten und Hängen aufragt. Breit und leicht konkav, bewaldet, Tor zu weiteren Bergen, die immer schroffer werden, bis sie nur noch Stein sind, dieser Berg, der als »der Berg« bezeichnet wird, als wäre er der einzige seiner Art, ist für uns in Vallorgàna eine unausweichliche Gegenwart; so sehr, dass man ihn auch nachts nicht nur spürt, sondern tatsächlich sieht, weil er von einer undurchdringlichen, zentripetalen Dunkelheit ist, schwarz herausgemeißelt aus dem umgebenden Dunkel.
Während jedenfalls die Welt in diesen dunklen Abgründen versinkt, behält die Villa meiner Vorfahren im Gegensatz zum Berg stets eine schwache Phosphoreszenz, was sie nicht allzu sehr von einem nackten, kahlen, nahezu weißen Felsen unterscheidet. Und sie würde wirklich aussehen wie purer, nackter Fels, wäre sie nicht nach einem mathematischen, strengen Plan entstanden: das Bogenportal genau im Zentrum der Fassade; die Drillingsfenster in perfekter Reihe; die exakten Kanten; die vollkommen gleichmäßigen Fenster; der emporragende Giebel; und schließlich, neben dem Giebel selbst, die beiden hohen, schlanken Schornsteine wie Fialen.
Nachdem ich in der Dunkelheit des Hofes kaum weniger als eine halbe Stunde verbracht hatte, hörte ich außerhalb ein Geräusch, am Ende der Wiese, zwischen den Hecken der Haselsträucher. Es konnte ein Reh sein, oder ein Dachs, ein Fuchs, oder vielleicht der Wind, vielleicht aber auch gar nichts. Mir schien jedoch, auf der Wiese bewegten sich Schatten, auf dem Gipfel des Giebels wehe ein Stück Stoff, aus dem Inneren der Villa, im Salon im ersten Stockwerk, schauten mich weit aufgerissene Augen an. Für diejenigen, die in einem Haus leben wie meinem und nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kommen, ist es nicht ungewöhnlich, diese Phantasien zu haben; doch es genügt, den Schlüssel im Schloss zu drehen, dass sich diese Phantasien in ihre Ecken zurückziehen und uns in die Realität zurückversetzen.
Tatsache ist jedoch, dass der Schlüssel der Villa, der in der Lage ist, Unruhe und Phantasien in einem Augenblick zu vertreiben, an diesem Abend nicht da war. Er war nicht in der Jacke. Er war nicht in der Hosentasche. Er war nicht im Auto. Und da sah ich meine zerstreute Hand vor mir, wie sie den Schlüssel bei Rubino auf die Theke legte und später vergaß, ihn wieder mitzunehmen.
Ich hatte mich darum damit abgefunden, ins Dorf zurückzukehren, und als ich die Bar betrat, hielt Rubino mir bereits den Schlüsselbund entgegen, mich daran erinnernd, was man nicht im Kopf hat und so weiter, als ich sah, dass bei Fastréda am Tisch nun drei Männer aus Vallorgàna saßen: Gianfranco Coltiàlt, Vittorino Pisàn und Giuseppe Giacón. Sie sahen mich mit einem Hauch Verlegenheit an, von dem auf Fastrédas Gesicht jedoch nicht die kleinste Spur zu entdecken war. Im Gegenteil legte er Wert darauf, mir zu erklären, dass man am Tisch gerade über die Ziegen Don Attilios sprach.
Es sei ja schön und gut, dass man ihnen diese einzigartige Freiheit gewährte, sagte Fastréda, aber Galilea, die braune, sei in letzter Zeit gefährlich geworden. War es nicht sie gewesen, die wenige Minuten zuvor mit gesenktem Kopf den hier anwesenden Gianfranco Coltiàlt verfolgt und beinah auf die Hörner genommen hatte? »Denkst du nicht auch?«, fragte mich Fastréda anschließend und lächelte sein großmütiges Lächeln, »Tiere muss man vor allem zu halten wissen. Sonst sollte man es lieber lassen. Und dann auch noch Ziegen! Die von allen am schwierigsten zu handhaben sind. Oder irre ich mich?«
Was konnte ich Fastréda antworten, um mich aus der unangenehmen Lage zu befreien, noch immer diesem Lächeln gegenüberzustehen? Ich sagte, er irre sich nicht, und er sprach weiter mit den dreien. Ich hätte dieser unbedeutenden Unterhaltung kein Gewicht beigemessen, hätte ich nicht, nachdem ich die Bar verlassen hatte und zur Seite getreten war, zufällig, wer weiß warum, noch einen Blick ins Innere geworfen. Fastréda sprach nun mit einer gewissen Rage, die mir einem Diskurs über Ziegen unangemessen schien.
Fünftes Kapitel
»Du hast einen Schatten in den Augen«, sagte tags daraufDina Cristi zu mir. Ich verneinte, und sie stellte den Topf mit dem Kaninchen auf den Tisch, denn das ist es, was Dina tut: Sie kommt jeden Tag in die Villa und kocht mir das Mittagessen. Wohlbemerkt hatte ich ihr mehrfach und mit der größten Höflichkeit gesagt, dass ich es gern annahm, wenn sie mir ab und zu Kaninchen, Geschnetzeltes oder Braten brachte, doch dass ich keinesfalls akzeptieren konnte, dass sie jeden Tag hierherkam, um mir das Mittagessen zu kochen, die Küche wieder in Ordnung zu bringen und um mir zuweilen sogar in einem Topf, bereit zum Aufwärmen, das Abendessen hinzustellen; nachdem sie darüber hinaus für diese Dienste keinerlei Entlohnung akzeptierte.
Doch Dina Cristi, gleichgültig gegenüber meinen Skrupeln, wollte keine Vernunft annehmen. Im Gegenteil: Wenn ich sie bat, für ihre Großzügigkeit einen kleinen Lohn anzunehmen, war sie beleidigt und sprach von einer alten Schuld; der Schuld, die sie meiner Familie gegenüber zu haben glaubte, im Besonderen gegenüber meinem Großvater Ausilio, aus der Zeit, als sie kaum mehr als ein Mädchen war. 1945, nach dem Krieg, hatte Dina es übernommen, die Schuld ihres Vaters zu begleichen, der doch bereits teuer dafür bezahlt hatte, für seine Schuld: Er und seine Frau waren mitten in der Nacht hoch auf den Berg geschleppt und erschossen worden. Es war mein Großvater Ausilio, wie Dina wieder und wieder erzählte, der sie aus der Verzweiflung rettete, indem er sie als Hausmädchen anstellte, ein Kind, das keine Ahnung hatte, was es in einem Herrenhaus zu tun gab.
Und so wurde Dina Cristi zur Bediensteten der Cimamontes, im Sommer hier oben in der Villa und im Winter in unserem Haus in Berua, so lange, bis sie heiratete. Dann bekam sie zwei Söhne, der ältere von beiden starb mit fünfzehn, als er einen Berghang hinunterstürzte; jung, wie er war, hatte er bereits eine Leidenschaft für die Jagd. Der andere Sohn verließ aus Gründen unüberwindbarer und nie vollständig ausgesprochener Zerwürfnisse Vallorgàna, nachdem Dina Witwe geworden war, und richtete nie wieder das Wort an sie. In die Villa zu kommen und für mich zu kochen war, wie ihr eines Tages versehentlich über die Lippen kam, die einzige Gelegenheit, sich von der Trübsal ihrer Gedanken abzulenken.
Doch an diesem Tag betrachtete mich Dina Cristi eindringlich und behauptete, einen Schatten in meinen Augen zu entdecken. Beim Mittagessen fügte sie hinzu, es sei ein dunkler Schatten, der sie beunruhige, da sie in der vergangenen Nacht eine Alte gesehen habe.
Bei dieser Gelegenheit muss ich hinzufügen, dass ich häufig ihre Berichte darüber zu hören bekam, wie sie die Nacht unter den Qualen der Schlaflosigkeit verbracht hatte. Manchmal erzählte sie, während sie wach lag, ganz deutlich Stimmen gehört zu haben. Sie war überzeugt, es handle sich um Nachrichten von ihrem Mann, der sie als Geist besuche und sich manchmal hustend bemerkbar mache, manchmal indem er ihren Namen rief, manchmal indem er einen Engel schicke, der vor ihrem Fenster sang. Kurz, für Dina war jede Nacht eine einsame Reise ins dunkelste Unbekannte, aus dem sie Nachrichten, Warnungen und Vorhersagen bezog.
Im Lauf der vorhergangenen Nacht war Dina also eine Alte erschienen; es musste der Geist einer Alten sein, die nicht böse war, vielleicht nur ein wenig brüsk, die ihr, nachdem sie sich ans Fußende gesetzt hatte, enthüllte, dass ich nicht mehr für lange Zeit in Vallorgàna bleiben würde. Das hatte die Alte gesagt, und jetzt meinte Dina in meinem Gesicht diesen Schatten auszumachen. War das etwa keine Bestätigung? Dachte ich nicht vielleicht wirklich darüber nach, fortzugehen?
Ich beruhigte Dina auf jede erdenkliche Weise, garantierte ihr, dass ich keineswegs vorhatte, Vallorgàna zu verlassen. Doch diese Beschwichtigungen reichten ihr nicht. Sie musterte mich weiter, studierte mich, murmelte, dass gewisse Dinge ihr eben nicht entgingen, dass dieser Schatten in meinem Blick Tatsache sei, er ihr real und offenkundig schien.
Und so fügte ich mich in meine Beichte und erzählte ihr, was mir durch den Kopf ging: die sechshundert Doppelzentner Holz, das Abholzen jenseits der Grenzlinie durch die Brüder Cimín, Mario Fastrédas Einmischung in meine Geschäfte, die Tatsache, dass Letzterer ohne ein gültiges Motiv zu den Brüdern Cimín gegangen war, um ihnen meine Grundstücksgrenzen zu zeigen, und noch dazu die falschen.
Dina war erleichtert. Sie sagte, wenn dies meine Gedanken seien, hatte ich keinen Grund, mich zu quälen. Es geschehe nicht selten, dass eine Grenze falsch gezogen oder missverstanden wurde. Ich sagte, das könne schon sein, aber nicht, dass man sich um sechshundert Doppelzentner vertut, und dass dies auch nicht die Einmischung Fastrédas in die Angelegenheit erklärt.
Doch nach Dinas Meinung war der Grund, weshalb Fastréda die Brüder Cimín hinsichtlich dieser Grenze instruiert hatte, tatsächlich nicht unerklärbar, da die Wälder, die an meinen Wald angrenzen, wie sie sagte, ebenjenem Mario Fastréda gehörten.
Ich gebe zu, dass ich Dina vielleicht mit allzu großer Arroganz gegenübertrat. Ich sagte, dass sie töricht über Dinge spreche, von denen sie nichts verstand. Ich stellte klar, dass Fastréda keinen Wald sein Eigen nenne, der an meinen angrenze, und dass es darum besser war, da sie offenbar keine Ahnung hatte, das Thema zu wechseln. Doch Dina behauptete, Dinge zu wissen, die ich nicht wusste, Dinge, die jedoch unzweifelhaft waren, da sie ihr von Luigia, ihrer Cousine zweiten Grades, zugetragen worden waren, die Fastrédas Frau war. Kurz, es hatte sich zugetragen, so erzählte mir Dina, dass sie vor einigen Wochen Luigia traf. Da sie ihr verstimmt erschien, hatte sie sich berechtigt gefühlt, nachzufragen. Luigia hatte auf nichts anderes gewartet, als sich bei irgendjemandem auszulassen, denn sie sagte sofort, sie ertrage den Größenwahn des Ehemanns nicht länger, der noch mit über achtzig Jahren Unternehmungen ersann und Geld ausgab, mit dem Ziel, weiteres Geld zu verdienen. Luigia hätte gern ein wenig ihre Ruhe gehabt, an diesem Punkt in ihrem Leben, doch durch Zufall, durch einen ungeschickten Telefonanruf des Landvermessers Zanolla, hatte sie herausgefunden, dass Fastréda oben am Berg viele Hektar Wald gekauft hatte, ohne ihr ein Sterbenswörtchen davon zu sagen. »Der Wald, den Fastréda gekauft hat«, schloss Dina, »grenzt an deinen Wald, Duca, das heißt an den Wald der Cimamontes. So wenigstens hat Luigia es mir gesagt.«
Ich spürte, wie ich erstarrte. Ich bat Dina fortzufahren, doch sie sagte, mehr wisse sie nicht. Ich flehte, und sie begann, Unsinn zu reden. Sie sagte, als junges Mädchen sei sie durch meine Wälder gelaufen, zu den Weiden auf dem Bergrücken, um Narzissen, wunderschöne weiße, weiche, duftende Narzissen zu suchen. Vielleicht, sagte sie, wüchsen die Narzissen noch heute oben am Berg. »Wie schrecklich, alt zu sein«, fuhr sie fort. »Wie schrecklich. Bloß nicht alt werden, Duca. Ich warne dich: Bloß nicht alt werden!«
Es war jedoch Schicksal, dass die Dinge an diesem Tag dazu bestimmt waren, mit überraschender Geschwindigkeit Fahrt aufzunehmen. Kurz nachdem Dina gegangen war, hörte ich es an der Tür klopfen. Ich schaute durch das dreibogige Fenster hinunter und sah Gianfranco Coltiàlt. Nachdem ich nicht geöffnet hatte, hoffte ich, er würde bald verschwinden, doch stattdessen setzte er sich auf die Brüstung und machte sich, so schien es mir, bereit für ein geduldiges Warten.
Ich dachte also, dass dieser loyale Handlanger Fastrédas, denn das hatte ich am Abend zuvor mit eigenen Augen gesehen, in der Bar, wie er zusammen mit seinen Spießgesellen an Fastrédas Lippen hing, ich dachte also, dass dieser loyale Handlanger hier oben sein könnte, um irgendeine Aufgabe zu erledigen, die ihm Fastréda selbst aufgetragen hatte; und deshalb lohnte es sich vielleicht, ihn anzuhören.
Als ich aus der Tür kam, sagte Coltiàlt, dass er es für nötig hielte, ein paar Worte mit mir zu reden. Zehn Minuten würden genügen. Also führte ich ihn in die Küche, bot ihm einen Platz an, und er begann einen ausschweifenden Diskurs: Dass die List und die Unredlichkeit Zwillingsschwestern seien; dass die schlimmsten Unglücke aus im Verborgenen Gesprochenem entstünden; dass die Ehrlichkeit eine Tugend sei, die man nicht lerne, entweder besitzt man sie oder nicht.
Als er seine seichte Vorrede beendet hatte, sagte Coltiàlt, dass ich vielleicht noch nicht wusste, dass Fastréda oben am Berg einen erheblichen Teil des an meinen angrenzenden Waldes gekauft hatte. Ich überraschte ihn mit der Antwort, das wisse ich bereits, doch da fügte Coltiàlt hinzu, dass ich aber sicher nicht wissen könne, dass Fastréda diese Wälder aus Gründen verschiedener Interessen und Vorteile gekauft hatte. Ich antwortet Coltiàlt, ich verstünde ihn nicht. Er solle sich klar ausdrücken.
»Natürlich, Duca«, antwortete er. »Es sind andere Dinge, die ihn interessieren, nicht das Holz. Flächen. Hektar. Ist es wahr oder nicht, dass Fastréda hinter dem Bergrücken seine Weiden hat? Und ist es nicht wahr, dass er im Sommer um die vierzig Färsen hinaufschickt? Und auch du, Duca, wirst wissen, dass es da verschiedene Unannehmlichkeiten gibt. Welche? Dass es keine Straße gibt, die bis zu den Weiden hinaufführt. Dass Fastréda das Vieh im Lastwagen bis zur letzten Kurve der Bergstraße hinauffahren und dann noch über eine Stunde zu Fuß hinaufgehen muss, auf uralten Pfaden, das Vieh in einer Reihe. Ein weiteres Problem, auf Fastrédas Weiden gibt es nichts weiter als die Ruinen einer alten Alphütte, ein paar Blechunterstände für das Vieh und eine Hütte, die Fastréda nutzt, wenn er hinaufgeht, um nach dem Vieh zu sehen. Verstehst du, Duca«, fuhr er fort, »er braucht eine Straße und eine Alp. Eine echte Alp, denn Fastréda hat etwas Neues im Sinn. Kennst du Severo Zallòt? Zallòt, den Züchter aus Naroén, der eine Alp auf der anderen Seite des Val Fonda besitzt. Genau, der. Er hat angefangen, kleine Käse zu machen, die die aus der Stadt mögen. Frischen, natürlichen Käse, mit Kräutern. Tatsache ist, dass Severo Zallòt die Alp nach allen Regeln der Kunst aufgezogen hat, er hat die Genehmigung des Gesundheitsamts, hat Frau und Tochter mit eingespannt, kurz, er hat mit diesen kleinen Käsen einen ziemlichen Reibach gemacht. Die Leute kommen aus der Stadt herauf, essen auf der Alp und kaufen kiloweise Käse und anderen Unsinn wie Berghonig und Kräutergrappa. Fastréda hat sich also in den Kopf gesetzt, die Grundmauern der Ruinen zu nutzen und selbst eine Alp aufzuziehen, mit allem Drum und Dran, eine bequeme Straße zu bauen und die Alp an jemanden zu vepachten, der im Sommer einen Agrotourismus oder etwas in der Art betreibt.«
»Ich interessiere mich nicht für Alpen oder Agrotourismus«, sagte ich. »Ich denke an meinen Wald. Was mein Wald damit zu tun hat. Das interessiert mich.«
»Er hat deswegen damit zu tun«, flüsterte Coltiàlt, »weil der Landvermesser Zanolla, also sein Landvermesser, ihm irgendeine Ausschreibung für Finanzhilfen für Landwirtschaftsbetriebe unter die Nase gehalten hat, wobei Gelder in Form von nicht rückzahlbaren Zuschüssen sowohl für den Bau der Straße als auch für die Alp herausspringen könnten. Aber weißt du, Duca, wie diese Finanzhilfen verteilt werden? Proportional zur Grundfläche, die der antragstellende Landwirtschaftsbetrieb in der entsprechenden Gegend sein Eigen nennt. Einfach gesagt: Um Geld für die neue Alp und die Straße zu bekommen, muss Fastréda am Berg eine bestimmte Menge Hektar vorweisen. Ich glaube, du hast verstanden, Duca. Fastréda brauchte Fläche am Berg, also hat er die an deinen Wald angrenzenden Wälder gekauft.«
»Hör mal, Coltiàlt. Ich wiederhole, Fastrédas Geschäfte interessieren mich nicht. Mich interessiert, wer die Grenzen verletzt hat.«
»In der Tat. Hab Geduld, Duca, und hör mir gut zu. Dem Landvermesser Zanolla und Fastréda, und hier liegt das Problem, fehlen noch immer einige Hektar, um das Finanzierungsziel zu erreichen, das ihnen vorschwebt. Nicht viel, aber etwas fehlt. Ein schönes Schlamassel, denn Fastréda ist das Geld ausgegangen. Er ist nicht pleite, aber er kann nichts mehr investieren. Kurzum, nach reiflicher Überlegung und eingehender Beratung mit dem Landvermesser hat Fastréda eingesehen, dass ihm nur eine einzige Möglichkeit bleibt: die Ersitzung. Musst du noch überlegen, Duca? Vielleicht nicht. Hier kann man nicht irren. Mario Fastréda hat beschlossen, sich die Hektar, die ihm fehlen, durch Nutznießung in Besitz zu nehmen. Er hat die Brüder Cimín beauftragt, seine neuen Wälder abzuholzen, hat ihnen aufgetragen, dabei in deine Wälder einzudringen, um sich auf diese Weise das Eigentum an jenen Hektar Wald zu erschleichen, die ihm fehlen, um den Jackpot zu knacken.«
Ich war kurz davor zu platzen. Ich schaute Coltiàlt in die Augen. Ich fragte ihn, wie es kam, dass ausgerechnet er so gut auf dem Laufenden sei über Fastrédas Geschäfte, und vor allem, warum er gekommen war, um mir diese Geschäfte mit solcher Liebenswürdigkeit zu enthüllen. Hatten er und Fastréda sich nicht am Abend zuvor in Rubinos Bar mehr als gut verstanden?
Coltiàlt musste sich getroffen fühlen, denn er machte Anstalten zu gehen, doch an diesem Punkt wollte ich alles wissen. Ich hielt ihn zurück, indem ich dieses Wort, Ehrlichkeit, aussprach, das der Name seines inneren Gottes zu sein schien. Coltiàlt beteuerte wieder und wieder, ein ehrlicher Mensch zu sein, mehr als ehrlich, und er fügte hinzu, am Abend zuvor in der Bar gewesen zu sein, zusammen mit seinen alten Freunden Giacón und Pisàn, weil Fastréda sie um ein Treffen gebeten hatte, ohne Angabe von Gründen. »Er hat uns die ganze Geschichte erzählt«, sagte Coltiàlt, »und dann hat er gefragt, ob wir bereit wären, ihm zu helfen.«
Was Mario Fastréda wollte, ist schnell erzählt. Mit seinem messerscharfen Gedächtnis hatte er sich daran erinnert, dass Coltiàlt und seine Freunde zwanzig Jahre zuvor als Waldarbeiter im Akkord gearbeitet hatten und dass sie damals Wälder gerodet hatten, die an meine grenzten. Kurz, Fastréda hatte Coltiàlt, Pisàn und Giacòn gebeten, eine Erklärung zu unterzeichnen, in der sie angaben, zwanzig Jahre zuvor im Auftrag des ehemaligen Eigentümers Holz geschlagen zu haben in dem Waldstück, das Fastréda mir durch Ersitzung abnehmen wollte. Nicht nur das: Er verlangte, sie sollten präzise und sorgfältig sein und erklären, dass die Cimamontes damals nichts einzuwenden hatten, da sie sich keinen Deut darum scherten, was in ihren Wäldern geschah; Wälder, die darum vollkommen verwahrlosten.
Bis heute weiß ich nicht, ob diese Denunziation Coltiàlts eine bewusste war, und wenn ja, welche Motive ihn dazu bewegt haben mochten, oder ob es sich nicht doch um eine brave Erfüllung von Fastrédas Anweisungen handelte. Tatsache ist, dass ich bei Einbruch des Abends zu Fuß von der Villa ins Dorf hinunterging, Tabiónas Hof erreichte, Nelsos Klingel betätigte und ihm erzählte, was ich zu erzählen hatte.
In meiner Bestürzung hätte ich mir ein Streichholz gewünscht, um einen Brand zu entzünden. Doch Nelso war ungerührt. Er beschränkte sich darauf, zu stammeln, dass er geglaubt habe, die sechshundert Doppelzentner Holz seien ein Versehen, ein zweifellos eigennütziges, der Brüder Cimín; sicher jedoch nicht, dass, wie er sagte, Fastréda seine Klauen im Spiel habe.
Also befeuerte ich meinen Ausbruch selbst: dass Fastréda ein Doppelspiel spiele, ein Dreifachspiel, dass es auf der Welt die Ehrlichen gebe und die Kanaillen, und dass Fastréda die größte Kanaille von allen sei. Doch als wäre die Angelegenheit nicht fatal, als verlange sie nicht in der Tat eingehende Beratungen, Klagen, Proteste und endlose Beschwerden, zog Nelso sich mit einer billigen Zurechtweisung aus der Affäre. Er sagte, man könne die Menschen nicht so pauschal verurteilen. Jeder, Fastréda eingeschlossen, habe seine Gründe.
Darum schickte ich Nelso zum Teufel und ging. Ich hatte noch nicht einmal den Winkel des Hofes erreicht, da rief Nelso mich zurück. Er sagte, zunächst müsste eine Sache getan werden. Am nächsten Morgen würden wir beide zusammen auf den Berg gehen. Er wollte sich vergewissern, dass die sechshundert Doppelzentner noch im Wald lagen, und vor allem, dass ich mit eigenen Augen meine Grenzen zu sehen bekäme. Dann schaute er weg, in die Abendluft, so als wittere er. Er sagte, etwas liege in der Luft. Was denn? Das sagte er nicht. Stattdessen ermahnte er mich, morgen um Punkt sieben bereit zu sein.
Sechstes Kapitel
Ich verstand, mit welchem Hintergedanken Nelso michhinauf in meinen Wald führen wollte, von dem Augenblick an, in dem er, während er mir Platz in seinem Geländewagen machte, zu dozieren begann, dass man einen Waldarbeiter nicht anhand der Sauberkeit seines Wagens beurteilen solle (in dem ich in der Tat zusammengeknüllte Zigarettenpackungen, verknotete Ketten von Motorsägen, Erde unter den Sitzen, Kanister mit Kraftstoff, Ölspritzer, Sägemehl und so weiter herumliegen sah), sondern anhand der Ordnung und außerordentlichen Gesundheit der Wälder, in denen er gearbeitet hat.
Kurz, für Nelso lag der Grund für diese Besteigung des Berges darin, mir die Gelegenheit zu verschaffen, einer praktische Unterweisung beizuwohnen, durch die ich, aus dieser Quelle übergroßer Weisheit trinkend, erweiterte Kenntnisse im Bereich der Waldverwaltung gewinnen sollte. Nelso fuhr die Bergstraße mit aufreizender Langsamkeit hinauf. Er fuhr, als wäre die Bergfahrt ein gefährliches Unterfangen voller Tücken. Er betrachtete dies, beobachtete das, zeigte mir jenes.
Er wollte, dass ich den Unterschied zwischen den von ihm persönlich betreuten Wäldern und denen von anderen Waldarbeitern sah, unbedachte und inkompetente Leute laut ihm, Schlendriane, die schlecht schneiden, den Wald in Unordnung zurücklassen, die falschen Pflanzen verschonen oder, noch schlimmer, keine einzige stehen lassen. »Und wenn du mir nicht glaubst«, sagte Nelso, »dass diese Halunken großen Schaden anrichten, warte noch einen Kilometer, dann siehst du es.«
Als dieser Kilometer hinter uns lag, bremste Nelso den Geländewagen in einer Flut aus Licht, die sich auf einmal in den Wald ergoss. Ich erinnere mich, wie verblüfft ich war. Wir standen in der Lawinenschneise, das heißt in der Wunde, die vom Dorf aus gesehen so klein ist, aber so groß und tief, wenn man mittendrin steht, die im Jahr zuvor von einem Strom aus Schnee und Steinen aufgerissen wurde, der sich kurz unterhalb des Gipfels gelöst hatte. In dieser kahl rasierten, leuchtenden Wüste war noch immer die brutale Kraft spürbar, die sie durchpflügt hatte, Bäume, Büsche und Gestein fortreißend, und die schließlich an einem großen Fels zum Halten gekommen war, der von der Straße aus gesehen etwas weiter unten im Tal aufragte und dieses Gemisch in die Höhe geschleudert und unter sich hatte auftürmen lassen, wie ein Wasserfall, zu einem riesigen, undurchdringlichen Schutthaufen.





























