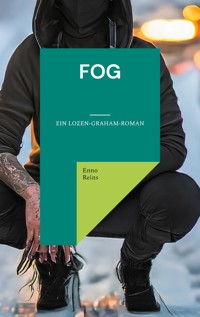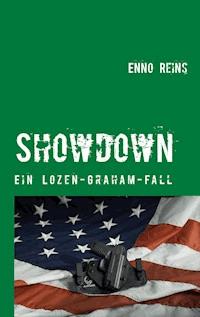Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mehrere Prostituierte werden ermordet. Warum? Ist ihre brutale Zuhälterin ausgerastet? Sind sie ins Kreuzfeuer konkurrierender Motorradgangs gekommen? Und was hat der Tod eines Umweltaktivisten mit den Taten zu tun? Viele Fragen für die private Ermittlerin Lozen Graham. "Der letzte Dreck" ist - nach "Die Vergangenheit stirbt nicht", "Showdown", "Rechte Patrioten" und "Verloren" - der fünfte Roman um die Ermittlerin Lozen Graham.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Epilog
1.
Wolken schoben sich vor den Mond. Das Pärchen wankte aus der Bar auf den Parkplatz. Ein kräftiger Typ mit Übergewicht hielt eine dralle Blondine mit aufgedunsenem Gesicht im Arm und gab ihr einen langen feuchten Kuss.
„Nicht hier“, sagte sie.
„Zum Fluss“, sagte er.
Sie wankten zu einem verrotteten Ford Fusion.
„Bin gleich wieder da“, sagte die Blondine.
Sie schwankte zwei Wagen weiter und kotzte. Als sie zurückkam, reichte ihr der Typ eine Whiskeyflasche, die er aus dem Auto geholt hatte. Sie nahm einen tiefen Zug.
„Alles in Ordnung, Sweetie?“, fragte er.
„Yeah. Lass uns fahren.“
Sie setzten sich ins Auto. Als der Typ den Motor anließ, sprang ein Radiosender für Countrymusik an. Ein Sänger erzählte von einem Trucker, der die USA durchquerte, zwischendurch mit seiner Frau telefonierte und ihr versicherte, dass er ihr treu war. Das Pärchen begann, mitzusingen.
Der Typ gab Gas. Sie rasten viel zu schnell über die Landstraße. Nach ein paar Meilen bog er auf einen Feldweg, den sie entlangfuhren, bis sie den Homer River erreichten. Mittlerweile sang ein anderer Sänger darüber, warum er das Kleinstadtleben klasse fand.
„Wir sind da“, sagte der Typ.
Er zeigte nach vorn. Die Scheinwerfer des Wagens beleuchteten den Fluss und das bewaldete Ufer. Sie reichte ihm die Whiskeyflasche und er trank, während sie den Sport-BH auszog. Gierig und grinsend drückte der Typ ihre linke Brust. Sie griff ihm zwischen die Beine.
„Yeah“, sagte sie zufrieden.
Die Blondine warf einen Blick aus dem Fenster, auf den Teil des Flusses, den die Scheinwerfer beleuchteten. An der Stelle war die Strömung stark. Das Wasser brach sich an einem Felsen. Auf dem lag etwas. Eine Frau. Sie sah verdammt tot aus.
2.
„Hast du mal ’ne Kippe?“
Die junge Frau in Tanktop und Jeans, die auf einem wackligen Klappstuhl vor einem grauen schmutzigen Trailer in einer heruntergekommenen Wohnwagensiedlung saß, sah hoch zum Mann, der die Frage gestellt hatte. Es war ein mittelalter Sioux auf Krücken, dem zahlreiche Zähne und das rechte Bein fehlten. Flüssigkeit lief aus seiner Nase. Sie nahm eine Zigarette aus der Schachtel, die auf ihrem Schoß lag, und reichte sie ihm.
„Bedankt“, sagte der Mann und ging.
Die Frau wusste, dass es ein Fehler gewesen war. Er würde wiederkommen. Dies war nicht der Ort für Großzügigkeit. Der Mann machte einen Bogen um eines der vielen mit Wasser gefüllten Schlaglöcher und stakste die schlecht asphaltierte Straße hinunter, an der links und rechts die typisch lang gezogenen amerikanischen Wohnwagen standen. Die meisten waren in einem miesen Zustand. Einige sahen mit ihren Spitzdächern und Verandas aus wie richtige Häuser, andere standen auf rohen Fundamentklötzen, wieder andere noch auf Rädern. Dies war kein Campingplatz für Touristen, sondern eine abgewirtschaftete Trailerpark-Siedlung in Chayton County, South Dakota – für Gestrandete, Geflüchtete, Gescheiterte, alle nur einen Schritt entfernt von der Obdachlosigkeit.
Die Frau nahm die Dose, die vor ihr auf dem Boden stand, und öffnete sie. Bier spritzte auf ihr Tanktop. Sie fluchte und legte ihren Mund über die Öffnung, aus der die Flüssigkeit sprudelte. In der Ferne zog ein Gewitter auf. South Dakota lag in der „Tornado Alley“ der USA. Im Osten und Südosten des Staates habe die Tornado-Saison begonnen, hatte sie im Radio gehört.
Die meisten Bewohner des „George Crook Trailer Park“ hatten sich in ihre Wohnwagen zurückgezogen. Nur ihr gegenüber war jemand draußen. Ein älterer Kerl mit Glatze und haarigem Oberkörper betrank sich mit einer wesentlich jüngeren Frau, die ein schwarzes Top und eine abgeschnittene Jeans trug. Sie war stark tätowiert. Leere Bierdosen lagen um sie verstreut. Sie redeten laut.
„Bei denen musst du aufpassen“, hatte Benny Fowler, der Trailerpark-Manager, gesagt, als er die Frau am Morgen zum Wohnwagen gebracht hatte, „der alte Mike ist ein jähzorniger Totschläger und Margie eine heroinabhängige Schlampe, die jeden beklaut.“
Die anderen Nachbarn waren nicht so gefährlich. Links neben ihr wohnte eine 80-jährige Rentnerin, rechts eine junge Afroamerikanerin mit zwei Kindern.
Die Sonne ging langsam unter. Die Frau leerte die Dose, warf sie auf den Boden - weil es in dieser Nachbarschaft anscheinend jeder so machte - und ging in den Trailer, der, wie die anderen Wohnwagen im „George Crook Trailer Park“, in den letzten Jahrzehnten nicht bewegt worden war und seine beste Zeit hinter sich hatte. Im Inneren roch es nach Reinigungsmitteln, Zigarettenrauch und Plastik. Der braune Linoleumboden war voller Brandlöcher. Der Wasserhahn im Küchenbereich tropfte, die Spüle war zerbeult. Die Klebefolie am Küchenschrank, die im Baumarkt bestimmt als naturgetreue Reproduktion einer Holzstruktur – Kiefer, Eiche? – verkauft wurde, löste sich ab. Die Tür des brummenden Kühlschranks schloss nur richtig, wenn man dagegentrat. In der Nasszelle roch es nach Fäulnis. In den Ecken der Dusche hatte die Frau Schimmel entdeckt. Dunkle Stellen von geschmolzenem Plastik verrieten, dass einer der Vormieter seine Zigaretten auf dem Toilettendeckel ausgedrückt hatte. Warum auch immer.
Am Ende des Wohnwagens stand ein quadratischer Tisch mit gespaltener Platte, dessen Beine am Boden festgeschraubt waren, links von ihm ein Klappstuhl und rechts ein nachträglich integriertes Regal mit einem kleinen Fernseher. Hinter dem Tisch war ein dunkelrotes durchgelegenes Bett mit keilförmigen Rückenkissen, sodass man es auch als Sofa nutzen konnte. 310 Dollar kostete die Unterkunft. Zahlbar am Ersten. Eine Monatsmiete hatte Benny Fowler als Sicherheit verlangt. Sie hatte ihm die Scheine auf den Tisch gelegt. Im „George Crook Trailer Park“ zahlte jeder cash.
„Wenn du die Miete nicht pünktlich vorbeibringst, fliegst du“, hatte Benny Fowler mit gelangweilter Stimme gesagt, die gelangweilt klang, weil die meisten der Mieter nicht pünktlich zahlten und Zwangsräumungen zu seinem Alltag gehörten. Er war ein großer Kerl mit Vollbart und dunklem, zurückgekämmtem Haar, der eine schmutzige dunkelgraue Latzhose trug. Mitleid und ähnliche Gefühle waren ihm längst abhandengekommen.
Die Frau nahm die schwarze Jeansjacke, die auf dem Bett lag, und zog aus der Brusttasche einen Joint und einen Schlagring. Beides steckte sie in die Beintasche ihrer Cargohose. Sie war schwarz angezogen: Tanktop, Hose, Springerstiefel. Die Frau war Mitte 30, schlank, mit mittellangem, schwarzem Haar. Auf ihren linken Oberarm war ein Adlerflügel tätowiert.
Sie zog das von Bier durchtränkte Tanktop aus. Von ihrer Achselhöhle bis zum Hüftknochen zog sich der Schriftzug „Apache Nation“. Eine Zugehörigkeitserklärung, denn die Frau war eine Chiricahua-Apachin. Die hatte sie sich vor ihrem ersten Einsatz als Soldatin stechen lassen.
Unter dem Tisch stand eine Sporttasche. Sie zog sie heraus und öffnete sie. Oben auf dem Wäschestapel lag eine Heckler & Koch P9S, die eine Modifikation für einen Schalldämpfer besaß, der neben der Waffe lag. Nachdem sie ein frisches Tanktop herausgenommen und angezogen hatte, schaute die Frau sich um. Sie wollte die Waffe an diesem Abend nicht mitnehmen. Aber sie einfach offen im Trailer liegen zu lassen, war keine Option. Denn trotz der zwei Schlösser an der Eingangstür war es einfach, einzubrechen. Sie sah durch ein Fenster nach draußen, wo Margie schwankend, mit einer Flasche Schnaps in der Hand, dem alten Mike zuprostete und dabei ihren Bauch entblößte.
Die Frau zog ein Karambit-Klappmesser am Fingerring aus der Hosentasche, wobei die klauenförmige Klinge aufsprang. Die hatte wegen ihrer Form etwas Fieses und Böses, was die Frau mochte. Der Ring für den Zeigefinger war praktisch, weil er verhinderte, dass sie das Messer fallen ließ, wenn sie einen Wirkungstreffer eingesteckt hatte und die Hand sich öffnete.
Mit der Klinge löste sie das Linoleum unter dem Regal und schob Pistole und Schalldämpfer unter den Bodenbelag. Dann stellte sie sich hin. Das Versteck war nicht zu sehen. Zufrieden verließ sie den Trailer. Als sie die Tür abschloss, gab Mike Margie eine heftige Ohrfeige, sodass sie taumelte. Blut lief ihr aus dem Mundwinkel. Margie begann zu lachen. Laut und hysterisch. Es hatte nichts Menschliches.
Sie ging zum Ausgang des „George Crook Trailer Park“. Benny Fowler saß rauchend vor dem grünen Container, in dem sich sein Büro befand. Er nickte der Frau zu. Sie bog auf die Landstraße und marschierte drei Meilen bis zu einem Parkplatz, an dessen Rand zwei Gebäude standen. Eines war ein unansehnlicher Bau mit Flachdach, auf dem ein grünes Neon-Zeichen angebracht war, das hektisch blinkte. „Sheridan’s Inn“ war zu lesen. Dahinter sah sie im Abendlicht die Silhouette eines einstöckigen Hauses, aus dem kein Licht nach außen drang. Entweder stand es leer oder die Fenster waren abgeklebt, schlussfolgerte sie.
Die Frau ging über den Parkplatz und passierte einen verbeulten Toyota, in dem ein Mann am Steuer saß. Sein Kopf war nach vorne geneigt. Eine Rothaarige in der Uniform einer Fast-Food-Kette stach ihm eine Nadel in den Hals und injizierte ihm etwas. Vermutlich Heroin. Auf dem Rücksitz des Wagens schlief ein Kleinkind in einem Babysitz.
Die Frau erreichte das „Sheridan’s Inn“, drückte die Tür auf und betrat die Bar. Schummriges Licht. Rockmusik. Es war viel los. Der Geruch von Schweiß und billigem Parfüm kam ihr in die Nase. An der langen Theke fand sie einen Platz. Beim Barkeeper, der um die 60 Jahre alt war und einen Vokuhila-Haarschnitt trug, den er wahrscheinlich seit den 1980ern nicht geändert hatte, bestellte sie ein Bier.
„Drei Dollar“, sagte der Barkeeper und stellte den halben Liter auf die Theke. Die Frau zahlte.
Sie nippte am Bier und schaute sich um. Ein mieser Schuppen. Aufgepumpte Kerle mit Baseball-Caps und Cowboyhüten, Rocker mit Vollbart, Typen mit Hakenkreuzen auf dem Oberarm, Rednecks in Baumfällerhemden mit abgeschnittenen Ärmeln, Verlierer mit Nadeleinstichen in den Armen, Frauen in knappen Klamotten, von denen sie die Hälfte als Prostituierte einstufte. Es gab eine Bühne, auf der eine dreiköpfige Rock-Band spielte. Ein Teil der Gäste hörte zu, ein Teil war mit sich selbst beschäftigt, ein Teil tanzte.
Ein Mann kam auf die Frau zu. Das ging verdammt schnell, dachte sie.
„Hey, Hübsche, hab dich hier noch nie gesehen.“
Die Frau schaute ihn an. An den Schläfen rasierte Haare, glasige Augen, Dreitagebart, T-Shirt, auf dem „America First“ stand. Er sah wie ein Bodybuilder aus, über dessen Körper sich eine drei Zentimeter dicke Fettschicht gelegt hatte.
„Drink?“, fragte er.
Sie zeigte ihm das fast volle Bierglas. Er bestellte sich einen Wodka.
„Woher kommst du?“
„George Crook Trailer Park.“
„Keine Kohle, was?“
Die Frau zuckte mit den Schultern.
„Du bist scharf. Ich könnte dir helfen.“
„Wie?“
Der Typ grinste.
„Hey, Matt, was machst du da?“
Eine große und attraktive Frau kam zu ihnen. Die kurzen hellbraunen Haare waren nach hinten gekämmt. Sie hatte kleine Ohren, an denen kleine Ohrringe hingen.
„Wer ist die Schlampe?“
„Keine Ahnung, Laconia. Hab sie erst kennengelernt.“
„Lügner.“
Laconia atmete schwer. Sie war offensichtlich betrunken.
„Lass Matt in Ruhe“, sagte sie lallend zur Frau.
„Mich interessiert dein Matt nicht.“
„Sicher.“
Laconia holte aus und schlug eine rechte Gerade. Eine zu große und zu langsame Bewegung. Problemlos wich die Frau aus. Die Angreiferin schlug ins Leere, verlor dadurch das Gleichgewicht und fiel gegen die Theke.
„Fuck“, rief Laconia, die sich wehgetan hatte.
„Alles in Ordnung, Sweetheart?“, fragte Matt.
„Fuck.“
Matt drehte sich um und starrte die Frau an.
„Hast du sie nicht alle?“
Matt nahm Laconia in den Arm. Aus dem Augenwinkel sah die Frau, wie zwei Typen sich erhoben. Einer von ihnen hatte eine Hakenkreuz-Tätowierung am Hals, rechts neben einem gigantischen Kehlkopf. Offenbar Freunde von Matt.
Der Abend lief nicht gut.
„Es wäre klug, zu gehen“, sagte eine Stimme hinter ihr.
Die Frau drehte sich um und sah einen jungen Mann mit asiatischen Gesichtszügen, dessen schwarzen Haare zu Rastafari-Locken geflochten waren. Seine Augen sprachen für Drogenmissbrauch, sein Ratschlag für ein funktionierendes Gehirn. Sie stand auf und ging ohne Eile zum Ausgang. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass ihr der Kehlkopf mit dem Hakenkreuz folgte. Sie drückte die Tür auf, ging nach draußen, am Haus entlang, bis sie zu einem Müllcontainer kam, hinter dem sie sich versteckte und den Schlagring aus der Beintasche zog. Sie bemerkte, dass ihre rechte Hand leicht zu zittern begann. Nicht jetzt, dachte sie. Kurz darauf hörte sie Schritte, ein nicht einzuordnendes Geräusch und ein leises Stöhnen.
„Hey, du kannst rauskommen. Steve macht Pause.“
Die Frau erkannte die Stimme. Sie gehörte dem jungen Mann mit den asiatischen Gesichtszügen. Sie trat aus dem Schatten des Müllcontainers. Der Typ mit dem gigantischen Kehlkopf lag bewusstlos am Boden. Der junge Mann grinste. Er hatte einen Taser in der Hand.
„Der Kehlkopf heißt Steve?“
„Yeah.“
„Ich hatte die Lage unter Kontrolle. Trotzdem danke“,
sagte sie und fügte hinzu: „Ich bin Lozen.“
„Ich bin Johnnie To.“
„Wie der Regisseur.“
„Hey, die Lady kennt ihr Kino.“
Lozen lächelte. Der Junge war ein Cineast. Johnnie To, so hieß ein bekannter chinesischer Regisseur. Sie steckte den Schlagring weg, zog den Joint aus der Beintasche der Cargohose, zündete ihn mit einem Feuerzeug an, wobei sie mit dem Rücken zu Johnnie To stand, weil sie nicht wollte, dass er das Zittern sah, und nahm tiefe Züge, bis die Hand ruhig wurde. Dann reichte sie den Joint ihrer neuen Bekanntschaft.
„Bock auf ’n Bier in friedlicher Atmosphäre? Wohne in der Nähe und hab was kalt“, fragte Johnnie To, nachdem er einen Zug genommen hatte.
Sie sah ihn misstrauisch an.
„Wenn es wirklich nur um ein Bier geht.“
„Keine Angst. Frauen sind nicht mein Ding.“
„Wie beruhigend.“
3.
„Wer bist du, Lozen, dass du keine Angst vor Nazi-Schlägern hast?“
Sie zuckte mit den Schultern.
„Immer einen Schlagring dabei?“
„Er macht sich gut an meiner Hand.“
Johnnie To grinste. Sie saßen vor seinem Wohnwagen – einem alten verrotteten Airstream, der aussah wie eine Patrone auf Rädern und dessen silberne Oberfläche mit Graffitis übermalt war – an einem wackligen Campingtisch auf zwei altersschwachen Stühlen. Auch Johnnie To wohnte im „George Crook Trailer Park“.
„Du bist schwer bewaffnet. Der Ring da an der Hosentasche gehört zu einem Karambit“, sagte er.
„Gut beobachtet.“
„Was hat dich nach Chayton County gebracht?“
„Ein Kumpel hat mir einen Job versprochen und sein Versprechen nicht gehalten.“
„Pech.“
„Jup.“
Sie stießen an.
„Und du? Hilfst du immer Frauen in Not?“
„Nein, aber Matts Freunde von der ‚Patriot Nation‘ sind Ärsche.“
„Wer ist die ‚Patriot Nation‘?“, fragte Lozen, obwohl sie die Antwort kannte, weil sie schon in Chayton County gewesen war, was sie aber Johnnie To nicht sagen wollte.
„Ein rechter Haufen, der was gegen Juden, Schwarze, Asiaten, eigentlich gegen alle hat, die nicht weiß und heterosexuell sind. Halten sich für amerikanische Patrioten, verticken nebenher Meth und Black-Tar-Heroin.“
„Verstehe. Du hast was gegen rechte Vögel und Drogen“, sagte sie.
„Ich habe sicher nichts gegen Drogen.“
„Sorry, wie konnte ich nur auf die Idee kommen.“
„Ja, wie konntest du nur.“
„Und wer war die Frau?“
„Laconia? Oh, die ist in Ordnung, wenn sie nicht drauf ist. Schafft an. Für Sista Louisa. Der gehört das ‚Sheridan’s Inn‘ und das Hotel.“
„Hotel?“
„Das abgedunkelte Gebäude hinter dem Sheridan.“
„Verstehe. Hat das Hotel einen Namen?“
„Nein. Alle nennen es nur ‚Hotel‘.“
Als Lozen später ihren Trailer erreichte, begann es zu regnen. Aus dem Wohnwagen von Mike und Margie hörte sie wildes Stöhnen. Ein widerliches Paar, dachte Lozen und schloss die Tür auf. Sie holte eine Plastikplane aus dem Schrank, ging wieder raus, zur Hinterseite des Trailers, wo ein altes Motorrad stand, eine 2002 Yamaha WR426F, über die sie die Plane warf. Dann ging sie zurück ins Trockene, nahm eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank, setzte sich aufs Bett, stellte den Fernseher an und zog das Smartphone aus der Hosentasche. Sie musste einen Anruf machen. Es machte keinen Sinn, ihn noch länger zu verschieben.
Sie gab das Passwort ein, drückte auf das grüne Telefonsymbol, ging auf die Anrufliste und drückte – nach einem kurzen Zögern – auf die oberste Nummer. Sie schaute auf die Uhr. Es war kurz vor elf Uhr abends. Er war bestimmt noch im Büro.
„Graham Security.“
„Nick, ich bin es.“
„Lozen.“
Lozen Graham war die Chefin von „Graham Security“ – einer kleinen Sicherheitsfirma in Washington D. C., die Ermittlungsarbeiten und Personenschutz anbot.
Wie schon oft fragte sie sich, wann ihr Angestellter nach Hause ging und schlief. Es war eines dieser Rätsel, die Nick Davout umgaben.
„Ich bin in Chayton County.“
„Habe ich mir gedacht, als du nicht im Büro aufgetaucht bist.“
Nick Davout war dagegen gewesen, dass sie nach South Dakota ging. Sie hatten gestritten. Wäre es ein Wettkampf gewesen, hätte sie verloren. Was daran lag, dass er die besseren Argumente gehabt hatte. Die hatte sie ignoriert und sich einen Flug gebucht.
Heimlich. Ohne ihn oder jemand anders zu informieren. Dabei hatte sie sich feige gefühlt.
„Als Chefin einer Sicherheitsfirma kann man es sich nicht leisten, einen solch teuren Gefallen zu tun. Wir haben zu viel zu tun.“
„Du weißt, dass ich Earl helfe.“
Earl Arendts war ein Freund von Lozen und der Sheriff von Homer City, einer Kleinstadt mit rund 600 Einwohnern in Chayton County.
„Das ist der einzige Grund?“
„Ich bin die Chefin, ich muss mich nicht rechtfertigen.“
„Das ist richtig.“
Nick Davout war ein schwieriger Mitarbeiter, aber ein unentbehrlicher. Weil er ein Genie war. Für ihn war die Welt, in der er lebte, viel zu langsam. Er war ein Computer-Ass mit fotografischem Gedächtnis, der mit 18 seinen Doktortitel gemacht, eine kurze Karriere beim CIA hingelegt und schließlich bei Lozen angeheuert hatte, weil strenge Hierarchien und viel Bürokratie nichts für ihn waren.
„Sonst noch was?“, fragte sie.
„Weißt du, wie lang die Angelegenheit dauern wird?“
„Schwer einzuschätzen.“
„Hab ich mir gedacht. Das ist unverantwortlich.“
„Nick.“
„Es ist alles gesagt“, sagte er und legte auf.
4.
Eine Woche zuvor in Washington D. C.:
Ein Mann betrat ein kleines Apartment im zweiten Stock eines renovierungsbedürftigen Miethauses und schaltete das Licht im Wohnzimmer an. Er hatte ein angenehmes Gesicht, dichtes schwarzes Haar und schöne braune Augen. Der Mann verdiente sein Geld als Fahrlehrer. Seinen Namen hatte Lozen vergessen. Er hatte im vergangenen Herbst einen Brandsatz in ein koscheres Lokal in Montreal geworfen, damit zwei Menschen getötet und acht verletzt. Lozen saß auf dem Dach des Hauses gegenüber und zielte mit einem Gewehr mit Zielfernrohr, ein M24 SWS, auf den Kopf des Mannes. Sie trug Handschuhe und eine schwarze Jacke mit Kapuze. Neben ihr lag ein geöffneter schwarzer Koffer, der mit einem für die Einzelteile des Gewehrs konfigurierten Schaumstoffpolster ausgekleidet war.
Vor vier Tagen war die Mail gekommen. Verschlüsselt. Mit Namen und Adresse der Zielperson, dazu eine Datei mit Lebenslauf und Hintergrundinformationen. Seit einiger Zeit arbeitete Lozen für eine inoffizielle Einsatztruppe, die Terroristen eliminierte. Nicht, weil sie an diese Art von Gerechtigkeit glaubte. Sie hatte den Auftrag herauszufinden, wer zur Truppe gehörte und wer sie finanzierte. Bisher hatten ihre Ermittlungen nichts ergeben.
Der Mann verschwand aus ihrem Sichtfeld. Kurz darauf ging das Licht in einem anderen Raum an. Es war die Küche. Der Fahrlehrer trat ein und stellte die Kaffeemaschine an. Lozens Hände begannen zu zittern. Sie legte das Gewehr auf den Boden und rauchte einen Joint. Teil der Truppe zu werden war der einfachste Weg gewesen, den Auftrag zu erfüllen. Hatte sie darüber nachgedacht, ob es die richtige Entscheidung war? Ja. Hatte sie lange genug darüber nachgedacht? Nein. Sie hatte es sich einfach gemacht, hatte sich gesagt, dass sie als Soldatin und Ermittlerin beim CID, der Militärstrafverfolgungsbehörde der US-Army, bereits getötet hatte, sie hatte sich gesagt, dass es keine Unschuldigen treffen würde, dass es gerechtfertigt wäre, weil sie am Ende eine Gruppe ausschaltete, die das Gesetz in die eigene Hand nahm. Aber jetzt, Monate später, wurde ihr klar, dass alte Konditionierungsmuster die Kontrolle übernommen hatten, die man ihr bei der Ausbildung zur Scharfschützin einprogrammiert hatte. Handeln, nicht denken. Keine Skrupel. Die Zielperson hat es verdient. Die aktivierte Konditionierung ließ sie in einer schwarz-weißen Welt leben, die nur beim Militär – und in schlechten Filmen – existierte. Es war eine Welt, von der sie gedacht hatte, sie hätte sie längst verlassen.
Als sie die Entscheidung getroffen hatte, war Lozen nicht in bester Verfassung gewesen. Sie war Zeugin eines Anschlags gewesen, beim jährlichen Filmfestival von Homer City. Schützen hatten ein Blutbad angerichtet. Eike Wolfen, ein guter Freund, Deputy Sheriff von Homer City und Ehemann von Earl Arendts’ verstorbener Tochter Chumani, wurde schwer verletzt. Sie selbst fing sich eine Kugel, hatte die Täter trotzdem gejagt und erwischt. Terroristen umzubringen, hielt sie damals für keine schlechte Idee. Aber der Zorn war längst verflogen.
Lozens stummgeschaltetes Smartphone vibrierte. Sie zog es nicht aus der Gesäßtasche. Falscher Zeitpunkt. Sie schaute wieder zum Gebäude gegenüber. Der Fahrlehrer verließ die Küche. Diese Aufträge machten etwas mit ihr. Sie wusste nicht genau, was, sie konnte es nicht in Worte fassen. Anfangs hatte sie die Lebensläufe gelesen, um die Gewissheit zu haben, dass es jemand erwischte, der es verdient hatte. Mittlerweile las sie die Briefings nicht mehr. Das beunruhigte sie. Sie glaubte zwar, dass man Terroristen nicht mit dem Gesetzbuch in der Hand jagen konnte, aber das hieß nicht, dass sie gleichgültig war. Dies war nicht der richtige Weg. Aber was tun? Sie könnte einfach aufstehen und gehen. Den Fahrlehrer leben lassen. Irgendwann würde die Polizei oder das FBI ihn fassen. Eine Frage der Zeit. Aber in dieser Zeit konnte er in einem anderen Restaurant ein Massaker anrichten. Sie drückte den Joint aus, steckte den Stummel in die Hosentasche und nahm das Gewehr. Die Hände waren wieder ruhig. Der Fahrlehrer saß mittlerweile im Wohnzimmer und las auf einem Tablet. Sie zielte und drückte ab. Bullseye.
Lozen nahm das Gewehr mit gekonnten Griffen auseinander, legte die Einzelteile in die Einsätze des Kofferpolsters, schloss ihn, zog die Kapuze der Jacke tief ins Gesicht und verließ das Dach. Im Treppenhaus kam ihre eine fette Frau entgegen, die Lozen nicht beachtete, weil sie mit ihrem Gewicht und den Stufen kämpfte. Auf der Straße waren viele Menschen unterwegs. Wegen eines Konzertes in der Nähe. Deshalb hatte Lozen diesen Tag gewählt. Keinem würde sie auffallen. Sie war ein Teil der anonymen Masse. Sie ging vier Blocks, nahm die U-Bahn, fuhr eine Haltestelle weit und stieg aus. Das Smartphone begann wieder zu vibrieren. Sie zog es heraus und schaute aufs Display. Es war Earl Arendts. Diesmal ging sie ran.
„Hi, Earl.“
„Hallo, Lozen. Störe ich?“
„Nein.“
„Wo bist du? Es hört sich seltsam an.“
„Ich gehe gerade aus einer U-Bahn-Station.“
„Verstehe.“
Was wollte der Sheriff? Nur um zu plaudern, rief er normalerweise nicht an.
„Earl, was gibt`s?
„Jemand ist mir reingefahren. Ich hab zwei gebrochene Beine.“
„Mist.“
„Du sagst es. Morgen darf ich immerhin raus aus dem Krankenhaus.“
Lozen fragte sich erneut, warum Earl Arendts anrief.
Krankengeschichten auszutauschen war nicht sein Ding. Der große Mann, den sie selten ohne seine beige-braune Sheriff-Uniform gesehen hatte, war einer der wenigen, auf den die Bezeichnung „harter Kerl“ zutraf, und harte Kerle jammerten nicht.
„Um was geht es, Earl?“
Der Sheriff atmete durch.
„Ich brauche deine Hilfe. Nicht persönlich. Bei der Arbeit.“
„Aha.“
„Ich kann dir nicht mehr als ein Deputy-Gehalt zahlen.“
„Das ist schlecht.“
„Deine Preise kann sich die Stadt nicht leisten.“
„Worum geht es?“
Lozen hatte die Station verlassen und überquerte eine Straße.
„Zwei Prostituierte wurden ermordet.“
„Du hast Eike.“
Eike war früher Kommissar der Berliner Mordkommission gewesen.
„Weg. Hat sich eine Auszeit genommen.“
Lozen blieb stehen.
„Auszeit? Das klingt nicht nach Eike.“
„Er ist nicht klargekommen. Seit dem Anschlag war er nicht mehr derselbe.“
„Wirklich? Als ich ihn damals aus dem Krankenhaus geholt habe, wirkte er okay. Und bei den Telefongesprächen danach auch“, sagte sie.
„Manchmal dauert es, bis sich zeigt, wo man wirklich verletzt worden ist.“
„Hm.“
„Auf jeden Fall geht er nicht ans Telefon und beantwortet keine E-Mails und keine SMS und keine Instant-Messages.“
„Seit wann?“
„Seit fast zwei Monaten.“
„Hm.“
„Er wird wieder auftauchen.“
„Glaube ich auch“, sagte sie.
Es entstand eine kurze Gesprächspause. Lozen ging weiter.
„Und deine anderen Deputys?“, fragte sie.
„Filmore ist kein Ermittler. Und den Neuen, den ich habe, kann ich nicht einschätzen.“
„Warum hast du ihn dann eingestellt?“
„Auf Wunsch von Kraft.“
Joel Kraft war der Gouverneur von South Dakota, gleichzeitig Bürgermeister von Homer City und einer der wichtigsten Arbeitgeber von Chayton County. Er besaß eine Fleischverarbeitungsfabrik und ihm gehörte Maka Prison, eines der größten Gefängnisse in den Dakotas. Ihm schlug man keinen Gefallen ab.
„Verstehe.“
„Die Highway Patrol und das FBI interessieren tote Prostituierte nicht sonderlich.“
„Aber dich.“
„Irgendwas stimmt da nicht.“
„Intuition?“
„Auch.“
„Aber da ist noch was.“
„Ich glaube, dass mein Unfall kein Zufall war.“
„Wie kommst du darauf?“
„Der Fahrer hat mehrere Vorstrafen, arbeitete für die Zuhälterin der Opfer und ist seit dem Unfall nicht aufzufinden.“
„Klingt wirklich nicht nach Zufall.“
Lozen hatte ihren Wagen erreicht. Sie öffnete ihn und legte den Koffer auf die Rückbank.
„Earl, ich muss über die Sache nachdenken. Ich kann hier nicht einfach so weg.“
„Verstehe ich. War nur so eine Idee. Du hast mir mal erzählt, dass du Mordermittlungen magst. Also melde dich.“
„Mach ich.“
„Bye.“
„Bye.“
Es stimmte: Mordfälle hatten ihr immer gefallen. Der letzte lag Jahre zurück. Damals, als sie Ermittlerin beim CID gewesen war.