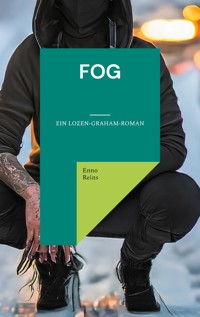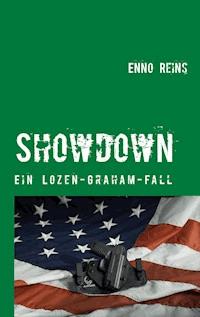Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lozen Graham-Fall
- Sprache: Deutsch
Nur schnell raus aus Zürich und der Schweiz. Das muss die ehemalige Ermittlerin Lozen Graham. Nachdem sie eine Mörderin aus dem Gefängnis befreit hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Epilog
1.
Der Schlangenmann ging mit schnellen Schritten an den Beamten der Zollkontrolle vorbei, durch die Sicherheitsschleuse und betrat dann den Ausgangsbereich des Zürcher Flughafens. Er war schlank, hatte einen rasierten Kopf und einen starken Bartschatten, trug eine graue Lederjacke, T-Shirt, Jeans und Stiefel. Hals und Hände waren tätowiert. Der grüne Rucksack war, wie beim vorherigen Besuch, sein einziges Gepäckstück. Er ging auf eine Frau zu, deren untere Kopfhälfte rasiert war und die das lange schwarze Deckhaar mit blauen Strähnen gescheitelt zur linken Seite trug. Sie hatte eine schwarze Bomberjacke mit silbernen Reißverschlüssen an, dazu schwarze Jeans und schwarze Springerstiefel.
„Hallo“, sagte der Schlangenmann zur Begrüßung auf Englisch.
Lozen nickte. Der Kerl kam aus New York. Seinen Namen kannte sie nicht, sie hatte keine Ahnung, warum er kam und was seine Aufgabe war, und es war ihr auch egal. Wahrscheinlich wusste der Schlangenmann mehr über sie als umgekehrt. Sie gingen ins Parkhaus und stiegen in einen blauen SUV. Lozen setzte sich hinters Steuer.
„Zuerst zur Wohnung, Ms. Freeman“, sagte er und steckte sich kabellose Kopfhörer in die Ohren. ‚Dee Freeman‘, unter dem Namen kannte er Lozen.
Sie fuhr los. Draußen war es dunkel, der Berufsverkehr vorbei. Lozen schaute wiederholt in den Rückspiegel, aber niemand folgte ihnen. Obwohl sie absichtlich einen Umweg fuhr, war es eine kurze Fahrt. Sein Apartment lag in Nähe des Flughafens in einer Neubausiedlung. Sie mochte die Bleibe des Schlangenmanns nicht, weil sie voller Terrarien war, in denen Schlangen hausten, weshalb sie ihm den Spitznamen gegeben hatte. Ein junger Typ mit langen roten Haaren und Brille ließ sie rein. Er kümmerte sich um die Tiere. Lozen vermutete, dass er der Geliebte des Schlangenmanns war.
Der Schlangenmann schaute sich mit dem Rotschopf die Tiere an, nahm ab und zu eines aus dem Terrarium, küsste es auf den Kopf und legte es zurück. Lozen, die am Eingang wartete, fand das Hobby seltsam, weil sie in New Mexico aufgewachsen war, wo Klapperschlangen etwas Alltägliches gewesen waren. Als Kind wurde sie von einer in den Oberschenkel gebissen. Das hatte wehgetan. Es war ihre erste Narbe gewesen.
„Ich mache mich kurz frisch, dann müssen wir weiter“, sagte der Schlangenmann, als er mit der Begrüßung der Reptilien fertig war.
Der Rotschopf fragte Lozen, ob sie einen Kaffee haben wolle, was sie dankend ablehnte, obwohl er einen guten machte, den er stets in einer roten Tasse servierte, aber sie hatte am Flughafen zwei Energy Drinks getrunken, die sie durch die Nacht bringen würden.
Der Schlangenmann brauchte nicht lange. Als er aus dem Bad kam, gab ihm der Rotschopf eine Pistole in einem Knöchelholster, das er am rechten Bein befestigte. Wie die Begrüßung der Schlangen gehörte das zu den Abläufen, die Lozen von den vorherigen zwei Besuchen kannte. Bei der Waffe handelte es sich um eine Ghost Gun, ein Bausatz aus einem 3-D-Drucker, selbst zusammengebaut, ohne Seriennummer und nicht zurückverfolgbar, daher der Name.
„Wir können“, sagte er zu Lozen, als er fertig war.
Sie verließen die Wohnung, gingen zum SUV, fuhren ins Stadtzentrum und parkten in einer Nebenstraße. Lozen führte den Schlangenmann durch einen dunklen Hinterhof zu einer Stahltür, vor der ein bulliger Typ saß. Er nickte Lozen zu, öffnete die Tür und ließ sie rein. Lozen ging vorne weg. Sie gelangten in einen spärlich beleuchteten Gang, in dem Kühltruhen, Bierfässer und Getränkekästen standen. In der Ferne war Musik zu hören.
„Einschätzung?“, fragte der Schlangenmann.
„Normaler Club. Viele Menschen. Unübersichtlich.“
Lozen hatte sich die Location am Vorabend angeschaut. Laut. Voll. Grelle, sich bewegende Scheinwerfer, die die Sicht erschwerten.
„Georgy steht auf diesen Scheißladen.“
Er schaute zu einer Kiste mit polnischem Wodka.
„Erwarten Sie Probleme?“, fragte sie.
„Ich erwarte immer alles.“
Sie kamen zu einer Tür, die Lozen aufdrückte und die in den Club führte. Eine deutschsprachige Rapperin erklärte, sie sei anders als die anderen. Lozen war US-Amerikanerin, konnte aber fließend Deutsch. Sie besaß ein Talent für Fremdsprachen. Sie lernte sie nicht, sie schnappte Sprachen auf, durch Zuhören und Praxis. Ihre Spanischkenntnisse hatte sie von einem mexikanischen Mechaniker, der ihre erste Liebe gewesen war, arabisch konnte sie durch Gespräche mit einheimischen Ordnungskräften während ihrer Einsätze in Afghanistan und im Irak. Deutsch hatte sie sich während der Stationierung in Stuttgart in den Kneipen der Stadt angeeignet. Am Anfang war Lozen überrascht gewesen, wie unterschiedlich Schweizerdeutsch und Hochdeutsch waren, und es hatte gedauert, bis sie die Varianten verstanden hatte. Sie hatte im Internet eine Liste der zwanzig besten Schweizer Filme gefunden, die sie ohne Untertitel abgearbeitet hatte, nachdem sie sie auf buccaneer.com gefunden hatte, eine Plattform, von der man semilegal Filme aus allen Zeiten und aller Welt runterladen konnte.
Lozen sah sich im Club um. Gäste mit bunten Leuchtstäben in der Hand schwitzten auf der Tanzfläche, an der Bar gab es keinen freien Platz, genauso wenig im Loungebereich, der mit knautschigen Sofas aus buntem Kunstleder eingerichtet war. Auf einem saß ein unsympathischer muskulöser Typ mit Glatze, der T-Shirt und Jeans trug. Vor ihm stand ein Kühler mit Champagner, neben ihm rekelten sich zwei kichernde knapp bekleidete Frauen, hinter ihm stand ein massiger Kerl mit blondiertem Haar.
Sie führte den Schlangenmann zum Sofa. Der muskulöse Typ gab den Frauen ein Zeichen und sie verschwanden auf die Tanzfläche. Der Typ hieß Georgy Kitup. Ein russischer Gangster. Mehr wusste Lozen nicht über ihn. Der Schlangenmann suchte ihn bei jedem seiner Besuche auf.
Die Kerle umarmten sich. Lozen stellte sich neben den Blondierten. Sie wusste, es würde eine lange Nacht werden. Gewöhnlich soffen der Schlangenmann und der Gangster bis in die Morgenstunden und redeten darüber, worüber sie reden mussten. Es war ein Scheißjob, aber gut bezahlt. Das war gut. Das Leben in Zürich war verdammt teuer.
2.
Kurz vor Sonnenaufgang kam Lozen müde nach Hause. Sie wohnte in einem unansehnlichen Mietshaus, das in den späten 1950ern gebaut worden war. Sie schloss die Haustür auf, ging in den zweiten Stock, öffnete die Wohnungstür, die außen eine Klinke besaß, eine Schweizer Eigenart, die sie nach wie vor irritierte, und betrat das Einzimmerapartment, in dessen Mitte eine breite Matratze lag, auf der sich ein Laptop, eine Bettdecke mit Superheldenmotiven und Kopfkissen befanden. Am Kopfende stand eine altmodische Schirmlampe, daneben eine grüne portable Bluetooth-Lautsprecherbox der Marke Kawammi, am anderen Ende thronte ein schwarzer LED-Fernseher, der auf einer Obstkiste stand. T-Shirts, Jeans, Socken, Hausschuhe, schwarze Sneaker, Kurzhanteln, eine Langhantel und zerfledderte Taschenbücher bedeckten den abgenutzten beigen Teppichboden. An einer Wand, zwischen Kinoplakaten von Filmen aus den 1990ern, gab es eine Dartscheibe, in der ein Wurfmesser steckte. Vor den Fenstern hingen grüne, viel zu lange Vorhänge aus dickem Stoff. Durch eine Tür gelangte sie in die klitzekleine Küche mit einer dunkelroten Einbauküche, durch eine andere ins weiß gekachelte Bad.
Vor der Küchentür lag ein riesiger haariger weißer Hund auf einer Tatamimatte, der sich erhob und zu ihr getrottet kam. Sie ging in die Knie und täschelte seinen Kopf.
„Wie geht es dir, Warschoi?“
Das Tier schleckte ihre Hand. Warchoi war in Star City, Lozens Lieblings-Science-Fiction-Serie, die von den Bewohnern einer riesigen Stadt erzählte, die durch den Weltraum schwebte, ein Rakken, ein gigantischer Wolfshund, der den einsamen Sternenkrieger Toburak begleitete. Nach ihm war er benannt.
Nachdem sie mit Warchoi um den Block gegangen war, ging sie ins Bad und schaute in den Spiegel. Sie fand, dass man ihr die lange Nacht in dem blöden Club ansah. Lozen legte ihre Waffe, eine Glock 22, für die sie einen gefälschten Waffenschein besaß, auf den Wasserkasten des Klos, zog Tanktop, Hose und Stiefel aus. Darunter trug sie schwarze Sportunterwäsche. Auf dem Rücken flog ein Drache, von ihrer Achselhöhle bis zum Hüftknochen zog sich der Schriftzug ‚Apache Nation‘. Eine Zugehörigkeitserklärung, denn sie war eine Chiricahua-Apachin. Die hatte sie sich vor ihrem ersten Einsatz als Soldatin stechen lassen. Auf dem linken Oberarm hatte sie einen Adlerflügel, im Nacken saß eine Krähe, die sich in kleine schwarze Schwalben auflöste, auf ihrem linken Handrücken befand sich ein Drachenkopf.
Sie holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank, setzte sich auf die Matratze, fuhr, weil sie zum Schlafen zu aufgedreht war, das Laptop hoch und startete einen Film über eine Gruppe mittelalter Typen, die versuchten, ihren Alkoholpegel ständig bei fünf Prozent zu halten. Nach einer halben Stunde schlief Lozen ein.
3.
„Umdrehen, Hände an die Wand, Beine spreizen“, sagte Lozen zum schlecht rasierten Kerl in Lederjacke und Jeans. Sie stand vor einer Suite, die der Schlangenmann in einem zweitklassigen Hotel gemietet hatte. Er hatte ihr gesagt, dass er drei Gäste erwarte, Lozen sie durchsuchen und eventuelle Waffen abnehmen solle.
„Ich mach, was du willst, Schönheit“, sagte der Kerl auf Basler Schweizerdeutsch und drehte sich zur Wand. Sie begann, den Kerl abzutasten.
„Du darfst mich überall anfassen, Schönheit.“
„Noch nie gehört den Spruch“, sagte sie und gab ihm einen Stupser in die Genitalien, der ihn zusammenzucken ließ.
„Hey, sachte.“
Sie suchte weiter, entdeckte ein Klappmesser im Stiefelschaft, das sie an sich nahm. Sie öffnete die Tür und schickte ihn ins Zimmer. Er war der letzte Gast. Die anderen waren ohne Waffen gekommen. Lozen lehnte sich an die Wand, steckte die kabellosen Kopfhörer ins Ohr und ließ einen Song abspielen. Die Sängerin sprach über einem Traum, dem sie hinterlief, und einem Geheimnis, dem sie auf der Spur war.
Nach zwei Stunden verließen die Gäste die Suite und Lozen gab dem Schlechtrasierten das Messer zurück.
„Auf Wiedersehen, Schönheit.“
„Ich hoffe nicht.“
Sie drehte sich um und ging in die Suite. An einem runden Tisch, auf dem Gläser und leere Cola- und Wasserflaschen standen, saß der Schlangenmann und tippte etwas ins Smartphone.
„Hatte einer eine Waffe?“, fragte er.
„Der, der die Erfindung des Rasierapparats nicht mitbekommen hat.“
Der Schlangenmann schaute sie an und lächelte leicht.
„Das wäre mein Tipp gewesen.“
Gegen neun Uhr abends setzte sie den Schlangenmann bei seiner Wohnung ab und fuhr nach Hause. Nachdem sie mit Warchoi einen ausführlichen Spaziergang gemacht hatte, holte sie ein Schweizer Bier aus dem Kühlschrank, setzte sich auf die Matratze, schrieb erst eine E-Mail an einen Odinson23 und öffnete dann die Accounts von Dee Freeman auf LukOut, dem zurzeit angesagtesten Social-Media-Kanal, und den bei dem Konkurrenten BeCuul. Sie fotografierte das Bier und postete die Aufnahme auf beiden Kanälen. Sie hörte eines ihrer Smartphones klingeln. Sie besaß drei: eines für private Anrufe, eines für Dienstgespräche mit dem Schlangenmann und anderen Kunden und eines für ihren Auftraggeber. Der Klingelton war der Refrain eines alten Punksongs. Das hieß, es war das private.
„Hey, Nick.“
„Guten Abend.“
„Wie gehts?“
„Wie soll es gehen?“
Small Talk war nicht Nick Davouts Ding. Er war ein humor- und emotionsloses Genie, jemand, für den die Welt, in der er lebte, viel zu langsam war, ein Computer-Ass mit fotografischem Gedächtnis, der mit achtzehn seinen Doktortitel gemacht und eine kurze erfolgreiche Karriere beim CIA hingelegt hatte.
„Besondere Vorkommnisse?“, fragte er.
„Der Schlangenmann ist in der Stadt.“
Lozen hatte früher eine kleine Sicherheitsfirma für Personenschutz und Ermittlungen in Washington DC geleitet. Nick Davout war ein ehemaliger Mitarbeiter, der die Firma weiterführte, nachdem ihr eine Milliardärin, der sie Manipulation bei dem US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes nachgewiesen hatte, einen Mord angehängt hatte und es ihr nicht gelungen war, ihre Unschuld zu beweisen.
Lozen war aus dem Gefängnis geflohen und Nick Davout hatte es geschafft, dass sie offiziell für tot erklärt worden war, sodass sie sich um die Verfolgung durch die Polizei keine Sorgen machen musste.
Seitdem lebte Lozen unter dem Alias ‚Dee Freeman‘.
Sie kommunizierten in unregelmäßigen Abständen, wobei sie jeweils eine E-Mail an Odinson23 schickte, eine der diversen Internetidentitäten von Nick Davout, der sie zurückrief.
„Hast du die Posts gemacht?“
„Gerade ein Bier.“
Dee Freeman war eine Erfindung von Nick Davout.
Er hatte eine Internetseite und LukOut- und BeCuul-Accounts unter ihrem Namen eröffnet und mit Content gefüllt. Fotos, die er dabei benutzt hatte, waren durch Ausschnitt- und Farbveränderungen so bearbeitet, dass sie mit einer umgekehrten Bildsuche nicht zurückverfolgbar waren. Damit die Konten echt wirkten, hatte er darauf bestanden, dass es pro Woche acht Aktivitäten gab, worauf Lozen begonnen hatte, Biergläser und Flaschen abzufotografieren und die Aufnahmen zu veröffentlichen. Die Legende von Dee Freeman war nicht spektakulär. Sie war Anfang 30, aus Washington DC, hatte Highschool und College in Bildungsinstitutionen besucht, die mittlerweile geschlossen waren, war viel gereist und hatte sich mit den verschiedensten Jobs durchgeschlagen: Türsteherin, Handwerkerin und zurzeit als Kinovorführerin. Dee Freeman war eine echte Drifterin.
„Hast du was, Nick?“
„Nein. Keine besonderen Aktivitäten.“
„Dann ist ja alles gut.“
Wer sich intensiv mit dem virtuellen Leben von Dee Freeman beschäftigte und sich mit der Jagd nach Menschen auskannte, würde in den Texten, Hashtags und Bildern Hinweise finden, die Nick Davout mit Absicht hinterließ. Sie führten zu einem leer stehenden Büro in einer miesen Gegend in DC, in dem niemand arbeitete und versteckte Überwachungskameras jeden Besucher filmten. Nick Davouts Idee. Seine Welt bestand aus Paranoia. Er schloss nicht aus, dass es Menschen gab, die nicht an Lozens Ableben glaubten und sie suchten.
„Ich kann mich nur wiederholen. Jobs für den Gangster zu erledigen, ist unklug“, sagte er.
„Nicht schon wieder diese Diskussion.“
Mit ihm zu arbeiten, ist anstrengend, dachte Lozen, beendete das Gespräch, klappte das Laptop zu, trank das Bier, holte ein zweites und legte sich, nachdem sie es ausgetrunken hatte, schlafen.
4.
Der gut aussehende Typ ging aufs Herrenklo des Clubs. Als er vor dem Pissoir stand und urinierte, erschien eine schöne Frau in einem beeindruckenden Abendkleid neben ihm, lächelte und schoss ihm in den Kopf. Umschnitt. Ein Junge sprang vom Sprungturm eines Freibades, blieb länger unter Wasser als nötig, bevor er auftauchte. Der Abspann begann und das Licht im Saal ging an. Die Zuschauer erhoben sich und verließen das Kino. Es war ein nicht sehr anspruchsvoller Actionfilm mit gut choreografierten Kampfszenen und ohne Happy End gewesen. Lozen, die eine schwarze Cargohose, ein schwarzes Tanktop und schwarze Springerstiefel trug, sammelte die Gläser und Flaschen im Saal ein und brachte sie zur Theke, wo sie das Geschirr abwusch.
Wenn sie nicht als Bodyguard Geld verdiente, arbeitete sie im ‚Caiman‘, einem Programmkino, das im Zuschauerraum eine Bar besaß, an der die Gäste Popcorn, Essigchips, Wasser, Bier, Wein, Prosecco und Sprizz kaufen konnten. Das Caiman fasste fünfzig Personen, die sich auf gemütlichen Sesseln niederlassen konnten, vor denen Holztische für die Getränke standen. Sie mochte die Arbeit. Nicht, weil sie viel einbrachte, sondern weil sie Filme liebte.
Sie räumte auf, nahm, als sie fertig war, die schwarze Lederjacke, gab Warchoi, der unter der Theke döste, ein Zeichen, worauf er zu ihr getrottet kam, machte das Licht aus, verließ den Saal, schloss die Eingangstür ab und fuhr den Rollladen runter. Es war ein warmer Sommerabend. Die Luft roch gut. Sie beschloss, nicht direkt nach Hause zu gehen.
Nachdem sie eine Weile mit Warchoi auf der Wiese eines Friedhofs in der Nähe getobt hatte, schlenderte sie zu einem weitläufigen Platz, an dem Restaurants und Kneipen lagen. Menschen saßen draußen, tranken, aßen, redeten. Der Idaplatz erinnerte Lozen wegen seiner Weitläufigkeit an Berlin, wo sie mal einen Auftrag erledigt hatte. Sie betrat eine Bar, die ‚Morgan‘ hieß, in der es eng und dunkel war und düstere Musik lief. Eine Sängerin fragte, ob er nicht wisse, dass sie keine Angst habe, Blut zu vergießen.
„Hey“, sagte der Barkeeper.
Er war Ende vierzig, hatte schwarz gefärbte Haare, trug ein weites T-Shirt, hieß Alan Klein und war Neuseeländer. Sie legte die Lederjacke über einen Barhocker und setzte sich drauf. Der Rakken legte sich neben sie auf den Boden. Alan Klein stellte ihr eine Flasche schottisches Pale Ale auf die Theke. Sie machte ein Foto und postete es.
„Viele Gäste?“, fragte er.
Ihm gehörte neben dem Morgan auch das Caiman.
„Fast ausverkauft. Wegen des australischen Hauptdarstellers. Der Film war durchschnittlich.“
„Morgen kommt was Schweizerisches. Geht um einen schwulen Fußballer.“
„Klingt gut.“
„Ist gut.“
„Wann machen wir eigentlich die Star-City-Nacht?“
„In einer Woche. Ich habe das Rechtliche abgeklärt.“ „Schön.“
Sie rieb sich den Oberarm, auf dem der Adlerflügel tätowiert war. Ein bärtiger breitschultriger Typ mit grimmigem Blick, der Baseball-Cappy, T-Shirt, knielange Hosen und Turnschuhe trug, betrat das Morgan. Lozen musterte ihn und ordnete ihn als Problemfall ein. Er setzte sich an einen freien Tisch.
„Der wird Ärger machen“, sagte sie zu Alan Klein.
„Kannst du in die Zukunft schauen? Typen in knielangen Hosen sind harmlos.“
Sie zuckte mit den Schultern und bestellte ein weiteres Bier. Es war nicht ihr Problemfall.
Sie hatte das Bier halb ausgetrunken, als der Typ mit einem Kerl vom Nebentisch Ärger anfing und Alan Klein dazwischengehen musste. Mithilfe der Kellnerin gelang es ihm, den Problemfall rauszuwerfen. Lozen grinste ihn an, als er atemlos und mit rotem Kopf zurückkam.
„Bist du jetzt stolz auf dich?“, fragte er.
„Ich bin immer stolz auf mich.“
Sie leerte das Bier, klopfte dem Neuseeländer auf die Schulter, verließ mit Warchoi das Morgan und ging nach Hause.
5.
Vier Personen auf dem Bahnsteig außer ihr und dem Schlangenmann. Zwei Kerle, die sich unterhielten, eine Frau mit Kopftuch, die auf ihr Smartphone starrte, eine weitere Frau, die apathisch auf den Boden guckte. Sie schaute nach links und sah die blau-weiße Straßenbahn der Linie 14, die sich der Haltestelle näherte. Nachdem sie eingefahren war, stieg der Schlangenmann, der den grünen Rucksack bei sich trug, in den zweiten Waggon, Lozen folgte ihm. Er fuhr bis zum Hauptbahnhof und schlenderte die Bahnhofstraße, die Einkaufsstraße der Stadt, hinunter. Es war ein schöner Nachmittag, viele Touristen und Kaufwillige waren unterwegs.
Geschickt bewegte sich der Schlangenmann durch die Menschenmenge, ohne dass er jemanden berührte, als hätte er einen Radar, der ihm den besten Weg zeigte.
Lozen hatte Mühe, mitzuhalten. Sie wusste nicht, wohin es ging, er hatte ihr nur gesagt, er wolle Besorgungen machen und anschließend Geschäftspartner aufsuchen. Bei seinem ersten Besuch hatte er, typisch US-Amerikaner, den Wagen genommen, aber schnell begriffen, dass er durch Zürich mit seinem dichten Straßenbahn- und Busnetz entspannter und oft schneller mit öffentlichen Verkehrsmitteln kam.
Lozen entdeckte links vor ihnen einen Typen am Straßenrand, der ihr nicht gefiel. Auch wenn sie nicht glaubte, dass jemand etwas auf der Bahnhofstraße versuchen würde, ging sie schneller, bis sie sich neben dem Schlangenmann befand. Sie passierten den Typen, ohne das etwas geschah. Der Schlangenmann steuerte auf ein Kaufhaus zu, in dem er ein Parfum und eine Jeans kaufte, die er im Rucksack verstaute.
Wieder draußen ging er in ein BeBe, gesprochen BiBi, eine US-amerikanische Kaffeehauskette, die sich seit Monaten auch in Europa ausbreitete. Lozen war das erste Mal in einem, sie hatte bisher nur davon gehört, von ihrem Freund Eike Wolfen, weil ein BeBe in Homer City aufgemacht hatte, die Kleinstadt, in der er lebte. Die Wände bestanden aus grauem Stein, Theke und Regale aus dunklem Holz. Es gab eine Verkaufsfläche, wo die Kunden verschiedene Kaffeesorten in stahlgrauer Verpackung mit weißer Schrift, T-Shirts und Tanktops mit dem BeBe-Logo kaufen konnten. Die Musik, die lief, war klassischer US-amerikanischer Rock. An den Wänden hingen Geweihe. Der Schlangenmann und sie stellten sich an die Theke und bestellten beim bärtigen Barista, der ein schwarzgraues T-Shirt und ein Baseball-Cappytrug, beide mit Firmenlogo. Die Kasse sah nach frühem zwanzigsten Jahrhundert aus, bestand aus scheinbar rostigem Metall, auf dem das verblassende Stars-and-Stripes-Motiv zu sehen war.
Der Cappuccino für ihn und die Vanilla Latte für sie kamen schnell und sie setzten sich in eine Ecke an einen runden Tisch aus grobem dunklem Holz.
Während der Schlangenmann etwas auf seinem Tablet las, recherchierte sie mit dem Smartphone. Laut der Internet-Enzyklopädie LaiLai war BeBe das Kürzel für Berettas Beans. Der Ex-Soldat Saul Beretta hatte die Kette vor vier Jahren mit anderen Veteranen gegründet, weshalb republikanische Politiker und ihre Anhänger die Kette mochten.
Lozen kannte Saul Beretta. Er hatte eine Spezialeinheit in Afghanistan geleitet, die jeder ‚Berettas Commando‘ genannte hatte. Killer, die hinter den feindlichen Linien eingesetzt wurden, um Warlords und Terroristen auszuschalten und Geiseln zu befreien. Lozen war ihm in ihrer aktiven Zeit begegnet. Ein harter Hund, kompromisslos, patriotisch, christlich, ein Profi und Chauvinist. Als sie auf Klo ging, entdeckte sie auf dem Weg ein Foto von ihm und den anderen Gründern. Vier unrasierte Männer in T-Shirts irgendwo in einem Wald grinsten in die Kamera.
Als sie den Kaffee getrunken hatten und das BeBe verließen, bewegte sich ein Demonstrationszug über die Straße. Menschen mit bunten Plakaten für Klimaschutz und Polizisten, die den Zug begleiteten.
Lozen schaute sich um. Zwei maskierte Typen sprayten etwas auf das Schaufenster eines Modegeschäftes. Ein Mädchen kam auf sie zu und drückte ihr ein Flugblatt in die Hand. Sie überflog es.
Offenbar waren für die nächsten Wochen verschiedene Aktionen in Zürich und Umgebung geplant. Lozen hörte einen Aufschrei. Polizisten jagten die Sprayer, die Richtung Hauptbahnhof flüchteten.
„Wohin wollen Sie als Nächstes?“, fragte sie den Schlangenmann.
Er zeigte auf die Haltestelle auf der anderen Straßenseite.
„Wird dauern, bis da was kommt. Wegen der Demonstration.“
Er zuckte mit den Schultern und ging los. Er schlängelte sich durch die Demonstrierenden wie zuvor mit großem Geschick. An der Haltestelle warteten sie eine gute halbe Stunde, bis die nächste Straßenbahn kam. Diesmal setzte sich Lozen dem Schlangenmann gegenüber. Er kannte sich in der Stadt nicht aus und orientierte sich mit LukOutMap. Lozen fragte sich, wie schon öfter zuvor, wozu er sie brauchte. Ihr war klar, dass der Schlangenmann ein Krimineller war, weshalb Gefahr ein Bestandteil seines Lebens war, ohne dass er Lozen angedeutet hatte, wovon genau sie ausgehen könnte. Sie war eben nur ein Bodyguard. Der Auftrag kam von einem Mitglied der Russenmafia, das Aslan Dvoskin hieß, für den Lozen in den USA gearbeitet und der sie nach Europa gebracht hatte. Er war knapp über fünfzig, ein Russe mit ossetischen Wurzeln, geboren und wohnhaft in New York City, sehr sympathisch, der sie und ihre Arbeit schätzte und akzeptierte, dass sie gewisse Dinge nicht tat, wobei es Lozen nicht um Illegalität, sondern um die Art der Illegalität ging.
In den nächsten Stunden fuhren sie zu zwei Speditionen, die in verschiedenen Ecken der Stadt lagen und die wie normale Firmen wirkten, was sie wahrscheinlich nicht waren. Sie hatte keine Ahnung, welche Geschäfte der Schlangenmann über die Firmen abwickelte. Er ging stets direkt ins Büro des Chefs, wo er sich eine Weile aufhielt, während Lozen vor der Tür wartete und die misstrauischen Blicke der Angestellten an sich abprallen ließ. Bei Sonnenuntergang standen sie vor dem Appartmentgebäude, in dem der Schlangenmann wohnte.
„Ich bin die nächsten Tage am Walensee“, sagte er.
„Ich melde mich, wenn ich zurück bin und Sie benötige.“
„Okay. Viel Spaß.“
Wahrscheinlich geht er wandern, dachte sie. Der Schlangenmann war ein sportlicher Typ. Kein Gramm Fett, sehnige Muskeln, Narben auf der Brust, die nach Messerstichen aussahen. Sie hatte ihn einmal mit freiem Oberkörper gesehen, als sie ihn in ein Fitnesscenter begleitet hatte. Dort hatte er von einem Personal Trainer ein hartes Konditionstraining verabreicht bekommen, das sie beeindruckt hatte, weil sie nicht glaubte, dass sie es durchgestanden hätte.
6.
Lozen saß in Unterwäsche Joint rauchend auf ihrer Matratze. Auf dem Fernseher lief eine US-Dokumentation über ein Camp für Behinderte in den 1970ern mit einem guten Soundtrack. Warchoi interessierte der Film nicht. Er schlief. Es war kurz vor Mitternacht. Lozen hatte im Caiman gearbeitet.
Der Schweizer Film über den schwulen Fußballer war, wie Alan Klein gesagt hatte, nicht schlecht gewesen.
Sie zog am Joint und wechselte das Fernsehprogramm, landete bei einem deutschen Privatsender, wo Promis erraten mussten, ob Kandidaten singen konnten oder nicht. Die VIPs beurteilten einen Typen in Bauarbeitermontur, als eines ihrer Smartphones klingelte. Der Ton war das Pfeifen einer alten Dampflokomotive. Das hieß, es war ihr Auftraggeber. Sie wühlte sich durch ein paar T-Shirts, bis sie das Smartphone fand. Es war ein BeCuul-Videoanruf. Sie krabbelte unter die Bettdecke und nahm den Anruf an.
„Ich vergesse immer den Zeitunterschied“, sagte er.
„Macht nichts.“
„Schön, dich zu sehen, Dee.“
Aslan Dvoskin trug ein rotes langärmliges T-Shirt.
Die Ärmel waren hochgeschoben, die Unterarme muskulös und tätowiert. Die schwarzen Haare waren kurz geschnitten, ein schmaler Bart umrahmte seinen Mund. Schöne Zähne, ein gutes, interessantes Gesicht.
Er lächelte sie an. Das konnte er gut.
„Du siehst auch gut aus, Aslan.“
Er lachte. Sie hatten sich das letzte Mal vor zehn Monaten gesehen, als Lozen die USA verlassen hatte und in die Schweiz gereist war.
„Wie ist das Leben?“
„Ich vermisse Washington.“
„Ich weiß nicht, was du an DC findest.“
„Eine coole Stadt.“
„Wenn du es sagst. Ich war nie dort.“
„Was kann ich für dich tun?“
„Eine heikle Angelegenheit.“¨
„Du kennst meine Regeln.“
„In diesem Fall ist es etwas Persönliches.“
7.
Lozen stand allein an der Bushaltestelle in einem Neubauviertel am Stadtrand. Ein Kleintransporter hielt, die Tür wurde aufgerissen, ein kleiner dicklicher Typ mit Dreitagebart, der eine Kunstlederjacke und Jogginghose trug, befahl ihr, einzusteigen. Sie kletterte in den Wagen, setzte sich und fragte sich, ob Nichtrasieren bei Typen gerade in war. Der Dreitagebart richtete eine Waffe auf sie, warf ihr einen Sack zu, forderte sie auf, sich den über den Kopf zu ziehen, damit sie nicht mehr sehen konnte. Lozen folgte der Anweisung. Sie hörte, wie eine weitere Person einstieg und die Tür zuzog. Der Geruch von billigem Aftershave kroch in ihre Nase. Sie spürte Hände, die sie nach Waffen abtasteten. Natürlich suchten sie besonders intensiv bei Busen, Po und zwischen den Schenkeln. Sie nahmen ihr das Karambit ab, das in der rechten Hosentasche steckte.
Das Karambit war ein Messer mit klauenförmiger Klinge und einem Ring für den Zeigefinger, der verhinderte, dass man das Messer fallen ließ, wenn man einen Wirkungstreffer eingesteckt hatte und die Hand sich öffnete. Ihre Lieblingswaffe. Die Glock hatte sie zu Hause gelassen.
Die Fahrt ging los. Der Wagen bog oft ab und stoppte häufig. Lozen zählte mit. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde ihr befohlen, aus dem Kleintransporter auszusteigen. Sie zog Bilanz: viele Stopps, also Ampeln, in einem seltsam regelmäßigen Rhythmus. Zwanzig Mal waren sie abgebogen, überwiegend nach rechts. Das bedeutete, dass sie im Kreis gefahren waren und sich noch in der Neubausiedlung befanden.
Sie gingen ein paar Meter, blieben stehen, Lozen hörte ein Summen, sie gingen weiter, der Geruch von Reinigungsmitteln, die Schritte hallten, sie befanden sich in einem Gebäude. Ein dumpfes Geräusch, vermutlich eine Metalltür, die zugefallen war. Der Geruch änderte sich, war irgendwie abgestanden.
Stufen, sie befanden sich in einem Treppenhaus.
„Fuck. Wann reparieren die diesen verdammten Fahrstuhl endlich?“, sagte eine Stimme.