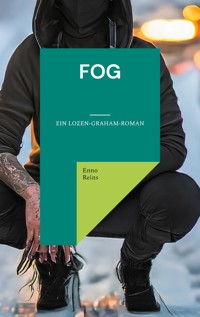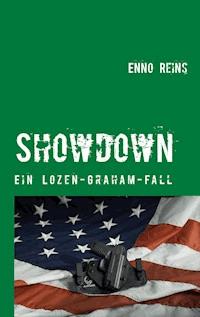Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Lozen Graham-Fall
- Sprache: Deutsch
Er wird gesucht: Der Datenschlüssel für die codierte Formel eines unbekannten Kampfstoffs. Sie hat ihn: Ageng, eine Cyberkriminelle. Ihr auf der Spur sind der US-amerikanische und chinesische Geheimdienst, eine Horde Rechtsradikaler - und Lozen Graham. Sie ist nicht freiwillig dabei. Ihr Auftraggeber erpresst sie mit ihrer Vergangenheit. Deshalb heisst es für sie: Zurück in den Knast oder sie findet den Schlüssel und seine Besitzerin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke, Uta. Wie immer.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
1.
„Wenn die Sonne unter- und der Mond aufgeht, verwandle ich mich in ein Sexmonster“, erklärte der Sänger. Ein alter Song aus den 1980ern. Was für ein blöder Text, dachte sie. Die Frau war seit anderthalb Stunden unterwegs. So lange hatte sie von Washington, D.C., nach Hagerstown in Maryland gebraucht, eine Stadt mit rund vierzigtausend Einwohnern. Es war weit nach Mitternacht. Sie war nicht müde. Die vergangenen Tage hatte sie als Rausschmeißerin im Mountain Valley gearbeitet. Deshalb war sie im Nachtrhythmus.
Sie fuhr in einem alten, schwarzen Dodge Charger auf der Cleveland Avenue durch eine schlecht beleuchtete Wohngegend. Keine Fußgänger, kein Verkehr, perfekte Atmosphäre für einen Film über die Zombieapokalypse, dachte sie. Sie bog nach links in eine schmale, spärlich beleuchtete Gasse und hielt vor einem schäbigen weißen einstöckigen Holzhaus mit Spitzdach, in dem Licht brannte. Neben dem Gebäude parkte ein verdrecktes Wohnmobil, das offenbar lange nicht mehr bewegt worden war, denn es lagen volle Müllbeutel, leere Bierdosen, eine schwarze Plastikwanne und ein Fahrrad mit verbogenem Vorderrad davor. Sie stellte die Musik aus, den Wagen ab und stieg aus. Die Frau trug ein schwarzes Tanktop, schwarze Jeans und Springerstiefel. Ihre untere Kopfhälfte war rasiert und das lange schwarze Deckhaar, in dem es blaue Strähnen gab, trug sie gescheitelt zur linken Seite. Sie holte aus dem Kofferraum eine Schuhschachtel.
Es war heiß, trotz der späten Stunde. In den News wurde von einem Jahrhundertsommer gesprochen und der Klimawandel heftig diskutiert. Sie begann zu schwitzen. Im Haus hörte jemand laut Speed Metal. Drei durchgetretene Stufen führten rauf zur verdreckten Veranda und dem Eingang. Sie berührte mit der rechten Hand den Metallring, der aus ihrer vorderen Hosentasche schaute. Er gehörte zum Karambit, ihrer Lieblingswaffe. Es war ein Klappmesser mit einer klauenförmigen Klinge. Der Ring war für den Zeigefinger bestimmt und verhinderte, dass man es fallen ließ, wenn man einen Wirkungstreffer eingesteckt und die Hand sich geöffnet hatte. Das Karambit steckte in der rechten Hosentasche, befestigt mit einem Gürtelclip am Rand, sodass nur der Fingerring zu sehen war. Wenn sie das Messer an ihm herauszog, sprang die Klinge automatisch heraus.
Sie klingelte. Wegen der lauten Musik musste sie es mehrfach tun, bevor ein mittelalter Typ mit langen blonden Haaren, Vollbart, tätowierten Armen und Bierbauch die Tür öffnete. Er trug nichts außer einer zerrissenen Trainingshose und roch nach Schweiß. Hinter ihm stand eine dürre, bleiche Frau in T-Shirt und Jeans, die aussah, als wäre sie auf irgendeinem Trip.
„Deine Lieferung“, sagte die Besucherin.
In der Schachtel befanden sich Kreditkartenrohlinge. Die transportierte sie für einen russischen Gangster, für den sie arbeitete. Der Typ griff nach der Schachtel, sie machte einen ausweichenden Schritt nach hinten.
„Erst die Kohle.“
Der Typ kniff die Augen zusammen und starrte sie grimmig an. Er wollte ihr Angst machen. Sie war nicht beeindruckt.
„Die Kohle“, sagte sie.
Der Typ gab der Dürren hinter sich ein Zeichen, die daraufhin verschwand und kurz darauf mit einer dicken Rolle Dollarscheine wiederkam, die von einem Gummiband zusammengehalten wurde. Sie reichte sie ihm. Er zog das Gummi ab, zählte ein paar Scheine ab, hielt sie der Frau mit der Box hin und steckte den Rest in die Hosentasche.
„700“, sagte er.
„Ich bekomme 2000“, sagte sie.
„700. Mehr als genug.“
Warum mussten Loser es immer wieder versuchen, dachte sie, drehte sich um und ging, ohne ihn dabei aus den Augen zu lassen, die Treppen hinunter. Er folgte ihr.
„Schwester, mach keinen Ärger und gib mir die Schachtel.“
Sie ging weiter, stellte die Schachtel aufs Autodach und legte die Hand auf den Fingerring des Karambits. Der Typ kannte seine Grenzen nicht.
„Nimm die 700, sonst kriegst du gar nichts.“
Schnell zog sie das Karambit heraus, setzte die klauenförmige Klinge an seinen Hals und ritzte ihm in die Haut, sodass er leicht zu bluten begann. Panisch riss er seine Augen auf. Sie schaute zu seiner Partnerin. Die stand auf der Veranda und sah nicht aus, als verstünde sie die Situation.
„Hey“, sagte er.
Sie sah ihn fragend an.
„Was ‚Hey‘? Erzähl mir jetzt bloß nichts von einem Missverständnis.“
Er atmete schwer. Sie trat ihm zwischen die Beine und verpasste ihm einen harten Schlag mit dem Ellenbogen gegens Kinn. Er ging zu Boden. Die Dürre rührte sich nicht. Sie kniete sich hin, zog das Geld aus der Hosentasche, zählte die 2000 ab, ließ den Rest auf den Boden fallen und warf die Schachtel vom Autodach, die auf dem Asphalt knallte, wodurch sich der Deckel öffnete und die Rohlinge herausfielen. Sie stieg in den Wagen, startete ihn und fuhr die Gasse hinunter, bis sie auf der Canon Avenue landete. Ihre Hände begannen zu zittern. Sie stoppte am Straßenrand. Seit sie bei einem Terroranschlag angeschossen worden war, kamen diese Anfälle, was sie bis heute nicht verstand, weil sie zuvor schon oft verletzt worden war. Posttraumatische Störung, hatte ihr Psychiater damals gesagt. Irgendwann kann man nicht mehr einstecken und muss einen anderen Job suchen, hatte er gesagt. Ihr Mittelfinger war die Antwort gewesen. Sie holte einen Joint aus dem Handschuhfach und zündete ihn an. Wie gewöhnlich verschwand das Zittern nach ein paar Zügen.
Sie schaute auf die Uhr ihres Smartphones. Es war fast eins. Sie hatte keine Lust, noch anderthalb Stunden zu fahren, und beschloss in Hagerstown zu übernachten. Sie suchte mit ihrem Smartphone im Internet ein Motel in der Nähe und entdeckte eines, nicht mal zwei Meilen entfernt. Sie fuhr hin und mietete bei einem bekifften Rentner ein Zimmer mit einem einigermaßen sauberen Bett und einem kakerlakenfreien Bad. Da sie Hunger hatte, ging sie zum Diner, den sie an der Einfahrt gesehen hatte, und bestellte bei einer übermüdeten Kellnerin einen Caesar Salad und ein Mineralwasser. Während sie aufs Essen wartete, schrieb sie ihrem Freund Lionel, der mit ihrem Mitbewohner Johnnie To unterwegs war, eine Nachricht, dass sie erst am Morgen wiederkommen würde. Sie bekam keine Antwort. Wahrscheinlich machten die beiden wild Party und schauten nicht aufs Telefon.
2.
Als sie aus dem Diner trat, standen sie da. Zwei Polizisten in schwarzen Uniformen, die mit ihren Waffen, die sie mit beiden Händen hielten, auf sie zielten. Sie schwitzten wegen der Hitze.
„Hände hinter den Kopf, auf die Knie“, sagte der ältere der Polizisten.
Sie folgte den Anordnungen und fragte sich, was los war. Konnte es mit dem Arsch und den Kreditkartenrohlingen zusammenhängen? Eine Passantin blieb stehen und schaute herüber. Der Jüngere steckte seine Waffe weg, kam zu ihr, legte ihr Handschellen an, zog sie auf die Beine, tastete sie ohne unsittliche Absichten ab, nahm ihr das Smartphone, den Führerschein, das Geld, Autoschlüssel und das Karambit ab. Er zeigte das Messer seinem Kollegen.
„Schau, Bob, was die Fieses bei sich trägt.“
Der ältere Polizist starrte auf das Klappmesser.
„So ein Ding habe ich noch nie gesehen“, sagte er, „ist sie die Richtige?“
Sein Kollege schaute in den Führerschein.
„Dee Freeman. Sie ist es.“
„Gut. Bring sie zum Wagen.“
Am schwarz-weißen Streifenwagen, auf dem mit blauer Schrift das Wort Police stand, lehnte eine skeptisch dreinschauende Frau mit Pferdeschwanz. Sie trug ein braunes T-Shirt mit dem Logo eines belgischen Kirschbiers, Jeans und Sneaker. Der Polizist schob die Gefangene auf die Hinterbank des Wagens, schloss die Tür, setzte sich ans Steuer und wischte sich mit einem weißen Taschentuch den Schweiß von der Stirn.
„Was soll das Ganze?“, fragte sie.
„Werden Sie schon erfahren, Ms. Freeman.“
Sein Kollege sprach draußen mit der Pferdeschwanzträgerin, die schließlich zu einem schwarzen SUV ging.
Als sie losfuhren, stellte der Ältere das Radio an. Eine Countrysängerin beklagte, dass die Honky-TonkKneipen geschlossen wurden.
„Ist das eure Musik, Jungs?“, fragte die Verhaftete, bekam aber keine Antwort.
Nach einer Viertelstunde stoppten sie vor einem zweistöckigen beigen Steingebäude mit Spitzdach, das aussah, als wäre es Anfang des vergangenen Jahrhunderts erbaut worden. Der Jüngere zog sie unsanft aus dem Wagen und schob sie zum Eingang ins Gebäude. Er führte sie durch ein Büro mit grauen Schreibtischen, auf denen alte Computer und noch ältere Telefone standen, zu einer grünen Metalltür, die er mit einem Sicherheitscode öffnete und hinter der sich vier Zellen befanden, nebeneinander durch Gitter getrennt, jeweils mit zwei Liegen, einem metallenen Klo ohne Klobrille und einem Waschbecken. In eine dieser Zelle schubste sie der Polizist.
„Hände“, sagte er.
Das Gitter besaß einen Durchlass, durch den sie ihre Hände steckte. Er nahm ihr die Handschellen ab und verließ den Raum. Sie schaute sich um. Außer ihr gab es einen weiteren Gefangenen, der in der Zelle ganz rechts eingesperrt war. Ein mittelalter Kerl mit Vollbart, der ein blaues Hemd und eine graue Trainingshose trug. Er starrte sie eine Weile an, dann zog er Hose und Unterhose runter und begann sich stöhnend einen runterzuholen.
Sie setzte sich auf eine der Liegen und fragte sich, warum sie in der Zelle saß. War sie aufgeflogen? Sie hatte nicht damit gerechnet, dass es ewig gut ging. Aber wer war ihr auf die Schliche gekommen und was hatte die Frau mit Pferdeschwanz damit zu tun?, fragte sie sich.
3.
Die Metalltür öffnete sich und ein mittelgroßer Kerl trat ein. Er humpelte. In der rechten Hand hielt er einen schwarzen Krückstock, in der linken einen Hocker. Der Besucher hatte grau melierte Haare und kleine Narben um die Augen, die von seiner Vergangenheit als Boxer zeugten. Sie kannte den Kerl. Leider zu gut. Und seine Anwesenheit erklärte die Verhaftung. Keine Frage, die Frau mit Pferdeschwanz arbeitete für ihn. Der Besucher stellte den Hocker vor die Zelle, setzte sich hin und legte den Krückstock auf die Oberschenkel. Seit er total betrunken einen Autounfall gehabt hatte, besaß er ein steifes Bein, das ihm Schmerzen verursachte, weshalb er regelmäßig Schmerzmittel schluckte. Den Wichser ignorierte er.
„Ich mag die blauen Strähnen“, sagte er, nachdem er sie eine Weile schweigend beobachtet hatte.
Sie zuckte mit den Schultern. Sie wusste, dass der Besucher eine Schwäche für sie hatte. Nicht, dass es irgendeinen Vorteil brachte. So etwas Sentimentales wie Freundschaft gab es in seiner Welt nur, solange die nicht im Weg stand.
„Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich freue, dich lebendig wiederzusehen“, sagte er.
„Kann ich von mir nicht sagen.“
„Der Name Dee Freeman passt nicht zu dir.“
Sie sagte nichts.
„Gefällt dir dein neues Leben?“, fragte er.
Sie zuckte mit den Schultern.
„Du bist ständig in Bewegung, arbeitest für jeden, der dich bezahlt. Du bist nicht wählerisch. Zu deinen Stammkunden gehört Aslan Dvoskin, ein namhafter Gangster. Wegen ihm warst du in Hagerstown, nehme ich an.“
Er zog sein Smartphone aus der Hosentasche und rief eine Datei auf.
„Mal schauen, was in meiner Akte über dich steht.“
„Kennst du die nicht auswendig?“
Über den Besucher gab es die Legende, dass er über jeden in der Hauptstadt eine Akte hatte.
„Lozen Graham. Ex-Army, Ex-CID, ehemalige Besitzerin einer kleinen Sicherheitsfirma in Washington, D.C., für Personenschutz und Ermittlungen. Angeklagt wegen Mordes. Aus dem Gefängnis ausgebrochen. Kurz darauf tot aufgefunden. Was ist passiert?“
„Das weißt du nicht?“
„Nicht wirklich.“
„Ruth Manning, eine Milliardärin, der ich Manipulation beim Präsidentschaftswahlkampf nachgewiesen hatte, hat mir aus Rache den Mord angehängt. Wollte mich fertigmachen. Nach dem Ausbruch hab ich es nicht geschafft, meine Unschuld zu beweisen.“ „Du hättest das Land verlassen können.“
„Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis das Gesetz mich erwischt hätte. Da machte der Tod Sinn.“
Im Augenwinkel sah sie den Wichser, wie er die Hosen hochzog. Entweder war er fertig oder der Besuch hatte ihn abgetörnt.
„Wie?“, fragte sie.
„Meine Leute haben Spuren eines Eindringlings in das National Crime Information Center entdeckt.“
Das National Crime Information Center war die nationale Datenbank, in der Informationen über Verbrecher und Verbrechen gesammelt wurden, die mit nationalen und regionalen Polizeiorganen und Ämtern, wie der Kraftfahrzeugbehörde, verbunden waren. Da Lozen eine gesuchte Ausbrecherin gewesen war, hatte es DNA-Proben und ihre Fingerabdrücke im System gegeben. Damit sie als tot galt, hatte beides ausgetauscht werden müssen.
„Die virtuelle Spur kann nicht gereicht haben.“
„Nein, hat sie nicht.“
Lozen zog die Stirn kraus.
„Du bist schlampig geworden.“
Er zog sein Smartphone und spielte ein Video ab.
Zwei Frauen kämpften in einem Oktagon. Die eine war Lozen, die andere eine rothaarige Asiatin.
„Du bist seit zwei Monaten dabei.“
„Gut recherchiert.“
„Butterflyfights sind cool.“
Bei den Butterflyfights verdiente sich Lozen etwas nebenbei. Es war eine unabhängige Kampfreihe, die erst seit Kurzem legal war und zu keiner der etablierten Mixed-Martial-Arts-Organisationen wie Ultimates oder Guerreador gehörte. Die Fights wurden im Internet gestreamt.
„Das bringt dir Spaß, oder?“, fragte er.
Lozen war sich des Risikos bewusst gewesen, aber davon ausgegangen, dass sie ihr Äußeres ausreichend verändert hatte und sich niemand mehr für die tote Lozen Graham interessierte. Sie schaute den Besucher an. Er war einer, der sich gerne ins beste Licht stellte.
Genau das tat er gerade, dachte sie. Die Verhaftung, der Knast, sein Auftritt, das hätte es nicht gebraucht, um mit ihr Kontakt aufzunehmen. Er hätte einfach an ihrer Haustür klingeln können.
„Du erzählst Unsinn.“ „Glaubst du?“
„Yeah.“
Sie grinste ihn an.
„Du hast mich durch Zufall entdeckt. Dann hast du deine IT-Menschen auf Spurensuche geschickt.“
Er zuckte lächelnd mit den Schultern. Sie schüttelte den Kopf.
„Touché.“
„Du schaust die Butterflyfights regelmäßig.“ „Und eines Abends sehe ich da eine Frau, deren Bewegungen mir bekannt vorkommen. Als du gewonnen hattest, gab es ein Close-up. Beim zweiten Mal hinsehen war es klar.“
„Pech.“
„Nein, kein Pech. Als Verstorbene sollte man öffentliche Auftritte meiden.“
„Hm.“
„Seitdem habe ich dich im Auge behalten und Informationen gesammelt. Und jetzt gibt es zufälligerweise eine Situation, für die ich dich brauche.“
„Was heißt das?“
„Ist es wichtig? Du willst nicht zurück nach Maka Prison und wegen Mordes vor Gericht landen.“ Sie antwortete nicht und stellte sich vor, wie sie durchs Gitter den Kopf des Besuchers packte und gegen die Stahlstäbe schlug.
„Guck nicht so grimmig“, sagte er, „natürlich wirst du bezahlt.“
4.
Der jüngere Polizist gab ihr Smartphone, Führerschein, das Geld, Autoschlüssel und das Karambit zurück und sah ihr ratlos hinterher, als sie die Polizeistation verließ. Draußen war es nach wie vor unerträglich heiß. Vor dem Eingang lehnte die Pferdeschwanzträgerin am schwarzen SUV und trank eine Cola. Lozen nahm ihr Smartphone und schickte eine Nachricht an den Typen, dem sie das Geld für die Kreditkartenrohlinge übergeben sollte, dass sie es später vorbeibringen würde. „Alles klar“, lautete die prompte Antwort. Lozen ging zur Frau am SUV.
„Mein Name ist Special Agent Jodie Miwa“, sagte die Pferdeschwanzträgerin, „ich bringe dich zum Flughafen und will keinen Ärger.“
„Befehle befolgen ist meine Stärke.“
„Kann ich mir nicht vorstellen.“
Jodie Miwa hatte eine tiefe angenehme Stimme mit Südstaatenakzent.
„Geht die Aircondition im Wagen, Miwa?“, fragte Lozen.
„Sicher.“
„Dann sollten wir einsteigen.“
Lozen ging um den Wagen herum, öffnete die Tür und setzte sich auf den Beifahrersitz. Im Inneren war es angenehm kühl. Das Radio lief. Ein schneller Song.
„Die Zeiten ändern sich, auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben gewartet“, erklärte der Sänger.
Jodie Miwa schob sich hinters Steuer, stellte die Cola in den Getränkehalter, die Musik leiser und starrte Lozen an.
„Was?“
„Woher kennst du Mr. Farossi, Freeman?“
Lozen sah sie an. Harvey Farossi, so hieß der Besucher. Sie fand es interessant, dass er ihre wahre Identität für sich behalten hatte.
„Wenn er es dir nicht gesagt hat, warum sollte ich es?“
Harvey Farossi war der Berater des amtierenden US-Präsidenten Adam A. Kettle und damit ein mächtiger Mensch in Washington, D.C., mit dem man sich nicht anlegen wollte. Lozen hatte in der Vergangenheit für ihn gearbeitet. Er war ein Intrigant, ein Arsch, aber zahlte gut.
„Freeman, ich weiß nicht, was du bei dieser Mission sollst. Die bist eine Drifterin, eine Herumtreiberin und mehr nicht.“
„Drifterin?“
„Was weiß Mr. Farossi über dich, das ich nicht weiß?“
„Vielleicht bist du zu schon zu lange beim FBI, Miwa, und baust langsam ab. Denn Fragen zu stellen, die einem der Boss nicht beantwortet, ist Subordination.“
„Klugscheißerinnen gehen mir auf den Sack.“
„Du hast einen Sack? Bist du transgender?“ Jodie Miwa schnaufte, ließ den Wagen an und fuhr los. Es herrschte kaum Verkehr. Ein neuer Song begann. Hip-Hop. Jodie Miwa schaute genervt.
„Du bist eine Indianerin“, sagte sie zu Lozen.
Jodie Miwa hatte recht. Sie war eine Chiricahua-Apachin.
„First American wäre das richtige Wort.“
„Scheiß ich drauf.“
„Wenn ich es mir leisten kann, krieg ich das, was ich will“, erklärte der Rapper. Jodie Miwa wechselte zu einem Sender, auf dem Country and Western lief.
„Kommen wir zur wichtigsten Frage“, sagte Lozen.
„Die da wäre?“
„Was ist mit meinem Wagen? Er steht beim Motel.
Ich habe ihn noch nicht sehr lange.“
Sie hatte ihn widerwillig gekauft. Sie fuhr nicht gern.
Aber für gewisse Jobs brauchte sie einfach einen.
Jodie Miwa sah kurz zu ihr rüber.
„Gib mir den Schlüssel. Ich lasse ihn zu dir nach Hause bringen.“
Lozen reichte ihr den Schlüssel.
„Das wird meinen Mitbewohner freuen.“
Der Dodge Charger war schlank, schnell und eigentlich überhaupt nicht ihr Ding, aber sie hatte den Fehler gemacht, ihren Mitbewohner Johnnie To den Wagen kaufen zu lassen, und er stand auf eine Actionfilmreihe, in der einer der Helden den Hobel fuhr. Immerhin hatte er für wenig Geld eine Hybridversion bekommen. Sie wollte nicht wissen, von wem und welche Geschichte der Wagen hatte.
5.
Sie sprangen aus dem gelandeten Hubschrauber in die Dunkelheit. Wolken bedeckten den Mond. Es war kaum etwas zu erkennen. Das Team versammelte sich und schaute zu, wie der Hubschrauber abhob und wegflog.
„Wo lang?“, fragte jemand, dessen Akzent nach den Virginias klang.
„Drei Meilen nach Osten“, sagte einer mit russischem Akzent.
Sie waren zu acht und gemeinsam nach Nigeria geflogen. Sechs Typen, zwei Frauen, ausgerüstet mit italienischen Sturmgewehren und Handfeuerwaffen, die sie bei der Ankunft in Lagos in einer heruntergekommenen Flughalle von einem massigen Inder bekommen hatten, der sie wahrscheinlich aus Lagerbeständen der nigerianischen Armee geklaut hatte, weil die mit diesen Waffen ausgerüstet war. Der Inder hatte ihnen auch kugelsichere Westen, grün-braune Uniformen und Rucksäcke gegeben, die aus weißrussischen Beständen stammten.
Die Wolken gaben den Mond frei. Das Team marschierte los durch eine baumlose, hügelige Gegend und erreichte nach einer Stunde einen Fluss mit dichten hohen Büschen, die das Ufer säumten. Sie rasteten. Die meisten holten Essen und Trinken aus den Rucksäcken.
„Scheißdunkel“, sagte ein Russe im Flüsterton zu Lozen.
„Yeah.“
„Woher kommst du?“
„US of A.“
„Ich liebe Amerika. Bin vor Kurzem zu meinem Onkel in San Francisco gezogen.“
„Coole Stadt.“
„Wenn diese Mission vorbei ist, mach ich da einen Laden auf.“
„Mega.“
Der Russe biss in ein Sandwich, wobei Senf auf seine Hose tropfte. Lozen stand auf und ging zum Flussufer, dessen Wasser langsam dahinfloss. Nicht sehr tief, schätzte sie. Sie ging flussabwärts, so weit, dass sie die anderen nicht sehen und hören konnten, setzte sich und trank etwas. Sie blieb gerne für sich. Die Luft war heiß, aber kaum heißer als in D.C. Sie hörte ein leises Geräusch und schaute in die Büsche. Sie starrte in die Dunkelheit. Etwas war dort. Beobachtete. Kein Tier.
Ein Mensch. Wer beobachtete, war eine potenzielle Gefahr. Sie wartete. Nichts passierte. Sie war nicht das Angriffsziel. Sie trank einen Schluck, steckte die Flasche weg, stand auf und ging ohne Eile zurück zum Team und sprach einen kräftigen Typen an, dessen Kopfhaar rasiert war. Er hieß Jack Miwa. Er war der Anführer und, wie sich herausgestellt hatte, der kleine Bruder von Jodie Miwa.
„Jemand ist flussabwärts“, sagte sie.
„Jemand?“
„Jup.“
„Geht es genauer?“
„Nope.“
„Hast du sie gesehen?“
„Nope. Aber da ist jemand.“
„Niemand weiß, dass wir hier sind.“
Lozen schwieg. Sie mochte Jack Miwa nicht, er war zu selbstbewusst, einer, der einen in den Tod führte, weil er glaubte, jede Situation zu beherrschen, was in dieser Branche eine Unmöglichkeit darstellte. Typen wie ihn hatte sie oft sterben sehen.
„Bestimmt ein Tier. Wir sind im verfickten Afrika.
Bei Tigern und Löwen“, sagte er.
Sie nickte und ging landeinwärts in die Büsche. Sie spürte, dass der Amerikaner ihr hinterherschaute. Als sie sicher war, dass er sie nicht mehr sehen konnte, lief sie in einem Bogen zurück, versteckte sich und blickte zum Lager. Sie war auf Hörweite. Jack Miwa rieb sich den Nacken und machte einen sexistischen Spruch zum Typen neben ihm, der leise lachte. Dann standen sie auf einmal da. Ein breitschultriger Asiate und ein Nigerianer, beide in Zivilklamotten, bewaffnet mit Maschinenpistolen.
„Sie sind nicht sehr vorsichtig, Mr. Miwa“, sagte der Asiate, dessen Englisch einen Bostoner Akzent hatte, aber nicht den echten, sondern den, den Lozen von Hollywoodstars auf der Leinwand kannte. Er und sein Begleiter standen mit dem Rücken zu ihr. Jack Miwa schaffte es nicht, seine Überraschung zu verbergen.
Der Asiate sah ihn voller Verachtung an.
„Wenn wir Feinde wären, wären Sie tot, Mr. Miwa.“
Lozen war dem Asiaten schon einmal begegnet. Sie fand ihn überheblich. Sein Ego brauchte einen Dämpfer, dachte sie und trat lautlos, mit gezogener Waffe aus den Büschen. Jack Miwa bemerkte sie und fing an zu grinsen.
„Vielleicht, Mr. Chang“, sagte er mit ruhiger Stimme,
„vielleicht aber auch nicht. Wie siehst du das, Dee?“
„Wenn die Typen Feinde wären, wären sie tot.“
Jack Miwa lachte, der Asiate drehte sich um.
„Ms. Freeman.“
„Mr. Chang.“
Der Asiate war kräftig, mit einer roten Narbe, die sich über sein Gesicht zog. Sie hatte ihn in der Lagerhalle in Lagos kennengelernt. Mit vollem Namen hieß er Len Chang. Er hatte den Kontakt gesucht. Jodie Miwa hatte ihr vor dem Abflug gesagt, dass sie ihn treffen würde, er ein Freelancer wäre, dem man nicht über den Weg trauen durfte. Dass sie sie trotz der offensichtlichen Abneigung gewarnt hatte, hatte Lozen beeindruckt.
Len Chang und der Nigerianer führten das Team erst flussaufwärts, dann bogen sie ins Landesinnere, wo sie nach einer Stunde eine Industrieanlage erreichten.
„Noch was unklar?“, fragte Len Chang.
Keiner sagte etwas. Er hatte es in der Lagerhalle erklärt, nachdem sie Waffen und Ausrüstung erhalten hatten. Vor ihnen lag eine Chemiefabrik, betrieben von einer chinesischen Firma. Unweit der Anlage gab es eine Ansiedlung aus Wellblech- Holzhütten, in der die Angestellten und ihre Familien wohnten. Laut Len Changs Briefing hatte es vor achtundvierzig Stunden einen Angriff einer islamistischen Terrorgruppe gegeben, die die Anlage gestürmt, das Personal als Geiseln genommen und von der Betreiberfirma ein Lösegeld verlangt hatte. In der Anlage befänden sich Daten, die wichtig für die nationale Sicherheit der USA wären.
Die galt es sicherzustellen. Was den Einsatz erschwerte, war, dass es, laut Len Chang, beim Angriff einen Unfall gegeben hatte, bei dem ein toxisches Gas freigesetzt worden war.
Jodie Miwa hatte Lozen die Geschichte schon auf dem Weg zum Flughafen erzählt. Sie hatte die FBI-Agentin gefragt, warum Daten in einer chinesischen Fabrik so bedeutend wären, aber keine Antwort erhalten.
Das machte für Lozen alles keinen Sinn. Was sie zusätzlich beunruhigte, war der Umstand, dass das Team schnell zusammengestellt worden war, weil es bedeutete, dass es nicht die Besten der Besten waren. Sie hatte drei Bewertungskategorien. Profis. Loser. Amateure. Der Unterschied zwischen den beiden letzten Kategorien bestand darin, dass Loser Professionelle waren, die keine Qualität besaßen, was sie schwer berechenbar und gefährlich machte. Jack Miwa gehörte für sie in diese Kategorie.
Die Anlage lag in totaler Dunkelheit. Wahrscheinlich war die Stromversorgung zerstört worden. Jack Miwa verteilte Pillen ans Team. Lozen schluckte sie. Es dauerte nicht lange, bis die Unsicherheit und Angst verschwanden und sie sich entspannt und unbesiegbar fühlte. Es lebe das chemische Upgrade, dachte sie.
Die Mitglieder des Teams setzten Gasmasken und Nachtsichtgeräte auf und näherten sich dem Gelände, das von einem Drahtzaun umgeben war. Der Russe schnitt ein Loch hinein, durch das sie aufs Gelände schlichen. Sie trafen auf keine Wachen und Len Chang hielt nach keinen Ausschau, was Lozen überraschte. Sie betraten das Gebäude, durchquerten den menschenleeren Eingangsbereich, marschierten einen Gang entlang, der zur Werkshalle führte, dessen Tor offen stand. Dem Team bot sich ein gespenstisches Bild. Rund hundert Menschen standen im Raum, nahezu bewegungslos, einige schwankten leicht hin und her. Man hätte denken können, sie schliefen, aber ihre Augen waren weit aufgerissen und glänzten weiß in der Dunkelheit. Unheimlich, diese Schlafenden, fand Lozen.
„Wir müssen durch die Halle, dahinter sind die Büroräume“, sagte Len Chang im Flüsterton. „Und nicht vergessen: keinen Krach machen.“
„In den Büros sind die Daten?“, fragte Jack Miwa.
„Genau.“
Jack Miwa gab ein Handzeichen und das Team bewegte sich langsam durch die Halle, vorbei an den schwankenden Schläfern, die sie trotz der aufgerissenen Augen erstaunlicherweise nicht wahrnahmen.
Lozen fragte sich, was für Chemikalien durch den Angriff freigesetzt worden waren. Vor ihr gingen Jack Miwa und Len Chang, der sich ständig umschaute. Ihr gefiel nicht, dass er nervös war. Sie schob sich an einer dicken Schläferin vorbei, die schwitzte und nach Urin stank.
Als die Hälfte der Strecke hinter ihnen lag, klingelte ein Handy, worauf der Russe fluchte, das Telefon aus der Hosentasche zog und ausschaltete. Aber es war zu spät. Die Schläfer waren erwacht. Sie gaben ein seltsames glucksendes Geräusch von sich, blickten sich um, lokalisierten die Mitglieder des Teams und warfen sich auf sie.
Lozen sah ein Dutzend Gestalten, die den Russen zu Boden warfen. Jack Miwa schrie, als ein Hundert-Kilo-Typ in seine Wange biss und ihn zu Boden riss.