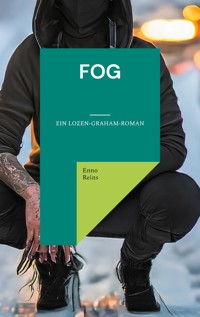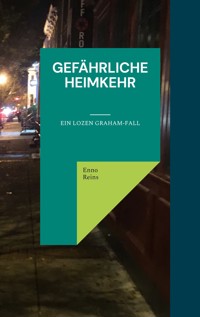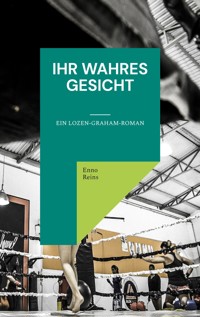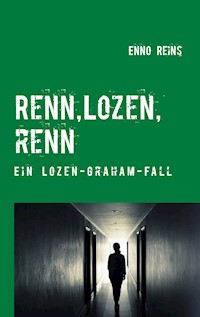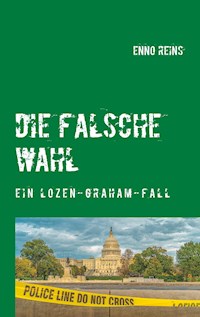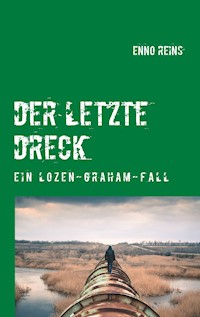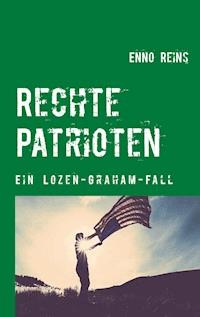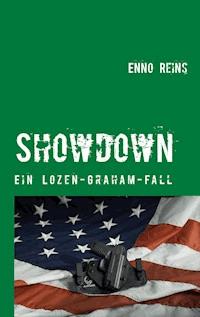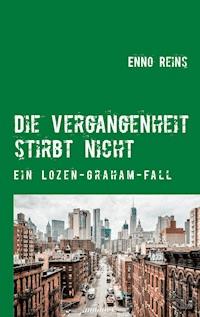
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Lozen-Graham-Fall
- Sprache: Deutsch
Die amerikanische Ermittlerin Lozen Graham beschattet einen deutschen Blogger. Arvist Bunger sucht Informationen über den unbekannten Hauptdarsteller eines kürzlich aufgetauchten Stummfilms. Was immer der Blogger findet - Lozen Graham soll es stehlen und ihrem Auftraggeber schicken. Die Überwachung: Ein Routineauftrag. Leicht verdientes Geld. Aber dann will ihr Auftraggeber den Deutschen umbringen. Doch Mord ist nicht Lozen Grahams Geschäft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Anhang
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1.
Die blonde Frau griff nach dem Colt. Sie richtete die Waffe auf den grimmig dreinblickenden Cowboy, der zu ihr auf die Anhöhe geklettert war. Der Mann hatte keine Angst. Im Gegenteil, er schüttelte sich vor Lachen. Sein Oberkörper kippte übertrieben nach vorne und hinten. Die Selbstsicherheit hatte einen Grund. Hinter der Frau tauchte sein Kumpan auf. Lüstern blickte der sein Opfer an und zwirbelte dabei den buschigen Schnauzbart. Er schlich sich an die ängstliche Frau heran und nahm ihr mit einem Griff den Colt ab. Die Frau schrie. Kein Ton war zu hören. Eine Schrifttafel erschien auf der Leinwand. Auf der stand in Englisch geschrieben: Bill wird mich retten. Die Männer lachten lautlos und wippten wieder mit den Oberkörpern übertrieben hin und her. Der Mann, der ihr die Waffe abgenommen hatte, warf die Frau mit einer kraftvollen Bewegung über die Schulter. Er schleppte sie den Abhang hinunter und schleuderte sie auf einen Pferderücken. Wieder ein stummer Schrei der Frau.
Schrifttafel: Bill wird mich retten.
Schnitt. Ortswechsel: Sand, Steine, Staub und Kakteen. Ein Schurke mit einer Winchester beobachtete Cowboy Bill, der im Galopp den Hügel hochritt.
Schrifttafel: Bill in großer Gefahr.
Der Schurke mit der Winchester legte an. Als er abdrücken wollte, verschwand Cowboy Bill hinter einem Felsen. Er sprang unbemerkt vom Pferd und kletterte den Abhang hoch. Irritiert blickte der Schurke mit der Winchester auf das reiterlose Pferd, das hinter dem Felsen hervorkam.
Dr. Jeff Chandler von der Academy of Motion Picture Arts & Sciences blickte auf die Leinwand, auf diesen kinematografischen Schatz aus der Stummfilmzeit. Neben ihm saß Esteban Ruiz, der Leiter des argentinischen Filmmuseums in Buenos Aires. Dr. Chandler mochte ihn nicht. Ruiz war feist, selbstgefällig und roch nach Lavendel.
Er hatte Dr. Chandler angerufen und eingeladen. Ruiz war der als verschollen gegoltene Western von der amerikanischen Regielegende Basil Warden Bond unverhofft in den Schoß gefallen.
Cowboy Bill sprang den Bösewicht mit der Winchester von hinten an. Eine wildes Gerangel, dann schlug Cowboy Bill seinen Gegner nieder und sprang aufs Pferd, das vorbeitrabte.
Schnitt. Ortswechsel: Eine Grenzstadt. Wind. Viel Staub. Die Main Street nicht asphaltiert. Ein Dutzend bewaffneter Männer stand um drei Ford T.
Schrifttafel: In Wind City ist der Sheriff stets bereit, einen Verbrecher zur Strecke zu bringen.
Cowboy Bill kam in die Stadt geritten, gestikulierte wild mit seinen Armen. Der Sheriff und seine Leute sprangen in die Wagen und fuhren los. Einige verloren dabei ihre Ten-Gallon-Cowboyhüte. Bill gab dem Pferd die Sporen und galoppierte in die entgegengesetzte Richtung.
Dr. Chandler fragte Ruiz nach dem Namen des Hauptdarstellers.
»Will Kess steht im Abspann«, sagte der Museumsdirektor.
Der Name sagte Dr. Chandler nichts. Aber das Gesicht. Er war sich anfangs nicht sicher gewesen. Erst nach der Nahaufnahme von Cowboy Bill, während des Gesprächs mit dem Sheriff, gab es keine Zweifel mehr. Dr. Chandler nahm sein Smartphone und machte Fotos. Immer dann, wenn eine Nahaufnahme des Hauptdarstellers zu sehen war. Der Amerikaner bemerkte den irritierten Blick von Ruiz. Er ignorierte ihn. Dr. Chandler erinnerte sich an frühere Tage, als er sein Geld damit verdiente, aus Geheimnissen Neuigkeiten zu machen. Nur würde er in diesem Fall umsonst arbeiten. Es war ein Freundschaftsdienst.
Ein Tross bewegte sich durch eine Schlucht im Grand Canyon. Cowboys trieben mit Peitschen ärmliche Chinesen vorwärts. Die Frau saß auf einem Pferd. Hilflos musste sie die lüsternen Blicke der zwei Cowboys ertragen. Der eine zwirbelte wieder diabolisch an seinem Schnauzbart. Cowboy Bill ritt derweil auf einen Flugplatz. Er sprang in einen startbereiten Doppeldecker und befahl dem Piloten zu starten. Schnell erreichten sie den Grand Canyon. Cowboy Bill suchte den Boden nach den Schleppern ab, die illegal chinesische Einwanderer in die USA brachten. Wütend musste er feststellen, dass sie das Lager vom Vortag verlassen hatten. Cowboy Bill gab dem Piloten Handzeichen weiterzufliegen. Klein, wie ein Moskito, wirkte das Flugzeug, als es über die beeindruckenden Canyons flog. Der Bandit, der das Mädchen entwaffnet hatte, bemerkte das Flugzeug und wurde unruhig. Zeitgleich sah Cowboy Bill den Treck der illegalen Einwanderer. Sein Gesicht verwandelte sich in eine grimmige Maske, als er die blonde Frau entdeckte. Er rief dem Piloten etwas zu.
Schrifttafel: »Zum Fluss. Da steige ich aus.«
Cowboy Bill befestigte eine Strickleiter und warf sie aus dem Doppeldecker. Er kletterte bis zur untersten Leiste. Als das Flugzeug über den Fluss flog, ließ er los und fiel ins Wasser. Der Doppeldecker drehte ab. Bill schwamm mit kräftigen Zügen ans Ufer.
Dr. Chandler hatte gerade ein weiteres Foto gemacht, als Cowboy Bill einen Schlepper aus dem Sattel hob, sich aufs Pferd schwang, mit dem Lasso zwei Schurken fing und fesselte, vom Pferd absprang und die Frau befreite. Dr. Chandler blickte zu dem jungen Mann, der neben Ruiz saß und gelangweilt auf die Leinwand schaute. Gabriel war Praktikant des Filmmuseums von Buenos Aires. Ruiz hatte den Jungen in den Keller geschickt, um ihn zu beschäftigen. Es gab dort eine Unzahl von zugestellten Räumen, die seit Jahrzehnten niemand betreten hatte. Der Praktikant sollte aufräumen.
Zufällig war Gabriel auf die verrostete Kiste gestoßen. Als Student der Filmwissenschaften hatte ihn die ausgeblichene Beschriftung Basil Warden Bond neugierig gemacht. Ironischerweise konnte der junge Mann nichts mit Stummfilmen und Western anfangen. Cowboy Bill verfolgte derweil den Oberschurken. Eine wilder Jagd durch Flüsse und über steile Abhänge. Das Pferd des Helden strauchelte und überschlug sich. Cowboy Bill landete hart auf dem Boden. Pferd und Reiter erhoben sich benommen. Etwas mühsam zog sich der Held in den Sattel.
»Das war bestimmt kein geplanter Stunt, sondern ein Unfall, den sie reingeschnitten haben. Damals haben die Stars so was selber gemacht«, stellte Ruiz begeistert fest. Der Student grunzte anerkennend. Dr. Chandler machte ein Foto von Cowboy Bills angestrengtem Gesicht.
Cowboy Bill holte den Schurken ein, sprang, riss den Bösewicht aus dem Sattel und fiel mit ihm zu Boden. Die Pferde galoppierten weiter. Es gab einen dramatischen Faustkampf, den erwartungsgemäß der Held gewann. In der Schlussszene erhielt Cowboy Bill vom Vater der Geretteten die Erlaubnis, sie zu heiraten. Der Held ging zur Frau, die abseits wartete. Dr. Chandler machte eine letzte Aufnahme.
Schrifttafel: Darf ich dein Beschützer bis zum Ende unserer Tage sein?
Die Frau nickte so stark, dass Dr. Chandler sich Sorgen um ihr Genick machte. Vor der Kulisse des Grand Canyons gab es den Schlusskuss.
Dr. Chandler blickte zu Ruiz, der leicht lächelte. Wahrscheinlich träumte er davon, dass jemand Berühmtes aus Hollywood sich melden würde. Dr. Chandler war Ruiz vor ein paar Jahren in Los Angeles begegnet. Wie sein Praktikant konnte er nichts mit Western anfangen. Er hielt sie für reaktionären Ami-Scheiß, für die Verherrlichung des US-amerikanischen Imperialismus, für abstoßende Monumente amerikanischer Gewalttätigkeit. Ab dem heutigen Tag würde sich das ändern, da war sich Dr. Chandler sicher. Ab jetzt waren sie für Ruiz bedeutende Stücke der Filmgeschichte.
»Wie hat ihnen der Film gefallen?«, fragte Ruiz.
»Faszinierend«, sagte Dr. Jeff Chandler.
Der Amerikaner war mit seinen Gedanken woanders. Er musste einen alten Freund warnen und ihm ein Foto des Stummfilmcowboys schicken. Die eigentliche Sensation war nicht der Filmfund. Sondern etwas ganz anderes.
2.
Arvist Bungers Smartphone klingelte. Er konnte die Rufnummer nicht lesen. Das Display des Telefons war kaputt. Weil er dachte, es wäre die Online-Redaktion, für die er als Reporter arbeitete, nahm er den Anruf an. Ein Fehler. Es war seine Mutter. Er verfluchte das defekte Display.
»Hallo Arvist.«
»Ich habe keine Zeit.«
»Wo bist du?«
»Filmfestspiele von Cannes. Ich habe gleich ein Interview mit Hollywoodstar Kevin Keener. Über seinen neuen Film Ivanhoe.«
»Das ist doch ein Ritterfilm. Gab es den nicht schon mal in den 50ern?«
»Mutter, was willst du?«
»Du musst unbedingt die Nachrichten anschauen.«
»Mutter, ich bin bei der Arbeit. Worum geht es?«
»Schau ins Internet.«
»Ich kann nicht.«
»Es ist eine tolle Geschichte.«
»Ich interessiere mich nicht für Geschichten.«
»Geschichten sind das Leben.«
»Mutter.«
»Es dauert nur ein paar Minuten.«
Eine der Organisatorinnen des Interviews winkte Arvist zu sich. Endlich, dachte er. Arvist und die anderen zwanzig Journalisten aus aller Welt saßen seit zwei Stunden in dem überfüllten und schlecht belüfteten Hotelzimmer und warteten auf den Hollywoodschauspieler. Das Gerücht ging um, Keener hätte am Vorabend zu heftig mit der komischen Nebenrolle gefeiert.
»Mutter, ich muss Schluss machen.«
»Arvist ...«
Arvist legte auf. Die Organisatorin führte ihn durch den Hotelflur zu einer Suite.
»Sie haben vier Minuten«, informierte sie ihn. Die Organisatorin und Arvist betraten die Suite und gingen einen halbdunklen Gang entlang. Der mündete in ein hell ausgeleuchtetes Zimmer. Kevin Keener saß in Shorts, schwarzem T-Shirt und Strumpfsocken vor dem Filmplakat von Ivanhoe. Seit dem Ende der Dreharbeiten hatte er mindestens 5 Kilo zugelegt, schätzte Arvist. Links neben dem Hollywooddickerchen saß der Kameramann.
Arvists Smartphone klingelte. Er stellte es aus. Keener schüttelte gelangweilt seine Hand. Der Reporter stellte seine Fragen, hörte mit halbem Ohr zu, als sein berühmtes Gegenüber meinte, dass diese Zeit Helden wie Ivanhoe bräuchte. Mut, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Patriotismus – vergessene Tugenden, die es dringend bräuchte im Kampf gegen feige Terroristen, korrupte Politiker und betrügerische Wirtschaftsbosse. Er machte aus dem Action-Streifen ein bedeutendes Epos, dessen Moral nur von der Bibel übertroffen wurde. Amen, Bruder, dachte Arvist. Als die vier Minuten Interviewzeit abgelaufen waren, überreichte der Kameramann ihm die Disc mit den Aufnahmen.
Arvist verließ das Hotel und ging die Croisette entlang zu seinem Hotel in der Altstadt. Auf dem Weg stellte er das Smartphone an. Vier Anrufe in Abwesenheit. Er hörte die Mail-Box ab. Vier Mal seine Mutter, die um Rückruf bat. Er hatte keine Zeit. Er musste den Bericht fertigstellen. Arvist Bunger war freiberuflicher Filmjournalist. Bei den Filmfestspielen von Cannes war er im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks.
Angekommen in seinem Hotelzimmer, zog er die Datei mit dem Interview auf den Laptop. Mit dem Schnittprogramm montierte er aus den Gesprächsaufnahmen, Bildern vom Foto-Call am Vormittag und Filmausschnitten einen 90sekündigen Beitrag. Anschließend lud er ihn auf den FTP-Server und informierte per Mail den zuständigen Redakteur. Der Beitrag würde erst bei den TV-Nachrichten laufen und dann auf die Kulturseite des Senders gesetzt werden. Im Anhang befand sich der Beitragstext für den Sprecher. Das Smartphone klingelte. Wie zuvor dachte er, es wäre die Redaktion, wieder verfluchte er das defekte Display, als er die Stimme seiner Mutter hörte.
»Hast du schon nachgesehen?«
»Mutter!«
Arvist legte wieder auf. Er musste noch arbeiten. Der Filmjournalist besaß eine eigene Internetseite. Sie hieß Drifter. Auf der ging es, neben Kino und Kultur, hauptsächlich um Arvist selbst. Sein biografisch geprägter Blog hatte hohe Klickzahlen. Für seine multimedialen Beiträge, die eine geschickte Verknüpfung von Text, Fotos und Web-Videos waren, hatte er vor zwei Jahren einen Preis gewonnen. Seitdem schalteten Filmverleiher und Kinoketten Werbung und namhafte Sender buchten ihn als Freelancer. Arvist schrieb auf seinem Blog, der unter dem Namen Dumm und dümmer lief: Warum es mich entspannt, an der Cote D' Azur auf eine Hollywoodgröße zu warten: Es ist Zen pur. Die Ungeduld der Kollegen ist mein Mantra. Die gelassenen Gesichter der Interview-Organisatoren, denen der Unmut der Journaille am Arsch vorbeigeht, sind meine Meister. Freunde da draußen, bleibt mir gewogen. Der kurze Text wurde durch ein Video ergänzt, das 10 Minuten dauerte und – in einer Einstellung – die wartenden Journalisten in dem Hotelzimmer zeigte. Arvist hatte es heimlich mit seinem Smartphone gedreht.
Nach getaner Arbeit setzte sich Arvist in ein Straßencafé, bestellte Bier, Steak-Frites und fuhr das Laptop hoch. Von seinem Platz aus konnte er auf eine Monitorwand sehen, auf der live die Bilder vom roten Teppich des Filmpalastes gezeigt wurden. Die schön hergerichteten Stars flanierten und gaben den Klatschblättern die Bilder, die sie wollten. Arvist ging auf die Nachrichtenseite News-Block: Berlin:
Deutsche Fußballnationalmannschaft spielt unentschieden gegen Kolumbien, Ägypten: Amerikanische Flagge vor der US-Botschaft in Kairo verbrannt, Irak: Anschlag in Bagdad, USA: Shannon Warwick – Präsidentschaftskandidatin der Demokraten gibt auf, Argentinien: Verschollener Basil-Warden-Bond-Film aufgetaucht.
Die letzte Schlagzeile interessierte Arvist. Nicht nur, weil es sich um den amerikanischen Regisseur Basil Warden Bond handelte, dessen Westernklassiker Lakota er sehr mochte. Zu jeder Schlagzeile gehörte ein Foto. Von dem unter der Basil-Warden-Bond- Schlagzeile konnte Arvist seinen Blick nicht lösen. Es zeigte einen grimmigen Stummfilmcowboy mit breitkrempigem Hut und Schnauzbart, der zwei Colts in den Händen hielt, aus denen Rauchwolken austraten. Er begriff, warum seine Mutter aufgeregt war.
Arvist erkannte auf dem Foto seinen Ururgroßvater Alphonse. Es gab einen Grund, warum er das Gesicht gut kannte. Im Wohnzimmer seiner Eltern hing eine alte, braun-weiße Fotografie von ihm. Es zeigte einen schlanken, blonden Mann mittleren Alters mit hoher Stirn, Segelohren, Seitenscheitel, die Haare akkurat gegelt, der ernst dreinblickte und in einer schlechtsitzenden Uniform steckte. Arvists Mutter mochte den alten Charakterkopf. Arvist hatte das Foto als Kind eine Höllenangst gemacht. Das lag an den zu Schlitzen zusammengepressten Augen, die ihn anstarrten, egal, wo er sich im Raum befand.
Arvist wusste wenig über seinen Ururgroßvater. Er hieß Alphonse Kessel, war in die USA ausgewandert, hatte im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft und kehrte später nach Deutschland zurück. Seine Mutter war eine Nachfahrin. Keine aufregende Geschichte. Er las die Nachricht, zu der das Foto gehörte: Ein verloren geglaubtes Frühwerk des bekannten Western-Regisseurs Basil Warden Bond (1884-1963) war in Argentinien entdeckt worden. Der Film mit dem Titel Sunset erzählte die Liebesgeschichte eines Cowboys mit einer texanischen Rancher-Tochter. Beim Hauptdarsteller handelte es sich um einen unbekannten Schauspieler namens Will Kess. Der 1917 entstandene Stummfilm war im Keller des argentinischen Filmmuseums entdeckt worden. Das Museum und die amerikanische National Film Preservation Foundation wollten nun in Zusammenarbeit mit der Academy of Motion Picture Arts & Sciences an der Erhaltung und Restaurierung arbeiten.
Arvist versuchte, im Netz mehr über Will Kess herauszufinden. Obwohl er ein Meister des Google Fu war, fand er kaum etwas. Der Name tauchte in der Internet Movie Database und anderen relevanten Filmdatenbanken bei zwei weiteren Stummfilmen von Basil Warden Bond auf. Einem One-Reeler – Einakter auf einer Rolle Film von circa 11 Minuten Länge – und einem Two-Reeler – Zweiakter auf zwei Rollen Film von insgesamt circa 20 Minuten Länge. William, the Patriot hieß der Zweiakter. Der Einakter trug den Titel Mr. Kelly, USA. Es gab keine weiterführenden Informationen über Kess. Keine Angaben zum Geburtstag, Todestag, zu Auszeichnungen. Alte Filmkritiken fand Arvist ebenfalls keine.
Arvist bestellte beim Kellner einen Pastis und rief einen Bekannten bei der Academy of Motion Picture Arts & Sciences an. Vor ein paar Jahren hatte er Dr. Jeff Chandler beim Filmfest in Venedig auf einer Premierenfeier kennengelernt. Ein alkoholreicher Abend, der am Strand vom Lido endete. Der Regisseur, Chandler und Arvist feierten den Aufgang der Sonne mit Whiskey. Seither mailten sie sich regelmäßig. Arvist wollte von seinem amerikanischen Bekannten wissen, ob er mehr über den Schauspieler wusste.
»Wow, Arvist, was für eine Geschichte. Dein Grandgrandgranddad ein Hollywoodschauspieler«, sagte Dr. Chandler.
»Wahnsinn, oder?«
»Ja.«
»Weißt du mehr über ihn, als im Internet steht?«
»Nein. Leider nicht. Als ich die Meldung von dem aufgetauchten Film gelesen habe, habe ich recherchiert. Der ist ein unbeschriebenes Blatt. Die drei Filme, das war’s. «
Arvist war enttäuscht. Er schrieb auf seinem Blog Dumm und dümmer: Warum mich der wiedergefundene Basil-Warden-Bond-Film persönlich betrifft: Der Hauptdarsteller gehört zu meiner Familie. Statt Alphonse Kessel nannte er sich Will Kess. Den kennen nicht mal amerikanische Filmexperten. Verrückt. Freunde da draußen, bleibt mir gewogen.
3.
Arvist sprang aus der Straßenbahn. Es war die Endhaltestelle. Arvist überquerte die Straße, passierte den Kiosk, vor dem zwei alte Männer und eine dicke Frau Kölsch aus der Flasche tranken, und ging stadtauswärts. Spießige Vorgärten mit und ohne Gartenzwerg, langweilige Einfamilienhäuser, übergewichtige Bewohner. Cannes-Köln: Arvist spürte, wie ein kleiner Kulturschock ihn erschütterte. Die Filmfestspiele waren vorbei. Er war müde. In den vergangenen 11 Tagen hatte Arvist 11 Berichte produziert. Vor sechs Stunden hatte er Cannes verlassen. Nachdem Arvist in Köln gelandet war, hatte er das Gepäck in seiner Wohnung abgestellt, ein neues Smartphone gekauft und war in die Straßenbahn gestiegen. Seine Mutter hatte darauf bestanden, dass er unverzüglich vorbeikam.
Seine Eltern lebten in einem Reihenhaus am Stadtrand. Zögernd betrat Arvist den Garten. Ein Jahr hatte er sich nicht blicken lassen. Familiäre Anlässe – wie Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, Jubiläen und anderer bürgerlicher Schnickschnack – besaßen für ihn keine Bedeutung.
Arvist ertrug die stürmische Begrüßung seiner Mutter und genoss den formellen Handschlag seines Vaters. Seine Mutter war aufgeregt. Auf dem Weg ins Wohnzimmer erzählte sie Arvist ihre neuste Erkenntnis: Der Stummfilm-Cowboy auf dem Foto konnte nicht der Ururgroßvater von Arvist sein. Alphonse Kessel war 1836 geboren worden. Das Foto aus dem Film zeigte einen Mann Mitte, Ende dreißig und war 1917 entstanden. Zur Zeit der Aufnahme wäre Alphonse Kessel 84 Jahre alt gewesen. Das passte nicht. Simple Mathematik. Diese Offensichtlichkeit war Arvist entgangen.
Zu dritt saßen sie auf dem Sofa im Wohnzimmer und verglichen die Fotografie an der Wand mit der des Stummfilm-Cowboys, die Arvist auf dem Laptop aufgerufen hatte. Sie fanden Unterschiede. Der Cowboy hatte kleinere Segelohren, kürzere Koteletten und ein schmaleres Gesicht.
»Trotzdem ist die Ähnlichkeit erstaunlich«, sagte Arvists Mutter.
»Es gibt zwei Möglichkeiten«, sagte Arvists Vater in der ihm eigenen Sachlichkeit, »entweder handelt es sich um einen unglaublichen Zufall oder Ahne Alphonse hatte einen Sohn, von dem wir bisher nichts wussten.« »Oder es handelt sich um eine Reinkarnation«, sagte Arvists Mutter, die eine esoterische Ader hatte.
»Hast du andere Fotos von Alphonse, Claudia?« Die Bungers redeten sich auf Wunsch der Mutter mit Vornamen an. Wenn Claudia ihn nervte, so wie in Cannes, benutzte Arvist das Wort Mutter – um sie zu ermahnen.
»Nein. Es gibt Briefe und Tagebücher aus Amerika.« »Was steht drin?«
»Keine Ahnung. Ich hab sie mal überflogen. Das war vor 20 Jahren.«
»Und wo sind die Sachen?«
»Ich habe die Schriftstücke einem befreundeten Historiker überlassen. Er verfasst Bücher und Artikel über Deutsche in den USA und baut eine Sammlung mit Auswandererbriefen auf.«
»Dann sollten wir uns mit ihm in Verbindung setzen.« »Ich ruf ihn an.«
Arvists Mutter ging zum Telefon. Sie erreichte den Historiker, legte ausführlich dar, worum es ging, und machte – ohne Arvist zu fragen – einen Termin.
»Dr. Sigel ist noch drei Tage auf einem Historiker-Kongress in Zürich. Du triffst ihn am Donnerstag in der Uni«, sagte Claudia, als sie aufgelegt hatte.
»Du kommst doch mit?«, fragte Arvist.
»Ich kann leider nicht. Morgen beginnen die Proben fürs neue Stück.«
Claudia arbeitete als Schauspielerin am Kölner Schauspielhaus.
»Rainer?«
»Ich muss auch arbeiten.«
Rainer war Anwalt.
»Es ist dein Abenteuer«, sagte Claudia.
Arvists Mutter hatte einen Hang zum Theatralischen. Er mochte das nicht.
4.
Die Sonnenstrahlen schafften es kaum durch die schmutzige Fensterfront. Der Ventilator an der Decke bewegte die heiße Luft. Kühlung brachte er keine. Eine Fliege setzte sich auf den Rand des vollen Aschenbechers. Als eine haarige Hand eine Zigarette ablegte, flog die Fliege weg. Aus dem alten Radio schepperte ein uralter Guns and Roses-Song. Die Frau mit den langen, schwarzen Haaren kannte das Lied nicht, obwohl sie Axl Rose mochte. Trotz der Hitze trug sie ein schwarzes Männerhemd über dem weißen Tanktop. Es verdeckte die Waffe im Hosenbund. Die Frau stand vor der rostigen Kasse einer Tankstelle. Der Besitzer nahm die Zigarette aus dem Aschenbecher und steckte sie in den Mundwinkel. Er sah mit seinen langen, fettigen Haaren, dem schwarzen T-Shirt und der abgewetzten Bluejeans wie ein Rocker aus. Er schwitzte. Neben der Frau stand ein ölverschmierter Mann im Blaumann, der sie unverhohlen anstarrte. Die Frau bezahlte das Benzin und zwei warme Flaschen Wasser. Die Kühltruhe in der Tankstelle funktionierte nicht.
Der Besitzer gab ihr das Wechselgeld. Die Fliege landete auf seiner Stirn. Er reagierte nicht. Die Frau setzte die Sonnenbrille auf und ging nach draußen. Keine Wolke am Himmel. Es war heiß. Die schmale Straße, die an der Tankstelle vorbeiführte, drohte vom Sand überdeckt zu werden. Es gab keinen Verkehr. Es gab keine Bäume. Es gab keine Häuser. Die Tankstelle befand in der Wüste Arizonas. In der Ferne waren Berge zu sehen. Die Frau setzte sich unter das Vordach der Tankstelle auf den Boden. Durch die schmutzige Fensterfront beobachtete sie der Typ im Blaumann. Die Frau trank einen Schluck Wasser. Ihr Handy klingelte. Sie kannte die Nummer.
»Was willst du?«, fragte sie.
»Klassische Ermittlungsarbeit.«
»Ich höre.«
»Eine kleine Reise nach Deutschland. Verfolgen – Überwachen. Das Übliche. «
»Wer ist die Zielperson?«
»Ein Blogger. Ein kleines Licht. Ich schick dir die Details.«
»2000 pro Tag, plus Spesen. Ich schick Ronan.«
»Nicht Ronan. Du. Es ist eine heikle Angelegenheit. Ich will, dass jemand, dem ich vertraue, die Sache macht.«
»Seit wann vertraust du mir?«
»Ich zahle 3000.«
»Deal.«
»Danke, Ma`am.«
»Du warst schon witziger.«
»Ab wann kannst du? Es ist eilig.«
»Morgen. Schließ heute einen Auftrag ab.«
Sie beendete das Gespräch.
Der Typ im Blaumann kam aus dem Tankstellengebäude, warf einen Blick auf die Frau, ging an der einzigen Zapfsäule vorbei zu einem Pickup. Die Frau stellte die Wasserflasche auf den Boden, zog die Waffe aus dem Hosenbund und folgte ihm.
»Mr. Kaine«, sagte sie.
Der Typ im Blaumann wirbelte herum. In seiner Hand ein Messer.
»Mr. Kaine«, sagte die Frau erneut und zeigte ihm die Waffe. Resigniert ließ Kaine das Messer fallen. Er war kein Schläger. Er war Angestellter einer Software-Firma und hatte ein wichtiges Projekt an die Konkurrenz verkauft. Harry Kaine war aufgeflogen und untergetaucht. Der Firmenboss wollte mit Kaine darüber sprechen. Die Polizei auch.
»Umdrehen. Hände auf den Rücken.«
Kaine folgte der Anordnung. Die Frau fesselte ihn mit einem Kabelbinder.
»Zum Wagen.«
Die Frau war mit einem schwarzen SUV gekommen. Sie schubste Kaine auf die Rückbank und schloss die Tür. Anschließend schrieb sie eine SMS: Nick, ich hab Kaine. Kurz darauf kam die Antwort: Dann schick ich die Rechnung ab.
5.
Dr. Carl Sigel, Jahrgang 1960, Professor für angloamerikanische Geschichte, entsprach nicht Arvists Vorstellung von einem Historiker. Stoppelhaarschnitt, Boxernase, ein grauer Bismarck-Backenbart, ein tätowierter Stiernacken, den Oberkörper eines Turners, der in einem alten Ed-Hardy-T-Shirt steckte. Der Historiker erinnerte an einen in die Jahre gekommen Türsteher. Das Äußere täuschte nicht ganz. Arvists Mutter hatte erzählt, dass der Gelehrte sein Studium in den USA durch Boxkämpfe finanziert hätte.
Dr. Sigel führte seinen Gast in die Bibliothek der Universität. Arvist fühlte sich unwohl. Universitäten mochte er nicht. Ungern erinnerte er sich an die Studienzeit. Mangels Zukunftsideen hatte er Geschichte und Philosophie studiert und sich gelangweilt. Nicht weil er mit den Inhalten nichts anfangen konnte, sondern mit wissenschaftlichem Arbeiten. Er war Polemiker. Behauptungen zu belegen, lag ihm nicht.
»Natürlich sind die meisten der rund 10.000 Briefe und Tagebücher, die wir besitzen, digitalisiert. Aber diese alten, historischen Dokumente in der Hand zu haben, das Papier zu sehen und zu riechen, das ist Geschichte erleben«, sagte Dr. Sigel.
Um den Wissenschaftler nicht zu beleidigen, willigte Arvist ein, die alten Papiere und nicht die Computerdateien zu sichten, auch wenn ihm Letzteres lieber gewesen wäre. Er fand Bücher zum Anfassen entsetzlich altmodisch und las ausschließlich E-Books.
Der Historiker führte Arvist durch die Bibliothek, zu einer hölzernen Tür, die ins Kellergeschoss führte, in dem Originalquellen gelagert wurden. Arvist war vom Anblick des Archivs enttäuscht. Er ging an billigen Metallregalen vorbei, in denen beschriftete Kartons standen. Er kam sich vor wie in einer gigantischen Abstellkammer. Vor einem Regal blieb Dr. Sigel stehen. Er zeigte auf einen Karton.
»In dem finden Sie, was Sie suchen«, sagte er und drückte Arvist ein Bündel Ausdrucke in einer Klarsichtfolie in die Hand: »Fakten, die nicht in den Briefen stehen und die wir aus anderen Quellen gefiltert haben.«
Arvist bedankte sich. Nachdem sich die Männer für den Abend in einem Brauhaus verabredet hatten, ließ der Historiker Arvist alleine. Arvist nahm den Karton aus dem Regal. Mit einem dicken Filzstift hatte jemand den Namen Alphonse Kessel auf die Pappe geschrieben. Arvist konnte keinen Tisch oder Stuhl entdecken. Er setzte sich auf den Boden. Hinter einem Regal stand die dunkelhaarige Frau in Jeans und schwarzer Lederjacke. Sie beobachtete ihn. Arvist bemerkte die Frau nicht.
Arvist war neugierig. Wie kam sein Verwandter in einen Stummfilm-Western und was für ein Verwandter war das? Er starrte auf den ungeöffneten Karton. Neues Wissen bedeutete neue Geschichten. Die konnten gut oder schlecht ausgehen. Er erinnerte sich an einen Film, in dem eine Waise feststellte, dass sie keine Waise war, sondern die Eltern den Jungen in die Babyklappe gesteckt hatten, woraufhin er sich daranmachte, rauszufinden, wer er war, woher er kam, und als er es wusste, so angeekelt war, dass er sich auf drastische Weise zu einer echten Waise machte. Arvist wollte kein Film-Held sein.
Er öffnete den Karton. Der Geruch von altem Papier stieg in seine Nase, obwohl jedes Blatt in einer Klarsichthülle steckte. Vorsichtig nahm er die Briefe heraus. Sie waren auf Deutsch verfasst. Die Schrift seines Vorfahren war seltsam in die Länge gezogen. Einige Briefe waren auf einfachem Papier geschrieben, andere besaßen einen Briefkopf von der amerikanischen Unionsarmee. Mehrere waren mit lokalpatriotischen Darstellungen von New York verziert. Hübsche Vignetten zeigten öffentliche und kommerzielle Gebäude. Die drei Tagebücher waren handgroße, schmucklose Ledereinbände.
Arvist warf einen Blick auf die Ausdrucke von Dr. Sigel. Der Historiker hatte Passagierlisten, Bürgerverzeichnisse, Steuerunterlagen, Zeitungen und ähnliche Quellen aus Deutschland und den USA aufgetrieben und analysiert. Sie ergänzten die Angaben der Briefe und Tagebücher. Alles in allem würde er nicht länger als drei Stunden brauchen, um die Briefe, Tagebücher und Ergänzungen zu lesen, schätzte Arvist.
Alphonse Kessel wurde 1838 in Ahrensburg bei Hamburg geboren. Zusammen mit seinem älteren Bruder Ferdinand begann er nach der Schule in Kiel ein Studium der Geisteswissenschaften. Bald hoch verschuldet, beschlossen sie auszuwandern. Da ihnen die Mittel fehlten, brachen sie den Schreibtisch des Vaters auf. Arvist benutzte die Notizfunktion des Smartphones. Dieb tippte er.
Am 1. März 1857 reisten die Brüder mit dem Segler Sir Isaac Newton von Hamburg nach New York. Die erste Zeit in der Stadt war nicht leicht. Als die Brüder das Schiff verließen, wurden sie Opfer eines Deutschen, der neu ankommende Landsleute in ein überteuertes Gasthaus führte und dafür eine Prämie kassierte. Alphonse geriet kurz darauf in eine Auseinandersetzung mit Nativisten. Arvist sah auf sein Smartphone, stellte fest, dass er Netz-Empfang hatte und schlug den Begriff bei Wikipedia nach. Er erfuhr, dass es sich bei Nativisten um Amerikaner handelte, die keine Deutschen und andere Einwanderer in den USA haben wollten. Das erinnerte ihn an Martin Scorseses Film Gangs of New York.
Alphonse erschlug einen Nativisten. Er und sein Bruder befürchteten Ärger und verließen New York. Ein Bürgerverzeichnis aus Texas belegte, dass die Brüder sich in dem kleinen Ort Comfort, in der Nähe von San Antonio niederließen. Als Beruf der Brüder war Händler angegeben. Laut des Verzeichnisses starb Ferdinand ein Jahr nach Ankunft in Amerika an einem Schlangenbiss.
Am 12. April 1861 brach mit der Beschießung Fort Sumters durch die Konföderierten der amerikanische Bürgerkrieg aus. Er veränderte das Leben von Alphonse Kessel. Als Einwohner von Texas sollte er den Eid auf die Konföderation schwören und in die militärischen Dienste des Südens gezwungen werden. Wer das nicht tat, dem wurde mit dem Verlust des Eigentums gedroht. Alphonse Kessel floh mit Nachbarn in die Berge. Arvist fand in den Unterlagen keinen Hinweis, warum Kessel in die Berge ging. Weder in den Briefen noch im Tagebuch sprach er sich gegen die Sklaverei aus. Sklavengegner?, tippte Arvist ins Smartphone.
Kessel und seine Nachbarn wurden vom Feind gestellt. Nur Kessel wurde nicht erschossen. Weil er sich während des Gefechts absetzte und in einer Höhle wartete, bis der Kampf vorbei war. Was ist dieser Alphonse Kessel für ein Mann, fragte sich Arvist. Er ließ seine Kameraden einfach im Stich. Feigheit oder gesundere Pragmatismus, durch den er überlebte, notierte er.
Alphonse Kessel schlug sich durch Texas und das Indianerland nach Kansas durch, das zu den Nordstaaten gehörte. Anfang 1963 trat er den Unionstruppen bei. In dieser Zeit entstand das Foto, das im Haus der Bungers hing. Alphonse Kessel erwähnte es in einem Brief an seine Eltern: »Anbei übersende ich Euch ein Portrait von mir. Die Uniform gehörte einem Kameraden, dem der Feind in den Kopf geschossen hat. Kleidung ist knapp in der Armee. Die Uniform passt nicht. Ich muss sie bald umschneidern lassen ...«
Erstaunt stellte Arvist fest, dass Alphonse Kessel ein Lügner war. In den Briefen an seine Eltern erweckte er den Eindruck, als regulärer Soldat zu kämpfen. Aber die Unterlagen von Dr. Sigel belegten, dass Alphonse zu den Jayhawkern gehörte, laut Wikipedia eine berüchtigte Guerillaeinheit, die hinter den feindlichen Linien agierte, sich durch Raubzüge versorgte, wegen ihre Brutalität berüchtigt war und verantwortlich für einige der schlimmsten Gräueltaten des Bürgerkriegs. Arvist kam sich vor wie Johnny Depp im Film Die Siebte Pforte, in dem die Suche nach einem Buch mit der Begegnung mit dem Teufel endete. Lügner, Kriegsverbrecher, tippte Arvist.
Nachdem General Lee am Appomattox Court House kapituliert hatte und Jefferson Davis, der Führer der Konföderierten, gefangen genommen worden war, blieb Alphonse zwei Jahre bei der Armee und kämpfte gegen die Sioux. Anschließend quittierte er den Dienst und zog ziellos durch die Gegend. Er hielt sich mit Pharo und anderen Glücksspielen über Wasser, arbeitete zwischendurch als Croupier und Rausschmeißer in Saloons. Letzteres offenbar mit einem gewissen Vergnügen, wie Arvist in einem Tagebucheintrag lesen musste: »Ein beschränkter Trapper hat heute Ärger gemacht. Ich hab ihm zwei Kugeln in den Wanst geschossen. Hab ihn mit Joe zu Schlitzaugen-Chang gebracht. Der hat ihn zu den Schweinen geworfen. Die Tiere hatten Hunger…«
Über die Zeit zwischen 1870 und 1880 fand Arvist nichts in den privaten Papieren. Die Auskünfte in Dr. Sigels Unterlagen waren spärlich. In den Jahren 1873, 1875 bis 1882 fand sich Alphonse Kessels Name im Adressverzeichnis von New York City. 1881 schrieb Arvists Vorfahre seinen Eltern, dass er mit einem Deutschen namens Joseph Zweigert – genannt Joe – in der Lower East Side einen Saloon eröffnet hatte, der den Familiennamen des neuen Freundes trug. Der nächste Brief stammt aus dem Sommer 1882. Alphonse und Joe hatten New York verlassen und das Zweigert der Obhut von Joes Schwester Mary – eigentlich Marie – überlassen. Aus dem Tagebuch erfuhr Arvist, dass sein Vorfahre ein Verhältnis mit dieser Mary hatte. »Sie war ein Weib, das seinen Mann stehen konnte. Voller Tatendrang verrichtete sie ihre Arbeit im Zweigert. Sie war nicht sehr hübsch, aber mit Charme und Witz. Auch wenn sie nicht die Art Frau war, die mir gefiel, ließ ich mich mit ihr ein.«
Die Männer zogen nach Tombstone. Arvist musste auflachen, als er das las. Ausgerechnet in die legendäre Grenzstadt, in der die amerikanische Westernlegende Wyatt Earp sein berühmtes Duell am O. K. Corral ausgetragen hatte, der Wyatt Earp, der über die Jahre von Stars, wie Henry Fonda, Burt Lancaster, James Garner, Kevin Costner und Kurt Russell im Kino verkörpert worden war. Was für ein absurder Zufall.
Der Aufenthalt im Tombstone blieb nur eine Episode. 1883 lebte Alphonse Kessel wieder in New York. Im Sommer 1884 kehrte Alphonse Kessel überraschend nach Deutschland zurück. Das Tagebuch erzählte Arvist den Grund:
Am 3. März 1884
.Joes Schwester Mary ist von mir schwanger. Werde sie nicht ehelichen. Sie ist nicht die Richtige. Joe ist furchtbar aufgeregt wegen der Angelegenheit ...
Am 5. März 1884
Mary ist meine Ehefrau. Wir haben in New York geheiratet. Joe hat mir keine Wahl gelassen. Mit einem Bowie-Messer im Rücken sagt man schnell JA ...
Am 6. März 1884
Habe beschlossen, abzuhauen. Ohne Mary. Joe stellte sich mir in dem Weg. Mit seinem riesigen Bowie-Messer. Ich habe auf ihn geschossen und getroffen. Keine Ahnung, ob er überlebt. Ich hab den Tresor ausgeräumt und bin weggeritten …
Am 14. April 1884
Erfahre, dass Joe lebt. Er sucht mich. Ich denke, es ist Zeit, nach Hause zu fahren ...
Arsch, tippte Arvist.
Nach dem 14. April 1884 gab es keine Briefe und Tagebucheinträge mehr. Laut der Passagierliste einer Reederei reiste Kessel drei Tage später zurück nach Deutschland. Arvist packte die Papiere zurück in den Karton und stellte ihn ins Regal.
Was für eine Geschichte, dachte er, und sie ist noch nicht vorbei. Arvists Neugier war gewachsen. Er wollte mehr über den Stummfilm-Cowboy, über den bisher unbekannten Sohn von Alphonse Kessel wissen. Dieser Drang überraschte Arvist. Familiengeschichte hatte ihn bisher nicht interessiert. Er kannte nicht einmal die Geburtstage seiner Großeltern. Egal ob väterlicher- oder mütterlicherseits.
Arvist schrieb auf seinem Blog Dumm und dümmer: Hab alte Briefe meines Verwandten Alphonse gelesen. Hat im Wilden Westen gelebt. Das ist cool. Er war kein Held. Eher das Gegenteil. Das ist höllisch verstörend. Und interessant. Ich bleib dran. Freunde da draußen, bleibt mir gewogen.
6.
Die dunkelhaarige Frau in Jeans und schwarzer Lederjacke saß im Lesesaal der Kölner Bibliothek und überflog am Computer die digitalisierten Briefe und Tagebucheinträge von Alphonse Kessel. Sie war zwei Meter entfernt gewesen, als Professor Sigel Arvist von den digitalen Kopien erzählt hatte. Als die Männer im Keller verschwanden, folgte sie ihnen. Es war langweilig, Leute zu verfolgen, die in einer Welt lebten, in der Beschattungen im Kino, nicht in der Realität vorkamen. Als der Professor Arvist die Kiste mit den Unterlagen reichte, konnte sie den Namen lesen, der auf dem Deckel stand. Sie war zurück in die Bibliothek gegangen und hatte sich an einen Rechner gesetzt, von dem sie die Kellertür sehen konnte.
Die Frau hatte lange keinen Text auf Deutsch gelesen. Es dauerte, bis der alte Fluss wieder da war. Sie besaß ein Talent für Fremdsprachen. Sie lernte sie nicht. Sie las keine Anleitungen. Sie schnappte Sprachen auf. Durch Zuhören und Praxis. Ihre Spanisch-Kenntnisse hatte sie von einem mexikanischen Mechaniker, der ihre erste Liebe gewesen war. Arabisch lernte sie durch Gespräche mit einheimischen Ordnungskräften während ihrer Einsätze in Afghanistan und im Irak. Deutsch hatte sie sich während ihrer Stationierung in Stuttgart in den Kneipen der Stadt angeeignet.
Aus dem Rucksack holte sie ein Tablet, öffnete den Mail-Account und schrieb eine Nachricht, in der sie den Computertyp und den Standort des Bibliotheksrechners angab. Von der Homepage der Universität hatte sie Name und E-Mail-Adresse des Netzwerk-Administrators. Diese Angaben trug sie ebenfalls in die Mail ein. Die schickte sie an einen Mitarbeiter ihre Firma: [email protected]. Nachdem sie die Nachricht abgeschickt hatte, kopierte sie Kessels Schriften, hängte die Dateien an eine zweite Mail und verschickte auch sie.
Die Frau verließ die Bibliothek und rief ihren Auftraggeber an.
»Lozen, wie läuft’s?«, fragte der Mann.
»Gut«, sagte Lozen Graham, »hab dir eben eine Mail mit den Dateien der Briefe und Tagebücher geschickt.«
»Worum geht‘s?«
»Du hast mich nicht zum Lesen engagiert. Sag du es mir.«
»Es geht um Geschichte. Um bald vergessene Geschichte, wie ich hoffe.«
7.
Arvist saß auf dem Boden. Vor ihm stand das Laptop, neben dem ein Tablet lag. Er surfte. Arvist lebte in einer geräumigen 1-Zimmer-Wohnung, in der es nur eine Matratze, einen Kleiderständer und einen Flachbildschirm gab. In seinem Blog stand die Begründung: Warum meine Wohnung leer ist: Haptisches ist out. Imaginäres und Virtuelles sind in. Wenn man das konsequent denkt und lebt, bleibt nur eines: eine leere Wohnung. Freunde da draußen, bleibt mir gewogen.
Arvists Festnetz-Telefon klingelte. Er nahm ab.
»Bunger.«
»Ich bin’s, Claudia.«
»Wie geht`s?«
»Ich kann es immer noch nicht fassen. Der eigene Ururgroßvater ein Dieb und Totschläger, das ist eine schockierende Erkenntnis.«
Arvist hatte seiner Mutter aus der Bibliothek eine Mail geschrieben, in der er die Erkenntnisse über Alphonse Kessel zusammengefasst hatte.
»Ja. Echt schockierend.«
»Hast du entschieden, was du jetzt machst?«
»Ja, die Nachfahren der Zweigerts in den USA finden.«, sagte Arvist.
»Hast du dafür die Zeit?«
»Ja. Ist der Vorteil, wenn man als Freiberufler unterwegs ist.«
»Kannst du dir denn eine Auszeit leisten?«
»Ich hab in Cannes gut verdient. Außerdem glaube ich, dass sich aus der Suche ein interessantes Projekt machen lässt, das den einen oder anderen Euro abwerfen könnte.« »Könnte?«
»Mutter.«
»Ich würde die Briefe gerne lesen. Hast du Ausdrucke der Briefe und Tagebücher schon abgeschickt?«
»Nein. Noch nicht.«
»Dass du sie nicht als Datei hast.«
»Wie gesagt: Sigel hat sie von seiner Assistentin ausdrucken lassen.«
»Wie altmodisch.«
»Was erwartest du von einem, der mit der Vergangenheit sein Geld verdient.«
»Du bist so zynisch.«
»Mutter.«
»Schickst du die Ausdrucke morgen los?«
»Sicher.«
Die Ausdrucke lagen vor Arvist auf dem Boden.
»Danke.«
Nach dem Telefonat fuhr Arvist das Laptop runter und legte es auf die Matratze. Anschließend packte er das Tablet in den Rucksack und verließ die Wohnung. Er fuhr mit der Straßenbahn in die Innenstadt zum Treffen mit Prof. Sigel. Das Päffgen-Brauhaus war voll und laut. Arvist schnappte kölsche, hochdeutsche, englische, chinesische und russische Sprachfetzen auf. Er ging durch den Hauptsaal auf der Suche nach dem Historiker. Jemand rief seinen Namen. Arvist schaute sich um und entdeckte Dr. Sigel. Er saß an einem Tisch für vier Personen. Ein Platz war noch frei. Arvist setzte sich.
»Haben Sie vom Brand im Filmmuseum von Buenos Aires gehört?«, fragte der Professor nach der Begrüßung.
»Nein. Was ist passiert?«
»Ein Feuer ist ausgebrochen. Dabei ist der aufgetauchte Warden- Bond-Film verbrannt. Eine Tragödie.«
Das theatralische Wort Tragödie amüsierte Arvist. Mit dem Smartphone ging er auf News-Block. Unter der Rubrik Kultur fand er die Meldung. Er erfuhr nicht mehr als das, was ihm schon der Historiker gesagt hatte. Die argentinische Polizei ermittelte. Die Ursache des Feuers war ungeklärt. Esteban Ruiz, der Leiter des Museums, sprach von einem unersetzlichen Verlust. Der Brand gab der Angelegenheit etwas Mysteriöses, fand Arvist.
Ein Kellner kam vorbei und stellte ungefragt zwei Kölsch auf den Tisch. Prof. Sigel und Arvist stießen an und leerten die kleinen 0,2-l- - Gläser, die für die Rheinmetropole typisch waren.
»Der Film ist zerstört. Schade. Ich hätte ihn gerne gesehen«, sagte Arvist.
»In der Tat.«
»Aber immerhin hat der Filmfund dazu geführt, dass ich herausgefunden habe, dass Alphonse Kessel tatsächlich ein Kind gehabt hat, von dem bisher nichts bekannt war.« »Wirklich? Erzählen Sie.«
Der Kellner stellte ungefragt zwei Kölsch auf den Tisch.
Angetrunken kehrte Arvist spät am Abend zurück in seine Wohnung. Der Historiker hatte sich als unterhaltsamer Gesprächspartner und extrem trinkfest erwiesen. Mit Mühe zog Arvist den Schlüsselbund aus der Hosentasche, suchte und fand den Haustürschlüssel, zielte damit aufs Schloss – und verfehlte. Es spielte keine Rolle. Die Tür ließ sich aufdrücken. Sie war aufgebrochen worden.
Arvist schob die Tür auf und schaltete das Licht an. Die Matratze war aufgeschlitzt. Das Laptop lag in Einzelteilen daneben. Drumherum viele kleine Papierschnipsel. Arvist betrat den Raum und schloss die Tür. Der dadurch entstandene Luftzug wirbelte die Papierschnipsel in die Luft. Arvist schaute sich um. Der Kleiderständer: umgeworfen. Hosen, Hemden und T-Shirts lagen verstreut auf dem Dielenboden. Der Flachbildschirm an der Wand war zerschlagen. An ihm klebte eine rote Masse. Weiße Flüssigkeit tropfte auf ein zersplittertes Marmeladenglas und eine zersplitterte Milchflasche am Boden. Der Einbrecher war offenbar in die Küche gegangen, hatte die Lebensmittel aus dem Kühlschrank geholt und sie gegen den Fernseher geworfen. Arvist ging in die Küche, in der es nur eine Spüle und einen Kühlschrank gab, auf dem Geschirr und eine Einzelkochplatte standen. Hier hatte der Verbrecher nicht gewütet.
Arvist ging zurück ins Zimmer und setzte sich auf die Matratze. Aus seinem Rucksack holte er das Tablet, ging ins Netz und schrieb in seinem Blog über den Einbruch. Erst als er damit fertig war, begriff Arvist, dass die Papierschnipsel die Tagebücher- und Briefkopien waren.
Arvist rief die Polizei. Zwei übernächtigte Uniformierte erschienen 20 Minuten später. Sie schauten sich gelangweilt um und riefen den kriminaltechnischen Dienst, der eine Stunde später an der Tür klingelte und die Spurensicherung vornahm. Eine ältere Frau machte Fotos, ein Typ rannte mit einem Pinsel durch die Gegend. Bei CSI kommt das irgendwie cooler, dachte Arvist. Die Polizisten baten ihn, eine Liste der gestohlenen Gegenstände zu machen, und blickten enttäuscht drein, als sie erfuhren, dass nichts gestohlen worden war. Gegen 5 Uhr morgens zogen die Beamten ab.
Arvist überlegte, ob er zu seinen Eltern fahren sollte, um zu schlafen. Aber er war zu aufgedreht. Er schleppte nacheinander die zerschnittene Matratze und den zerschlagenen Flachbildschirm aus der Wohnung. Er wusste, dass zwei Straßen weiter ein Container vor einer Baustelle stand. In den warf er Matratze und Bildschirm und deckte beides mit Schutt zu. Anschließend ging er in eine Bäckerei, die bereits geöffnet hatte. Er bestellte Kaffee und zwei Croissants.
Als die Geschäfte öffneten, kaufte sich Arvist ein neues Laptop und eine neue Matratze, brachte sie mit einem Lastentaxi in die Wohnung, reinigte die Dielen, bezog die Matratze und legte sich hin. Er war todmüde, aber einschlafen konnte er nicht.
8.
»Etwas zu trinken?«, fragte die Flugbegleiterin.
Arvist saß zwei Tage nach dem Einbruch im Flieger nach New York. Er war froh, eine Zeit lang nicht in seiner Wohnung schlafen zu müssen. Seit dem Einbruch und der Verwüstung fühlte er sich unwohl in dem Raum. Er hatte in Internetforen recherchiert. Das durchlebten viele Einbruchsopfer. Willkommen bei den Neurotikern. Arvist fragte sich, was der Einbrecher gedacht hatte, als er in der leeren Wohnung stand. Wohl Wut. Weil es nichts zu klauen gab. Das würde die Marmelade auf dem Flachbildschirm und die zerrissenen Unterlagen erklären.
»Einen Rotwein“, sagte Arvist zur Flugbegleiterin.
Sie stellte ihm das Getränk auf den Klapptisch. Arvist nippte am Plastikbecher, blickte tiefenentspannt aus dem Fenster und verlor sich im Anblick der weißen Wolken. Er hatte vor dem Abflug einen Joint geraucht. In dem berauschten Zustand hatte er einen Aufsager für seine Homepage gemacht, den er mit der Kamera seines neu gekauften Laptops aufgezeichnet hatte. In diesem Aufsager hatte er die Suche nach seinem unbekannten Vorfahren zum Web-Event erklärt und angekündigt, ein tägliches Update der Suche auf seiner Homepage und auf verschiedenen sozialen Netzwerken zu posten.
Arvists Seite war klar strukturiert. Es gab ein aktuelles Hauptbildelement, meist ein Video. Es besaß, wie die übrigen Videoelemente, eine gerahmte, abgerundete Form, die an die Muster der 1970er erinnerte. Der Eindruck wurde durch den gelb-braunen Hintergrund der Seite verstärkt. Über dem Hauptbildelement gab es die Möglichkeit auf die Buttons Biografie, Film und Serien, Dumm und dümmer, Kontakt zu klicken. Die Typo erinnerte ebenfalls an die 1970er und fand sich auch in den Video- und Blog-Überschriften. Links unter dem Hauptbildelement standen die Webvideos, für die er prämiert worden war, rechts die aktuellen Blog-Einträge. Für den Web-Event hatte er das Design der Homepage leicht verändert, indem er seinen Storify-Account in die Seite integriert und eine Überschrift über das Hauptbildelement positioniert hatte. The Search stand dort. Der knallige Schrifttyp erinnerte an die Filmplakate von Exploitation-Streifen.
Arvist nahm einen Schluck Rotwein. Genoss das warme Gefühl im Bauch, dass er auslöste. Er hatte eine Spur. Nachdem er im New Yorker Online-Telefonbuch keinen Zweigert gefunden hatte, suchte er mithilfe von Suchmaschinen, Personensuchmaschinen und über soziale Netzwerke nach Nachfahren von Mary und Joe Zweigert. Gemeldet hatte sich über Facebook eine Amerikanerin namens Amy Miller:
Habe eine Bar. Das Swaggerts. Ganz, ganz früher hieß es Zweigert.
Arvist hätte vor Freunde fast geschrien. Das Zweigert, die Kneipe, die Alphonse Kessel und sein Kumpel Joe gegründet hatten, existierte noch. Hektisch tippte er die Antwort.
Warum wurde die Bar umbenannt?
Keine Ahnung. Muss ich meine Grandma fragen.
Habe keine Zweigerts in New York gefunden.
Es gibt dem Namen nach keine Zweigerts mehr. Meine Grandma hat als junge Frau einen Ben Witter geheiratet und weg war der Name.
Du heißt aber Miller.
Wie mein dämlicher Ex-Mann.
Verstehe.
Auch geschieden?
Bisher noch nicht.
Mein Tipp: Heirate nie den Barkeeper deiner Bar.
Mach ich.
Warum willst du das alles wissen?
Dauert, das zu erklären. Skype?
Klar.
Arvist kontaktierte Amy Miller via Skype. Er war aufgeregt, eine echte Zweigert zu sehen. Amy war eine in Schwarz gekleidete Mittdreißigerin mit langen, roten Haaren, roten Augen und einem jungen Gesicht. Von dem Raum, in dem sie saß, war wegen der schlechten Qualität ihrer Kamera wenig zu erkennen. Arvist erklärte, warum er auf der Suche nach den Zweigerts war, und fragte, ob er sie besuchen dürfe. Er würde gerne mit ihr persönlich sprechen, weil er eine Web-Doku plane. Amy Miller hatte damit kein Problem. Deshalb war er auf dem Weg nach New York. Die Aktion war etwas überstürzt, musste er zugeben, aber gründliches Planen und Recherchieren entsprachen nicht Arvists Natur.
Arvist war euphorisch. Wie zuletzt vor zwei Jahren, als er die preisgekrönten multimedialen Beiträge entwickelt hatte. Seitdem hatte er sich treiben lassen, auf den Lorbeeren ausgeruht. Er hatte gutes Geld verdient, aber nichts Kreatives auf die Beine gestellt. Aus der Suche nach den Vorfahren ließ sich etwas Großes machen. In seinem Blog hatte er geschrieben: Man versteht sich selber nur, wenn man seine Vorfahren kennt. Es gibt eine genetische Verbindung und eine mimetische. Es geht ums Verhalten. Der Mensch übernimmt Verhaltensmuster von den Menschen, bei denen er aufwächst. Das heißt, ich habe was von meinem Vater übernommen, der von seinen und der wiederum von seinen. Freunde da draußen, bleibt mir gewogen.
Arvist würde auf zwei Ebenen über seine Suche berichten. Einmal in Textform in seinem Blog. Dazu gab es reportageartige Webvideos, in denen er selbst als Reporter im Mittelpunkt stand. Arvist atmete durch. Gerne hätte er einen zweiten Joint geraucht. Er nahm sich vor, einen Blog zu schreiben, in dem er für die Gründung einer Kiffer-Airline plädierte.
Fünf Reihen vor Arvist saß Lozen Graham. Sie hatte den Facebook-Dialog zwischen Arvist und Amy Miller verfolgt, den Blog-Eintrag gelesen und den Aufsager angesehen, in dem der Deutsche den Beginn seiner Suche verkündete. Daraufhin informierte sie ihren Auftraggeber. Der war nicht begeistert gewesen, dass der Blogger seinen Vorfahren suchte. Er verlängerte den Auftrag. Das hatte Lozen Graham weder gefreut noch geärgert. Trotz des Einbruchs in die Wohnung des Deutschen war dies ein Routineauftrag. Wenn er länger dauerte, gut, wenn nicht, war das auch nicht schlimm.
Lozen trank ein Glas Orangensaft und las auf ihrem Smartphone einen alten Blog-Eintrag von Arvist: Warum ich tumbe Badeurlaube in den Gettos der Pauschalurlauber mag: Ich steh auf Nichtorte, deren einziger Zweck die Beherbergung von Touristen ist. Ich beobachte den stillen Wettkampf um Hautkrebs zwischen dicken Männern und dicken Frauen, die unter der Mittagssonne auf dem Wasser treiben. Diese Menschen sind meine Idole. Freunde da draußen, bleibt mir gewogen.
»Der Typ ist ein Freak«, dachte Lozen.
9.
Arvist filmte mit einer kleinen Kamera aus dem Fenster des Yellow Cab und streamte die Aufnahmen direkt ins Netz. Arvist war direkt am Flughafen in das Taxi gestiegen. Der Fahrer fuhr über die Queensboro Bridge zur Jackson Avenue. Der Weg kam Arvist wie ein Umweg vor. Aber er sagte nichts. Er war schon ein paar Mal in New York gewesen, doch das reichte nicht, um sich mit einem Taxifahrer anzulegen.
Das Yellow Cab hielt vor einem roten Backsteingebäude. Links ein Laden für geistige Getränke, rechts der Eingang zum Blend, eine Mischung aus Café und Restaurant. Amy Miller hatte ihm den Namen und Adresse per SMS geschickt. Arvist zahlte, stieg aus, filmte das Backsteingebäude, drehte die Kamera auf sich und sagte mit dramatischer Stimme: »In diesem Restaurant wartet Amy Miller, die Nachfahrin der Zweigerts und damit eine entfernte Cousine von mir.«
Arvist schaltete die Kamera aus und betrat das Blend. Es war Mittagszeit und der Laden voll. Er schaute sich um. Amy Miller saß in der hintersten Ecke. Sie sah aus wie beim Skype-Gespräch.
Amy und Arvist machten anfangs Small Talk über betrügerische Taxifahrer und lästige Flugsicherheitskontrollen in Zeiten des Kriegs gegen den Terror. Als die Kellnerin erschien, bestellte Amy Miller Soba-Nudeln mit Gurken, Bohnensprossen, Pilzen, angemacht mit einer Soja-Ingwer-Sauce, dazu eine Diet Coke. Arvist, der sich fast ausschließlich vegetarisch ernährte, folgte ihrem Beispiel.
Während sie auf das Essen warteten, erzählte Arvist von Alphonse Kessels Briefen. Amy Miller hörte mäßig interessiert zu. Arvist fragte, ob sie etwas dagegen hätte, wenn er die Kamera anstellen würde. Amy Miller war einverstanden. Er holte sie aus dem Rucksack und stellte sie an. Arvist erkundigte sich, ob sie Fotos und andere Dinge besäße.
»Ich habe nichts. Mich interessieren die alten Geschichten nicht. Grandma wüsste bestimmt mehr darüber.«
»Ist es möglich, mit ihr zu sprechen?«
»Sie kommt erst in zwei Tagen zurück. Sie kurvt mit ihrem Wohnmobil durchs Land und wirft nur selten einen Blick aufs Handy.«
»Frag sie doch bitte, ob sie mit mir sprechen will. Ich fliege erst in vier Tagen zurück.«
Eine Großmutter, das klang doch gut.
»Ich frage sie. Grandma wird bestimmt gerne mit dir sprechen. Wie alle alten Leute redet sie gerne von der Vergangenheit.«
Die Kellnerin brachte die Nudeln und die Coke. Arvist blieb mit der Kamera auf Amy Miller.
»Aber wenn du Lust hast, einen Ausflug zu machen: Ich habe vor Jahren ein Haus in den Pocanos, in Stroudsburg, renoviert, das meiner Grandma gehört und jetzt vermietet ist«, sagte Amy, »auf dem Dachboden habe ich eine Kiste entdeckt, in der jede Menge altes Zeug ist.« »Was genau?«
Pocanos, Dachboden, eine Kiste plus eine Großmutter, das klang verheißungsvoll.
»Keine Ahnung. Ich hab nur kurz reingeschaut.«
»Das schaue ich mir gerne an. Klingt nach einem Geheimnis, das gelüftet werden muss.«
»Wenn du meinst.«
Die hervorstechende Eigenschaft von Amy Miller war ihr Phlegma, fand Arvist.
»Kennst du einen Mann namens Charles Becker, Arvist?«, fragte Amy Miller.
»Meinst du den korrupten New Yorker Bullen, der Anfang des 20. Jahrhunderts hingerichtet wurde?«
»Nein, von dem hab ich noch nie gehört. Der Becker, von dem ich spreche, lebt noch.«
»Dann kenn ich ihn nicht. Warum?«
»Er kam gestern ins Swaggerts. Wollte etwas über die Vergangenheit der Bar und meiner Familie wissen.«
Pocanos, Dachboden, eine Kiste plus eine Großmutter, plus einem mysteriösen Typen, der wie ein korrupter Bulle aus der Vergangenheit von New York hieß. Supergeil.
»Was hast du ihm erzählt?«, fragte Arvist.
»Nichts. Er war ein aalglatter Typ. Hatte was vom Anwalt oder Banker. Ich mochte ihn nicht.«
»Verstehe.«
»Möchtest du das Swaggerts heute sehen? Oder willst du dich erst hinlegen? Wegen Jetlag und so.«
»Ich bin nicht müde.«
»Dann fahren wir nach dem Essen hin. Du wirst das Swaggerts mögen. Es steckt voller alter Geschichten.«
Als Amy und Arvist das Blend verließen, folgte ihnen Lozen Graham, die Kirschkaugummi kauend gegenüber dem Restaurant gewartet hatte. Sie fuhren mit der Subway nach Manhattan. Lozen saß keine zwei Meter von ihnen entfernt und las eine Zeitung.
Das Swaggerts lag im Kellergeschoss. Ein langer Schlauch mit einer dunklen Theke.
»Nur das McSorley ist älter«, behauptete Amy Miller, als sie eintraten. Die Bar war gerade erst geöffnet worden. Es gab keine Gäste. Arvist stellte die Kamera an. Amy gab eine Tour durch die Bar und ratterte historische Fakten runter, wie sie es wahrscheinlich schon für Tausende Touristen getan hatte. Arvist filmte, wie Amy dem massigen Barkeeper zunickte und die Theke entlang auf das WC-Zeichen zuging. Neben dem Zeichen führte eine Tür in ihr Büro. Die Barbesitzerin zeigte ihm den alten Schreibtisch aus Holz, von dem ihre Großmutter behauptete, er stünde seit den 20er-Jahren in dem Raum. An der Wand hingen geschichtsträchtige Schwarz-Weiß-Fotos. Wie der Tisch schienen sie überwiegend aus den 1920ern zu stammen.
Arvist filmte die Fotos ab, suchte nach einer Aufnahme von Alphonse Kessel oder seinem Sohn. Aber er konnte keine entdecken.
»Wer sind die Leute auf den Bildern?«, fragte Arvist, während er filmte.
»Da kann ich dir nicht viel sagen. Außer zu dem da.«
Amy Miller zeigte auf einen kräftigen Kerl mit gegeltem Haar und Backenbart. Arvist zoomte auf die Aufnahme. Der Mann war um die 60. Er trug ein weißes Hemd, Hosenträger und schwarze Hosen. Im Bund steckte ein großes Messer. Der konnte bestimmt Eisenstangen mit der bloßen Hand verbiegen, dachte Arvist. Im Hintergrund war eine Theke zu sehen. Es war die des Swaggerts. Sie hatte sich in den vergangenen hundert Jahren kaum verändert.
»Der Mann heißt Joseph Zweigert und hat diese Bar gegründet«, sagte Amy Miller.
»Genannt Joe. Alphonse Kessel erwähnt ihn in seinen Briefen und Tagebüchern.«
Amy Miller sah Arvist gelangweilt an.
»Gibt es ein Bild seiner Schwester Mary?«
»Ja. Es ist das links daneben.«
Das Foto zeigte eine hagere Frau mit grauem oder blondem Haar. Das Gesicht war kantig. Sie trug ein schlichtes, schwarzes Kleid. Sie lächelte. Neben ihr stand ein dicker Mann mit Schnauzbart und Pfeife. Er trug eine zu enge Jacke und eine karierte Weste. Für Arvist sah er bayrisch aus.
»Wer ist der Dicke?«
»Keine Ahnung. Irgendein Typ.«
»Kann ich mir das Bild näher ansehen?«
»Tu dir keinen Zwang an.«
Arvist nahm das Foto von der Wand und zog es aus dem Rahmen. Er schaute auf die Rückseite. Auf der stand etwas geschrieben. Arvist hatte Schwierigkeiten, die Handschrift zu lesen. Die Schreiberin hatte Sütterlin benutzt. Ich und Günther Billigmeier von der Deutschen Botschaft. New York, Sommer 1915. Arvist machte ein Bild von der Rückseite, tat das Foto zurück in den Rahmen und hängte es an die Wand.
»Noch jemand, den du kennst?«, fragte Arvist.