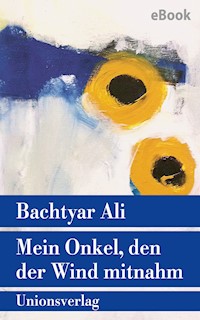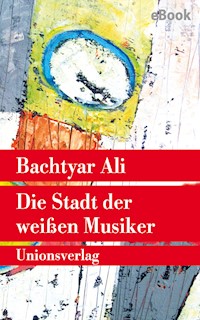11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An Bord eines Bootes, das ihn zusammen mit anderen Flüchtlingen in den Westen bringen soll, erzählt Muzafari Subhdam seine Geschichte. Selbst ein hochrangiger Peschmerga, rettete er dem legendären kurdischen Revolutionsführer einst das Leben, als sie von Truppen des Regimes umstellt waren. Er aber geriet in 21-jährige Gefangenschaft, mitten in der Wüste. Wieder in Freiheit, begibt er sich auf eine Reise durch das, was aus seinem Land geworden ist. Eine Reise durch Geschichten, Geheimnisse und zu Personen, die ihm dabei helfen, seinen verschollenen Sohn zu finden. Eine Reise, die ihn schließlich auf den Weg führt, den Tausende schon vor ihm genommen haben: übers Mittelmeer in den Westen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
An Bord eines Bootes, das ihn zusammen mit anderen Flüchtlingen in den Westen bringen soll, erzählt Muzafari Subhdam seine Geschichte. Nach einundzwanzig Jahren Gefangenschaft in der Wüste begibt er sich auf die Suche nach seinem Sohn, in einem Land, das er nicht mehr kennt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Bachtyar Ali, geboren 1966 in Sulaimaniya (Nordirak), ist der bekannteste Schriftsteller des irakischen Kurdistan. Sein Werk umfasst Romane, Gedichte und Essays. Er lebt seit Mitte der Neunzigerjahre in Deutschland. 2017 wurde er mit dem Nelly-Sachs-Preis, 2023 mit dem Hilde-Domin-Preis ausgezeichnet.
Zur Webseite von Bachtyar Ali.
Ute Cantera-Lang, geboren 1974 in Erlangen, lebt seit vielen Jahren in Österreich. Sie studierte Musik an der Kunstuniversität in Graz. Zahlreiche Auslandsaufenthalte führten zu Dolmetschtätigkeiten in Spanisch und Englisch. Gemeinsam mit Rawezh Salim übersetzt sie aus dem Kurdischen (Sorani).
Zur Webseite von Ute Cantera-Lang.
Rawezh Salim, geboren 1973 in Sulaymaniyah (Nordirak), floh während des kurdischen Bürgerkrieges nach Österreich, wo er Translationswissenschaften studierte. Er arbeitet unter anderem als Übersetzer und Dolmetscher für die Sprachen Deutsch, Kurdisch und Arabisch.
Zur Webseite von Rawezh Salim.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Bachtyar Ali
Der letzte Granatapfel
Roman
Aus dem Kurdischen (Sorani) von Ute Cantera-Lang und Rawezh Salim
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel Dwahamin Hanari Dunya.
Die Übersetzung aus dem Kurdischen (Sorani) wurde vom SüdKulturFonds in Zusammenarbeit mit LITPROM – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. unterstützt.
Originaltitel: Dwahamin Hanari Dunya
© by Bachtyar Ali 2002
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Sazgar Salih (Ausschnitt)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer, Zürich
ISBN 978-3-293-30938-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 15:06h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER LETZTE GRANATAPFEL
1 – Im Morgengrauen des ersten Tages erkannte ich …2 – Es liegt einige Jahre zurück, dass Mohamadi Glasherz …3 – Jakobi Snauber kam gegen Mittag. Er war allein …4 – Vor langer Zeit hatten Laulawi und Schadaryai Spi …5 – Als ich ihn fragte, wo Saryasi Subhdam sei …6 – Seit Mohamadi Glasherz im Schutt seines gläsernen Zuhauses …7 – Eines Nachts fand mich in diesem fernen …8 – Lasst uns zu den weißen Schwestern zurückkehren …9 – Drei Wochen dauerte es, bis Ikrami Keu wiederkam10 – Im Bazar nennt man Saryasi den »Professor der …11 – Heute Nacht ist die Zeit gekommen, euch zu …12 – Nach Saryasi Subhdams Tod und der Zerschlagung der …13 – In der zweiten Nacht meiner Freiheit führten mich …14 – Das Treffen der beiden Saryasi an jenem Abend …15 – Schon lange hatte niemand mehr etwas vom zweiten …16 – Die erste Kassette. – Ich heiße Saryasi Subhdam …17 – Über lange Zeit hinweg tauschten Saryasi und ich …18 – Am Tag, als Mohamadi Glasherz von den Fluten …19 – Eines Abends machten der letzte Saryasi und ich …20 – Zwei Wochen später, im Morgengrauen, weckten mich die …Mehr über dieses Buch
Über Bachtyar Ali
Werke von Bachtyar Ali
Über Ute Cantera-Lang
Über Rawezh Salim
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Bachtyar Ali
Zum Thema Kurden
Zum Thema Irak
Zum Thema Kindheit
Zum Thema Revolution
1
Im Morgengrauen des ersten Tages erkannte ich, dass er mich eingesperrt hatte. In einem Schloss, mitten in einem schwer zugänglichen, abgelegenen Wald. Er sagte, draußen habe sich eine Art tödliche Krankheit verbreitet, eine Seuche, ähnlich der Pest. Wenn er log, flogen die Vögel davon. Schon als Kind war er so gewesen. Jedes Mal, wenn er log, geschah etwas. Entweder begann es zu regnen, oder Bäume fielen um, oder ein Vogelschwarm flog über unsere Köpfe hinweg.
Ich war in einem großen Schloss eingesperrt. Er brachte mir einen Stapel Bücher und sagte, ich solle sie lesen.
Ich antwortete nur: »Lass mich gehen.«
»Die Welt ist von Kopf bis Fuß von dieser Krankheit befallen, Muzafari Subhdam«, sagte er. »Bleib hier, hier ist die Welt in Ordnung. Dieses Schloss habe ich mir selber erbaut, für mich und meine Engel, für mich und meine Teufel. Setz dich und lehne dich zurück, meine Engel und meine Teufel gehören dir. Dort draußen lauert die Pest, und du musst verschont bleiben, verstehst du?«
Ja, hier war von dieser Pest nichts zu spüren.
Schon als wir Kinder waren, hatte er mir jeweils seine Sachen überlassen und ich ihm meine. Jakobi Snauber, der Mann, der Dinge geschehen ließ, wenn er in den Himmel blickte: Plötzlich wuchsen Wolken, eine Sternschnuppe fiel, blitzschnell drang Erleuchtung in unsere Herzen, oder die Nacht brach vorzeitig an. An seiner Seite war die Welt schon immer eine andere gewesen. Ich hatte ihn oft auf seinen Märschen begleitet. Wie ein Magier verwandelte er den Weg unter seinen Füßen und die Dinge, die ihn umgaben. Er konnte uns tage- und nächtelang auf seinen Wegen mitführen, ohne dass wir Hunger verspürten. Jakobi Snauber war ein Mann voller Fantasie. Ich war sein einziger, langjähriger Gefährte, denn wir kannten uns seit unserer Kindheit. Die anderen, die an unserer Seite gekämpft hatten, waren jünger gewesen. Später wurde ein Teil von ihnen zu seinen Feinden und der andere Teil zu seinen Knechten.
Wann hatte die Geschichte von mir und Jakobi begonnen? Nach einundzwanzig Jahren Gefangenschaft ist mir, außer einigen Fetzen Erinnerung, nichts geblieben. Einundzwanzig Jahre Gefangenschaft haben aus mir einen Knecht gemacht, an Leib und Seele. In diesen einundzwanzig Jahren war er der Einzige, der mir Briefe schickte. Er schrieb auf kleine Zettel: »Wenn du herauskommst, wird eine neue Epoche herrschen. Du lebst bald in einem der schönsten Schlösser der Welt.« Über Jahre hinweg schickte er mir solche Briefchen, unter die er keinen Namen schrieb, sondern nur Worte wie »ein liebender Freund vermisst Dich«. Oder er malte wie früher in die untere Ecke des Zettels einen Vogel. Mit den Jahren entwickelte ich ein Gespür für seine Handschrift. Ich erkannte in ihr die Veränderungen seiner Seele. Während dieser einundzwanzig Jahre erhielt ich außer seinen Schreiben nichts, was mir von der Welt da draußen erzählte. Seine Briefchen waren mein einziges Fenster zu den Veränderungen da draußen gewesen. Einundzwanzig Jahre immer wieder der Satz vom Schloss, das auf mich wartete.
Meine erste Nacht in diesem Schloss war kalt, still und furchterregend. Nach einundzwanzig Jahren Alleinsein und Schweigen. Ich hatte mich bemüht, die Sprache nicht zu verlernen. Nein, ich habe sie nicht vergessen. In diesen langen Jahren hatte ich Zeit gehabt, mir meine eigene Sprache zu erschaffen, eine Sprache ähnlich der Poesie. Als ich aus dem Gefängnis herauskam, konnte ich alles sagen, aber für andere war es manchmal unverständlich. Als ich herauskam, roch ich nach Wüste. Jede Wüste hat ihren eigenen Geruch. Nur wer lange mit der Wüste gelebt hat, kann diese Gerüche voneinander unterscheiden. Ich roch nach meiner Wüste. Nur ein einziges Mal hatten sie mich aus ihr herausgeholt, sie wollten mich gegen einen Staatsgefangenen austauschen. Der Plan scheiterte. Nach zehn Tagen in einem anderen Gefängnis wurde ich wieder in meine Wüste zurückgebracht.
Einundzwanzig Jahre lang hatte ich dem Sand zugehört. Mein Gefängnis befand sich am Ende der Welt. Eine kleine Zelle mitten im Sandmeer, umringt von Himmel und Wüste. Einundzwanzig Jahre lang zählte ich zu den gefährlichsten Gefangenen der Nation. Abgeschnürt von der Welt, am fernen Ende des Landes, an einem Ort, wo sogar Gott die Menschen vergisst, wo das Leben endet und das Sterben beginnt, in einer Gegend in den Farben eines unbewohnten Planeten. Dort hatten sie mich versteckt. Während dieser einundzwanzig Jahre lernte ich, mit dem Sand zu sprechen. Wundert euch nicht, wenn ich sage, dass die Wüste voller Stimmen steckt. Der Mensch wird sie nie ganz verstehen können, aber nach und nach entzifferte ich die Hieroglyphen ihrer unterschiedlichen Stimmen. Wenn du so viele Jahre in einem Zimmer mitten in einer Wüste leben musst, lernst du, wie du dein Leben füllst, wie du dir Aufgaben schaffst. Vor allem musst du vermeiden, an die Zeit zu denken. Sobald du in der Lage bist, nicht an das Verrinnen der Zeit zu denken, schaffst du es auch, den Ort zu vergessen. Was einen Gefangenen umbringt, ist das andauernde Denken an die Zeit und an andere Orte.
Bis zum siebenten Jahr meiner Gefangenschaft hatte ich Tag für Tag die Stunden gezählt. Anfangs zählst du ganz genau, Sekunde für Sekunde, aber eines Tages wachst du auf und siehst, dass sich alles verwirrt hat. Du weißt nicht mehr, ob du dich seit einem Jahr oder einem Jahrhundert an diesem Ort befindest. Du weißt nicht mehr, wie die Welt da draußen aussieht. Am meisten Angst macht das Wissen, dass jemand auf dich wartet. Erst wenn du dir gewiss bist, dass niemand mehr auf dich wartet und dass dich die Welt vergessen hat, beginnst du, an dich selbst zu denken.
Nach einundzwanzig Jahren in der Wüste ist der Sand das Einzige, woran du denken kannst. Es gibt Nächte, in denen ruft die Wüste deinen Namen. Schwierig daran ist, dass du nicht weißt, was antworten. Ich sah die Geister der Wüste, die Gestalten aus Sand, die der Wind wachsen ließ und die der Wind wieder zerstreute. Es dauert lange, bis man lernt, mit dem Sand zu sprechen. In einundzwanzig Jahren erkennt man das Geheimnis der Gespräche mit dem Sand. Die Kunst ist, nie eine Antwort zu erwarten, nur selbst zu sprechen und dem Echo zu lauschen. Einem Echo, das wie Erdreich vom Wüstenboden geschluckt und von tausend anderen Echos erdrückt wird.
Einmal im Monat erlaubten sie mir, hinaus in die Wüste zu gehen. Sie schickten einen Wächter, mit dem ich ein paar Hundert Meter über den Sand ging. Diese Tage waren die schönsten meines Lebens. Bereits eine Woche vorher begann ich, mich vorzubereiten. Wenn meine Füße den Sand berührten, flatterte mein Herz vor Freude. Einundzwanzig Jahre lang war der Sand mein bester Freund. Wenn ich meinen Fuß in den Sand grub, spürte ich das Leben in mir, fühlte die Erde und spürte mein grenzenloses Sein, das in dieser kleinen Hütte zum Tode verurteilt war.
Nach und nach vergaß ich die Menschen. Das Universum wurde mein Lebensgefährte. In einundzwanzig Jahren hat man viel Gelegenheit, sich Gedanken über das Universum zu machen. Im Sand ans Universum denken … Ich wusch mich mit Sand, und dadurch kehrte meine Kraft in mich zurück. Und schließlich kommt der Tag, an dem die Freiheit, die das grenzenlose Sandmeer dir schenkt, dich ganz ausfüllt. Nach ein paar Jahren Gefangenschaft, ich weiß nicht mehr recht, wann das war, war ich von allen Gedanken über die Politik reingewaschen.
In manchen Nächten erhellte das Mondlicht mein Gefängnis so klar, dass ich alles sehen konnte wie am helllichten Tag. Dieser silbrige Glanz schenkte mir zusätzlich Kraft, vieles zu vergessen. Eine Ewigkeit war ich nun schon tot. Außer Jakobi Snauber wusste niemand, dass ich noch am Leben war. Niemand suchte mich, niemand vermisste mich. Ich kam aus dem Nichts und war wieder zu nichts geworden. Mit den Jahren verwandelten sich all meine Erinnerungen in Sand.
Ich wusste nicht, wo ich gefangen war. Diese Wüste hatte keinen Namen. Als sie mich herbrachten, saß ich tagelang mit verbundenen Augen auf der Rückbank eines Militärlastwagens. Aber ich konnte riechen, dass wir durch die Wüste fuhren. Einundzwanzig Jahre hoben sie mich auf, um mich eines Tages gegen einen Großen auszutauschen.
Zuletzt, in einer dunklen Nacht, ließen sie mich frei. Wenn du nach einundzwanzig Jahren rauskommst, siehst du nur Sand und denkst nur an Sand. Als sie mich in dieses Schloss brachten, begriff ich nichts und wollte auch gar nichts begreifen. Alles war stockfinster. Von dem Moment an, als ich aus dem Gefängnis weggebracht wurde, bis zu dem Moment, als ich in diesem Schloss meine Augen öffnete, sah ich kein Tageslicht. In der Dunkelheit wurde ich von einer Hand zur nächsten weitergereicht. Hände, verschwiegen wie die Nacht, stiller als eine Wand und stummer als eine verschlossene Tür, hinter der ein alter Gefangener wartet.
Ein Mann hatte mein Handgelenk gepackt und mich in einen anderen Wagen gesetzt. Er schwieg. Ich konnte nicht einmal sein Atmen hören. Ich hörte nur den Schrei des Sandes. Wohin brachten sie mich? Ich wusste es nicht, und es hatte auch keine Bedeutung. Wer nur ans Universum denkt, ist frei von Angst. Zweiundzwanzig Jahre alt war ich, als sie mich verhaftet hatten, und dreiundvierzig, als sie mich freiließen.
Als sie mich geholt und meine Augen verbunden hatten, fragte ich den Wächter, ob sie mich zur Exekution führten. Er sagte: »Nein, wir werden dich in die Freiheit entlassen.« Was meinte er mit Freiheit? Es ist sinnlos, nach einundzwanzig Jahren mit einem Gefangenen über Freiheit zu reden. Meine wahre Freiheit war, in der Wüste zu leben. Ich war mir sicher, die Welt da draußen nicht mehr zu verstehen. Ich fürchtete mich vor Städten und Menschen. In diesen einundzwanzig Jahren hatte ich außer den Wachen niemanden gesehen. Sie waren dumpf und fremd, fremder als die Wüste. Sie wechselten kaum ein Wort mit mir. Es schien, als seien sie hier geboren und hätten auf dieser Welt keinen anderen Ort gesehen.
Der Weg war kaum befahrbar gewesen und ging steil bergan, also fuhren wir auf eine gebirgige Region zu. Als ich am nächsten Morgen, in diesem großen Schloss, durch das Fenster sah, überfiel mich panische Angst vor den Blättern. Es war ein leicht windiger Morgen, Tausende von Blättern bewegten sich in der Brise hin und her. Der Anblick überwältigte mich. In den Bäumen sah ich unzählige geflügelte Kreaturen, grüne Wesen, deren Augen wie Tautropfen glänzten. Schwärme davon!
Doch dann, als ich in diese grüne Wildnis sah, wurde mir bewusst: Ich war befreit. So hartherzig schien mir dieses Grün. Und doch tanzten die Sonnenstrahlen zwischen den Bäumen. Ein Licht, das dem klaren, spiegelnden und unendlichen Licht der Wüste ähnelte. Dies war der erste Morgen nach einundzwanzig Jahren, an dem ich die Augen aufmachte und nicht in die Wüste blicken konnte. Die Wüste, meine alte Geliebte, die in meine Seele eingedrungen war.
Ich wusste: Er war es, der mich hierhergebracht hatte. In diesem Schloss stand er mir vor Augen: Jakobi Snauber.
Ich begann, durch die Zimmer zu wandern, und spürte schmerzhaft, dass sich mein Körper nicht an diese neue Umgebung gewöhnen konnte. Noch hielt mich der Sand umschlungen, und ich konnte die Freiheit nicht erfassen.
Als sie mich aus dem Wagen geholt hatten, roch es nach frühem Morgen. An jedem Ort hat das Erdreich im Morgengrauen seinen besonderen Geruch. Nach einundzwanzig Jahren im Sandmeer hatte sich mein Land in eine Illusion verwandelt. Nun aber konnte ich die Brise des frühen Morgens, das Aroma der Bäume und den leichten Wind der kalten Täler ringsum riechen, aber diese Gerüche waren wie gefangen in der unendlichen Macht des Sandes. Als ich über diesen Boden ging, zitterte ich vor Angst. Angst davor, zusammenzubrechen und in einen Abgrund zu stürzen. Ich hatte das Gefühl, auf dieser Welt das einzige Wesen zu sein.
Als ich schließlich meine Augen öffnete, befand ich mich in einem weitläufigen Zimmer. Es herrschte Dunkelheit, und nur in der Ecke brannte ein schwaches Licht. Die Kerze war frisch, jemand hatte sie kurz vor meiner Ankunft angezündet und war dann gegangen.
Ich schrie in die weiten Räume: »Du, der diese Kerze angezündet hat, wo bist du?« Außer meiner eigenen hallenden Stimme, die immer tiefer in die Finsternis hineinwanderte und leise zu mir zurückkehrte, hörte ich nichts. Ein Echo, das so anders klang als das Echo im Sand. Das Haus war menschenleer. Die Fenster waren verschlossen. Ich war ganz alleine in diesem Schloss, hinter verriegelten Toren. Sie hatten mich hergebracht und gleich wieder verlassen. In der Ferne hörte ich noch den Wagen wegfahren.
Die Einrichtung war seltsam, wie die Residenz eines Königs, aber ohne menschliche Spuren. Ich war erschöpft und wollte schlafen oder sterben.
Durch die großen Fenster sah ich den Schatten eines dichten Waldes. Der schwarze Himmel über mir war bedrohlich. Das war nicht mein vertrautes Wüstenschwarz. Die Wüstennacht hat immer einen bronzefarbenen Glanz, und der Himmel bewegt sich im Gleichklang mit dem Sand. Das Schwarz des Sands wiederum ähnelt erloschener Kohle, die den Atem, der sie erglühen ließ, ausgehaucht hat.
Die ständige Bewegung der Blätter erschreckte mich. Einundzwanzig Jahre lang hatte sich meine Welt anders bewegt. Ich war aus einem geregelten und vertrauten Universum in eine fremde Welt versetzt worden. Ich wollte nicht nachdenken, nicht durch dieses Schloss streifen, also legte ich mich in die nächstbeste Ecke und schlief ein. Vor dem Bett hatte ich Angst. Nicht nur, weil ich einundzwanzig Jahre lang auf dem Boden geschlafen und kein richtiges Bett gehabt hatte, sondern weil dieser Ort mein Misstrauen weckte.
Einundzwanzig Jahre lang hatte ich gewusst, wo und wer und weswegen ich gefangen war. Aber jetzt: Warum war ich hier? Mein Körper wusste nicht mehr, wie das war: sich von einem Zimmer in ein anderes zu bewegen. All die Gegenstände ringsum zerstörten meine Einsamkeit. Meine Welt war karg gewesen, schlicht, ohne Zierrat, schmucklos, eine Welt, in der ein Mensch nichts besitzt als seinen Schatten.
In dieser Zeit hatte ich erkannt, dass schmucklose Leere und Besitzlosigkeit die Schönheit des Lebens ausmachen. Der Sand führt uns zur wahren Essenz des Menschen, so, wie er ursprünglich ist, ohne künstliche Äußerlichkeiten. Sand und Himmel vervollkommnen die Seele und erweitern sich zum Universum. Hier aber war mir alles fremd und löste in mir unbeschreibliche Angst aus. In diesem Moment sehnte ich mich nach meinem leeren Leben. Leer von allen Schatten.
Nein, glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Als ich Saryasi Subhdam verließ, war er ein paar Tage alt. Damals wusste ich nicht, dass außer ihm noch ein Saryasi und noch ein Saryasi auf diese Welt kommem würden. Nein, glaubt nicht, dass ich im Gefängnis nicht an Saryasi Subhdam dachte. Glaubt nicht, ich wäre ein schlechter Vater, der nur den Sand im Kopf hatte. Aber wenn du einundzwanzig Jahre lang nichts als Sand siehst, dann wachst du eines Tages auf und bemerkst, dass sich alles in dir verändert hat. Du stehst auf und merkst, dass alle anderen Bilder aus deiner Erinnerung verschwunden sind. Ah, nichts kann unsere Erinnerungen so auffressen wie der Sand. Jeden Tag, wenn du aufstehst, merkst du, dass wieder ein Teil deiner Vergangenheit vergessen ist. Nein, Saryasi Subhdam vergaß ich nie. Ich vergaß die ganze Welt, nur Saryasi Subhdam nicht. Er war das Einzige, das in mir grün blieb und nicht zu Sand wurde. Über all die Jahre sah ich ihn jeden Morgen. Jeden Tag wuchs er in meinen Gedanken. Ich stellte mir Tausende Gesichter von ihm vor, jeden einzelnen seiner Gesichtszüge. Täglich schaute ich durch die Fenster und dachte an ihn. Ich nehme an, dass die rätselhaften Katastrophen rund um Saryasi Subhdam begannen, als ich anfing, ihm an den Morgen und Abenden in der Wüste neue Gesichtszüge und Gestalten zu geben. Mit jedem Jahr aber verblassten sie, weil ich letztlich ja nicht wusste, worüber ich mir Gedanken machte.
Ich konnte sorglos an diesen einen Menschen denken, den ich zurückgelassen hatte, denn ich war ja wie tot. Für die anderen war ich gestorben, die ganze Welt hatte mich vergessen. Der Gedanke, gestorben zu sein, während die anderen weiterleben und ihre eigenen Wege gehen, schenkt unendlichen Frieden. Dass niemand deine Rückkehr erwartet, fühlt sich an, als ob du im Paradies wärest. Nach den ersten sechs Jahren war ich mir ganz sicher, dass sich Saryasi an meine Abwesenheit und an meinen Tod gewöhnt hatte. Der Tod ist auch wie eine Gefangenschaft, man gewöhnt sich daran. Ein Mensch muss, wie andere Dinge auch, einen Raum eingenommen haben, damit man bemerkt, dass er nicht mehr da ist. Wie eine Vase auf einem Tisch oder die Stimme aus dem Radio auf einer Fensterbank. Sie müssen da gewesen sein, um verschwinden zu können. Aber wenn etwas von Anfang an nicht da ist, eine Stimme, oder eine Farbe, dann bemerkst du weder Abwesenheit noch Verschwinden. Wie ein Schlag erfasste mich damals die Erkenntnis, dass mein Leben in dieser Wüste ohne jegliche Verbindung nach außen Vollkommenheit erreichte. Ich und meine Umgebung, ich und dieses grenzenlose Nichts des Universums – das war Vollkommenheit.
Auch die Welt da draußen war in ihre eigene Vollkommenheit vertieft. Für sie war ich bedeutungslos. Ohne mich lief das Leben aufs Beste weiter. Mein Fernbleiben schlug keine Wunde ins Leben von irgendjemandem. Nach einundzwanzig Jahren war ich mir sicher, dass mein Sohn sein eigenes Leben lebte. Natürlich dachte er wie alle anderen, ich sei tot. Bis zum zehnten Jahr hatte ich nur eine Hoffnung: ihn für ein paar Minuten zu sehen und danach zu sterben. Aber eines Morgens wachte ich auf und hatte auch diesen Wunsch aufgegeben. Nach zehn Jahren des Getrenntseins wäre jedes Wiedersehen zu einem weiteren einander Verlieren geworden. Saryasi und ich waren nur in meiner Fantasie Vater und Sohn.
Eines Morgens, als ich das Altern des Sandes beobachtete, kam ich zu dem Schluss, dass aus mir nie ein echter Vater werden würde. Falls ich zurückkehrte, wäre ich ein Häufchen Sand, ein Niemand, der seine Hand auf etwas legt, das zu Staub zerfällt. Vater zu sein ist eine Umarmung, aber ich war wie eine Handvoll schwarzer Erde. Falls ich zurückkehrte, wäre ich ein Nichts aus der Wüste.
In jener Nacht, als ich nun wider Erwarten zurückkehrte, wusste ich nicht, wo mein Saryasi sich befand. Ich wusste noch nicht, dass wir zwei uns in einer anderen Art von Wüste verlieren würden. In einer Wüste, die weder meine war noch seine.
2
Es liegt einige Jahre zurück, dass Mohamadi Glasherz, einer, der gerne Geheimnisse lüftet, an einem Abend loszieht, um sich mit einem Antiquitätenhändler zu treffen. Es ist eine wichtige, bedeutungsvolle Begegnung. Ein Treffen, das möglicherweise Einblick in ein Geheimnis bringt. Der Abend ist regnerisch, die Wolken stehen drohend am Himmel. Mohamadi Glasherz aber kümmert das nicht, singend schlendert er vom nördlichen Teil der Stadt hinunter in den südlichen Teil. In seiner Hand hält er einen Schlüsselbund, den er an einem Anhänger kreisen lässt, und in seiner Tasche befindet sich ein gläserner Granatapfel. Er wirft seine Schlüssel in die Luft und fängt sie wieder auf. Gläserne Schlüssel, welche diesem Jungen die Türen in eine andere Wirklichkeit öffnen. An diesem Abend hält er sich für den glücklichsten Menschen der Welt.
Jeder kennt ihn. Jeder hat die Geschichten dieses jungen Mannes mit dem gläsernen Herzen, die Geschichte von jedem einzelnen Stück seiner gläsernen Antiquitätensammlung, die er zu Hause in Vitrinen und auf Ablagen hütet, schon gehört. In seinen Träumen sieht er den eigenen Tod. Kein Tag, an dem er nicht von seinem Todestraum erzählt. Wie sein gläsernes Herz zu Boden fällt und zerspringt.
An diesem Abend regnet es leise. Mohamadi Glasherz wirft einen Blick zum Himmel und bemerkt, dass er in seinem Leben noch nie so Furcht einflößende Wolken gesehen hat. Unbekümmert spielt er weiter mit den Schlüsseln zu den Traumtüren und singt vor sich hin. Es ist ein glücklicher Abend für Mohamadi Glasherz, denn einer seiner Schlüssel öffnet die Türen nur bei Regen, so glaubt er.
Ich habe Mohamadi Glasherz nie gesehen, kann mir aber vorstellen, wie er durch die Gassen schlendert und mit seinen Schlüsseln spielt. Er wirft sie von einer Hand in die andere, unter dem Bein durch und fängt sie wieder auf. Ich sehe vor meinen Augen einen glücklichen jungen Mann, der zum Himmel aufschaut und lacht, anstatt Angst zu bekommen. Erst seit Kurzem führt er ein Leben aus Glas. Nur er weiß, wie zart dieses Leben ist und wie schnell es zerbrechen kann. Aber unbekümmert spaziert er dahin. Sein Zimmer ist angefüllt mit seltsamen Vasen, Teekrügen, Kannen mit chinesischen Ornamenten, Gläsern mit Vogelmustern und Porzellantellern, die mit Drachen, Tigern und Feuervögeln verziert sind. Seine Vitrinen, sein Bücherregal, sein Tisch, sein Schrank, alles ist aus Glas. Auf einer Vitrine liegt eine blaue Glaskugel, auf der die ganze Welt abgebildet ist. Ein Atlas, der mich an die gläserne Welt erinnert, in der du und ich leben, mit ihrer verborgenen und unberechenbaren Bereitschaft, jederzeit zu zerbrechen.
Im leichten Regen spielt er mit seinem Schlüsselbund. Dass der Regen stärker und stärker wird, stört ihn nicht, im Gegensatz zu den andern Menschen, die eilends mit ihren Regenschirmen ins Trockene flüchten. Stetig wird dieser Regen stärker, und es wächst eine gigantische Flut, die alles auf der Straße mit sich reißt. Die Gassen und Gehsteige werden menschenleer. Alle flüchten in die oberen Etagen der Häuser, auf die Minarette und blauen Kuppeln der Moscheen, auf die Dachterrassen der Hotels, auf die Eukalyptusbäume, die Zypressen und die alten Maulbeerbäume. Nur Mohamadi Glasherz lässt sich sorglos, ohne unterzugehen, von der Flut durch die Gassen tragen, als würde ihn ein durchsichtiges, kleines Boot über Wasser halten. Mit überkreuzten Beinen und strahlendem Lächeln sitzt er auf der Wasseroberfläche und staunt über die Welt. Er sieht die Autos, Kleidungsstücke, Stühle und die Ertrunkenen, welche die Flut rechts und links an ihm vorbeitreibt. An der Wasseroberfläche sieht er die Eingeweide der Stadt, Abfälle, Autoreifen, Stapel ungelesener Bücher, Tabletts mit vorbereiteten Speisen, Haushaltsgeräte, ertrunkene Frauen in ihren schwarzen Umhängen und tote Männer, deren Hände noch ihre Hosentaschen umklammern, um das darin verwahrte Geld vor Nässe zu schützen. Als würde er auf einem Gebetsteppich sitzen, trägt die Flut Mohamadi Glasherz davon, zusammen mit all den Dingen und Leichen. Den Menschen, die ihn von den Dächern und Balkonen aus beobachten, winkt er lächelnd zu und wirft ihnen Kusshände hinauf. Er richtet sich lächelnd auf, als wolle er auf den Wellen, die ihn davontragen, ein Kunststück darbieten. Stehend wirft er seinen Schlüsselbund in die Luft und fängt ihn wieder auf. Das Wasser trägt ihn durch die Straßen und Gassen. Alle sind Zeugen dieses Wunders. Mohamadi Glasherz, wie er zwischen den Leichen spielt, auf die mitgerissenen Autos hüpft und wieder auf die Wasseroberfläche zurückspringt. Wie ein Artist jongliert er mit den Äpfeln und Orangen, die auf dem Wasser schwimmen, greift nach den mit Gold gefüllten Schachteln, welche aus dem Laden des Goldschmiedes gespült wurden, und wirft das Gold in die Reihen der Zuschauer. Der Anblick von Mohamadi Glasherz bringt mitten in dieser Tragödie alle zum Lachen.
Im strömenden Regen schwebt er durch die Gassen, als ob er ein verzaubertes Ruder hätte oder in einem von Gott gesteuerten Boot säße. Er fährt durch breite Straßen und enge Gassen, die mit Wasser aufgefüllt sind. Bei den Metzgerläden streicht er mit der Hand über die Schultern der geschlachteten Tiere, die an der Oberfläche treiben. Er macht ein Tänzchen mit den geschlachteten, abgezogenen Lämmern. Bei den Antiquitätenläden greift er nach einer dahintreibenden Silbervase und legt sie in seinen Schoß.
Bedächtig trägt ihn das Wasser von den überfüllten Straßen und Bazaren in die ruhigeren, stummen Stadtteile, in die engen, finsteren Gassen der Quartiere im Süden. Ins Gewirr der verlassenen, engen und verwinkelten Sackgassen, aus denen keine Stimme, kein Wispern zu hören ist. Hier hat der Wasserspiegel bereits die höheren Etagen und Dächer erreicht.
Schließlich, bei Anbruch der Dunkelheit, als auch der Regen sich beruhigt, führt das Wasser Mohamadi Glasherz nach seiner langen Reise vor das Tor eines zweistöckigen Hauses in einer Sackgasse. Er will auf dem Wasser umkehren, versucht verzweifelt, aufzustehen und über die Wellen zu einer anderen Gasse zu gelangen, aber ohne Erfolg. Mit unbezwingbarer Kraft tragen ihn die Wellen zu dem Tor, wo das Wasser zum Stillstand kommt. Eine tiefe Angst steigt in ihm auf. In aller Ruhe geht die Sonne unter, es wird dunkel, und die Wolken lösen sich leise auf. Schüchtern und still zeigt sich der Mond.
Plötzlich hört Mohamadi Glasherz einen Schrei, der aus seinem Herzen kommt. Ein Schrei, der ihm sagt: »Dieser Abend ist der Abend der Liebe!« Er greift in seine Tasche und holt seine Schlüssel hervor. Einer dieser Schlüssel ist der Schlüssel der Leidenschaft und seiner unerfüllten Liebe. Beklommen sperrt er das Tor auf. Als es aufspringt, spült ihn die Flut in den großen Hof eines alten, stattlichen Hauses. Wie jemanden, der um einen Tempel kreist, zieht ihn das Wasser im Kreis um das alte Haus herum. Er schaut in die Fenster und lauscht der unendlichen Stille der Wände.
In einem der Fenster erblickt er zwei weiß gekleidete Mädchen. Ihre langen Zöpfe baumeln im Wasser, während sie ihn aus einem Fensterspalt beobachten. Eines der Mädchen heißt Laulawi Spi, Weiße Winde, und das andere, die ältere der Schwestern, heißt Schadaryai Spi, Weißes Königsmeer. Er lässt sich vom Wasser zum Fenster tragen und begrüßt sie: »Guten Abend, ich heiße Mohamadi Glasherz. Die Flut führte mich hierher. Könnt ihr mir euer Fenster aufmachen?«
Laulawi Spi öffnet ihm das Fenster und bittet Mohamadi Glasherz herein, ohne zu wissen, dass sie damit das Tor zu einer Sturzflut auf ihr Leben aufmacht.
Mohamadi kommt herein und trägt nichts bei sich außer einer silbernen Vase, einem gläsernen Granatapfel und seinem Schlüsselbund mit Anhänger. Schon beim ersten Atemzug ist er sich sicher: Nun ist er in eine große, verworrene Liebe verwickelt. Bewundernd sieht er die beiden Mädchen an, die ihre langen Zöpfe hinter sich über den Teppich ziehen, wobei sich allerlei Dinge darin verfangen. Es wirkt, als würden die Zöpfe Wellen schlagen und sich dann wieder beruhigen. Noch nie hat er solches gesehen. Er, der Sohn von Slemani dem Großen, einem der bekanntesten Männer der Stadt, welcher nach der siegreichen Revolution alle die großen und gefährlichen Geheimnisse dieser Stadt kennt. Noch nie sah Glasherz solche Schönheit. Dabei ist er doch der Schlüsselmacher zu allen verschlossenen Türen. Bisher haben seine Schlüssel auch die schwierigsten Türen aufzusperren vermocht. In der Kunst des Aufdeckens von Geheimnissen ist er der Geschickteste.
An diesem Abend beginnt die Geschichte einer hoffnungslosen Liebe. Die beiden Schwestern machen mit offenen Seelen und reinen Herzen die Fenster ihres Lebens für Mohamadi Glasherz auf. Sie erkennen, dass er ein gutherziger, fröhlicher, junger Mann ist, der immer ein Lächeln im Gesicht trägt. Schon am ersten Abend sagt ihm Laulawi Spi: »Vergiss nicht, dass du nicht durch die Tür hereinkamst.«
Die beiden Schwestern kümmern sich an diesem Abend sorgfältig um Mohamadi Glasherz. Sie trocknen ihm Haare und Kleider, kochen Tee und sagen zu ihm: »Betrachte uns als deine eigenen Schwestern. Wir sind deine Schwestern.«
Darauf erwidert Mohamadi Glasherz freundlich: »Das ist nicht möglich. Ihr seid nicht meine Schwestern. Ich kam auf der Flut zu euch geritten, um mich in eine von euch zu verlieben. Der Regen schickte mich her, um mich in Laulawi zu verlieben.« In seiner Stimme liegt ein seltsamer Klang. Zärtlichkeit gemischt mit einem traurigen Tanz und einem Freudenschrei. Sein Blick ist voll Scheu und gleichzeitig Mut, gefüllt mit Lachen und Weinen, mit dem Hall des Windes, mit dem Klingen und dem Klirren von Glas.
Schadaryai Spi ist sich sicher, dass etwas Außergewöhnliches auf sie zukommt, als sie in die Augen des jungen Mannes blickt, den die Flut aus einem unerfindlichen Grund ihnen zugeführt hat. »Mohamadi Glasherz, wir kennen dich nicht«, sagt sie. »Gleich, ob die Flut, der Wind, der Regen oder der Wirbelsturm dich hierhergebracht haben, wir müssen dich erst kennenlernen.«
»Ihr müsst wissen, dass ich ein Herz aus Glas habe. Ein sehr zartes Herz, und selbst der kleinste Riss darin würde mich töten. Ich bin aus Glas. Wenn ich zerbreche, dann in kleine Splitter. Und wenn ich kleine Splitter hinterlasse, werde ich zu einem Toten, der Unglück bringt, und niemand wird wissen, dass der Grund für das Unglück in seinem Leben meine kleinen Splitter sind. Darum brecht mein Herz nicht.« In seinen Worten mischen sich Drohung und Bitte, Flehen und Furchteinflößen.
Der Abend verläuft ruhig. Die Schwestern erbitten von ihm den gläsernen Granatapfel, er aber sagt verlegen: »Das ist nicht mein Granatapfel, sondern der Granatapfel der Geheimnisse.« Stattdessen überreicht er ihnen zur Erinnerung die silberne Vase. Der Granatapfel sollte erst später auf einem anderen Wege in die Hände der weißen Schwestern gelangen. Die Vase gelangte einige Jahre später zu mir, und ich trage sie mit auf meiner Reise über das Meer.
Bis in die späte Nacht hinein lauschen die Schwestern den Geschichten von Mohamadi Glasherz. Schließlich verlässt er das Haus und die weißen Mädchen. Nun ist er so verängstigt und beunruhigt wie noch nie zuvor in seinem Leben. So durcheinander, dass er vergisst, Muzhday Schams, den Antiquitätenhändler, aufzusuchen. An diesem Abend ändert eine unbekannte Hand die Richtung von Glasherz’ Reise. Eine Reise, welche ich dann Jahre später fortsetzen muss. Eine Stimme flüstert ihm zu: Schlag diesen Weg nicht ein! Schmerz und Angst werden dich aus der Bahn werfen!
Draußen, die eisige Nachtluft sticht in seinen Lungen, kommt er zum Schluss, dass er nicht wegen seines außergewöhnlichen Glücks die Flut überlebt hat. Nein, sein Tod wurde damit nur hinausgezögert. Ein Tod, der später ein kleines Chaos unter seinen Freunden auslösen wird. Ein Tod, den einige als einen göttlichen Fluch ansehen und als eine Strafe für jene, welche die Geheimnisse lüften.
Als er das Haus der weißen Schwestern verlässt, weiß er nicht, wohin er sich wenden soll. Er verspürt zum ersten Mal einen tiefen Schmerz in seinem gläsernen Herzen. Die Spuren der Verwüstung sind überall zu sehen. Es sieht so aus, als sei die halbe Stadt zerstört. Gemeinsam mit Hunderten von Menschen machte er sich auf den Weg zum nördlichen Teil der Stadt. Platschend watet er durch Wasserlachen. Die Stadt ist Furcht einflößend, gespenstisch und finster geworden. Die Menschen gehen mit Taschenlampen durch die Straßen. Die Flut hat die Hälfte der Geheimnisse dieser Stadt in die Gassen gespült. Viele Wege sind durch aufgetürmte Gegenstände versperrt.
Mohamadi Glasherz geht, verborgen in der Menschenmasse, zu seinem gläsernen Zimmer zurück. In sich verspürt er ein seltsames Zittern. »Es ist Liebe, gewiss, das muss Liebe sein«, sagt er sich. Als er sein Zimmer erreicht, spürt er einen beängstigenden Sturm in seinem Leib, eine rätselhafte Bilderflut, die viel stärker ist als jene, die ihn am Abend mitgerissen hat. In seinem Traum wird er von einer weißen Welle mitgerissen, ein Weiß wie Milchschaum. Überall sieht er weiße Boote und weiße Wesen. Jeder überquert diese Flut, nur er nicht. Er sieht Menschen, die mit überkreuzten Beinen auf dem Wasser sitzen, aber er ertrinkt beinahe und wird davongerissen. In seinem Traum gelangt er vor das Tor eines weißen Schlosses, welches von einem weißen Meer umspült ist. Dort holt er seine Schlüssel hervor und will das Tor aufsperren, wie soeben am Haus der Schwestern. Doch nun gelingt es ihm nicht. Er versucht einen Schlüssel nach dem andern, aber vergebens. Seine Hände zittern, er muss sich beeilen, das Wasser zieht ihn langsam tiefer hinab bis auf seinen weißen Grund, und er beginnt zu schreien. Da erwacht er und sieht im ersten Augenblick um sich nichts als weißen Nebel. Ein tödlicher Schmerz bringt ihn zum Weinen.
Während dieses Traumes entsteht der erste Riss in seinem gläsernen Herzen. Was danach geschieht, steht im Schatten der Trümmer seiner Liebe.
3
Jakobi Snauber kam gegen Mittag. Er war allein, und wenn er sich nicht vorgestellt hätte, hätte ich ihn wohl nicht erkannt. Seine Stimme hatte noch jenen seltsamen Klang, er war ein wenig gealtert, aber immer noch imposant und stattlich. Er begrüßte mich kühl und förmlich. Ich hatte erwartet, dass wir uns beim Wiedersehen in die Arme fallen und gegenseitig beweinen würden. Aber weder umarmte er mich noch ich ihn.
Als würde er meine Ängste spüren, fing er an, in verwirrenden Sätzen zu sprechen: »Endlich bist du wieder bei uns. Nun bist du wieder einer von uns. In der elenden Wüste hat der Mensch endlos Zeit, sich Gedanken über Gott und die Welt zu machen, den Himmel, die Sonne und Sterne nachzudenken und den Sand zu beobachten. Aber hier, in diesem undurchdringlichen Wald, auf dieser üppigen Erde, wo jeder Baum ein Wunder ist, jeder Vogel Stoff zum endlosen Nachdenken gibt, wo ein ganzes Leben nicht reicht, um einen Menschen zu erforschen, macht uns die Erde zu Sklaven. Die Welt überwältigt uns mit ihren vergänglichen, kleinen, flüchtigen Dingen. Hier verliert sich der Mensch und vernachlässigt, was bedeutsam ist. Schätze dich glücklich, dass du aus einer Welt kommst, in der deine Gedanken bei der Tiefe des Universums und des Lebens waren.«
Er nahm meine Hand und führte mich in ein großes Zimmer, dessen Tür ich bis dahin noch nicht geöffnet hatte. Es war so teuer und luxuriös eingerichtet, wie ich es bisher noch nie gesehen hatte.
»Wundere dich nicht, alles hat sich geändert, jetzt regieren wir«, sagte er. Das Wort »regieren« hatte einen magischen Klang in seiner Stimme. Er ahnte wohl, dass ich keine Ahnung hatte von dieser neuen Welt. Er war der Einzige, der all die Jahre gewusst hatte, dass ich in Gefangenschaft und noch am Leben war. Mit der Schwermut eines Mannes, der von tiefem Leid spricht, sagte er zu mir: »Ich dachte oft an dich, sehr oft. Es war nicht einfach, dich zu finden, um dir die kleinen Briefe schicken zu können. Das hat mich viel Geld gekostet. Riesige Summen. Aber ich wollte dir zeigen, dass ich wusste, dass du am Leben bist. Dass ich dich nicht vergessen habe. Dass ich in Treue zu dir hielt.«
Jakobi Snauber wusste nicht, dass nach einundzwanzig Jahren Gefangenschaft alles Gerede über Treue oder Untreue sinnlos ist.
Er holte tief Atem. »Ich weiß, dass du nicht an jene Nacht denken willst. Das will ich auch nicht. Niemand außer dir und mir weiß, was damals geschah. Niemand. Ich trage seit einundzwanzig Jahren dieses Geheimnis in mir.«
Zum ersten Mal seit langer Zeit hörte ich mich lachen. »Mein lieber Jakobi, zwischen dir und mir gibt es keine Geheimnisse, kein einziges. Wie es geschah, musste es sein. Du warst der Anführer, du warst wichtiger als ich.«
Auch er lachte, aber wehmütig wie jemand, der tief in seinem Inneren einen großen Schmerz empfand. »Schon lange hat mich niemand mehr ›mein lieber Jakobi‹ genannt. Wie viele Jahre ist das her?«
Ich legte meine Hand auf die seine. »Einundzwanzig Jahre.«
»Stimmt, einundzwanzig Jahre … einundzwanzig.« Er wollte über jene Nacht reden, in der ich festgenommen wurde. Wir beide waren umzingelt in einem kleinen Haus. Wir wären entweder beide festgenommen worden, oder einer von uns musste vorne Widerstand leisten, bis der andere sich hinten hinaus in Sicherheit brachte. In jener Nacht umarmte ich ihn und sagte: »Ich bleibe. Ich gebe dir Deckung und lenke sie ab, bis du in Sicherheit bist. Wir werden uns nicht wiedersehen. Pass auf meinen Saryasi Subhdam auf.« Jahrelang summten diese Worte in meinen Ohren. Ich hätte mich in Sicherheit bringen können. Meine Chancen waren größer als seine. Aber er war der Anführer, und ich war einer seiner Stellvertreter, derjenige, der ihm am nächsten stand. Also war es meine Pflicht, alles zu opfern, damit er weiterlebte.
Vielleicht hatte er mich nicht mit einer Umarmung begrüßt, weil er gekommen war, um mir zu befehlen, dass ich in diesem Schloss bleiben müsse. Er sagte: »Reine und unschuldige Menschen können da draußen nicht überleben. Eine schmutzige Krankheit hat die Welt befallen. Eine namenlose Krankheit, die man nicht beschreiben kann. Du kannst sie Pest nennen, nenne sie, wie du möchtest, aber bleib hier, solange es möglich ist. Hier bist du am sichersten.« Er betrachtete mich kurz mit einem seltsamen Blick. »Verzeih, dass ich vorhin sagte, du wärest einer von uns. Du bist nicht mehr einer von uns, nein, du wirst nie wieder zu uns gehören. Du riechst noch nach Reinheit. Wenn du dich unter uns mischst in unserer Welt, dann weiß nur Gott, was mit dir passiert. Du bist keiner von uns und keiner von ihnen. Du bist Muzafari Subhdam und Schluss. Vergiss nicht: Du bist ein Toter. Außer mir weiß niemand, dass du noch am Leben bist. Ich selbst löschte deinen Namen aus. Ich wusch dich rein von jeglicher Schuld. Es gibt kein einziges Dokument mehr, in dem dein Name steht. In keinem Geschichtsbuch dieses Landes taucht er auf. Ich hielt dich von jedem Schmutz fern. Du existierst nicht. Muzafari Subhdam, das Leben da draußen ist nichts für dich. Ich drehte all die Geschichten und Ereignisse so, dass du nirgendwo vorkommst. Niemand wird dir glauben, niemand. Niemand weiß, dass du in jener Nacht mein Freund warst und dich für mich geopfert hast. Wer es wusste, ist entweder tot oder ausgewandert oder kann sich an nichts erinnern.« Seine Stimme war sanft.
Ich verstand nicht recht, was er sagte. So war es schon immer gewesen. Man wusste nie sicher, wovon er sprach. Er war in der Lage, jede seiner Sünden als Barmherzigkeit und Großmut darzustellen. Wenn er auftauchte, brachte er eine tiefe Stille, eine merkwürdige Ruhe und Traurigkeit mit sich. Und wenn er wieder ging, wurdest du nachdenklich. Er regte alle zum Nachdenken an. Sogar die Blumen, die Vögel, und die Bäume dachten nach, nachdem er fort war. Seine ruhige, tiefe, dunkle Stimme verwirrte einen, so, als würde man sich trunken in dunkler Nacht in einem Labyrinth verirren. Wenn er sprach, hatte ich ständig das Gefühl, mich zwischen Gärten, Brunnen und Blumenteichen zu verlaufen. Ein seltsam belebender Lufthauch schien von ihm auszugehen, wenn er redete. Als würde der Wind die Gischt eines weit entfernten Wasserfalls zu dir tragen. Als würdest du unter einem Baum schlafen und von einer Brise wach geküsst werden. Es strömte aber auch ein dunkler Hauch aus seinen Worten, die dich auf eigenartige Weise dazu brachten, dich in dir selbst zu verlieren. Er hinterließ jedes Mal einen tiefen Riss in den Dingen. Etwas wanderte aus ihm zu dir und blieb in dir. Am Anfang schien es sanft, zart und harmlos wie der Flug einer Nachtigall von einem Garten zum anderen, wie das Herunterschweben eines Blattes von einem hohen Ast. Aber wenn er wegging, hinterließ er einen Schmerz wie von einer Dolchwunde, einen unbeschreiblichen Schmerz, wie er zwischen Menschen entsteht, wenn sie sich nicht verstehen. Einen Schmerz aus Leid, Zweifel und Verunsicherung. Ich hatte das Gefühl, dass immer, wenn er einen Ort aufsuchte, jedes Wesen dort für einige Nächte nicht mehr schlafen konnte. Ja, wenn er gegangen war, bemerkte ich, dass Vögel, Bäume und Blumen einige Nächte danach schlaflos waren.
Einige Jahre lang hatte er mich auf diese Weise verwirrt. Als ich ihn an diesem Morgen wiedersah, geschah es erneut. Er schien sogar noch stärker, hartherziger und gleichgültiger zu sein als früher. Ich fragte mich, was er von einem zerstörten Menschen wie mir, der keine Zukunft hatte, wollte, und wieso er mich in diesem Schloss einsperrte. Ich sagte: »Lieber Jakobi, mich kann nichts mehr zerstören. Ich bin auch auf der Suche nach dem großen Vergessen. Einundzwanzig Jahre im Sand. Tag und Nacht versuchte ich, meine Erinnerungen auszulöschen. Ich bin viel zu schwach, um meine Freiheit zu leben. Sei unbesorgt, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Die Wüste lehrt einen, sein Verlangen zu unterdrücken, man wird bedürfnislos. Meine Seele ist die eines Zahid, eines Eremiten, der seine Bedürfnisse durch das Beobachten des Wüstensandes stillt.«
Obwohl viele Jahre Anführer, war sein Verhalten normal geblieben. Er konnte spotten, ohne herablassend zu wirken. Er legte seine Hand auf die Stirn und sagte: »Für mich warst du schon immer ein Derwisch.«
Es war eine bittere, unerbittliche Tatsache: Mir reichte die Wüste. Doch sie war jetzt so weit! Was sollte ich mit dieser plötzlichen, geschenkten Freiheit anfangen, die ich nicht gesucht hatte?
Jakobi Snauber schien meine Gefühle zu ahnen. Mit seiner einzigartigen, tiefen Ruhe sagte er: »Die Freiheit tötet uns. Wenn wir nicht aufpassen, bringt sie uns um.« Nach einer kurzen Pause fügte er mit einem durchdringenden Blick hinzu: »Ich weiß nicht, wo ein Asket hingehen muss.« Uns beiden war klar, dass ich mich verlieren würde. Er machte sich Sorgen um mich. Er machte sich Gedanken um alles und jeden. Ich fühlte, dass auch er sich in diesem kalten, fremdartigen Garten verlor. Er sah in mir einen, der sich von der Vergangenheit befreit hatte.
»Ich freue mich darüber, dass niemand weiß, dass ich am Leben bin«, antwortete ich. »Ich habe keine Erwartungen mehr. Jakobi Snauber, niemand schuldet mir etwas. Aber sag mir doch, wieso hast du mich in dieses Haus gebracht? Warum sehe ich hier niemanden?«
Er überlegte kurz. »Wieso ich dich in dieses abgelegene Haus in der Wildnis brachte? Eine schwierige Frage.«
Ich blickte auf seine Hände und wusste, dass er die Wahrheit sagte. So war es schon immer gewesen. Wenn er sprach, schaute ich ihm nicht ins Gesicht, sondern auf die Hände. Er hatte eine große Fähigkeit, mit seiner Mimik zu spielen. All die anderen konzentrierten sich auf seinen Gesichtsausdruck, deshalb war es für sie schwierig herauszufinden, ob er die Wahrheit sagte oder log. Ich wusste als Einziger, dass man ihm auf die Hände schauen musste, wenn er sprach. Jetzt verrieten mir seine Hände, dass er die Wahrheit sagte. Er konnte mir tatsächlich nicht erklären, warum ich mich hier aufhalten musste. Er wiederholte immer wieder nur: »Es ist die Pest … Eine tödliche Krankheit, der du dich nicht widersetzen kannst.«
Ich beobachtete ihn, während er im Zimmer auf und ab ging, und bemerkte, dass er froh war. Mit mir konnte er all die alten Erinnerungen vor dem Vergessen retten. Ob ich frei war, kümmerte ihn nicht. In gewisser Weise waren wir uns ähnlich. Auch er war tief in seine Träume versunken, die alten und seltsamen Träume unserer Jugendzeit. Nur hatte ich, im Gegensatz zu ihm, diese Welt in mir gelöscht. Wir hatten zwei unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Ich war in die große Wüste gegangen und er in ein Leben voll Chaos und Reichtum. Und nun trafen wir uns wieder an einem Punkt am anderen Ende unserer Wege.
Viel später, als ich ihn woanders und unter ganz anderen emotionalen Umständen wiedertraf, wurde mir noch bewusster, wie sehr wir uns ähnelten, dass ich ein schlafender Teil von ihm war, der aufgewacht war und nun nicht mehr einschlafen wollte. Als ob er in meine Seele blickte, sagte er betrübt: »Manchmal sind sich Sieg und Tod ganz nahe.« Er behandelte mich wie einen Geist, wie einen Toten. Er hatte mich überall ausgelöscht, nur in seinen Erinnerungen nicht.
Er sah mich anerkennend an und sagte: »Ich möchte mit dir über den Tod reden.«
Widerwillig erwiderte ich: »Ich kehre nicht von den Toten zurück.«
In aller Ruhe nahm er eine Zigarette, zündete sie an und legte sie auf einen silbernen Aschenbecher, ohne einen Zug davon zu nehmen. Wie um mich zu trösten, sagte er: »Wir beide kehren in gewisser Weise vom Tod zurück. Die Wüste und die Politik sind eins. Zwei Felder, auf denen nichts wächst.« Er stellte sich ans Fenster. Es war, als würde er zu etwas sprechen, das in weiter Ferne lag. Etwas außerhalb unserer Existenz. Aufgewühlt, unruhig, wie an einer tiefen Wunde leidend, sagte er: »Muzafari Subhdam, mein Gefährte, ich kann dich nicht wieder in das schmutzige Leben werfen. Dort gehörst du nicht hin. Du bist nicht einer von uns.«
Er sah mich außerhalb von Raum und Zeit, fern von allem Geschehen, in einer anderen Welt. Und jetzt wollte er mich in seinem imaginären Königspalast festhalten. Er baute mir eine Welt auf, die seinen Erinnerungen entsprach. Gedankenverloren sagte er: »Hier können wir alt werden. Du und ich. Und die Welt da draußen beobachten und nachdenken. Hier wird dein und mein Platz sein. Gemeinsam werden wir uns von allem lösen. Wir werden zu zwei Asketen. Tag und Nacht werden wir uns über die Sterne, die Bäume und die Vögel unterhalten. Es wird der Tag kommen, an dem wir ihre Sprachen lernen. Wir werden gemeinsam unsere verbliebene Zeit dafür nutzen, die Blumen zu verstehen, die seltsamen Lichter zu verstehen, die nachts aus der Ferne kommen. Wir werden uns unseren Seelen zuwenden. Du sollst die Reinheit deiner Seele, so wie sie ist, bewahren, und ich werde alles geben, um meine zu reinigen.«
Bei diesen Worten geschah es zum ersten Mal nach langer Zeit wieder: Die Vorhänge begannen zu zittern, die in der Luft schwebenden Blätter veränderten ihre Richtung, die Vögel flogen auf, und eine plötzliche Stille verschleierte die Welt.
Entmutigt ließ er den Kopf hängen und sagte mit einem sarkastischen Lächeln: »Erinnerst du dich, mein Lieber, was wir beschlossen für den Fall, die Revolution würde gelingen? Wir wollten uns zurückziehen, ein einfaches, reines Leben führen, die Natur genießen. Ja, all unsere Kraft dafür einsetzen, die Schönheit der Rose, der Nacht, all die verborgenen Schönheiten der Dinge auszukosten.«
»Ich erinnere mich an nichts«, erwiderte ich. »An gar nichts. Ich arbeitete hart daran, alles in mir zu löschen. Sonst hätte mich die Wüste umgebracht. Der Wüste zahlst du einen hohen Preis auch für die kleinste und unbedeutendste Erinnerung, mein lieber Jakobi. Es hat lange gedauert. Nacht für Nacht saß ich da, und als würde ich eine Operation am Herzen eines Spatzen vornehmen, zog ich alles aus meinem Kopf heraus. Als würde man in den Tränen eines Vogels, Stück für Stück, den Glanz löschen. Nach einundzwanzig Jahren Gefangenschaft im Wüstensand sind die Erinnerungen weg. Es geht nicht mehr, verstehst du? Alles ist im Sand versunken.« Bei diesen Worten legte ich den Kopf in meine Hände und begann zu weinen. So wie ich es in den kalten Nächten in der Wüste getan hatte. Er konnte mich nicht verstehen, aber auch er senkte den Kopf in seine Hände und weinte.
Aus welchem Grund wir weinten, wusste ich nicht. Still wischten wir uns die Tränen ab und sahen einander mit kaltem Blick in die Augen. Meine Augen waren wie die Augen eines Vogels, die durch das Betrachten des weiten gelben Horizontes verbrannt waren. Seine Augen waren die eines Wolfes, der des Spielens überdrüssig war.
Für einen Augenblick spürte ich, dass er nicht wusste, wie wir weitermachen sollten. Auf seine eigenwillige, gelassene und umsichtige Art gab er mir zu verstehen, dass ich gefangen war. Hart und ohne Erbarmen sagte er: »Du bleibst hier. Dies ist der Ort, von dem wir jahrelang träumten. Wenn du hier weggehst, beginnst du eine Suche nach etwas, das du ein Leben lang nicht finden wirst. Die Wüste schenkte dir etwas. Die Einsamkeit gab dir etwas Tieferes und Bedeutungsvolleres, als mir gegeben wurde. Wenn du hinausgehst, wirst du nichts finden, nichts. Die Welt draußen ist in alle Himmelsrichtungen zersprengt, und niemand kann ihre Teile wieder einsammeln.« Er wiederholte: »Komm nicht heraus, um Dinge zu suchen, die du nicht finden wirst.«
Nun wollte er gehen, aber ich hielt ihn an der Tür zurück. »Mein lieber Jakobi, wer solche Gefangenschaft überlebt, kann auch die Last der Freiheit ertragen. Ich bin nicht tot. Ich muss verstehen und wissen, dass ich lebe. Jahrelang kämpfte ich Tag für Tag ums Überleben. Jede Nacht sah ich die Geister und schrie: »Ich lebe, ich lebe noch!« Nein, mein Gefährte, mein Anführer Jakobi. Zwischen uns steht weder eine offene Rechnung noch ein Traum. Nur eine Sache steht zwischen uns, nur eine ungeklärte Sache: Sag mir, wo ist Saryasi Subhdam?«
Damit öffnete ich den Fluten das Tor.
4
Vor langer Zeit hatten Laulawi und Schadaryai Spi gegenseitig einen ewigen Schwur abgelegt. Sie würden ihr Leben lang nicht heiraten, sich ihre Haare nie schneiden, sich ausschließlich in Weiß kleiden, und keine von ihnen würde je ohne die andere singen. Diese Abmachung trafen sie vier Jahre vor jenem Abend, an dem die Flut Mohamadi Glasherz zu ihnen trug.
Im Hause der beiden Schwestern brach eine Art Wettstreit der Lieder aus. Die Schwestern waren vierzehn und fünfzehn Jahre alt. Beide waren heimlich und kindlich verliebt. Tag und Nacht sangen sie vor sich hin. Die einzige Schwierigkeit, die zwischen den Schwestern stand, war, dass sie immer gleichzeitig sangen, aber zwei unterschiedliche Lieder. Dieser etwas verstörende Wettstreit schien endlos. In manchen Nächten sangen sie so lange gegeneinander an, bis ihre Kehlen bluteten. Die Sonne ging auf und wieder unter, und sie trällerten immer noch gegeneinander bis zur Erschöpfung, wie zwei dickköpfige, unbarmherzige Kämpferinnen. Doch dann verstummten sie gleichzeitig auf einen Schlag, ohne dass eine von ihnen aufgab, und fielen ohnmächtig und halb tot auf ihre Betten.
An einem Abend dieses endlosen Wetteiferns wurde Schadaryai krank. Es war eine Krankheit, die sie an den Rand des Todes brachte. Nur Laulawi wusste, woran Schadaryai im Innersten litt: Es steckte eine unerfüllte Liebe in ihr. Es war im Spätherbst, Schadaryai war im Krankenhaus und wurde in einem weißen Hemd auf einer Bahre zu einer schweren Operation gebracht. Der Morgen war trüb, die ganze Nacht hindurch war Sand vom Himmel gefallen. An diesem Morgen würde Schadaryai ihr Leben in die Hände der Ärzte legen, die ihr weder Hoffnung auf Leben noch Tod machen konnten. Doch zuvor musste Laulawi zu ihr gehen, sie um Verzeihung bitten und sie beweinen. Die ganze Nacht hatte sie kein Auge zugetan. Tränenüberströmt und von Schluchzern geschüttelt, kam sie im Krankenhaus an.
Schadaryai erwartete sie bereits in ihrem weißen Hemd. Weinend fielen die Schwestern sich in die Arme und legten den Schwur ab, bis zu ihrem Tod beieinanderzubleiben, die gleiche Kleidung zu tragen, sich niemals die Haare zu schneiden und gemeinsam das gleiche Lied zu singen. Diese Versöhnung wühlte sie so auf, dass sie noch größere Versprechen abgelegt hätten, wäre Schadaryai nicht von den Pflegern weggetragen worden. Die Hände der beiden lagen ineinander bis zur Tür des Operationssaales. Und bevor sie hineingebracht wurde, sagte Schadaryai zu Laulawi: »Schwöre mir für immer, dass du diesen Eid nie brichst.«
Laulawi antwortete unter Tränen und sich gegen ihre aufgewühlten Gefühle stemmend: »Ich schwöre, dass ich nie heirate, nie ohne dich singe und mir die Haare nie schneide und immer nur weiße Kleider trage.«