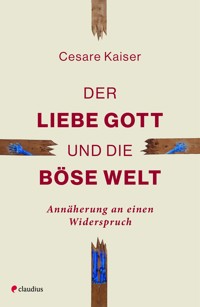
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Claudius Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie kann ein allmächtiger und guter Gott das Leid in der Welt zulassen? Immer wieder ringen Menschen mit dieser Frage. Cesare Kaiser wagt es, sich dieser Grundsatzfrage auf seine eigene Weise zu stellen. Fundiert, aber jenseits aller theologischen Worthülsen und mit unverwechselbarer Originalität denkt er über die sogenannte „Theodizee-Frage“ nach. Viele bisherige Antwortversuche sind ihm zu fromm oder zu einfach. Fragen helfen oft eher weiter als Antworten, findet er. Und er weiß, wovon er spricht, denn er ist nicht nur als Krankenhausseelsorger tagtäglich mit dem Leid der Menschen konfrontiert, sondern als unheilbar an Multipler Sklerose Erkrankter auch selbst betroffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wie kann ein guter und allmächtiger Gott das Leid in der Welt zulassen? Immer wieder ringen Menschen mit dieser Frage. Cesare Kaiser wagt es, sich dieser Grundsatzfrage auf seine eigene Weise zu stellen. Jenseits aller theologischen Worthülsen und mit unverwechselbarer Originalität denkt er über die sogenannte Theodizee-Frage nach. Viele bisherige Antwortversuche sind ihm zu fromm oder zu einfach. Fragen helfen oft eher weiter als Antworten, findet er. Und er weiß, wovon er spricht, denn er ist nicht nur als Krankenhausseelsorger tagtäglich mit dem Leid der Menschen konfrontiert, sondern als unheilbar an Multipler Sklerose Erkrankter auch selbst betroffen.
Cesare Kaiser, Jahrgang 1964, war nach dem Studium der evangelischen Theologie zunächst als Gemeindepfarrer in und um München tätig. Gleichzeitig begann eine rege Ausstellungstätigkeit als bildender Künstler. Seit 2012 wohnt er mit Frau und vier Kindern in Schwabach und arbeitet dort vor allem als Krankenhausseelsorger.
www.cesare-kaiser.de
Cesare Kaiser
DER LIEBE GOTT UND DIE BÖSE WELT
Annäherung an einen Widerspruch
© Claudius Verlag München 2025
Claudius Verlag im Evangelischen Presseverband für Bayern e.V.
Birkerstraße 22, 80636 München
Tel. 089/12172-119
www.claudius.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden. Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44 UrhG vor, was hiermit Dritten ohne Zusimmung des Verlages untersagt ist.
Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt, München
unter Verwendung von Motiven aus dem Bild „Verlust der Mitte“ von Cesare Kaiser
Seite 128: Cesare Kaiser, Verlust der Mitte / Kreuz in der Christuskirche
Bayreuth / Foto: Christian Böhm, Bayreuth
Lektorat: Stenger & Rode GbR, München
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2025
ISBN 978-3-532-60137-2
Inhalt
Einleitung: Eine große Frage
Der liebe Gott und die böse Welt – passt das zusammen?
Warum interessiert mich persönlich die Frage?
Wo bleibt die Gerechtigkeit?
Wie viel Gott darf es denn sein?
Einer allein macht es komplizierter
Buchstäbliche Schwierigkeiten
Vordenken und Nachdenken
Grundlegendes
Beziehungsweisen
Göttliche Beziehungen: Zu dritt sind sie eins
Nachwort: Beziehung macht weise!
Exkurse
Einleitung: Eine große Frage
Über die Frage, wie der gute Gott und die böse Welt zusammengehören, haben sich schon viele Menschen Gedanken gemacht. Es gibt für dieses Problem sogar ein eigenes Fremdwort: „Theodizee“. Das ist Griechisch und bedeutet „die Gerechtigkeit Gottes“. Auch wenn die Frage nach dem gerechten Gott schon intensiv gestellt wurde, ist bis jetzt keine eindeutige Antwort gefunden worden.
Das wird auch mit folgendem Buch so bleiben müssen, da ich mir nicht anmaße, Gott vollständig begreifen zu können. Dennoch versuche ich, der Frage möglichst nahe zu kommen, indem ich vorhandene Antworten miteinander vergleiche und auswerte. Dabei bin ich weiter gekommen, als erwartet. Den (Ent-)Schluss am Ende muss aber jeder für sich selbst ziehen. Auf jeden Fall kann es dann gelingen:
Dem
Theodizeeproblem endgültig gelöst
entgegenzusehen!
Wenn ich oft von „Gott“ rede, meine ich kein männliches Wesen, im Gegensatz zur weiblichen „Göttin“. Mir ist bewusst, dass das Fehlen einer geschlechtsneutralen Bezeichnung wirklich ein Verlust ist, da ich damit männliche Assoziationen wecke. Das ist ausdrücklich nicht gewünscht, zumal der mir bekannte Gott eine Beziehung wie „Vater“ und „Mutter“ anstrebt. Die Formulierung „Das Göttliche“ ist mir aber zu unpersönlich und daher keine Alternative – in dieser Beziehung bleibt Gott hier „Gott“, ohne männlich zu sein!
Der liebe Gott und die böse Welt – passt das zusammen?
Wahrscheinlich kann man Bibliotheken füllen, wenn man Gründe zusammenschreiben will, die gegen die Existenz eines „guten Gottes“ sprechen. Die Liste von Katastrophen, von Unglücken und Ungerechtigkeiten, von Mord und Totschlag hat kein Ende.
Aber nicht nur der Zustand unserer Welt weckt Zweifel an der Existenz eines guten Gottes. Gerade diejenigen, die an einen guten Gott glauben, machen es oft nicht einfach, diesen Glauben zu teilen. Manche tragen wenig zur Glaubwürdigkeit eines Gottes bei, einige Glaubensformen wecken sogar eher Zweifel als Zuversicht. Die zahlreichen, zum Teil bis in die Gegenwart andauernden Religionskriege, die schaurigen Hexenverbrennungen und andere Untaten religiöser Eiferer liefern hier ausreichend „zweifelhaftes“ Material.
Aber es braucht für den Zweifel am „lieben Gott“ gar nicht unbedingt die Fehler des religiösen Bodenpersonals. Auch die nicht religiös motivierten Kriege und Streitigkeiten lassen die Frage laut werden, ob es denn einen himmlischen Friedensstifter gibt und wo der denn bleibt. Gerade diese Erfahrungen von Ungerechtigkeit, sinnlosem Tod und Leiden machen es schwer, an einen liebevollen Gott zu glauben.
Bei selbstgemachten Unglücken können wir einen „lieben Gott“ noch entschuldigen, indem wir unsere menschliche Freiheit anführen: Wir sind frei, zu machen, was wir wollen, und unser Tun ist nicht fremdgesteuert oder vorherbestimmt. Diese Freiheit schließt eben auch die Freiheit zu Untaten, Tod und Zerstörung ein. Gott ist damit aus der Verantwortung, ihm kann man nur noch vorwerfen, ein wenig zu passiv zu sein. Aber was ist mit den Katastrophen, bei denen der Mensch keinen direkten Einfluss hat?
Da ist schon der Zustand unserer Welt eine Anfrage: Warum ist unsere Welt ein so labiles Konstrukt, dass wir Menschen es in so kurzer Zeit schaffen, unsere Umwelt zu einem Kollaps zu führen? Unser Planet stellt uns ausreichend Brennstoff zur Verfügung, und am Ende werden wir alle dafür zur Verantwortung gezogen, dass wir dieses Angebot auch angenommen haben. Dabei hat uns vorher keiner davor gewarnt! Ist das nicht unfair? Wer auch immer diese Erde gemacht hat, ein wenig robuster und stabiler hätte er/sie schon konstruieren können!
Und wie erklären wir uns Naturkatastrophen, wie zum Beispiel Erdbeben, bei denen wir Menschen gar keine Mitverursacher sind? Am 1. November des Jahres 1755 hat ein Erdbeben in Lissabon mit Zigtausenden von Toten bei vielen Menschen die Frage nach einem gerechten Gott ausgelöst. Ganz offensichtlich konnte hier kein Mensch verantwortlich gemacht werden. Schuld an diesen Massen von Toten konnte nur ein höheres Wesen sein. Ob wir das dann Gott oder anders nennen, ist dabei ohne Bedeutung. Damals wurde vielen Menschen deutlich: Es gibt nicht für alles einen haftbar zu machenden, schuldigen Menschen. Ein bisschen Verantwortung bleibt schon bei einem eventuell vorhandenen Gott hängen!
Wer davon ausgeht, dass es einen Gott oder eine höhere Macht gibt, bleibt zwangsläufig mit der Frage zurück: Warum sorgt dieser nicht für eine bessere Welt? Die Alternative könnte nur sein: Wir gehen eben davon aus, dass es Gott gar nicht gibt. Das würde manches erklären …
Wer an einem Gott festhalten will und sich dieses Buch besorgt hat, um eine ultimative Antwort auf diese Frage nach der göttlichen Gerechtigkeit zu bekommen, hat leider einen Fehlgriff getan. Denn nach menschlichem Ermessen ist eine solche Antwort nicht möglich, ohne dass aus dem lieben Gott ein lieber Bekannter wird, der um die Ecke wohnt. Er wäre damit gut durchschaubar und berechenbar, hätte aber nur wenig Göttliches an sich.
Doch es ist mir auch zu einfach, mit dem Hinweis auf höhere göttliche Gewalt hier ein Denkverbot zu verhängen. Schon das Interesse an der Frage, wie der Zustand der Welt mit einem Gott zusammengehen soll, verdient meiner Meinung nach den Versuch einer Antwort.
Die Lösung „Der liebe Gott wird’s schon wissen“ bleibt mir im Halse stecken, wenn es um das Sterben und den Tod von jungen Menschen geht. Bei einem Krieg oder einem Unfall mag man noch einen Menschen finden, dessen Verhalten hier schuld ist. So kann man dann vielleicht auch den eigenen Gott entschuldigen.
Aber spätestens dann, wenn unerklärbare Krankheiten den Tod von Kindern verursachen, bleibt ein großes Fragezeichen beim „lieben Gott“! Bei einem sinnlosen Tod, noch dazu in jungen Jahren, wird nie wieder „alles gut“!
Ich selbst musste diese Erfahrung noch nicht machen – Gott sei Dank! Aber in den vergangenen Jahren bin ich vielen Menschen begegnet, denen so etwas nicht erspart geblieben ist. Deren Erlebnisse und Erfahrungen sind mir deutlich vor Augen. Ein „Augen zu, da muss man eben glauben“ wird ihnen nicht gerecht. Eine solche Aufforderung ist unsensibel und unbarmherzig! Es gibt Wunden, die weder erklärt noch geheilt werden können.
Wir werden mit offenen Augen die Probleme der Frage nach einem „guten Gott“ anschauen müssen und manchmal auch ganz genau hinblicken, um manches „einsehen“ zu können. Bei meinem Nachdenken ist mir wichtig, dass Gott Gott bleiben kann, ohne dass er ein berechenbarer Marionettenspieler wird, der die Puppen tanzen lässt. Es ist damit auch im Vorhinein klar, dass ich als Mensch Gott nie ganz begreifen kann. Denn dann hätte ich ihn auch im Griff, er wäre völlig berechenbar. Wenn wir ihn völlig zu Ende denken könnten, kämen wir zu einem menschlichen Gedankenprodukt, das uns mit unseren Gedanken ziemlich alleine lässt.
Der Vorteil wäre allerdings, dass wir niemanden mehr hätten, dem wir die Mängel unserer Welt in die Schuhe schieben könnten. Denn wenn wir keinen Schuldigen finden, wächst bei uns vielleicht die Bereitschaft, an einer besseren Welt mitzuarbeiten. Wenn weder „der oder die da oben“ noch die anderen schuld sind, müssen wir vielleicht eher selbst etwas tun. Es ist aber die Frage, ob das wirklich hilft, um unser eigenes Engagement an einer Besserung der Welt zu erhöhen.
Im Folgenden will ich bei der Suche nach einer Antwort nicht auf die „Arbeitshypothese Gott“ verzichten, auch wenn das manchmal einfacher zu sein scheint. Auch einen anderen Ausweg, um schneller zu einer Antwort zu kommen, will ich nicht nehmen: Nämlich die Verschiebung eines gerechten Ausgleichs in eine ferne Zukunft. Die Schrecken und Katastrophen dieser Welt will ich ernst nehmen, ohne dass sie als zeitlich begrenzte Probleme auf die Seite gewischt werden. Die Erklärung der gegenwärtigen Probleme durch einen zukünftigen himmlischen Ausgleich scheint mir die gegenwärtige Notlage mancher Menschen nicht ernst genug zu nehmen! Eine versprochene Wiedergutmachung in einem zukünftigen Paradies würde die gegenwärtige Lage zu einem unbedeutenden Moment machen, über den es eigentlich nicht zu reden lohnt. Das gegenwärtige Leben würde dann belanglos – und das halte ich für keine geeignete Wertschätzung meines Gegenübers.
Um vorschnellen, nicht zu Ende gedachten und zu einfachen Antworten zu entgehen, ist es nötig, dass wir uns auf einen längeren Weg begeben, bei dem möglichst nichts übersehen wird. Wir werden auch manche Nebenwege verfolgen und dabei manchmal ein wenig vor- und zurückspringen müssen. Gradlinig, kurz und einfach lässt sich die Frage nach Gott und der Welt nicht beantworten. Auch wenn unser Weg nicht für jeden zu einem Antwortversuch führen sollte, werden wir auf jeden Fall in Zukunft hoffentlich vorschnelle Antworten besser erkennen und einordnen können. Wer beim Lesen zu anderen persönlichen Antworten kommt, kann diese auf jeden Fall besser durchdenken. Das wäre doch auch schon ein Gewinn! Es bleibt schwierig, aber nicht hoffnungslos.
Die Existenz dieses Buches zeigt, dass ich durchaus der Meinung bin, dass es sich lohnt, sich hier Gedanken zu machen. Hoffentlich können wir dann:
Uns selbst besser erkennen,
unsere Welt besser verstehen
und vielleicht sogar einen Gott besser erahnen!
Warum interessiert mich persönlich die Frage?
Ich bin Theologe und denke über Gott und die Welt nach
Es ist wohl schon deutlich geworden, dass sich die Frage nach einem guten Gott nicht so objektiv wie ein mathematisches Problem lösen lässt. Es braucht da schon ein wenig persönliches Engagement. Daher halte ich es für sinnvoll, erst einmal zu erklären, was mich als Autor zu der Beschäftigung mit dem Thema gebracht hat. Denn bei diesem Thema gibt es wohl keine völlige Objektivität. Da ist es nur fair, wenn ich meine Grundlagen offenlege. Mancher Gedankengang mag vor diesem Hintergrund leichter zu verstehen – im ungünstigen Fall abzulehnen sein!
Schon aufgrund meiner Profession als evangelischer Pfarrer bin ich nicht unparteiisch. Die Sache mit Gott beschäftigt mich schon seit über dreißig Jahren. Das hat aber auch entscheidende Vorteile, denn zu einem Theologiestudium gehört die Kenntnis der Geschichte der Kirche. Und die ist durchaus keine Geschichte, die sich stets nur positiv entwickelt hat. In der Vergangenheit hat man nicht nur ständig dazugelernt, sondern auch fast jede mögliche Sackgasse und viele Irrwege ausprobiert. Zum Teil waren das nur akademische Streitigkeiten, zum Teil erwuchsen daraus auch ganz handfeste Kriege mit all ihren entsetzlichen Folgen. Die Kenntnis dieser Geschichte ist daher hilfreich – nicht um ein besserer Historiker zu werden, aber um Wiederholungsfehler zu vermeiden. Wir müssen nicht jeden Fehler der Geschichte noch einmal machen!
Die Sache mit dem guten Gott und der bösen Welt hat die Menschen zu allen Zeiten beschäftigt. Die Theologen haben dafür sogar ein schlaues Fremdwort entwickelt. Sie nennen es die Frage der „Theodizee“, denn so lautet auf Griechisch die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Die Theologie ist also dieser Frage nicht ausgewichen, sondern hat versucht, Antworten zu finden.
Das Studium der Theologie hat den Vorteil, dass man sich immer wieder bei den Gedanken schlauerer Köpfe bedienen kann. Der eigene begrenzte Zeit- und Denkhorizont kann damit enorm erweitert werden. Als Pfarrer bekomme ich Zeit zur Verfügung gestellt, diese theologischen Gedanken mit unserer Weltsituation zu verbinden. Ein Privileg, das ich sehr genieße und dessen Früchte ich gerne teile.
Meine Arbeit als Pfarrer hat viel mit den Grenzen des Lebens, mit Geburt (Taufe) und Tod (Beerdigung) zu tun. Daher habe ich auch viel mehr Möglichkeiten und Notwendigkeiten, diese Gedanken fortzuführen, als der „Normalbürger“.
Aufgrund meines Berufes werde ich sicher viele Beispiele aus dem christlichen Bereich heranziehen, weil sie mir näherstehen. Sie stehen aber nur als Beispiele menschlichen Verhaltens da und nicht als unfehlbares göttliches Wort. Dennoch muss ich an dieser Stelle zugeben, dass es mir als Theologe schwergefallen wäre, wenn ich am Ende meines Nachdenkens festgestellt hätte, dass es aufgrund unserer Weltsituation keinen Gott geben kann!





























