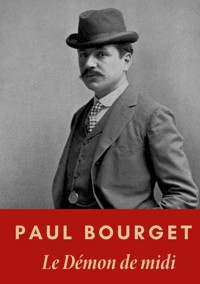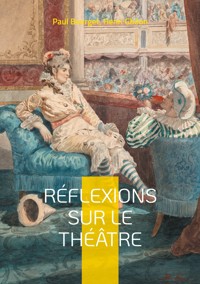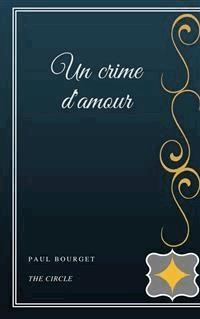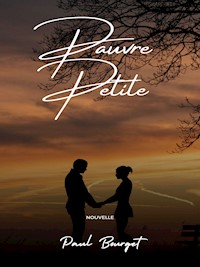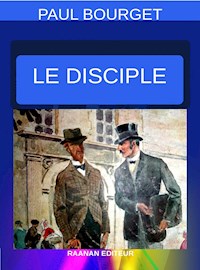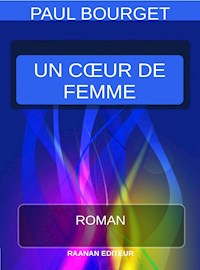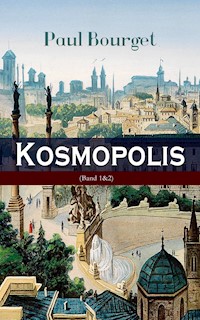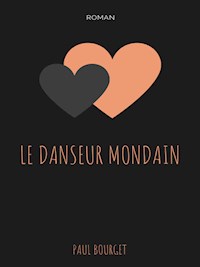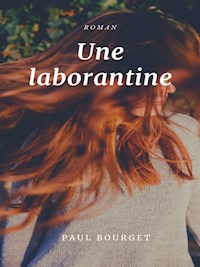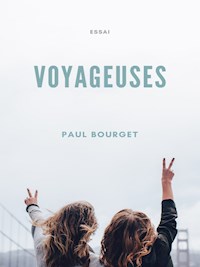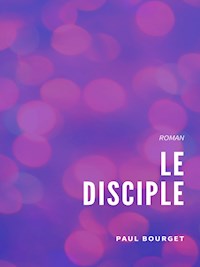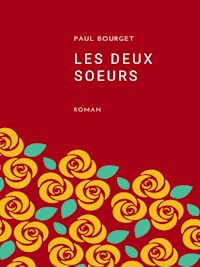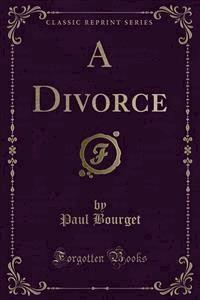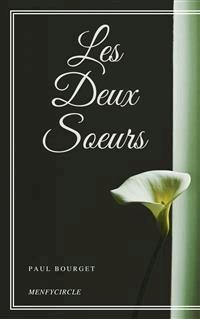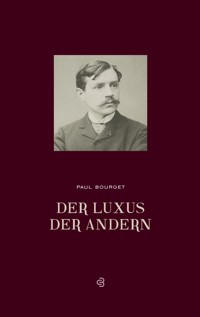
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Turbulentes Familiendrama eines Bildungsaufsteigers und seiner angetrauten Frau aus ehemals großem Hause. Nicht nur der familiäre Hintergrund der beiden unterscheidet sich, auch ihre Ansichten über gesellschaftlichen Status und existentielle Fragen der Liebe könnten nicht weiter auseinanderliegen. Reichlich Stoff also für eine Katastrophe, die sich nach und nach aufbaut - und auf denkbar bedauerliche Weise endet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Eine Pariser Häuslichkeit: Der Gatte
2. Eine Pariser Häuslichkeit: Die Frau
3. Eine Pariser Häuslichkeit: Die Tochter
4. Der Preis der Äußerlichkeiten
5. Empfangstag bei Frau Le Prieux
6. Charles Huguenin
7. Enthüllungen
8. Hektor Le Prieux’ Plan
9. Epilog
1. EINE PARISER HÄUSLICHKEIT: DER GATTE
W enn man mehrere Pariser Zeitungen regelmäßig liest – und wer verschwendet heutzutage nicht eine Stunde am Morgen und am Abend, um in einem Dutzend von Blättern dieselben Nachrichten, dieselben spitzfindigen Klügeleien, denselben Parteienstandpunkt wiederzufinden? – so hat man hundert-, ja tausendmal den Namen »Herr und Frau Hektor Le Prieux« gefunden.
Beide stehen mit Recht in erster Reihe unter denen, die man kurzweg als »Pariser Berühmtheiten« zusammenfaßt: Er, als einer der Veteranen unter den Berichterstattern über Pariser Leben und Theater; sie, obwohl nur die Gattin eines Journalisten, als eine sehr gefeierte Persönlichkeit, deren große Mittagsgesellschaften in den Zeitungen erwähnt werden. Auch fehlt sie nie bei einer Erstaufführung im Theater, bei der Eröffnung einer Ausstellung oder sonst bei einer der Feierlichkeiten, wo man jenes undefinierbare eigenartige »Tout Paris« trifft, von dem die Fremden und Provinzialen träumen. »Tout Paris« bedeutet nicht die vornehme Welt; die Elemente sind allzusehr zusammengewürfelt, als daß die ungleichartige Mischung jemals auch nur von fern als die »Gesellschaft« erscheinen würde. Und doch ist es auch eine »Gesellschaft«, die sich abschließt, ihre Sitten, ihre Rangordnung wahrt.
Die »schöne Frau Le Prieux«, wie sie trotz ihrer reichlich vierzig Jahre noch immer genannt wird, müßte dort unbedingt zu den Königinnen zählen, wenn man die Krone dem zuerkennt, der am häufigsten in den Berichten über diese beinahe täglichen Schaustellungen erwähnt wird. Aber berühmt sein, sagt man, heißt von der Mehrheit verkannt werden. Der scheinbar paradoxe Satz gilt ebensowohl von diesen eigenartigen Pariser Berühmtheiten, wie von jeder anderen. – Man nehme sich einmal die Mühe, über die Häuslichkeit zweier in einem solchen Strudel geschleuderter Wesen wie die Le Prieux’ nachzudenken, wenn man beinahe täglich den Namen der Frau in der Zeitungsrubrik: Aus der Gesellschaft und den des Mannes am Schlusse eines Artikels liest.
Ich wette, im Geist des Lesers entsteht die Vorstellung, daß er dem sagenumwobenen Typus des Boulevardbummlers entspricht, der als Gatte von nur sehr mäßiger Treue ist, ein ziemlicher Lebemann, Spieler, dabei Duellen nicht abhold und ständig sich verspätend in Spelunken oder hinter den Kulissen der kleinen Theater. Sie erscheint als der nicht weniger sagenhafte Typus der Pariserin, die man aus den modernen Romanen kennt: leichtsinnig, flatterhaft, wenn nicht gar gefallsüchtig und entgegenkommend. Man wird alles eher von dem glänzenden Zigeunertum eines solchen Paares glauben, als sie sich am häuslichen Herde, im Kreise der Familie vorstellen. Mit diesen Gedanken – und das ist das Los aller sich auf ganze Klassen beziehenden Urteile – hat der Leser recht und unrecht zu gleicher Zeit. Er irrt sich in den Personen, denn Hektor Le Prieux, obwohl Journalist vom Scheitel bis zur Sohle, ist der beste Gatte, den sich je ein ängstlicher Familienvater für sein Töchterchen erträumt hat, und Frau Le Prieux ist, was Ehrbarkeit anbelangt, die untadeligste der Frauen. Richtig sind jene Gedanken aber in Bezug auf das geringe wahre, innere Glück, das ein unter solchen Bedingungen und in einer solchen Umgebung geführtes Leben bieten kann. Die Häuslichkeit der Le Prieux’ beruht tatsächlich auf einer Anomalie, die erklärt werden muß, um das folgende kleine Gefühlsdrama verständlich zu machen, und die vorangegangenen und noch folgenden Betrachtungen bilden die lange, aber notwendige Vorrede dazu.
Außerdem gibt man, indem man die Geschichte dieses Paares berichtet, der Erzählung einer einfachen Begebenheit die volle Bedeutung einer sozialen Lehre. Das Vermächtnis dieser Ehegatten untereinander hängt nicht mit dem etwas eigenartigen Beruf des Herrn Le Prieux zusammen, denn ihre Beziehungen zueinander wären genau ebenso eigentümlicher Natur, wenn er die sechzig- oder siebzigtausend Franken, die er jährlich durch die mühevolle Arbeit eines zu großem Erfolge gelangten Journalisten verdient, an der Börse, im Handel oder in der Industrie erwürbe. Diese seltsame Häuslichkeit, deren zehrende Wunde, wie sich zeigen wird, jenes ganz moderne Übel, das krankhafte, leidenschaftliche Schielen nach dem Luxus der Mitmenschen ist, wird nur durch die besonderen Umstände außergewöhnlich. Der Wunsch zu glänzen, soviel man irgend vermag, das Verlangen, seinen Kreis zu verlassen und unaufhörlich und um jeden Preis in Lebensgewohnheiten, äußerer Pracht, Vergnügungen denen gleichzukommen, die eine Stufe höher stehen, was ist es sonst, als ein besonderer Fall des großen, demokratischen Entartungsprozesses? Man trägt Bedenken, so gewichtige Ausdrücke anzuwenden, da es sich nur um ein ziemlich alltägliches Erlebnis von Leuten handelt, die sich selbst für ganz einfach, ganz natürlich halten. Und doch – wenn man darüber nachdenkt, sind die großen Umwandlungen, welche die Sittengeschichte verzeichnet, nichts anderes als eine unendlich vielfältige Summe von kleinen, persönlichen Gewohnheiten, wie die unermeßliche Meeresflut nichts anderes ist, als das Vorwärtsdrängen von Milliarden kleinster Wellen.
In dem Augenblick, in dem das Drama, auf das ich anspiele, mit kleinen, aber dennoch tragischen Ereignissen beginnt, das heißt im Januar des Jahres 1897, war die Häuslichkeit der Le Prieux’ schon dreiundzwanzig Jahre alt. Hektor – in damaliger Zeit Leprieux in einem Wort, denn so wurde der Name geschrieben, als er noch nicht in den Nachrichten Aus der Gesellschaft genannt wurde – hatte Fräulein Mathilde Duret im Jahre 1874 geheiratet. Die Vermählung wurde unter höchst bescheidenen Umständen gefeiert, und nichts wies auf die zukünftige Vornehmheit der »schönen Frau Le Prieux« – in zwei Worten geschrieben – hin.
Die Feierlichkeit wurde zur Not von den beiden Zeitungen erwähnt, an denen der junge Gatte Mitarbeiter war. Hektor selbst verlangte diese Zurückhaltung, denn er wollte alles vermeiden, was an das noch in aller Erinnerung haftende Mißgeschick des Vaters seiner Braut anspielen könnte. Wie viele ähnliche Fälle sind seitdem vorgekommen! —
Wahrscheinlich erinnert sich niemand mehr jenes kühnen Armand Duret, der kurz vor und nach dem Sturze des Kaiserreichs sich in große, gefährliche Unternehmungen einließ, mit großem Geräusch die Departementsbank gründete, unerhörten Aufwand entfaltete, Zeitungen schuf und schließlich, zugrunde gerichtet, schmachvoll durch Selbstmord endete.
Die Witwe und Tochter dieses verunglückten Spekulanten hatten – nebst einigen Möbeln, die dem Hammer des Taxators entgangen waren – mit Mühe 4000 Franken Rente gerettet, gerade genug, um nicht Hungers zu sterben. Hektor seinerseits verfügte durch die doppelte Mitarbeiterschaft, von der ich sprach, über 5000 Franken jährliches Einkommen. An einer der beiden Zeitungen bekleidete er das Amt eines Berichterstatters über Gerichtsverhandlungen, das ihm 2400 Franken einbrachte, an der anderen gab er unter einem Pseudonym einen zweimal wöchentlich erscheinenden Bericht Pariser Neuigkeiten heraus; jeder Artikel brachte ihm 25 Franken oder zusammen 2600 Franken jährlich. Drei in seiner Heimat, dem Bourbonnais, verpachtete Bauernhäuser, die er vorsichtigerweise behalten hatte, bildeten den zwar magersten, aber sichersten Teil seiner Einkünfte; sie brachten ihm, ob die Zeiten gut oder schlecht waren, alljährlich 900 Franken. Diese Zahlen erklären zur Genüge den Entschluß des jungen Paares, mit der Mutter zusammen Haushalt zu führen. Die beiden Frauen machten dem jungen, mit dem praktischen Leben gänzlich unvertrauten Schriftsteller begreiflich, daß ein solches Zusammenleben eine Ersparnis bedeute. Insbesondere bestand die Mutter der Braut darauf, um den Ankauf einer neuen Einrichtung zu verhindern. Hektor hatte bis zu seiner Heirat ein möbliertes Zimmer in einer seinen Redaktionsbüros nahegelegenen Straße bewohnt.
»Mama ist so gut! Sie wird mir ihren Salon zu meinem Empfangstag abtreten«, hatte Mathilde mit so tiefem Dankgefühl gesagt, daß der verliebte Bräutigam bis zu den Tränen gerührt war, während er doch aus diesen einfachen Worten die Auf fassung seiner Braut für ihre gemeinsame Zukunft mit Sicherheit hätte ersehen können. Aber woher hätte der junge Mann, der nichts nach seinem wahren Werte zu beurteilen wußte, das besonders schwierige Verständnis für Charaktere nehmen sollen? Er hatte weder Vater noch Mutter, und es war niemand da, der ihn beraten, ihm im Voraus gesagt hätte, von wie großer Tragweite die im Anfang begangenen kleinen taktischen Fehler für ein zukünftiges Eheleben sind. Alles trug dazu bei, aus ihm den Ehesklaven zu machen, der er während seines ganzen Lebens bleiben sollte; sein Alleinstehen in erster Linie, seine Erziehung, seine Geistes- und Gefühlsrichtung, alles, alles, bis herab zu seiner Abstammung und der anererbten Gemütsart, die um so stärker in uns ist, als wir uns ihrer kaum bewußt sind …
Ich habe gesagt, daß Le Prieux – lassen wir ihm ein für allemal den Halbadel, den das von seinem Namen losgelöste Le bedeutet – aus dem Bourbonnais gebürtig war. Der Name allein würde diese Provinz verraten, denn man nennt noch heute in der Mundart Mittelfrankreichs einen Prieux oder Semonneux den ländlichen Sprecher, der von Dorf zu Dorf geht, um die Hochzeitseinladungen zu bestellen. Wurde vielleicht das Amt eines solchen Boten von den bäuerlichen Ahnen Hektors mit besonderem Schwung ausgeübt? Die bescheidenen Archive von Chevagnes, dem Geburtsort unseres Helden, erwähnen nichts; sie bezeugen hingegen, daß die Le Prieux seit mehreren Generationen unter diesem Spitznamen, der schließlich zum Familiennamen wurde, in Chevagnes bekannt sind. Sie müssen von jeher dort gewohnt haben, denn Hektor zeigt mit seinem eher breiten als langen Kopf, seinem platten, in ein rundes Kinn auslaufenden Gesicht, seinen glatten Haaren, die noch im Ergrauen das frühere Braun verraten, und mit seiner ganzen festen untersetzten Gestalt den vollendeten Typus des keltischen Bauern, wie er in diesem Teile Frankreichs zu Hause war, als Cäsar dort erschien.
Es ist ein eingeborener Stamm, dessen moralische Eigenschaften sich mit staunenswerter Treue durch alle Zeiten hindurch erhalten haben: vorsichtige Klugheit ohne starke, schöpferische Phantasie, ein geduldiger Wille ohne Entschlußkraft, was heutzutage die Gelehrten Herdengeist nennen, die Neigung, nicht selbständig zu handeln, fast das Bedürfnis, geleitet zu werden. Gewiß beruhen solche Charakteristiken auf einer gefährlichen Verallgemeinerung, und doch scheint die Geschichte der Auvergne und des Bourbonnais die Richtigkeit in diesem Falle zu bezeugen. Der Geschichte des Bourbonnais hat das Vorherrschen des keltischen Elements ein unverkennbar einheitliches Gepräge aufgedrückt. Was für Leute hat sie hervorgebracht während der langen, langen Dauer des Mittelalters und des ancien régime, als die landschaftliche Unabhängigkeit noch eine freie Entfaltung der Eigenart zuließ? Wenige oder keine großen Feldherrn, auch kaum einen bedeutenden Künstler, wie wenn das Blut dem Außerordentlichen widerstrebte, das solchen Helden eigen ist. Hingegen sind die verständigen Geister, die Männer des Gesetzes und der Kirche dort üppig emporgeschossen. Wenn man in so hohem Grade ein Kind seines Landes ist wie Hektor Le Prieux, so kommen die Vorzüge und Mängel der Heimat immer wieder zum Vorschein, selbst wenn Umgebung und Beruf dem Einfluß der Heimaterde aufs stärkste entgegengesetzt sind. Liest man eins seiner Theater-Feuilletons oder eine seiner Pariser Plaudereien, so findet man immer wieder bedächtige Klugheit, Alltäglichkeit, Urteilskraft, Schüchternheit, nüchterne Genauigkeit und eine etwas dürftige Weisheit. Es ist ein Talent, das zu frühzeitig zu wagen aufgehört, ein Charakter, der sich zu rasch unterworfen hat.
Wenn die anererbte, geistige Passivität Hektors tatsächlich die Erklärung dazu gibt, daß die Leitung seines Hausstandes von Anfang an in den Händen seiner Frau lag, so drängt sich uns ein Rätsel auf, das gelöst werden muß, bevor wir den Einfluß der Frau Le Prieux auf das Tun und Treiben ihres Gatten zeigen: Wieso hatte er trotz des Mangels an Unternehmungsgeist unter so vielen sicheren, amtlichen Lauf bahnen mit fester Besoldung und Ruhegehalt, die sich dem Herdenmenschen des heutigen Frankreich eröffnen, die abenteuerlichste unsicherste, mit bürgerlicher Vorsicht am wenigsten vereinbare gewählt? Auch hier, wo es sich scheinbar um Kühnheit und Eigenart handelt, hat der junge Mann seine Lenkbarkeit und sein geringes Zutrauen zur eigenen Kraft gezeigt. Der Zufall wollte es nämlich, daß Hektors Vater, der in Chevagnes als Arzt lebte, in dem benachbarten Bade Bourbon-Lancy einen alten Studienfreund wiederfand, welcher selbst als Arzt in der Nähe von Nohant niedergelassen war und die Dichterin Georges Sand behandelte. Von Hektors Vater zu einem Besuch in Chevagnes eingeladen, erzählte er in Gegenwart des Jünglings viel von seiner berühmten Patientin. Hektor saß damals gerade in der Unterprima, und wie alle Gymnasiasten seines Alters machte er heimlich schlechte Verse. Er war ein leidenschaftlicher Bewunderer von Lelia und Indiana. Angeregt durch diese Erzählungen beging der junge Mann die erste Kühnheit in seinem Leben. Unsere Geschichte wird auch die zweite erzählen. Er wagte es, an die gütige Dame von Nohant einen Brief zu richten, in dem er sie um Rat in Nöten seiner religiösen Entwicklung bat. Mit jener bewundernswerten Großmut, die sie sich trotz ihrer Arbeitslast bis ans Ende bewahrte, antwortete Georges Sand dem Schüler. Sie ahnte nicht, daß die vier mit der runden und durch das Alter etwas verzerrten Handschrift bedeckten Seiten ihres Briefes einen so unseligen Einfluß auf die Zukunft des Jünglings ausüben sollten. Er antwortete ihr und war diesmal kühn genug, ihr einige von seinen Gedichten zu schicken. Die alte Freundin Alfred de Mussets verstand von Poesie ungefähr ebensoviel wie von Politik; hingegen leistete sie Vortreff liches im Roman. Sie schrieb einen ganzen Band, der den jungen Dichter aus dem Bourbonnais zum Helden hatte, bloß weil er eine hübsche Heimat sage in sehr mäßige Stanzen gebracht hatte. Sie sah ihn bereits jene ländliche »Heimatkunst« in Frankreich einführen, die immer ihr Lieblingstraum gewesen ist. Sie ermutigte ihn durch Lobeserhebungen, – durch unvorsichtige, gefahrvolle Lobeserhebungen, mit denen ruhmgekrönte Künstler niemals sparsam genug umgehen; denn sie ermessen die Tragweite nicht, die sie auf die Phantasie der Anfänger ausüben. Ein Besuch in Nohant, wo er mit der herzlichsten Liebenswürdigkeit aufgenommen wurde, verdrehte dem Jüngling völlig den Kopf, und er glaubte fortan fest an seinen Dichterberuf. Die Folge davon war, daß er sich beim Verlassen der Schule nicht, wie der Vater es wünschte, in der medizinischen Fakultät einschreiben ließ, sondern um die Erlaubnis zum Studium der Rechte bat. Er sah darin die Gelegenheit zu weniger strenger Arbeit, die besser mit seinen geheimen Wünschen übereinstimmte.
Bald darauf starb der Vater – die Mutter hatte er schon in früher Kindheit verloren –, und er war Herr über sein Geschick. Er machte so schnell als möglich die bescheidene Erbschaft, die der Doktor von Chevagnes ihm hinterlassen hatte, zu Geld; nur die drei Bauernhäuser, die später den solidesten Bestandteil seines Heiratsgutes ausmachen sollten, wurden in diesem ersten Eifer geschont, weil es zu viel Schwierigkeiten verursacht hätte, die Pachtverträge zu lösen. Die aus Sparsamkeit in Dijon begonnenen Rechtsstudien wurden aufgegeben, und Madame Sands Schüler ließ sich in Paris nieder, um sich literarischen Ruhm zu erringen.
Dieses Ereignis – denn die Auswanderung des jungen Le Prieux erregte Aufsehen im Bezirke von Chevagnes, wo der verstorbene Doktor ebensoviel sogenannte Vettern, das heißt unentgeltlich behandelte Patienten besaß, als die bourbonnische Landschaft Sologne Weiler –, dieses Ereignis also trug sich im Jahre 1865 zu. Der Erfolg war der befürchtete: Ikarus verbrannte sich wieder einmal das Wachs seiner Schwingen an dem Feuer der Wirklichkeit. Im Jahre 1870, zur Zeit des Krieges, wo Hektor als braver Bursche seine Pflicht tat, hatte er bereits auf eigene Kosten zwei Bände Verse veröffentlicht: Der Heideginster und Bourbonnische Weisen, ferner einen Roman: Der Rote, worunter man in der Mundart seiner Heimat die Ochsen von roter Farbe versteht. Alle diese Arbeiten hatten einen ausgeprägt ländlichen Anstrich, wie es Sitte bei den Schriftstellern ist, die nach Paris kommen, um dort als Söhne ihrer Heimat aufzutreten. Alle drei Bücher waren zusammen in 150 Exemplaren verkauft worden, und während dieser Zeit hatte der junge Dichter Gelegenheit zu erkennen, wieviel Roheit, Eitelkeit und niedrige Gesinnung sich hinter dem hochtönenden Wortgepränge der Künstler-Bohème verbirgt. Da er an den Stammtischen des Quartier Latin, wohin ihn seine literarischen Bestrebungen führten, für reich galt – und reich war er allerdings im Vergleich zu den anderen –, hatte der Provinziale bald die zahlreichen Arten der systematischen Ausbeutung erkannt, der er zum Opfer fiel. Hektor war der gefällige Kamerad, der nie in ein Kaffeehaus eintrat, ohne einen Schweif von Freunden hinter sich zu haben, und trennte man sich endlich nach langen Reden über die hohe Ästhetik, so überließ man es ihm, die genossenen Speisen, von denen die zu Säulen aufgestapelten Teller Zeugnis ablegten, zu bezahlen. Öffnete am nächsten Morgen der liebenswürdige Wirt vom Abend vorher die Tür des Kaffeehauses, dann hörte er die feinfühligen Kunstjünger sein Werk und seine Person richten, in Ausdrücken, die ihn wie eine scharfe Klinge an der verwundbarsten Stelle seiner Eigenliebe trafen. Le Prieux war auch einer von den Leichtgläubigen, die sich mit 25 Louisdor an der Gründung einer Zeitschrift beteiligten, die dem Zwecke dienen sollte, »Jung Frankreich« zu verteidigen; – plötzlich begegnen ihm in dieser selben Zeitschrift Artikel mit grausamen Anspielungen, in denen er sich selbst wiedererkennt, und er sieht mit Schmerz, daß er seine eigene Schmach bezahlt hat, wie andere ihre Lobhudeleien. Er war nicht einmal, nein zwanzig-, ja fünfzigmal erst der gerührte und später der eingeschüchterte Mäzen gewesen, der seine Börse den gewerbsmäßigen Bettlern der literarischen Zunft öffnete, um bei der ersten Weigerung die Schmähreden dieser Burschen über sich ergehen lassen zu müssen, bloß weil er nicht mehr Lust hatte, ihre Unfähigkeit und Faulenzerei zu unterstützen. Aber wozu alle diese Erbärmlichkeiten aufzählen, die ebenso gemein wie alltäglich sind? Weniger alltäglich ist es, daß ein junger Mann durch solche Erfahrungen nicht sein gesundes, soziales Empfinden verliert.
Während sich Hektor bemüht, in Prosa und in Versen von gemachter Natürlichkeit die Poesie seiner leichtsinnig verlassenen Heimat auszudrücken, wirkte diese Heimat – zu seinem Glück – unbewußt in ihm. Die kluge Vorsicht seiner ländlichen Ahnen vermag diesen merkwürdigen Vorgang zu erklären. Von einem dunklen, unwiderstehlichen Erhaltungstrieb gedrängt, machte er sich ein klares Bild von den äußeren Umständen, unter denen er leben mußte, und er erriet das sicherste Mittel, um sich in seine Lage zu schicken. Während des traurigen Feldzuges von 1870 fing er an, ernste Betrachtungen anzustellen, zuerst im Zelt und später in Deutschland in der Gefangenschaft. Er sah sich ohne jeglichen Erfolg fast seines ganzen Vermögens beraubt, und er begriff nun, daß sein Traum vom baldigen Ruhm nur ein Hirngespinst war. Er verurteilte sich als Dichter wie als Romanschriftsteller und, seinen Jugendwerken zwar ein heimliches Wohlgefallen bewahrend, versuchte er die Verwirklichung seines Ideals in die Ferne zu schieben. Mit 25 Jahren sah er sich ohne Titel, ohne Gönner, ohne eine Laufbahn, und es wurde ihm klar, daß er zwei Dinge in seinem Leben unterscheiden müsse: die Kunst und den Beruf. »Ein Beruf ist so gut wie der andere«, sagte er sich, »und auch in der literarischen Lauf bahn kann man vorwärts kommen von dem Augenblick ab, wo man als gewissenhafter und pünktlicher Arbeiter, der man in jedem Stande sein muß, um etwas zu erreichen, seine Pflicht tut.« So sprach in ihm der gesunde Menschenverstand, den er von seinen ländlichen Ahnen ererbt hatte. Er sah ein, daß eine große Zeitung schließlich dasselbe sei wie irgendeine andere ausgedehnte, kaufmännische Werkstatt, die eine gewisse Menge positiver, regelmäßig ausgeführter Arbeit voraussetzt. Er entschloß sich, der gute, pünktliche Arbeiter einer solchen Werkstatt zu werden, und er hielt sich sein Versprechen. Mit einer Geduld, mit einer Planmäßigkeit ging er vor, würdig der Landbebauer, von denen er stammte, und deren zähe Willenskraft sich in ihm in der unerwartetsten Form wiederfand.
In den Kriegsjahren waren die literarischen Zirkel, zu denen er mehr oder weniger gehört hatte, naturgemäß auseinander gesprengt worden, und diesen Umstand nutzte er, um sich von fast allen seinen alten Kameraden abzusondern. Schließlich besann er sich noch, daß es das Beste sein würde, seine juristischen Studien fortzusetzen. Einige Prüfungen hatte er schon bestanden, und so besaß er den Mut, diese Laufbahn zu vollenden, sich als Advokat eintragen zu lassen und sich dann um eine Stellung als gerichtlicher Berichterstatter bei einer Zeitung zu bewerben. Durch die Vermittlung eines alten Kneipkameraden, der gleich ihm vernünftigerweise zur Presse übergegangen war, erhielt er die Stelle. Die Pünktlichkeit, mit der Hektor seine Manuskripte ablieferte, die klare Kürze seiner sorgfältig ausgearbeiteten Berichte, die Lauterkeit seines Charakters verschafften ihm bald Freunde an der großen Zeitung. Der Chefredakteur erwähnte ihn lobend bei dem Besitzer des Blattes, der kein anderer als Duret war. Dieser hatte das eifrige Bestreben, sich nützliche menschliche Werkzeuge heranzuziehen, zuverlässige, gute Arbeiter, die ihm mit ihrer Intelligenz helfen sollten, sein politisches Glück auf seinen finanziellen Erfolgen aufzubauen. Er wollte Le Prieux kennenlernen, und auf diese Weise kam Hektor als gering bezahlter, kleiner Zeitungsschreiber auf der Hintertreppe in das fürstliche Haus, das Duret damals in der Friedland-Allee besaß. Er gefiel dem Spekulanten sofort, denn es entging ihm nicht, daß Hektor einen klaren Verstand hatte, und er beabsichtigte, ihn zu seinem Vertrauensmann zu machen. Die schon erwähnten tragischen Umstände und der Zusammensturz der Departementsbank, der einen jähen Umschwung in Durets Verhältnisse brachte und ihn schließlich zum Selbstmord trieb, schienen Hektors Beziehungen zu den Hinterbliebenen des unglücklichen Spekulanten ein Ziel zu setzen. Doch es kam anders. Er stellte sich der armen Witwe, die nur zu froh war, in der entsetzlichen Verwirrung des Zusammenbruchs einen ergebenen Menschen zu finden, ganz zur Verfügung. Der junge Mann tat alles für die schöne, unglückliche Mathilde, für die er heiße Liebe und glühende Bewunderung empfand. Das übrige läßt sich leicht erraten: die wachsende Vertraulichkeit, Hektors schüchterne Leidenschaft, die anfangs nichts zu hoffen wagte, die Dankbarkeit der beiden Frauen, und schließlich die fast erschreckte Seligkeit des Liebenden bei der plötzlichen Aussicht auf eine mögliche Verwirklichung seiner höchsten Wünsche. Darauf folgte die unschuldige, die köstliche Idylle, bei deren Erinnerung noch heute nach einem Vierteljahrhundert dem ergrauten Schriftsteller das Herz pochte, wie wenn er noch immer der neunundzwanzigjährige, bescheidene Zeitungsschreiber wäre, der die Beförderung seiner Kleider und Bücher in die Wohnung seiner Schwiegermutter überwachte – eine ziemlich trübselige Wohnung mit der Aussicht auf den Hof – und der noch immer nicht ganz an die Wirklichkeit seines Glückes zu glauben wagte.
2. EINE PARISER HÄUSLICHKEIT: DIE FRAU
In der Tat war die erste Periode in dieser Häuslichkeit eine vollkommen, uneingeschränkt glückliche für Hektor. Sie dauerte ungefähr sieben Jahre; es war die Zeit, wo Hektor seinen Ruhm begründete, dieselbe Zeit auch, wo sich Frau Le Prieux jene Auffassung von der Arbeit ihres Mannes bildete, die ihre gemeinsame Zukunft so unselig beeinflussen sollte. Mathilde war eine jener Frauen, deren ungewöhnliche Einfalt in einem solchen Gegensatz zu der edlen Gesichtsbildung steht, daß sie den Beobachter irre führen konnte, ohne sich im geringsten verstellen zu müssen, namentlich wenn dieser Beobachter verliebt ist. Ihre Mutter, eine geborene Huguenin, war aus Aix in der Provence gebürtig, ihr Vater war der Sohn eines kleinen Kaufmanns aus dem Norden Frankreichs. Derartige Vermischungen des Blutes, so häufig in den Familien der neueren Zeit, daß niemand darauf achtet, bewirken oft eine Erblichkeit widersprechender Tendenzen, die einander auf heben. Vielleicht liegen die Ursachen des Verfalls der Rasse in Frankreich in dieser fortgesetzten Vermischung des Nordens mit dem Süden, des Westens mit dem Osten, in den Heiraten von Leuten von allzu verschiedenem Ursprung. Vom Vater hatte Mathilde den Hang zu glänzen, den schonungslosen Egoismus und die gänzliche Gefühllosigkeit, die alle Spieler, insbesondere die der Börse, kennzeichnet. Von der Familie der Mutter hatte sie den köstlichen südlichen Typus ererbt, der, wenn er sehr rein ist, an Feinheit und Anmut dem griechischen gleichkommt. Sie hatte tiefe, brennende, dunkle Augen bei einer mattweißen Gesichtsfarbe. Ihre kleine, runde Stirn schloß sich an die Nase mit jener fast geraden Linie, die so viel Adel verleiht, und ihr kleiner Kopf verriet unter dickem schwarzen Haar jene Form des länglichen Ovals, die sich in der Rasse des homo mediterraneus fortpflanzt, dieses schmiegsamen, zierlichen, dunklen Langschädels, den die Anthropologen rühmen. Dazu hatte sie schöne, regelmäßige Zähne zwischen fein gezeichneten Lippen, die wie mit dem Meißel geschnitten erschienen. Das Grübchen im Kinn und der reizende Halsansatz waren eines Tanagra-Figürchens würdig; Schultern und Hals schien sie einer Diana entlehnt zu haben. Sie war groß und schön gewachsen, hatte Kinderhände, kleine Füßchen und jenen Gang, der die Frauen von Arles sprichwörtlich gemacht hat.
In welche gesellschaftliche Stellung auch das Schicksal ein mit so großer Schönheit ausgestattetes Geschöpf wirft, es braucht nur zu erscheinen, um – auch ohne jeden Putz – unwiderstehlichen Reiz auszuüben, und nichts ist für ein Wesen, das schon instinktiv zur Verkennung seiner Person neigt, gefährlicher als dies. Das Übermaß der fortgesetzten Bewunderung vernichtet bei den Frauen, die der Gegenstand dieser Bewunderung sind, rasch jegliche Fähigkeit, sich zu beurteilen. Es geht ihnen wie den Fürsten, denen man zu viel schmeichelt, wie den Künstlern, denen man zu viel Huldigungen darbringt. Diese Opfer ihrer eignen Erfolge endigen schließlich damit, ihr Ich zum Mittelpunkt der Welt zu machen, mit einer Harmlosigkeit, die ebenso unbefangen wie grausam ist. Bei Mathilde hatte diese Selbstvergötterung eine Entschuldigung: Die Natur hatte ihr eine Gabe versagt, die übrigens weniger allgemein ist, als man glauben sollte, und die ich als den Geist des Altruismus bezeichnen möchte; es ist die Fähigkeit, sich in die Seele eines anderen zu versetzen, seine Gedanken zu verstehen, die Schattierungen seines Gefühlslebens zu erfassen. Hinter der edlen und stolzen Maske einer antiken Göttin verbarg sich jene – übrigens im Süden sehr häufige – fast animalische Art des Verstandes, die nur Konkretes denkt, wenn man so sagen darf. Hektors Hingebung schmeichelte ihr, ohne daß sie die geheime Ursache davon erkannte: das edle Mitleid dieses Poeten, der umsomehr Poet im Handeln war, je weniger er es in den Worten sein konnte. Sie hatte diesen Triumph ihrer Schönheit natürlich gefunden, und als sie einwilligte, Frau Le Prieux zu werden, tat sie es in dem guten Glauben, sich für ihre Mutter zu opfern.
Denn Frau Duret, die erheblich verständiger und feinfühliger als ihre Tochter war, bestand auf dieser Verbindung, weil sie der reiche Schatz von Selbstent äuße rung, den sie bei dem Liebhaber ihrer Tochter entdeckte, geradezu gerührt hatte. Durch eine grausame Erfahrung waren ihr die Augen geöffnet worden, und sie hatte bei Hektor gerade die entgegengesetzten Eigenschaften wahrgenommen, die ihren Mann in das furchtbare Verhängnis gestürzt hatten. So flehte sie denn ihre Tochter an, einen so zuverlässigen Beschützer anzunehmen, und diese hatte »Ja« gesagt, indem sie vor sich selbst eine so bescheidene Heirat dadurch rechtfertigte, daß sie sich für die Ruhe ihrer Mutter opfere. Denn wie wenig der Bräutigam auch zu bieten hatte, es hieß immerhin die bescheidene Rente von 4000 Franken auf 10 000 erhöhen, wodurch man in die Lage kam, ein Dienstmädchen mehr zu nehmen und der armen Mutter die Wirtschaftssorgen zu erleichtern. Von den Vorgängen in der Seele des aufstrebenden Dichters, der ein prosaischer Handwerker geworden war, von den noch immer heimlich genährten Hoffnungen Hektors, trotz der bezahlten Arbeit ein paar Kunstwerke zustande zu bringen: eine Sammlung Verse, einen Band Novellen, einen Roman – davon ahnte Mathilde nichts, als sie ihn heiratete. Sie ahnte davon auch nichts nach zwanzigjähriger Ehe oder bei den leidenschaftlichen Vorgängen, die den Stoff für unsere Erzählung bilden. Sie hielt sich und hält sich noch heute für die hingebendste Gattin. Sie ist stolz darauf, ihrem Gatten eine »Stellung« geschaffen zu haben. Man vergegenwärtige sich, daß sie im Monat Januar ungefähr 500 Visitenkarten für sich und ihren Mann abzugeben hat. Sie wird sterben, ohne zu wissen, daß sie das seltenste, feinfühligste Herz aufgeopfert hat für die kleinlichste, selbstsüchtigste Eitelkeit: um die Rolle der gefeierten Frau spielen zu können, um in den Zeitungsberichten, von denen ich vorhin sprach, als die »schöne Frau Le Prieux« genannt zu werden. Vielleicht wird der Leser am Schluß unserer Geschichte nicht mehr in Versuchung kommen, über diesen Beinamen zu lächeln, wenn er wissen wird, mit wieviel wirklichem Elend er verknüpft ist.
Doch man muß alles berücksichtigen: Im Anfang seiner Ehe freute sich Hektor über diese Eitelkeiten, ohne unter ihnen zu leiden. Es ist sehr selten, daß die Opfer solcher Familientragödien nicht auch ihre Urheber sind. Es sind gewöhnlich die Väter, die Ehemänner, die Mütter und Frauen, die am häufigsten bei ihren Kindern, Gattinnen oder Gatten diejenigen Fehler zur Entwicklung bringen, über die sie sich eines Tages bitter beklagen. Es ist wahr, daß viele Fehler zuerst liebenswürdige Eigenschaften sind: Die Lüge entsteht aus zu großer Geschmeidigkeit, Gefallsucht aus dem Wunsche zu gefallen, Heuchelei aus zu großer Zurückhaltung und so fort.
In den ersten Jahren seiner Ehe sah Hektor mit Entzücken alles sowohl in seinem Hause wie in seinem Leben zusammen stimmen, um die Schönheit seiner jungen Frau zur vollsten Geltung zu bringen. Wie hätte er sich nicht freuen sollen, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr seine Arbeit mutig zu vermehren, um die ersten 10 000 Franken Einkommen zu verdoppeln? Welche Freude für Hektor, Mathilden jenen kleinen Aufwand zu gestatten, der ebenso natürlich für ein schönes junges Geschöpf ist, als es grausam wäre, ihn ihr zu rauben!