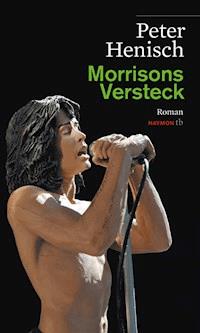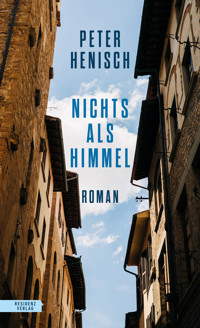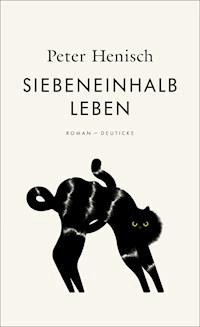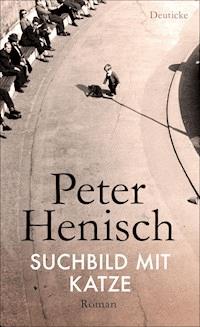Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In „Der Mai ist vorbei“ soll Paul Grünzweig einen Artikel über das Jahr 1968 schreiben. Dabei gerät er immer tiefer in seine eigene Geschichte: Während in Berlin, Paris und Prag demonstriert wurde, gründete er eine Literaturzeitschrift und zog in eine Kommune. Doch bald schwindet der Optimismus, es als Gruppe zu schaffen. Pepi Prohaska ist ein junger Mann mit viel Fantasie und Chuzpe. Eines Tages fällt ihm ein, dass Gott etwas mit ihm vorhat, nennt sich selbst „Pepi Prohaska Prophet“ und sammelt Jünger und Jüngerinnen um sich. Doch er wird auch unzählige von Widerspruchsgeist inspirierte Briefe an Politiker schreiben – und schließlich auf geheimnisvolle Weise verschwinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 902
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
In Der Mai ist vorbei soll Paul Grünzweig einen Artikel über das Jahr 1968 schreiben. Dabei gerät er immer tiefer in seine eigene Geschichte: Während in Berlin, Paris und Prag demonstriert wurde, gründete er eine Literaturzeitschrift und zog in eine Kommune. Doch bald schwindet der Optimismus, es als Gruppe zu schaffen.
Pepi Prohaska ist ein junger Mann mit viel Fantasie und Chuzpe. Eines Tages fällt ihm ein, dass Gott etwas mit ihm vorhat, nennt sich selbst Pepi Prohaska Prophet und sammelt Jünger und Jüngerinnen um sich. Doch er wird auch unzählige von Widerspruchsgeist inspirierte Briefe an Politiker schreiben – und schließlich auf geheimnisvolle Weise verschwinden.
Deuticke E-Book
PETER HENISCH
Der Mai ist vorbei
Pepi Prohaska Prophet
Zwei Romane
Deuticke
Inhalt
Der Mai ist vorbei
Pepi Prohaska Prophet
Der Mai ist vorbei
Erster Tag
Kinder die Zeit ist mir nicht mehr geheuer
wir leben schon wieder im Biedermeier
und wissens
und wollens nicht wissen
und wissens nicht /
jetzt liegen frustrierte Linke in ihren zu engen Ehebetten
und diskutieren was sie zu tun gehabt hätten
wenn
wenn anders
wenn nicht /
jetzt sagen so manche die etwas sagen sollten nicht einen Ton
natürlich ist es empfehlenswerter zu schweigen
die Pharisäer jedoch haben wieder Saison
und können mit nackten moralischen Fingern auf andere zeigen
und die Hausmeister haben sich das schon immer gedacht
und dürfen auch ausführlich drüber sagen und schreiben
das Rauschgift der freie Sex und die Antiautorität haben alles zu weit gebracht
so konnte es ja nicht bleiben /
der Mai ist vorbei und kommt voraussichtlich nimmermehr
nach einem typisch bürgerlichen Geschlechtsverkehr
(sie auf dem Rücken liegend ich auf ihr drauf)
dreh ich das Radio an da rockt Bill Haley der Opa noch immer schon wieder around the clock
oh weh sag ich Reminiszenzen auf den naiven Rock
wenn die Musik sich zurückwendet stehen die Mauern der Stadt wieder auf
1
Früher hatte sich Paul für einen Morgenmenschen gehalten, aber das war eine Weile her. Jetzt fiel es ihm immer schwerer, aus seinen Träumen herauszufinden, obwohl diese Träume immer seltener angenehm waren. Er lag auf dem Rücken, studierte die Risse über sich im Plafond. Der Traum, den er heute geträumt hatte, ließ ihn besonders lange nicht los:
Er war noch Schüler und lief, die Schultasche unter dem Arm, seinen üblichen Schulweg. Er wusste: Es musste schon spät sein; als er jedoch auf die Uhr sehen wollte, um festzustellen, wie viel Zeit er noch habe, bemerkte er mit einem Schrecken, der für diesen Anlass zu groß war, dass er sie nicht am Handgelenk trug. Endlich langte er vor dem Schulhaus an; als er die Aula betrat, war sie still und leer. Die Schuluhr über dem Stiegenaufgang zeigte halb neun.
Er lief die Treppe hinauf, wobei er immer zwei Stufen auf einmal nahm. Im ersten Stock, auf dem Gang, an dem sich sein Klassenzimmer (8B) befand, verursachten seine Schritte ein lautes Echo. Vor der Tür seiner Klasse blieb er kurz stehen, um Luft zu holen, von drinnen kam kein Geräusch. Dann gab er sich einen Ruck und griff nach der Klinke.
Er drückte die Klinke herunter und machte die Tür auf. Erschrak aufs Neue: Das Klassenzimmer war leer.
Die Tafel war sauber gelöscht, die Sessel standen verkehrt auf den Tischen. Kein einziger Mantel hing an der Kleiderablage.
Er atmete durch und lief eine Klasse weiter. Griff nach der nächsten Klinke: das gleiche Bild. Die nächste Tür. Er drückte die Klinke hinunter. Das Klassenzimmer war leer, wie die beiden zuvor.
Paul lief weiter und weiter. Ein Stockwerk höher. Öffnete Tür um Tür. Mit dem gleichen Ergebnis. Er kam ins Schwitzen. Sein Herz begann etwas zu stechen. Aber er konnte seine Klasse nicht finden.
Paul stand auf und zog die Vorhänge zu. Die alte Frau vis-à-vis, die ihn jeden Morgen, seit er hier hauste, mit offensichtlichem Misstrauen beobachtete, war wieder am Fenster. Vielleicht hätte er sich als Exhibitionist produzieren sollen, um sie ein für alle Mal von ihrem Fenster zu verscheuchen. Aber sie war imstande und rief die Polizei.
Er zog das verschwitzte Pyjama aus und fuhr in die am Vorabend neben die Couch hingestellten Jeans. Er war davon abgekommen, Unterhosen zu tragen, seit er alleine lebte. Du wirst schon sehn, wie das ist, wenn dir niemand mehr deine dreckige Wäsche wäscht, hatte Silvi gesagt. Schön. Jetzt sah er das also. Es war zu ertragen.
Er suchte die Hausschuhe, die ihm Fritz hinterlassen hatte (zwei Nummern zu groß). Fand sie weder unter der Couch noch unter dem Schreibtisch, aber unterm Klavier. Schleppte sich in die Küche, nahm das Lavoir vom Waschtisch. Sperrte die Tür auf, schlurfte hinaus auf den Gang.
Wie meistens, seit er hier wohnte, traf er die Nachbarin.
»Guten Morgen!«
Die Nachbarin sagte: »Mahlzeit.«
Sie schaute zur Seite (sein nackter Oberkörper gehörte sich nicht). Sie trug auf dem linken Arm eine volle Einkaufstasche, auf dem rechten ihr Kind.
Das Kind fing an zu krähen und erinnerte ihn an Dany. Er schluckte, deponierte das Lavoir auf dem Fensterbrett, verdrückte sich aufs Klo. Als er wieder herauskam, war die Nachbarin mit dem Kind schon in ihrer Wohnung verschwunden. Paul nahm das Lavoir vom Fensterbrett, hielt es unter den Wasserhahn der Bassena, ließ Wasser ein.
Er bemühte sich, nichts zu verschütten, als er zurück in die Küche kam, die Tür mit dem Ellbogen öffnend und mit der Ferse schließend. Stellte das Lavoir wieder auf den Waschtisch, goss ein bisschen Wasser in die Teekanne, die er zwischendurch auf den Kocher setzte, warf sich den Rest ins Gesicht und unter die Achseln. Als er mit der Zahnbürste den Backenzahn berührte, aus dem ihm erst unlängst eine große, bleigraue Plombe gefallen war, wachte er endgültig auf. Er ging ins Zimmer, griff sich die gestern zur Hälfte geleerte Sliwowitzflasche vom Schreibtisch, nahm einen Mund voll.
Dann schob er ein Tonband in den Kassettenrekorder (Vivaldis »Vier Jahreszeiten«, die er zum Frühstück liebte, obwohl er sich, seit er beim Frühstück allein war, jedes Mal, wenn der Sommer kam, einbildete, das sei schon der Herbst, und sich dann wunderte, dass es danach noch zwei Konzerte gab, statt, wie erwartet, nur mehr eines …), nahm die Teekanne vom Kocher und hing das Tee-Ei hinein. Eigentlich hatte er lieber Kaffee zum Frühstück, aber der Akt des Abwaschens nach dem Kaffeetrinken erforderte viel mehr Aufwand. Und dann saß er da, die Hände um die Tasse gelegt (wie immer die letzten drei Wochen fror er ein wenig, auch wenn draußen die Sonne schien). Und dann (die I Musici waren mit dem Frühling noch nicht zu Ende) klingelte das Telefon.
Sofort, als er Fiedlers korpulente Stimme erkannte, bereute es Paul, das Telefon noch nicht abgemeldet zu haben. Er hatte gedacht, es genüge, die Rechnung nicht zu bezahlen, aber die von der Telefonzentrale zeigten eine unverständliche Langmut. In den ersten Tagen, nachdem er hier eingezogen war, hatten eine männliche und mehrere weibliche Stimmen angerufen. Er hatte dann jedes Mal erklären müssen, dass er wirklich nicht Fritz sei, großes Ehrenwort, sondern ein Freund, und Fritz sei in Südamerika.
Man hatte ihm selten Glauben geschenkt (»Na hör’ einmal, Fritz, mach’ keine blöden Witze« etc.), sodass er sich vorgenommen hatte, nicht mehr abzuheben, bis das Geklingel von selbst aufhöre. Aber er hatte diesen Vorsatz nicht durchgehalten, er war noch immer ein neugieriger Mensch, und besonders die weiblichen Stimmen schienen ihm interessant. Und vielleicht hatte er insgeheim gehofft, Silvi würde ihn anrufen und ihn bitten, nach Hause zurückzukommen. Aber Silvi hatte das nicht getan.
»Hallo Meister!«, sagte Fiedlers Organ.
Paul hasste es, wenn Fiedler ihn Meister nannte.
»Was ist denn los mit Ihnen? Sind Sie gestorben?«
Woher verdammt noch einmal hatte Fiedler die Nummer?
»Sie sind mir einer!« (Fiedler klang amüsiert.) »Zuerst einen Vorschuss kassieren und dann verschwinden!«
Paul sagte nichts. Was hätte er sagen sollen?
»Hören Sie zu: Ich hab einen Auftrag für Sie.«
Paul sah sein Gesicht im Spiegel, der über dem Telefon hing und nicht geputzt worden war, seit er diese Bude von Fritz geerbt hatte, und offensichtlich hatte auch Fritz den Spiegel lang nicht geputzt. Es hatte eine Zeit gegeben, da hatte ihm sein Gesicht gefallen, aber die war vorbei. Nun überlegte er manchmal, ob es nicht besser wäre, wenn er es völlig zuwachsen ließe. Aber immer, wenn seine Bartstoppeln drauf und dran waren, die Abstände zwischen dem Knebelbart, den er seit Jahren trug, und den Koteletten zu überbrücken, rasierte er sie wieder ab.
Der Auftrag, einen Artikel über das Achtundsechzigerjahr zu schreiben, war ihm sofort zuwider.
»Jetzt«, sagte Fiedler, »ist die Zeit für die Retrospektive gekommen. Jetzt, wo wir wissen, Sie und ich, wie der Hase läuft. Jetzt, da wir endlich eine Tendenzwende haben …«
Was er sich vorstelle, seien zehn hübsche Normalseiten über das Jahr 68, die einen eleganten Bogen von den idealistischen Anfängen der Studentenbewegung zu deren terroristischen Auswüchsen spannten. Die Meinung des Verfassers, fügte er rasch hinzu, müsse sich keineswegs decken mit der Meinung der Redaktion oder umgekehrt, das letzte Wort habe ohnehin der Chefredakteur. Na Spaß beiseite, er lege im vorliegenden Fall sogar besonderen Wert auf persönliche Sicht, das sei ja der Grund, warum er sich mit diesem Auftrag ausgerechnet an Paul wende. Habe er doch auf dem Schutzumschlag eines verramschten Buches (»Nehmen Sie’s leicht …«) erst unlängst gelesen, der Autor Paul Grünzweig hätte alles Mögliche und Unmögliche studiert und im Sog der sogenannten Bewusstseinsrevolution des Jahres 68 sein Studium aufgegeben …
Mist, dachte Paul, das hat man von seinem Image. Die Veteranen des Jahres 68 … Die sogenannte Bewusstseinsrevolution … Schon das Wort an sich war ein Widerspruch.
»Also, mein Bester, wie gefällt Ihnen das?«
Das Sein bestimmt das Bewusstsein, nicht umgekehrt.
»Das muss doch für Sie ein gefundenes Fressen sein! Also wollen Sie oder wollen Sie nicht?«
Nein! Paul hätte ein deutliches Nein sagen sollen. »Ich mag eine Weile keine Artikel mehr schreiben. Prinzipiell. Und diesen Artikel schon gar nicht.« Aber das Neinsagen fiel ihm von jeher schwer.
Vielleicht war es seine Eitelkeit, die daran Schuld trug, vielleicht seine Feigheit. Er fühlte sich immer wieder geschmeichelt, wenn irgendein Zeitungsheini irgendwas von ihm wollte. Das war, als hätte er ständig Angebote bekommen, mit Leuten zu schlafen, die ihm eigentlich gar nicht gefielen. Er brachte es nicht übers Herz, sich die diesbezügliche Selbstbestätigung zu versagen.
Außerdem spielte natürlich die Existenzangst eine nicht unerhebliche Rolle. Heute bekam er noch Vorschüsse, aber morgen?
»Ich arbeite«, log er, »an einem neuen Roman. Und habe ein altes Drehbuch fertigzustellen.«
»Na gut, wie Sie meinen, Herr Grünzweig«, sagte Fiedler. »Ich zwinge Sie nicht. Ich könnte Sie gar nicht zwingen. Wir leben schließlich in einer Demokratie. Zahlen Sie halt Ihren Vorschuss beizeiten zurück. Sie werden doch sicher nicht verklagt werden wollen? Das würde doch unserem netten Verhältnis nicht guttun. Und was den Artikel betrifft, vergessen Sie ihn. Ich glaube, den biete ich halt dem Wüstenrot an.«
Das war der Vorteil der freien Mitarbeit. Man konnte zwar nein sagen, aber dann trug man die Folgen.
»Hallo, Herr Doktor, sind Sie noch dran?«, sagte Paul. »Ich hab mir das überlegt. Ich schreib den Artikel.«
Paul legte den Telefonhörer auf die Gabel zurück, allzu sanft, wie ihm vorkam, und drehte den Vivaldi, der inzwischen im Spätsommer war, ab. Er gönnte sich, obwohl ihm der Backenzahn nicht mehr wehtat, einen zweiten Schluck Sliwowitz und setzte sich an den Schreibtisch. Die paar Zeilen an Silvi, die er nie abgeschickt hatte (Liebe Silvi! Ich weiß nicht, ob eine Zweierbeziehung wie unsere heute noch funktionieren kann …), das Aerogramm an Fritz, das er hatte beenden wollen (Bester Fritz! Mag sein, es ist wirklich das Klügste, auf und davon zu fahren …), und in der Schreibmaschine noch immer das Blatt von gestern Abend:
Vielleicht wäre alles anders gekommen, wäre damals Schubert nicht wieder aufgetaucht.
Seit sich Paul hierher zurückgezogen hatte, versuchte er, sich darüber klar zu werden, wie alles gekommen war. Aber es fiel ihm nicht viel ein, er schrieb einzelne Sätze oder bestenfalls Absätze auf immer neu begonnene Seiten und verwarf sie wieder. So auch jetzt: Er zog das Blatt aus der Maschine, zerknüllte es, spannte ein neues ein. Aber er fand keinen anderen Anfang als diesen:
Vielleicht wäre alles anders gekommen, wäre damals Schubert nicht wieder aufgetaucht. Es hätte nie eine Wohngemeinschaft gegeben, Wüstenrot und ich, wir wären noch heute gute Freunde, Silvi und ich, wir wären noch immer beisammen. Ich hätte mein Studium fertig gemacht und wäre ein Lehrer mit dreizehn Monatsgehältern. Oder was beißt mich, dachte er, aber so völlig abwegig war der Gedanke nicht.
2
Von Paul ist die Rede, von Grünzweig, und nicht von mir. Was mich betrifft, so beginnt mein Tag schon wesentlich früher. Für gewöhnlich erwache ich an der Seite meiner Frau, die nicht Silvi heißt, am Plafond über mir gibt es keine Risse, unser Raufasertapetenhimmel ist sauber und weiß. Den Traum, den ich heute geträumt habe, habe ich vergessen.
Geweckt werden wir meistens von Miriam, die im Kinderzimmer mit ihrem Schlafsack kämpft. Sobald sie sich befreit hat, läuft sie tapp tapp tapp durchs Vorzimmer und schlüpft noch ein bisschen zu Sonja ins Bett. Manchmal lege ich mich auch noch ein wenig dazu, wenn ich von der Toilette zurückkomme, es ist schön, ihren kleinen, warmen Körper zu spüren. Aber meistens stehe ich auf und koche Kaffee.
Ich ziehe die Jalousien hoch, vor dem Küchenfenster fällt Schnee, vor dem Zimmerfenster auch. Es gibt keine alte Frau vis-à-vis (das Visavis ist auf beiden Seiten weit weg). Trotzdem hat man uns den Ausblick verstellt, den wir, als wir hier eingezogen sind, zumindest auf der Zimmerseite gehabt haben. Rundherum ist alles sozial verbaut.
Verbaut ist auch innen viel: Als die Kleine im Kommen war, hat sich Sonja hingesetzt und eine neue Ordnung entworfen. Es ist nicht meine Ordnung, aber das hört Sonja nur ungern, und außerdem ist sie praktisch. Man kann alles Mögliche an die Wand klappen: den Tisch, das Bett, außen ist weißer Schleiflack, der lässt die Räume größer wirken. Das rote Bücherregal habe ich in die Spengergasse 23 transportieren lassen, in die Bude, die Fritz mir vererbt hat, denn die gibt es wirklich.
Nicht meine Ordnung: Ehrlich gestanden, ich weiß nicht, was meine Ordnung ist. »Kein Wunder«, sagt Sonja, »das Wort Ordnung ist dir ja auch ein Fremdwort.« Aber es widerstrebt mir zum Beispiel, das Geschirr vom Abend wegzuräumen, bevor der Kaffee gekocht ist. Während Sonja, wenn sie aufsteht, um das Frühstück zu machen, das Geschirr vom Vorabend nicht sehen kann, sodass ich hören muss, wie sie damit klappert, während ich noch im Bett liege und doch weitaus lieber durch den Duft von frischem Kaffee geweckt würde.
Sonja und Miri werden zumeist durch den Geruch der übergekochten Milch geweckt. »Du kannst doch die Milch auf kleiner Flamme wärmen«, sagt mir meine Frau zum hundertsten Mal, aber ich will die Milch zum Frühstück schnell und heiß. »Du musst doch nicht unbedingt ins Badezimmer, wenn du die Milch auf dem Herd noch nicht abgedreht hast.« Es ist mir aber scheißegal, ob der Herd nachher dreckig ist, Hauptsache, ich habe mir den Schlaf aus den Augen gespült und der Kaffee ist trinkbereit. (»Du bist ein verkappter Anarchist!«, hat mir Sonja unlängst in einer Auseinandersetzung über unser politisches Bewusst- oder Unbewusstsein gesagt: Wahrscheinlich ist das ein Indiz.)
Nun sitzen Miri und ich beim Frühstückstisch und warten auf die Mama, die es sich nicht verkneifen kann, noch schnell irgendetwas Nützliches zu tun, bevor sie sich dem Vergnügen hingibt. Zum Beispiel gießt sie die Blumen auf dem Fensterbrett (genau genommen sind es ja jetzt, im Winter, nur Blätter), für deren Wachsen und Gedeihen ich, wie sie mir vorwirft, gar keinen Sinn habe. Man muss mit ihnen reden, sagt sie, und sie merken lassen, dass man an ihnen Freude hat, sonst wachsen sie nicht. Schau nur, schon wieder sind ein paar Knospen aufgegangen, und du hast nichts bemerkt.
Tatsächlich: Die einzige Pflanze, die mich je interessiert hat, war das REICH GOTTES, ein Senfkorn, das wir aus experimentellen Gründen angepflanzt haben. Zuerst ist es kleiner als alle anderen Samenkörner, doch dann wächst es hoch wie ein Baum und die Vögel des Himmels nisten darin. Wir sind also in die Apotheke und haben uns ein Päckchen Senfkörner gekauft, Sonja hat sie eingesetzt. Aber das REICH GOTTES ist nach anfänglich leidlichem Wachstum verdorrt.
Miriam wird mir von Tag zu Tag ähnlicher: Neuerdings liebt sie Identitätsspiele. »Der Papa ist die Mama«, sagt sie dann etwa, »die Mama ist die Miri, und die Miri ist der Papa.« Oder: »Die Miri ist die Mama, die Mama ist die Oma, und der Papa ist die Miri.« Erst, wenn jegliche Klarheit restlos beseitigt ist, ist sie zufrieden.
Beim Frühstück legt sie Wert auf Harmonie und Gerechtigkeit. Gibt ihr Sonja etwas von ihrem Ei, so will sie auch von mir etwas beziehungsweise umgekehrt. Wenn wir sie ansehen, müssen wir manchmal lächeln. Dann finden wir Wohlgefallen nicht nur an ihr, sondern auch aneinander.
Dieses Wohlgefallen wird empfindlich gestört, wenn mir Sonja erzählt, was sie heute alles einkaufen muss, und ich immer wieder darauf hinweise, dass unser Konto längst überzogen ist. Natürlich, sie kann nichts dafür, dass alles teurer wird, und ich kann auch nicht mehr tun, als zum Beispiel beim Fernsehen anzurufen und zu wiederholen, dass ich mein Drehbuch vor nunmehr drei Monaten abgeliefert habe und auf mein Honorar warte. »Diese Abhängigkeit von dir stört mich«, sagt Sonja, »es ist mir ganz einfach zuwider, dich um jeden Groschen anzubetteln und dann immer die gleichen Vorwürfe zu hören, bevor du dein Geldbörsel aufmachst. Froh werd ich sein, wenn wir die Kleine ab Herbst im Kindergarten unterbringen und wenn ich wieder mein eigenes Geld verdiene.«
»Aber du hörst mir ja gar nicht zu: Woran denkst du?«
»Ich denke«, sage ich, »an den Roman, den ich schreib.«
»Siehst du«, sagt Sonja, »so denkst du vor mir davon. Früher hast du mir von deiner Arbeit erzählt.«
»Was soll ich erzählen?«, frage ich, »ich weiß selbst noch nicht allzu viel. Nur dass es in dem Roman um einen mehr oder minder verkrachten Studenten, Schriftsteller und Journalisten namens Paul Grünzweig geht, der einen Artikel über das Jahr 68 schreiben soll und eigentlich nicht recht will. Und dass es mir Kopfzerbrechen bereitet, nur in der 3. Person zu schreiben, weil es mir widerstrebt, ganz einfach einen Illusionsroman zu machen. Doch bloße Autobiographie ist mir auch zu wenig.«
»Aha«, sagt Sonja, »so versteckst du dich hinter dem Paul.«
»Einerseits«, sage ich. »Andererseits wieder nicht. Kann sein, dass der Paul mir ähnlicher sieht als ich mir selbst. Und dass ich ihm ähnlicher werde, als mir lieb ist.«
Zum Abschied küsse ich meine Tochter und meine Frau und schließe die Tür hinter mir. Ich höre noch Miriams Stimme im Vorzimmer, die etwas fragt, und Sonjas Stimme, die darauf antwortet, dann übertönt das Geräusch des Staubsaugers alles, auch den Vivaldi im Rundfunk. Nein, Sonja ist keine begeisterte Hausfrau, da ist etwas Bitteres um ihre Mundwinkel, wenn sie zum Staubsauger greift. Aber einer, sagt sie, muss es doch tun.
Normalerweise fliehe ich mit dem Aufzug abwärts, doch heute muss ich zu Fuß gehn. Sie montieren uns eine Gegensprechanlage, im ganzen Haus werden Leitungen gelegt, alle Augenblicke streikt der Lift. Wir haben uns der Montage dieser Gegensprechanlage widersetzt, Sonja und ich, aber ohne Erfolg. Der Großteil der Mieter, hat es geheißen, wäre dafür.
Hausfremde Kinder im Parterre, Zigeuner und Fremdarbeiter im Stiegenhaus, Bettler und Hausierer an den Türen. Ein Mann ist im Aufzug gefahren, der hat die Frauen so merkwürdig angeschaut. Ein anderer (oder derselbe) hat sämtliche Hosenknöpfe offen gehabt. Jemand hat vor die Kellertür geschissen und oben, vor der Dachbodentür, hat einer übernachtet.
Wir haben gesagt, dass wir nichts gegen hausfremde Kinder haben, Zigeuner und Gastarbeiter mögen und Bettlern und Hausierern nicht die Türe weisen. Wir haben gesagt, dass wir die Frauen, die sich vor Männern im Aufzug fürchten, für hysterisch halten. Dass wir nichts davon bemerkt haben, wie jemand vor die Kellertür geschissen hat und dass es uns egal ist, ob einer vor der Dachbodentür übernachtet oder nicht. Und dass wir die Isolierung, die uns durch so eine Gegensprechanlage aufgezwungen wird, für bedenklich halten.
Man hat uns nicht verstanden oder nicht verstehen wollen. Frau Haslinger, die mit der Unterschriftenliste reihum gegangen ist, hat uns groß angeschaut. Ob wir denn überhaupt keine Zeitungen läsen, nicht fernsähen, nicht Radio hörten. Bankräuber, Lustmörder und Terroristen: In diesen chaotischen Zeiten könne man nie wissen.
Also werden wir die Gegensprechanlage bekommen, der Aufzug wird sicher noch öfter streiken, ich werde die fünf Stockwerke noch öfter zu Fuß gehn. Auf dem schwarzen Brett im Parterre hat es bis vor kurzem ein Plakat gegeben, aus dem hervorgegangen ist, dass eine gesunde Ehe die Keimzelle jeder Gesellschaft ist oder so ähnlich. Nur der Zettel, auf dem zu lesen steht, welche Telefonnummer man bei Leuchtgasgeruch sofort zu wählen hat, hängt nach wie vor. Und dabei ist der ganze Bezirk schon seit mehr als zwei Jahren auf Erdgas umgestellt, das ist bekanntlich nicht giftig.
Ich trete hinaus vors Haustor, es schneit noch immer. Die Krähen und Amseln haben Spuren im Schnee hinterlassen, auch dort, wo das Betreten des Rasens verboten ist: ein feines Netz. Die Bernhartstalgasse hinunter wird der Schnee immer schmutziger, zertreten von immer mehr Menschen, die zur Arbeit hasten, in der Gudrunstraße sind keine Vogelspuren mehr zu sehn. Die Luft ist eine graue, fast ungenießbare Suppe, die Gesichter derer, die an mir vorbeitreiben, wirken abgestumpft und verschlossen, in die Augen schaue ich ihnen lieber nicht.
An einer Fabrikmauer in der Nähe des Waldmüllerparks in großen roten Buchstaben die Parole PROLETARIER ALLER LÄNDER VEREINIGT, das EUCH ist nicht fertig geworden. Vielleicht liegt es einzig und allein an diesem fehlenden Wort, jedenfalls bleibt mir diese Parole eine Weile im Kopf. Ein Proletarier, habe ich einmal gelesen, ist ein Mensch, der seinen Leib und die darinnen wohnende Arbeitskraft für eine bestimmte, längerfristig fixierte Zeit zu vermieten gezwungen ist (oder so ungefähr). ich bin kein Proletarier, denke ich, nein, ich nicht.
Bei der Eisenbahnbrücke kurz vor dem Gürtel ein total zerquetschtes Autowrack. Da ist kein Abstand mehr zwischen Vorder- und Rücksitzen, das Lenkrad ragt absurd aufgebogen durch den leeren Rahmen der Windschutzscheibe, die Type ist nicht mehr erkennbar. Rundherum hat sich eine Traube von Menschen angesammelt und gafft fasziniert. »Der muss mindestens hundert draufgehabt haben«, sagt einer, »ach was«, sagt ein anderer, »mindestens hundertfünfzig.«
Spengergasse 23/19: Zimmer und Küche, 35 m2, Wasser und Klo auf dem Gang. Trotz klappernder Fliesen bin ich unbemerkt an der Wohnung des Herrn Schikaneder vorbeigekommen, dem ich noch die Miete für den letzten Monat schulde. Ich durchquere die Küche, die ich nicht benutze und (da der Herd seit der Erdgasumstellung versiegelt ist) auch gar nicht benutzen kann. Hier ist es so finster, dass ich auch am Tag das Licht aufdrehe; eine Motte flattert aufgescheucht von der nackten Glühbirne, die aus dem Plafond hängt, und wird sich, denke ich, hoffentlich wieder beruhigen.
Im Zimmer ein Schreibtisch, ein Klavier, eine Couch. Risse im Plafond, ein Luster, der beim Vorbeifahren schwerer Autos zittert. Ich gehe zum Fenster und ziehe die Jalousie hoch: die alte Frau vis-à-vis. Ich suche nach Streichhölzern, werfe den Ölofen an.
Die Bude hier ist ganz gemütlich gewesen, solange Fritz darin gewohnt hat, doch das hat sich radikal geändert. Fritz hat einen Sinn fürs Exotische gehabt und das Zimmer mit allerlei fernöstlichem Kram dekoriert. Aber als er mir die Wohnung übergeben hat, war alles abgerissen und ausgeräumt. Auf dem Boden ist Schutt gelegen, sodass ich mir einen Besen habe ausborgen müssen, und die Wände waren übersät mit Löchern von Bilderhaken und Nägeln.
Ich habe meine Pressekritiken und Plakate zum Tapezieren verwendet, aber inzwischen geht es mir auf die Nerven, so völlig von mir selbst umgeben zu sein, und ich nehme sie wieder ab. Sonst investiere ich hier keine Energie in wie immer geartete Häuslichkeit: Ich komme, um zu schreiben, und gehe, wenn ich geschrieben habe, sonst tue ich hier nichts. Auf dem Schreibtisch und auf den Sesseln türmen sich Zeitungen und Manuskripte, wenn sie zu Boden fallen, bleiben sie meistens liegen. Sonja hat ihre Ordnung, ich habe mein Chaos.
Ich setze mich an den Schreibtisch und trinke den ersten Schluck aus der Sliwowitzflasche. Ja, ich weiß, so früh am Morgen ist das schon gar nicht gesund, aber es wärmt Körper und Geist. Da sind die paar Zeilen an Sonja, da ist das Aerogramm an Fritz, da ist das Blatt in der Schreibmaschine. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wäre damals Schubert nicht wieder aufgetaucht usf.
3
An der Uni war wieder jemand gestorben. Nur wenig bewegt hing die schwarze Fahne im Wind. Genau wie damals, am Tag seines letzten Besuchs hier. Da hatte gerade der Rektor ins Gras gebissen.
Eine gewisse Scheu hatte Paul bislang davon abgehalten, hierher zurückzukehren. Hatte ihn jemand hier treffen wollen, so hatte er immer einen anderen Treffpunkt vorgeschlagen. War er zufällig in die Gegend geraten, so hatte er stets einen Bogen um die Uni gemacht. Die Uni war ein Komplex, dem er lieber auswich.
Es kostete ihn auch jetzt Überwindung genug, nicht noch im letzten Moment auszukneifen. Auf der Rolltreppe, die zum Luegerring hochführt, überlegte er, ob er nicht lieber an der Uni vorbei in den Rathauspark sollte. Die Sonne schien, die Springbrunnen waren schon in Betrieb. Anscheinend wurde das heuer ein schöner Mai.
Dann aber musste er an Fiedler denken. Zahlen Sie halt Ihren Vorschuss beizeiten zurück … Er schuldete noch die Miete für Fritzens Bude. Und außerdem war da die Drohung mit Wüstenrot.
Sicherlich war es verrückt, gerade an der Wiener Uni Inspirationen für einen Artikel über das Jahr 68 zu suchen. An der Wiener Uni, an der sich damals (abgesehen von der spektakulären Verunreinigung eines Hörsaals, die das Image der Wiener Studenten bis heute trübte: In die Hörsäle scheißen, gell ja, das könnt ihr …) eigentlich kaum etwas abgespielt hatte. Aber Paul hatte das Achtundsechzigerjahr nun einmal in Wien erlebt und nirgendwo anders. Wenn Fiedler sich einbildete, dass ausgerechnet er diesen Artikel schreiben sollte, dann musste er das in Kauf nehmen.
Paul stieg die Rampe zum Hauptportal zum ersten Male seit Jahren wieder hinauf. Was sich in Berlin getan hat, in Paris oder sonst wo, schrieb er im Geist, das haben die Wiener Studenten durchs Fenster betrachtet. Er studierte die Spuren akademischen Selbstbewusstseins auf den Plakaten links und rechts vom Portal. Sie haben Bewegungen mit- oder nachvollzogen, aber sie haben sich selber zu wenig bewegt. Eine AKTION NEUE RECHTE forderte die unverzügliche Säuberung sämtlicher Institute von bolschewistischen Elementen. Hier ist nichts geschehen, hier ist etwas passiert. Der linken Verseuchung sei endlich durch eine gesunde, rechtsorientierte Politik zu begegnen. Und passiert heißt bekanntlich vorbeigegangen.
Paul beschloss, etwas in diesem Sinn an den Anfang seines Artikels zu stellen. Ein Motto von Robert Musil (oder war es Karl Kraus, der das gesagt hatte? Er war da nicht ganz sicher) machte sich immer gut. Und außerdem ließ sich davon eine gewisse Berechtigung für den speziellen Aspekt ableiten, unter dem man das Thema von Wien aus anpacken konnte. War doch inzwischen auch anderswo eingetreten, was man hierzulande traditionsgemäß vorwegnahm, bevor man Zores bekam: die Resignation.
»Selbst in Berlin sind die APO-Genossen jetzt Kneipenbesitzer.«
Das hatte ihm unlängst einer jener Kollegen erzählt, die, in den frühen Sechzigerjahren mehr oder minder jung nach Berlin gegangen, weil man hierzulande noch keinen oder zu wenig Sinn für ihre Art von Avantgardismus gehabt hatte, nun allmählich zurückkamen, von Preisen oder der Ruhe im Lande gelockt. Und Cohn-Bendit hatte er in einer Fernsehsendung gesehen, als er den Großteil seiner Abende noch mit Silvi vor dem Bildschirm verbracht hatte. Der Kopf der Pariser Revolte hatte auch einen ganz schönen Bauch bekommen.
Paul war sich darüber im Klaren, dass er selbst ein ausgezeichneter Resignierer war. (Dass er sich diese Tatsache eingestand, war allerdings schon wieder ein Teil seiner Resignation.) Spätestens seit seiner Trennung von Silvi war Achselzucken die ihm naheliegendste Geste. Er musste sich manchmal wirklich zusammennehmen, dass er nicht unausgesetzt die Achseln zuckte.
Jetzt, als er sich die Slogans der an der Rampe aufgestellten Plakate notierte, kam er erneut in Versuchung. Er fühlte sich fast bestätigt: Das hatte ja kommen müssen … Trotzdem war er erleichtert, als er auf einem Zettel, den ihm ein Mädchen im Jeansanzug hinhielt, nur die Reklame eines Jeansshops las. Ungewohnt ordentlich faltete er den Zettel zusammen und steckte ihn ein.
Das Kriegerdenkmal für die STUDENTISCHEN HELDEN der Jahre 14 bis 18 und 38 bis 45 war frisch geputzt. Die Juristenstiege hinunter lärmten ein paar Couleurstudenten. Paul stieg die Philosophenstiege hinauf, und einen Augenblick lang hoben die wippenden Brüste zweier vermutlich erstsemestriger Mädchen, die ihm entgegenkamen, noch seine Stimmung. Doch dann erfüllte ihn dieses Flair einer derart selbstverständlichen Jugend erst recht mit Melancholie.
Er stand vor den Vorlesungsanschlägen neben dem Dekanat und kam sich vor wie beim Lesen der Speisekarte in einem Spezialitätenlokal. Die ontologische Differenz als Erkenntnisproblem, Nietzsche und seine ewige Wiederkehr. Das Angebot an kompliziert benannten Gerichten verwirrte ihn meistens. Und manchmal hatte er Lust, die Karte ganz einfach wegzulegen und den Kellner zu fragen, ob es hier nicht auch etwas Handfestes gab.
Studenten, die offenbar eilig zu ihren Kollegien mussten, rempelten ihn. Eine Zeitlang kämpfte er gegen die Strömung, dann gab er es auf. Da ihn ohnehin keine der für den heutigen Vormittag angekündigten Lehrveranstaltungen auch nur einigermaßen reizte, ließ er sich in den nächstbesten Hörsaal treiben. Es war der Hörsaal 41, den er von früher her kannte, hier hörte man Geschichte.
Die Vorlesung hatte bereits begonnen, Paul versuchte, möglichst unbemerkt zu bleiben, aber der Holzboden knarrte. Ein paar Studentinnen und Studenten drehten sich um, erschreckend glatte Gesichter. Die alten Holztäfelungen waren durch neue ersetzt, der modrige Geruch, den Paul noch immer in der Nase hatte, war einem eher sterilen gewichen, Professor Menrad, bei dem wahrscheinlich noch immer einige unabgeholte Zeugnisse auf den Namen Grünzweig lagen, war noch grauer geworden. Sein früher schon nicht besonders flüssiger Vortrag war fast völlig vertrocknet.
Es ging um die Französische Revolution und die Frage, ob sie von oben herab gekommen sei oder von unten herauf. Rousseau, sagte Menrad und nahm seine Brille ab, wodurch seine Augen einen stumpfen Ausdruck bekamen, als seien sie nicht imstande, bis zur ersten Reihe zu sehn, Beaumarchais. Einer der Studenten, der einen blonden Vollbart über einem indischen Hemd trug, zeigte auf, als hätte er einen Einwand, aber dann stand sein Arm in der Luft, wie vergessen, und sank allmählich wieder herab. Die Empörung des Volkes, sagte Menrad, und setzte seine Brille wieder auf die Nase, um über seine Studenten hinweg auf einen offenbar weit entfernten Punkt zu blicken, venerische Krankheiten am Hofe Ludwigs XVI.
Paul ließ die Tür hinter sich zufallen, stand einen Augenblick unschlüssig und ging dann den Gang Richtung Universitätsbibliothek. Recherchieren, einige Zeitungen aus dem Jahr 68 durchblättern. Vor dem Eingang zum Katalograum standen zwei auffallend blasse junge Männer mit runden Nickelbrillen und Seehundfrisuren. Sie sahen einander so ähnlich, dass Paul vorerst glaubte, die Flugblätter, die sie ihm zusteckten, seien die gleichen.
Dass er sie nicht auf der Stelle studierte, hing mit dem Blick zusammen, der ihn in diesem Moment vom Eingang des Lesesaals traf. Ein Bick aus tiefen, etwas zu weit auseinanderstehenden Augen. Das Mädchen hatte brünette, seidige Haare, ein rundes Gesicht, und trug einen quergestreiften Pullover. Paul versuchte, sich zu erinnern, woher er sie kannte, doch es gelang ihm nicht.
Es würde, sagte der Bibliothekar, bis zum Nachmittag dauern, bis die Zeitungen kämen. Also entschloss sich Paul, in die Mensa zu gehen. Er stieg die Wendeltreppe zum Hinterausgang der alten Uni hinunter, überquerte die Straße, legte, da es zu tröpfeln begann, die hundert Meter zum neuen Gebäude im Laufschritt zurück. Als er dort ankam, war er ziemlich außer Atem.
Eine beachtliche Schlange von Hungrigen stand vor dem Paternoster. Paul erinnerte sich eines alten Tricks und lief ein Stockwerk hinauf. Als er dort zustieg, waren drei Burschen in der Kabine und das Mädchen im Ringelpullover. Ihre Augen fesselten ihn bis zum siebenten Stock.
In der Mensa hatte sich auch so manches verändert. Es gab neue Tische, und ihre Anordnung erinnerte nicht mehr so schlimm wie früher an die in einem Heim. Dort, wo vor Jahren das Professorenzimmer gewesen war, gab es jetzt ein durch allerlei Blattpflanzen vom übrigen Raum abgeteiltes Espresso. Paul drängte sich an einen Fensterplatz, legte seine Kappe auf den Tisch, holte sich ein Glas Bier und ein russisches Ei.
Als er das russische Ei gegessen hatte, kam Schestak herein.
Paul wollte schon Leo (den Vornamen Schestaks) rufen, doch irgendetwas am Aussehen seines alten Kollegen machte ihn stutzig.
Endlich begriff er: Schestaks ehemals bis an die Schultern reichende Locken waren gefallen. Und der schlottrige Schnürlsamtanzug, den er stets getragen hatte, war mit einem dezenten Freizeitanzug aus blassbraunem Leinen vertauscht.
Paul machte den Mund wieder zu, aber Schestak hatte ihn schon erblickt. Er kam mit zum Händeschütteln gestrecktem Arm auf ihn zu und einem Lächeln, das eine gute Minute nicht aus seinem Gesicht wich.
»Ja ist das die Möglichkeit«, sagte er, »dass man dich wieder einmal hier sieht? Bist du vernünftig geworden und machst dein Studium fertig?«
»Nein«, sagte Paul, und Schestaks Formulierung befremdete ihn ebenso sehr wie sein verändertes Aussehen. Er sitze ganz einfach so da und trinke sein Bier. (Jetzt endlich schaltete Schestak sein Lächeln ab.) »Aber du«, fragte Paul, »was machst du denn noch hier?«
»Tja, weißt du«, erwiderte Schestak, »das hier ist jetzt mein Arbeitsplatz.«
»Was? Die Kantine?«
»Blödsinn! Das Institut.«
»Das Institut?«
»Na ja, ich bin Assistent.«
»Beim Alten?«
»Genau. Bei Professor Kilian.«
Er holte sich ein Glas Mineralwasser und nippte daran mit dem Ausdruck eines Menschen, dem es nicht schmeckt. »Die Nieren«, sagte er, »Schluss mit dem Alkohol. Der Onkel Doktor hat mir das Saufen verboten. Tja, mein Lieber, wir sind nicht mehr die Jüngsten!«
Paul schwieg. Es hatte ihm wirklich die Rede verschlagen. Schestak und Assistent bei Kilian!
»Ich kann mir vorstellen«, sagte Schestak, »was du jetzt denkst. Du musst aber wissen: Heute ist vieles ganz anders.«
»Du hättest ja auch nicht auf stur schalten müssen damals. Was hat denn das für einen Sinn auf längere Sicht? Du könntest dich immer noch mit dem Chef arrangieren. Im Grund genommen ist er gar nicht so übel.«
Professor Kilian und seine salbadernde Art! Beim Reden die Hände gefaltet, die Augen zur Decke gedreht. »Die Wahrheit, meine Damen und Herren, ist die Wahrheit des Ganzen!« (Auf Details war er lieber nicht eingegangen.)
»Du lieber Himmel, können Sie nicht über etwas anderes dissertieren? Wir haben doch nichts als marxistische Dissertationen! Was halten Sie beispielsweise vom Strukturalismus? Oder vom Pessimismus bei Schopenhauer?
Verstehn Sie mich recht, Kollege, ich rede Ihnen nichts aus. Aber ich glaube, Sie überschätzen den Trend. Das hier ist Wien, mein Lieber, und nicht Paris! Wir werden ja sehen, wer auf dem längeren Ast sitzt …«
»Ich war ja auch in der Institutsvertretung«, sinnierte Schestak. »Ich war ja genau wie du als Linker verschrien. Und jetzt – du siehst ja: Es ebnet sich alles ein. Ganz ehrlich, du warst schon ein bisserl paranoid.«
Als Paul durch den Speisesaal in Richtung Paternoster zurückwollte, sah er das Mädchen im Ringelpullover zum dritten Mal. Sie wickelte die Spaghetti, die es heute zum Mittagsmenü gab, mit einer derart eifrigen Hingabe, dass er Appetit bekam. Sobald sie ihn bemerkte, lächelte sie und hatte dabei Grübchen in den Wangen. Paul erschrak, eine, wie er fand, völlig inadäquate Reaktion, und schlüpfte, nachdem er ihr kurz und unentschlossen zugenickt hatte, in den Paternoster.
Später, im Lesesaal (er hatte sich gesetzt und schaute quer durch den Raum einem Bibliothekar zu, der in der Nase bohrte und, was er auf diese Weise zutage förderte, geistesabwesend aufaß), fiel ihm ein, wer das Mädchen sein könnte oder an wen sie ihn zumindest erinnerte. Julia: Er hatte ihr Nachhilfestunden gegeben, da war sie dreizehn gewesen, er fünfundzwanzig. Damals schon hatten ihn ihre Augen verwirrt. Er hatte die Nachhilfestunden abbrechen müssen.
Er versuchte, sich von seiner Nachhilfeschülerin (dem Mädchen, das seiner Nachhilfeschülerin ähnlich sah) abzulenken, und erinnerte sich an die beiden Flugblätter, die er ihretwegen noch nicht gelesen hatte. Sie stammten von zwei verschiedenen linken Fraktionen, die einander offensichtlich nicht mochten. Die einen beschimpften die anderen als Revisionisten, die anderen warfen den einen Trotzkismus vor. Beide gebrauchten dieselben Ausdrücke, um zu beweisen, sie seien (zum Unterschied von den anderen) die wahren Linken.
Beide schienen keine andere Sorge zu haben als die Reinheit ihres marxistisch-leninistischen Glaubens. Das aktuelle Problem (eine Aktion gegen den versteckten Numerus clausus bei Seminaren) war da nur Mittel zum Zweck. Paul versuchte, die Flugblätter zu Papierflugzeugen zu falten, aber er musste feststellen, dass er das nicht mehr konnte. Und dabei war er als Bub ein Meister im Papierflugzeugfalten gewesen: So ändern sich die Zeiten.
4
Paul knipste die Leselampe an, konnte sich nur schwer vom Anblick ihres grünen Schirms losreißen, der das Licht auf eine ebenso eigenartige Weise absorbierte wie seine Aufmerksamkeit, und musste sich schließlich regelrecht dazu zwingen, die Zeitungsbände aus dem Jahr 68 aufzuschlagen. Er konzentrierte sich vorerst auf die Osterdemonstrationen in Deutschland, die Mairevolte in Frankreich, fand aber keinen Einstieg in seinen Artikel. Er las Sätze wie: Es kam zu Straßenschlachten, wie sie Westdeutschland seit dem Ende der Weimarer Republik nicht mehr erlebt hatte; oder: Laut hallte der Kampflärm der neuen Französischen Revolution durch das Land; er identifizierte sich mit der Empörung der deutschen Kollegen über die gegen sie entfachte Pressehetze, mit dem Engagement der französischen Kommilitonen für eine spontane Sprengung des gaullistischen Systems. Er entdeckte nur oberflächlich verschüttete Aggressionen gegen die Hüter von Ruhe und Ordnung wieder, als er sich die (vermutlich ohnehin frisierten) Zahlen verletzter und toter Demonstranten im Vergleich zu denen verletzter und toter Polizisten notierte.
Da war die Erinnerung an zwei Wachleute, die er einmal in der Nähe des Südbahnhofs einen Gastarbeiter zusammenschlagen gesehen hatte. Er wusste nicht, ob sich der Mann etwas hatte zuschulden kommen lassen und was, aber er sah, wie die zwei Polizisten, zwei von der dicken, freundlich wirkenden Sorte, noch auf den Mann lostraten, wie auf einen Fußball, als der längst auf dem Boden lag und sich vor Schmerzen krümmte. Und schon das bloße Zusehen hatte wehgetan, Paul hatte die Stiefel der Polizisten in seinen Nieren und seinen Hoden gespürt. Da hatte er den Blick gesenkt, um das nicht länger mit ansehen zu müssen, und war weitergegangen.
Aber das war wohl schon vor 68 gewesen und gehörte nicht hierher. Konnte schon deswegen nicht hierhergehören, weil sich Paul dann Rechenschaft darüber hätte ablegen müssen, warum er diese Szene nur mit angesehen hatte, bis er sie nicht mehr hatte mit ansehen können, und sonst nichts. Und außerdem hätte Fiedler das nicht akzeptiert: »Was haben die Tschuschen mit den Studenten zu tun?«
Was indessen Deutschland und Frankreich betraf, so hatte Paul das Gefühl, dass er seinen Artikel nicht mir nichts, dir nichts damit beginnen konnte, wollte er nicht schon vom ersten Wort an lügen. Er überlegte, was er von alldem bemerkt hatte, damals, im Jahre 68, von Wien aus, was in ihm Enthusiasmus, Erschütterung oder wenigstens eine Art von Betroffenheit ausgelöst hatte, und musste sich eingestehen, dass das nicht allzu viel war. Ganz zu schweigen von irgendwelchen, über solch unverbindliche Mitgefühle hinausreichenden Reaktionen. Sicher, er hatte so manches gehört und gelesen, so manches im Fernsehn gesehen: Aber was hatte das für ihn bedeutet?
Er erinnerte sich, dass ihn das Attentat auf Rudi Dutschke beeindruckt hatte, genauer: die Schlagzeile einer Zeitung (welcher?) an einem Zeitungskiosk, in der von diesem Attentat die Rede war (in welchen Worten?). Das war, fiel ihm ein, auf der Wiedner Hauptstraße gewesen, nicht weit von der Wohnung seiner Mutter, die er besuchen wollte, um ihr zu sagen, dass er Silvi demnächst heiraten werde. Er kaufte sich die Zeitung und überflog den Artikel, aus dem hervorging, dass Dutschke vor dem SDS-Hauptquartier auf dem Kurfürstendamm von einem antikommunistischen Anstreicher namens Bachmann in Kopf, Hals und Brust geschossen worden war. Dutschke, der zum Zeitpunkt des Attentats auf einem roten Damenfahrrad gesessen sei, habe, stand da zu lesen, auf die Straße stürzend, seine festverschnürten Schuhe verloren.
Noch als er das Haus betrat, in dem seine Mutter wohnte, hatte Paul dieses Detail im Kopf, sodass er, in den Anblick seiner eigenen, schlecht geputzten Schuhe versinkend, mitten auf der Treppe stehen blieb. Was muss das doch, dachte er, für eine Art von Gewalt sein, die einen Menschen buchstäblich aus den Schuhen wirft? »Weißt du schon, Mama«, sagte er, als er sich kurze Zeit später auf die Küchenbank setzte und seine Mutter ihm eine Tasse Kaffee hinstellte, »den Dutschke haben sie angeschossen!« »Nein«, sagte seine Mutter, »wer ist der Dutschke?«
Er versuchte, seiner Mutter zu erklären, wer Dutschke sei und welche Funktion er habe, aber das war gar nicht so einfach. »Der Ideologe des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, na gut, aber was ist der Sozialistische Deutsche Studentenbund? Aha, und wofür oder wogegen sind die, die sind zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg und gegen die Manipulation durch den Axel-Springer-Konzern, die sind für den Sozialismus. Na schön, dass man gegen den Vietnamkrieg ist, das sehe ich ein, aber wer ist der Herr Axel Springer und was heißt Manipulation – und Sozialismus: Dafür ist doch der Kreisky auch.«
Paul gab sich Mühe, seiner Mutter begreiflich zu machen, was er für den Unterschied zwischen Sozialismus und Sozialismus hielt, aber mit wenig Erfolg. Es ging ihm dabei so ähnlich wie Ferry Lampel, dem Linksaußen des philosophischen Instituts, den er unlängst auf dem Floridsdorfer Schnellbahnhof vor Arbeitern reden gehört hatte. Lampel hatte den Arbeitern Klassenbewusstsein beibringen wollen, die Arbeiter waren gegangen. Pauls Mutter stand auf und begann, das Geschirr abzuwaschen.
Paul ließ die Ideologie und versuchte es mit einer eher existentiellen Argumentation, die ihm ohnehin besser lag. Dass dieses Leben, in dem man zwei Drittel seiner Zeit mit einer Tätigkeit verbringe, die einen im Grund genommen nichts angehe, kein Leben sei. Dass man sich unausgesetzt vertrösten lasse und selber vertröste (auf den Abend, den Sonntag, den Urlaub, auf die Pension), bis es nichts mehr gäbe, worauf man sich vertrösten oder vertrösten lassen könne. Dass man vor lauter Scheinbedürfnissen, die man sich einrede oder einreden lasse, gar nicht dazu komme, seine wahren Bedürfnisse zu erkennen, entsprechend zu artikulieren und in Solidarität mit anderen zu realisieren.
Was nun den Sozialismus beträfe, den er meine, so wäre der ein Zustand, in dem dieses Leben eine andere Qualität bekäme (wodurch?). In dem jeder Einzelne seinen wahren Bedürfnissen lebe, dieselben aber mit den Bedürfnissen der Allgemeinheit vermittle (wie?). Er versuchte, den jungen Marx zu zitieren, den er dem alten bei weitem vorzog: irgendetwas von Fischen am Morgen und vom Schreiben am Nachmittag oder umgekehrt (stand an dieser Stelle auch etwas von Fabrik- und Büroarbeit?). Aber es ging nicht so recht und vielleicht verwechselte er auch den jungen Marx mit dem alten Hemingway.
»Nein«, sagte seine Mutter, »das verstehe ich nicht.« (Und es waren nicht nur einige der von Paul verwendeten Fremdwörter, die sie nicht verstand.) »Man muss doch arbeiten, dass man sein Geld verdient! Heute geht es uns ohnehin besser als früher.«
»Warum so überstürzt?«, fragte sie in Bezug auf die geplante Heirat, »willst du nicht erst dein Studium fertig machen oder kriegt ihr ein Kind?«
»Nein«, sagte Paul, »wir kriegen kein Kind, aber Silvi bekommt eine Wohnung.«
»Du wirst sie doch hoffentlich nicht wegen dieser Wohnung heiraten wollen? Paul! Sei vernünftig! Du hast doch dein Untermietzimmer!«
»Blödsinn!« Paul schob gereizt die Tasse Kaffee weg. »Seit Jahren gehen wir miteinander. Wir haben uns gern.«
»Ja«, sagte seine Mutter. »Natürlich. Ich weiß. Aber jetzt sieht das alles ganz anders aus.«
Und woher hatten Silvis Eltern plötzlich das Geld, ihrer Tochter eine Wohnung zu kaufen? Und wieso wollten sie auf einmal, dass Paul und Silvi heirateten, noch dazu kirchlich? Paul hatte immer behauptet, sie mochten ihn nicht. Die ganze Geschichte war seiner Mutter verdächtig.
Und Paul erzählte von dem Bausparvertrag, den der Bundesbahnrevisor Josef Schmitz und seine Frau Stefanie für ihre Tochter abgeschlossen hätten, vor Jahren schon, und jetzt sei eben das Geld da. Und von ihrer unerschütterlichen Überzeugung, dass es sich nicht gehöre, in einer so zivilisierten Wohnung (mit Abschluss des Kaufvertrages wurde man schließlich Grundbesitzer …) eine wilde Ehe zu führen. Im Übrigen halte er die unerwartete Bereitwilligkeit dieser Leute, ihn, Paul, als Schwiegersohn zu akzeptieren, nachdem sie das sogenannte Verhältnis ihrer Tochter zu ihm jahrelang hintertrieben hätten, für bloße Taktik. »Sie haben uns«, sagte er, »nicht im Bösen auseinandergebracht, jetzt versuchen sie’s im Guten.«
Doch diese Taktik, erklärte er, werde ihnen nichts nützen. Weil es ja, wenn man sich gernhabe, gar keinen Unterschied mache, ob man verheiratet sei oder nicht. Ganz abgesehen davon, dass er dann für das noch zu ihrer Großjährigkeit fehlende Jahr Silvis Vormund sei. Und nicht mehr ihr Vater, der autoritäre Scheißer!
»Na ja«, sagte Pauls Mutter, »des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Wenn du sie heiraten magst, so wirst du sie heiraten, aber mach dir nichts vor. Man heiratet nicht aus strategischen Gründen, sondern weil man es will. Sie ist außerdem ein liebes Mädchen, ich werde sie gernhaben als Schwiegertochter, daran sollst du nicht zweifeln.«
Und dann war Paul von seiner Mutter weggegangen, um Silvi zu treffen, und hatte im Arthaberpark auf sie gewartet. Und als sie ihn sah, der wie immer beim Uhrturm saß, begann sie zu laufen, und da wippte ihr Rossschweif. Und Paul, der den Rhythmus ihrer Schritte erkannte, schaute von seinen Schuhspitzen auf, die er bisher angestarrt hatte, und lief ihr entgegen. Und auf Dutschke, der, irgendwo fern in Berlin im Krankenhaus lag, kam er erst später zu sprechen.
Und dann waren die Feiertage gekommen, und er war mit Silvi in die Wachau gefahren, und die Bäume hatten geblüht. Und natürlich war ihnen der angeschossene Dutschke hier und da eingefallen und sie hatten auch zwei oder drei Mal in die Zeitung geschaut, doch da standen Nachrichten aus einer anderen Welt. Zigtausende, berichteten die den Selbstbedienungsaufstellern entnehmbaren Blätter in einem Tonfall zwischen Faszination und Entsetzen, wobei das Entsetzen in genau demselben Maß oder Unmaß zunahm, in dem sich die Wut der Demonstranten gegen die Fensterscheiben und Auslieferungsautos des Springer-Konzerns entlud (auf einmal ging es nicht mehr um ideelle Werte, die man begrüßte oder ablehnte, sondern um Sachwerte, die der »akademische Mob« kaputtschlug, und wo die Gefährdung des Privateigentums anfing, da hörte sich alles andere auf, auch die Diskussion um die Begrenzung der Manipulation und die Bedingung ihrer Möglichkeit, schrieb Paul und strich die letzten Worte wieder durch, denn die hätte ihm Fiedler ohnehin gestrichen, »Sie sollen mir einen halbwegs lesbaren Artikel schreiben, lieber Freund, und keinen kryptomarxistischen Essay …«), Zigtausende protestierten und demonstrierten, marschierten und stürmten drei Tage lang durch die meisten größeren Städte Deutschlands. Und kamen nur durch die staatlich sanktionierte Gewalt von Gummiknüppeln, Wasserwerfern und Tränengas wieder zur Raison, die ja nur angriff, weil sie etwas zu verteidigen hatte.
Aber das war Geschichte, die da irgendwo ablief, die sie jedoch nicht einmal via Fernsehen miterlebten. Sie schliefen zusammen auf blumigen Wiesen und fühlten sich und einander ganz als Natur. »Liebst du mich?«, fragte Silvi Paul, und Paul sagte: »Ja.« Und nur einmal, mitten in einer Umarmung, sah Paul ein Gesicht, das über eine Böschung spähte, aber davon sagte er Silvi nichts.
Ihm fiel die Rede des Generals de Gaulle ein, die sie im Radio gehört hatten, als sie, ein paar Wochen später schon Eheleute, ihre frisch bezogene Wohnung bewohnbar machten. Sie standen in einem kahlen Zimmer ohne Vorhang, Silvi, Paul und der Bundesbahnrevisor Josef Schmitz, der es sich nicht hatte ausreden lassen, ihnen zu helfen, und klebten Tapeten. Paul benahm sich dabei ziemlich ungeschickt, wo immer er am Werk war, entstanden Luftblasen, die man später ausbügeln musste. »Eins sag ich dir gleich, dieser komische Mensch hat zwei linke Hände, nicht einmal einen Nagel einschlagen kann der«, hatte ihn Silvis Vater schon längst durchschaut.
Machten sie eine Pause, so setzten sie sich auf die Couch, das vorläufig einzige Möbel im Raum, und schauten durchs Fenster, durch das es noch eine weite Aussicht gab, und in der Ferne, jenseits der Schrebergärten, einen richtigen Horizont. »Das können’s mir glauben, dass das nicht gutgehen kann«, sagte der Schwiegervater zu Paul (sie waren noch immer per Sie), »der ganze französische Spuk ist ja völlig konfus. Ich war im Vierunddreißigerjahr dabei, Gewehr im Anschlag an einem Klofenster im Karl-Marx-Hof, ich weiß, wovon ich red’. Wir waren gut organisiert, besser jedenfalls als diese französischen Rotzbuben heutzutag, aber was hat uns das genützt? – Militär haben sie gegen uns eingesetzt und mit Kanonen auf die Gemeindebauten geschossen, das war der Effekt. Und die meisten von uns haben sie eingesperrt, und ein paar von uns haben sie umgebracht, die haben nichts gekannt. Und dabei haben wir wenigstens gewusst, wofür wir unsere Schädel hinhalten, das war eine schlechte Zeit. Aber die heutige Jugend … das ist ja verrückt … ihr lebt ja sowieso wie die Maden im Speck.«
Herr Josef Schmitz hatte die Gewohnheit, Paul und Silvi so anzureden, als verkörperten sie die ganze heutige Jugend oder zumindest das, was ihm an ihr nicht passte. Paul war es müde, noch darauf einzugehen: Sie hatten endlose Diskussionen geführt, von der Jeansmode angefangen über die Popmusik bis zu ebenjenen Ereignissen in Frankreich, die nun beinahe allabendlich über den Bildschirm liefen. Sicher, der Mann hatte viel mitgemacht, er war im Gefängnis gewesen, dann im Krieg, nach 45 hatte ihn die KP enttäuscht. Aber verdammt noch einmal, dachte Paul, was kann ich dafür?
Er achtete den Herrn Josef Schmitz als Veteranen des Jahres 34, aber seit damals war eine Menge Wasser die Donau hinuntergeflossen. Nicht nur die Verhältnisse hatten sich verändert, sondern offenbar auch der Schwiegervater; die ganze Politik, resümierte er gern, ist ein dreckiges Geschäft. Was ihn nicht daran hinderte, von Zeit zu Zeit in »Mein Kampf« zu blättern und sich die Stellen anzustreichen, deren er sich dann im Kleinkrieg gegen Paul bediente. Da sieht man es wieder, sagte er etwa, als Pauls erste Gedichte veröffentlicht wurden, der ganze Kulturbetrieb ist total verjudet, der Hitler war gar nicht so dumm.
Paul hatte das damals hinuntergeschluckt, schließlich ging es ihm darum, seine Silvi zu kriegen, und nicht darum, seine Abstammung zu verteidigen, aber es hatte ihm schon zu denken gegeben, dass ein alter Linker wie der Herr Josef Schmitz dieselben Ressentiments kultivierte wie die alten Nazis. Nun aber, da sie, seit es die Wohnung einzurichten galt, fast täglich über die Entwicklung in Frankreich sprachen, kam noch ein weiteres Vorurteil zum Vorschein, das der Schwiegervater mit den alten Nazis teilte: das gegen die Intellektuellen. »Ihr Studenten«, sagte er und redete Paul wieder an, als sei er für das, was jetzt in Paris geschah, verantwortlich, »was habt ihr schon Revolution zu spielen? Die Revolution, das ist eine Sache der Arbeiter, ist es schon immer gewesen! Die Phantasie an die Macht, was soll denn das heißen? Alle Macht den Räten! So haben wir das gelernt, das werdet ihr nicht ändern.«
Paul trat hinaus auf den Balkon, um Luft zu schnappen, er wollte um Silvis willen nicht mit dem Schwiegervater streiten, und schon gar nicht in der neuen Wohnung. Vis-à-vis war ein eingeplanktes Areal, auf dem wucherte das Unkraut, aber den Kindern gefiel’s, und in der ganzen Umgebung fanden sie keinen besseren Spielplatz. Paul sah eine Weile zu, wie sie sich voreinander versteckten, aneinander anschlichen usw., und er empfand dabei Freude und Wehmut in einem. Nebenan auf dem aufgelassenen Fußballplatz hatte ein Zirkus sein Zelt aufgeschlagen, und in auf- und abschwellenden Wellen floss die Musik von der Nachmittagsvorstellung vorbei.
Manchmal übertönte sie die Kurzmeldungen, die der Rede des Generals de Gaulle im Radio vorausgingen und die Paul sowohl aus dem Zimmer hinter sich als auch aus den offenen Fenstern rundum hörte. Die ganze vergangene Woche hatte es solche Kurzmeldungen über die Lage in Frankreich gegeben. Der seriöse Sender Ö1 gab sich objektiv besorgt, das Pop- und Beatprogramm Ö3 bekannte sich, wenn auch unterschwellig, zu seiner Sympathie für die Demonstranten. Immer wieder sang ein junger französischer Sänger, dessen Namen Paul nur schwer behielt, das Chanson »Paris S’Éveille«, das zwar nichts mit den laufenden Ereignissen zu tun hatte, aber, ein wenig Phantasie bei den Hörern vorausgesetzt, darauf bezogen werden konnte.
Paris, so schien es, war in der Hand der Neuen Linken, auch aus der Provinz meldete man Aufstände, Besetzungen und Streiks. Doch dann hatten die Gewerkschaften über höhere Löhne zu verhandeln begonnen und die linken Politiker über Organisation zu reden angefangen und die Bürger genug gehabt von der gewaltsamen Durchbrechung ihres Alltags. Und die Stimmen der Kommentatoren hatten sich immer gelöster angehört und mit immer größerer Sicherheit hatten sie prophezeit, was sie sich wünschten: dass es ja nicht ewig so weitergehen könne, dass nun bald alles wieder ins Lot kommen müsse, Law and Order, Produktion & Konsum, Abend- & Vaterland.
Paul fühlte sich innerlich wund, als er ins Zimmer zurückkam. Er werde nicht zurücktreten, sagte der General. Er werde die Große Nation doch nicht der Anarchie überlassen. »Sehen Sie«, sagte der Schwiegervater, »ich habs ja gesagt!«
Doch dann war der Schwiegervater gegangen, und Paul und Silvi waren endlich allein gewesen. Und sie setzten sich, von oben bis unten klebrig von Tapetenkleister, in die neue Badewanne, deren Email so verlockend glänzte, wie nie mehr danach. Und aus dem Kofferradio, das auf dem Wannenrand stand, hörten sie etwas über Truppenkonzentrationen in den Vororten von Paris. Aber da wurden sie ihrer Nacktheit gewahr und drehten das Radio ab.
5
Kennen Sie mich nicht mehr?«, fragte sie. Sie saß plötzlich neben ihm.
»Doch«, sagte er, »natürlich, Sie waren damals noch ein Kind.« Nein. (Ihre Augen: dunkelgrüne Gewässer.) Nein. Ein Kind war sie damals nicht mehr gewesen.
Er schob die Zeitungsbände beiseite, klappte sie zu. Sie war voller geworden und trug die Haare jetzt kürzer als früher, das stand ihr gut. Als sie bemerkte, wie er sie musterte, machte sie eine seltsame Bewegung, Kopf und Schultern mit einem kurzen, koketten Ruck parallel, aber gegenläufig verschiebend. Damals … auch das war 68 gewesen … oder gar davor.
Die erste Nachhilfestunde bei ihr: Er hatte an die Tür geklopft. Und nichts hatte sich gerührt bis auf ein vages Rumoren und Räuspern hinter den Nachbartüren. Er hatte schon gehen wollen, da hatte sich die Tür einen Spalt breit geöffnet und ihre Augen hatten ihn angeschaut. – »Ich bin der Nachhilfelehrer«, hatte Paul gesagt, »ich habe mit deiner Mutter telefoniert, lässt du mich rein?«
Sie nickte stumm, ließ ihn eintreten, ging ihm ins Zimmer voraus. »Meine Mutter«, sagte sie, »ist nicht da, sie hat gesagt, wir sollen miteinander lernen, das Geld liegt auf dem Tisch.« Ihre Stimme war leise, ihr Körper zu dünn für ihr Alter. Doch ihre Augen sahen erwachsen drein.
Paul fühlte sich unbehaglich und schaute sich um. Die üblichen Blumenvorhänge, die üblichen Nippes. Die übliche Sitzgarnitur, das übliche Ölbild. Die Nachhilfeschülerwohnungen glichen einander. Und trotzdem war alles beunruhigend anders als sonst. Er zögerte allzu lang, sich niederzusetzen. Auch sie blieb stehen; stützte die Hände hinter dem Rücken auf die Lehne eines Fauteuils. Und dann die Bewegung, die ihn noch heute erregte.
»Na gut«, sagte Paul und setzte sich endlich hin. »Dann fangen wir beide halt wirklich zu lernen an …«
»Von mir aus«, sagte das Mädchen und setzte sich auch. »Aber ich sag Ihnen gleich: Es hat keinen Zweck.«
»Was soll denn das heißen?«
»Nichts. Ich bin sowieso blöd.«
»Unsinn. Wer sagt das?«
»Das hat meine Mutter gesagt.«
Na ja. Wahrscheinlich war sie zornig auf dich.«
»Nein. Ich bin blöd. Das sagt meine Mutter immer.«
»Und dein Vater?«
Sie schüttelte trotzig den Kopf.
»Was ist mit ihm?«
»Ich kenn meinen Vater nicht.«
»Ach so«, sagte Paul. »Verzeihung.«
Sie sagte: »Warum?«
Dann schaute sie angestrengt zum Fenster hinaus.
»Ich heiße Paul. Und du?«
Sie gab keine Antwort.
»Julia«, sagte sie schließlich. »Ein blöder Name.«
»Wieso«, sagte Paul. »Ich finde ihn wunderschön.«
(Zwei ferne Lichter auf dem Grund ihrer Augen.)
»Das kann ich nicht glauben, Julia, dass du blöd bist.«
(Die beiden Lichter kamen allmählich näher.)
»Da sind Sie der Erste. Sonst scheint das jeder zu glauben.«
»Auch recht. Dann bin ich der Erste. Sag du zu mir.«
Er hatte sich ihre Hefte zeigen lassen, die übersät waren mit roten Korrekturen (sie stand auf Nicht genügend in Englisch und Mathematik). Und dann hatte er die Hefte weggelegt und gesagt: »Das können wir vergessen. Wir zwei, wir werden ganz neu beginnen, wenn du nur willst. Willst du? Wann ist denn die nächste Schularbeit?«
Sie sagte: »In Mathematik am nächsten Freitag.«
»Schön, du wirst sehen, du kriegst mindestens einen Dreier.«
Sie sagte: »Nein, den habe ich noch nie gekriegt.«
Er sagte: »Das macht nichts. Wetten wir um zehn Schilling?«
Darauf hatte sie zum ersten Mal gelächelt, zwar ungläubig noch, aber immerhin. Und er hatte ebenfalls gelächelt, denn ihr Lächeln war sein erster Erfolg. Und dann hatten ihn ihre Augen in einer Weise angeschaut, dass er die seinen niederschlug. Die Lichter waren auf einmal allzu nah.
Sie hatten noch zwei Stunden vor dem nächsten Freitag eingelegt, dann war die Schularbeit gewesen, Julia schrieb wirklich einen Dreier. Als sie das Heft in der darauffolgenden Nachhilfestunde vorzeigte, ging eine Wärme von ihren Augen aus, die Paul durchrieselte, als säße er unter einem Heizstrahler. Im Gegensatz dazu war ihre rechte Hand, die er bei der Entgegennahme der gewonnenen zehn Schilling berührte, totenkalt. »Was ist los mit dir?«, fragte er erschrocken und fing sich auch ihre Linke.
»Nichts ist los. Ich hab immer so kalte Hände.«
Er rieb ihre Hände wie die einer Erfrorenen: »Schrecklich!«
Sie taute auf. Ihre Hände wurden lebendig.
»Schon besser«, sagte er schnell. »Und wann haben wir die Schularbeit in Englisch?«
Sie sagte: »Mittwoch. Wird das wieder ein Dreier?«
»Sicherlich«, nickte Paul. »Ich verdopple die Wette.«
(Du liebe Güte: Wie war er doch damals von sich überzeugt gewesen! Wenn er sich vorgenommen hatte, eine Sechs zu würfeln, so hatte er sie meist gewürfelt; das war lang vorbei.)
Julia schrieb einen Zweier und zahlte zwanzig Schilling.
Er gab sie zurück: »Das ist doch dein Taschengeld!«
»Na und?« Für einen Moment sah sie böse drein. Die Lichter sanken davon auf den Grund ihrer Augen.
Dann sagte sie: »Weißt du was? Ich lade dich ein. An der Ecke ist eine Konditorei …«
Paul hatte nicht allzu viel übrig für Süßigkeiten. Aber er wollte ihr nicht die Freude verderben.
So gingen sie nach der Stunde Punschkrapfen essen. Julia hatte sich einen Poncho über die Schultern geworfen und sah damit sehr hübsch aus. Sie hatte so gut wie nichts mehr von dem ängstlichen, kleinen Mädchen, das ihm vor knapp drei Wochen die Tür geöffnet hatte. »Trinken wir einen Campari? Den zahl dann ich.«
Sie sagte ja und machte ihre Bewegung.
Der Campari kitzelte auf der Zunge.
Sie lächelte. Wenn sie lächelte, war sie noch hübscher.
Er sagte: »Gehen wir. Sonst wird es zu spät.«
Er brachte sie bis ans Haustor. Sie blieben stehen. Sie umarmte ihn plötzlich und drückte ihn fest. Er kam in Versuchung, noch fester zurückzudrücken. Doch machte er sich behutsam los von ihr …
Vor der nächsten Nachhilfestunde kam er sich unter den üblichen Blicken der Nachbarn aus den Spionen vor wie ein Kinderschänder. Er hatte von Julia geträumt, und dabei wusste er nicht einmal genau, ob sie schon vierzehn war. »Ich habe schon wieder so kalte Hände«, sagte sie, als sie über der Mathematikhausübung saßen. Paul tat vertieft in eine sehr einfache Schlussrechnung und überhörte das glaubhaft.
Die Schlussrechnung war wirklich sehr einfach: Er konnte sich ohne weiteres ausrechnen, wozu das führte. Er beschloss, sich vorsichtig zu verhalten, aber er wusste jetzt, was pädagogischer Eros war. Und wenn Julia ihn ansah, fühlte er sich weiterhin wie unter einer Heizsonne, und wenn er nach den Nachhilfestunden nach Hause ging, es war Spätherbst damals, die Abende waren dunkel und feuchtkalt, spürte er diese Wärme nach. Und auf die nächste Mathematikschularbeit bekam Julia ein Sehr gut und auf die nächste Englischschularbeit auch.
»Ich weiß nicht«, sagte ihre Mutter, die er eines Tages auch zu Gesicht bekam, eine noch junge, gut aussehende Frau, nur gab es da etwas Hartes um ihren Mund, das sie nicht wegschminken konnte, »ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber ich bin hochzufrieden.« Paul wusste, wie er das machte, und es war ihm klar, dass der Balanceakt, den er da vollführte, gefährlich war. Nicht nur Julia konnte ihn, nein, auch er selbst konnte sich aus dem Gleichgewicht bringen. Er träumte noch mehrere Male von ihr und die Versuchung, diese Träume zu verwirklichen, war groß.