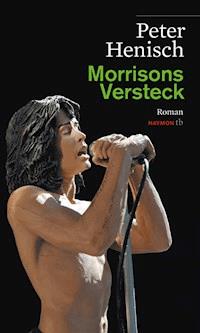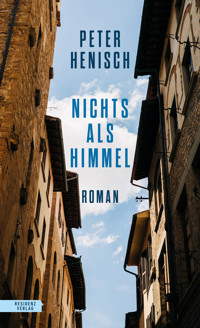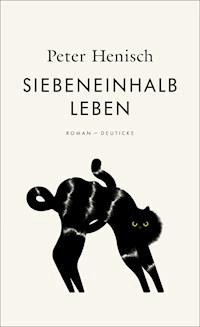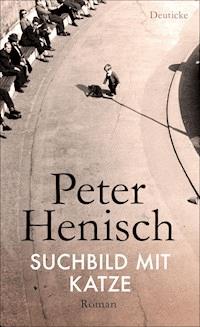
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kind lehnt am Fenster, neben ihm, auf dem Fensterbrett, sitzt eine Katze. Sie ist die erste in seinem Leben. Das Fenster ist eines von vielen, aus denen es schauen wird, doch hier erwacht sein Bewusstsein. Der Autor nimmt uns in diesem Buch mit in seine Kindheit im Wien der Nachkriegszeit. Dass es zu verträumt ist, das hört das Kind nicht selten. Das Träumen ist eine Eigenschaft, die sich der Schriftsteller Peter Henisch bewahrt hat, und bis heute ist er auch ein Katzenfreund geblieben. Die Katzen, die sein Leben begleitet haben, und die Fenster, aus denen er die Welt betrachtet hat, bilden den Rahmen für diese Autobiographie, in der Henisch kunstvoll persönliche Geschichte mit Zeitgeschichte verknüpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein Kind lehnt am Fenster, neben ihm, auf dem Fensterbrett, sitzt eine Katze. Die Katze ist die erste in seinem Leben. Das Fenster ist eines von vielen, aus denen es schauen wird, doch hier erwacht sein Bewusstsein. Peter Henisch nimmt uns in diesem Buch der Erinnerung mit in seine Kindheit im Wien der Nachkriegszeit. Dass es zu verträumt ist, das hört das Kind nicht selten. Das Träumen ist eine Eigenschaft, die sich der Schriftsteller Peter Henisch bewahrt hat, und bis heute ist er auch ein Katzenfreund geblieben. Die Katzen, die sein Leben begleitet haben, und die Fenster, aus denen er die Welt um sich herum betrachtet hat, bilden den Rahmen für diese poetischen Memoiren, in denen Henisch kunstvoll persönliche Geschichte mit Zeitgeschichte verknüpft.
Deuticke E-Book
Peter Henisch
SUCHBILD MIT
KATZE
Roman
Deuticke
Mit freundlicher Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien
ISBN978-3-552-06331-0
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2016
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Foto: © GettyImages/Imagno/Kontributor
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
für uns
I
DAS EINBAHNSCHILD auf der anderen Seite der Straße. Jeden Morgen, wenn ich das Fenster öffne, sehe ich dieses Einbahnschild. Auf blauem Grund ein weißer Pfeil mit schwarzer Schrift. Der Pfeil weist in die Richtung, in der es abwärts geht.
Nicht steil abwärts geht es in dieser Richtung, aber abwärts. Noch hundert Meter, dann ist die Gasse zu Ende. Sie endet nicht als Sackgasse, sie endet ganz einfach an der Währinger Straße. Davor ist ein Stoppschild, das ich aber nur sehen kann, wenn ich mich sehr weit aus dem Fenster beuge.
Was ich nicht sollte. Die Operationsnarben sind noch recht empfindlich. Ich muss das Stoppschild auch gar nicht sehen, ich kann es mir vorstellen. Weiß auf Rot. STOP, signalisiert es. Und wenn schon. Das geht mich eigentlich gar nichts an. Ich bin kein Autofahrer.
Eben. Ich muss ja gar nicht in der durch das Einbahnzeichen signalisierten Richtung denken. Ich will lieber aufwärts, in die andere Richtung. Da geht es sanft bergan, bis zur Kreuzgasse und darüber hinaus. Und dann, jenseits der Anhöhe, hinter der an manchen Abenden eine sehr rote Sonne versinkt, sollte, wenn es nach mir ginge, das Meer sein.
Wie wir damals das Meer suchten, Eva und ich. Sie hatte das Auto, den alten Renault, von der Landstraße auf einen Feldweg gelenkt. Und dann, als es immer holpriger wurde, geparkt. Am Rand des Feldes. Standen da Maiskolben oder Sonnenblumen?
Wir ließen den Wagen stehen und gingen zu Fuß weiter. Das Meer, von dem wir, noch von der Landstraße aus, einen Streifen gesehen zu haben glaubten, musste bald vor uns auftauchen. Zwar hatte sich die Richtung, in der uns der Feldweg führte, nach ein paar hundert Schritten ein wenig geändert, sodass nun eine Hügelkette die Sicht auf den blauen Streifen verstellte. Aber es war eine niedrige Hügelkette, und es konnte nicht lang dauern, bis wir das Meer wieder sehen würden.
So gingen wir weiter, und tatsächlich: nach einer Weile sahen wir das Meer wieder. Aber der Weg änderte seine Richtung noch mehrere Male. Manchmal sahen wir das Meer oder was wir dafür hielten, dann sahen wir es wieder nicht. Es kann aber nicht mehr weit sein, sagten wir zueinander, wir werden schon hinkommen.
Von einem Moment auf den anderen wird sich der Blick auftun, das Meer wird vor uns liegen, sagten wir zueinander. Allerdings bekamen wir nach und nach Durst. Hatten wir noch eine Flasche Mineralwasser im Auto? Ich glaube schon. Aber die mitzunehmen, auf den, wie wir gemeint hatten, kurzen Weg zum Meer, daran hatten wir nicht gedacht.
Und dann diese Frau, die einen Krug auf dem Kopf trug. Eine schlanke Frau, mit sehr aufrechtem Gang. Trug einen Krug auf dem Kopf oder eine Amphore. Vermutlich aus Ton, jedenfalls im selben Farbton wie die Erde unter ihren Füßen. Eine große Frau in einem langen schwarzen Kleid. Oder war das Kleid blau? Wenn es blau war, war es dunkelblau. Dieses Kleid, das in unserer Erinnerung im Wind weht. Wie auch ihr Haar. Dieses lange schwarze Haar, sagt Eva.
Aber war das Haar nicht vom Kopftuch bedeckt? Dass sie ein Kopftuch trug, ist doch sehr wahrscheinlich. Trotzdem, sagt Eva. Sie erinnert sich an langes schwarzes Haar. Langes schwarzes Haar, vielleicht ein paar graue Strähnen.
Diese Frau – warum haben wir sie nicht angesprochen? Sehr aufrecht unter dem Krug ging sie an uns vorbei. Allerdings, so scheint es mir jetzt, in einer gewissen Entfernung. Wir hätten sie nicht einfach ansprechen können, wir hätten rufen müssen.
Und wahrscheinlich waren wir uns gar nicht sicher, ob sie echt war. Eine Frau aus Fleisch und Blut unter dem langen, im Wind wehenden Kleid, oder eine Erscheinung …
Aber das Meer … Haben wir das Meer dann noch gefunden? Nein. Letzten Endes waren wir froh, dass wir das Auto wieder gefunden haben.
Das blaue Einbahnschild auf seiner grauen Stange. Wenn die Sonne scheint, wandert sein Schatten vom Gehsteig auf die Straße. Die Straße vor dem ebenerdigen Fenster, an dem ich stehe. Geflickter, gefleckter Asphalt und zwei Sorten Pflaster.
Gegen elf Uhr Vormittag erreicht der Schatten das Kanalgitter. Unter dem Gitter fließt ein eingesperrter Bach. Domestiziert. Zum Abwasserkanal erniedrigt. Aber manchmal hört man ihn trotzdem noch plätschern.
Wenn schon kein Meer jenseits der Kreuzgasse, so immerhin ein Bach im Untergrund. Angeblich gibt es unter der Oberfläche dieses Bezirks viele Bäche. Die Vorstellung, am Ufer eines plätschernden Bachs zu wohnen … Das hier muss eine nette Gegend gewesen sein.
Ich steh am Fenster und schau hinaus auf die Straße. Große Pflastersteine und kleine. Katzenkopfpflaster. Zwanzig Meter Katzenkopfpflaster, damit die Autos nicht zu schnell fahren. Die trotzdem zu schnell fahren, rumpeln über die Schwelle.
All die Fenster, aus denen ich schon geschaut habe. Nicht ganz wenige im Lauf eines Lebens. Die meisten in Wien und Umgebung, ein paar auch woanders. Fenster mit Blick ins Grüne oder ins Graue, Fenster mit und ohne Meerblick.
Das Fenster, das mir zuallererst einfällt, ist aber das Erkerfenster im dritten Bezirk.
Adresse: Wien III, Keinergasse 11, Ecke Hainburger Straße. Dort war die Wohnung, in der mein Bewusstsein erwacht ist. Was früher war, in meinen ersten zwei, drei Jahren, ist sehr dunkel.
Zuerst, als die Bomben auf Wien fielen, soll ich mit meiner Mutter in Gmünd gewesen sein, oben im Waldviertel. Dann haben wir eine Zeitlang bei meiner Großmutter gewohnt, in der Nähe des Naschmarkts. Auch das weiß ich eher aus Erzählungen als aus meiner eigenen Erinnerung. Zwar gibt es ein paar Bilder, die manchmal in meinen Träumen auftauchen, doch das ist ein Film mit vielen schwarzen Kadern.
In dieser Erinnerung aber ist es recht hell: Ich stehe, nein, ich knie am Erkerfenster. Auf einem Sessel knie ich, den mir meine Mutter in den Erker gestellt hat. Und wahrscheinlich hat sie mir noch einen Polster auf den Sessel gelegt.
Der Erker, ein kleiner, wie für mich gemachter Raum. An einer Ecke unseres sogenannten großen Zimmers. Es ist nicht wirklich groß, dieses Zimmer, aber es ist unser größtes. Eigentlich ist es das einzige Zimmer, sonst gibt es in unserer Wohnung nur das Vorzimmer, die Küche, und das Kabinett.
Die Wohnung, die ich mit meinen Eltern und der Katze bewohne, gilt als Zweizimmerwohnung. Doch das zweite Zimmer gibt es nicht mehr. Dieses Zimmer, heißt es, ist abgestürzt. Das soll in den letzten Kriegstagen geschehen sein oder vielleicht sogar schon in den ersten Tagen nach Ende des Krieges: es war eine stürmische Nacht, das durch den Bombentreffer, der das Nebenhaus zerstört hat, erschütterte Mauerwerk hat nachgegeben, die Balken haben nicht mehr getragen – aber da haben noch andere Leute hier gewohnt.
Am Erkerfenster knie ich also, auf dem Sessel, den mir meine Mutter dorthin gestellt hat. Auf einem Polster, damit mir die Knie nicht wehtun oder damit ich gerade in richtiger Höhe ans Fensterbett hinaufreiche. Die Ellbogen aufs Fensterbrett gestützt, das Kinn in die Hände geschmiegt. Und schau hinaus oder, genauer, hinunter – wir wohnen im Mezzanin, wie man das damals noch nennt, also im Halbstock, das ist nicht sehr hoch, aber doch eine andere Perspektive als aus dem Parterre.
Die Katze, schwarz bis auf den weißen Fleck auf der Brust, sitzt neben mir auf dem Fensterbrett, manchmal spüre ich ihre Schnurrhaare an meiner Wange. Wir überblicken den sandigen Platz vor dem Haus, der die Hainburger Straße unterbricht. Links reicht das Straßenpflaster noch bis an die Ecke mit einem Gasthaus, dessen Namen ich vergessen habe, auf der einen und der Wäscherei Schwan, über deren Tür tatsächlich ein Schild hängt, das einen Schwan darstellt, auf der anderen Seite. Rechts fängt das Straßenpflaster erst wieder auf der Höhe des Capitol-Kinos an, einem Gebäude mit flachem Dach, auf dem die Tauben spazieren gehen.
Vor dem Erkerfenster ist ein Blechsims, das vor dem Krieg bis zu den Fenstern des nächsten Zimmers gereicht haben muss. Dem Zimmer, das abgestürzt ist, einfach hinunter in die Schutthalde. Damit ist auch ein Stück vom Sims weggebrochen, gegen sein nunmehriges Ende zu wird es immer abschüssiger. Aber ich soll mich nicht zu weit hinausbeugen.
Es gibt ja genug zu sehen, wenn ich geradeaus schaue. Über den sandigen Platz, der sich damals fast bis zur Erdbergstraße erstreckt. Schneisen in den Häuserzeilen, Schutthaufen, die beinahe schon so aussehen, als ob sie von Natur aus hierher gehörten. Durchblicke bis zur Schule, in die ich ein, zwei Jahre später gehen werde.
Es scheint Sommer zu sein in dieser Erinnerung, denn ich sehe Kinder, die meisten barfuß, auf den Schutthügeln, zwischen blühendem Unkraut, Verstecken spielen. Ein Mädchen muss »einschauen«, das heißt, es steht mit vor die Augen gehaltenen Händen in einer Ecke und zählt bis zehn. Inzwischen rennen die anderen, um sich zu verstecken. Bis fünf hat das Mädchen langsam gezählt, aber dann, ab sechs, zählt es immer schneller, sieben acht neun zehn: ich schau!, und wahrscheinlich hat es schon vorher zwischen den nicht ganz dicht aneinandergepressten Fingern durchgespäht, denn es läuft sehr zielstrebig Richtung Streusandkiste, hinter die sich einer der Buben geduckt hat.
Nicht nur Kinder sehe ich da unten, sondern auch Erwachsene, natürlich. Die meisten Frauen, auch die jungen, tragen Kopftücher, die meisten Männer tragen Hüte und sehen alt aus. Manche gehen auf Krücken, weil sie ein Bein verloren haben, wie man die Tatsache, dass es ihnen weggerissen wurde oder, weil heillos kaputtgeschossen, amputiert werden musste, damals umschreibt, das Hosenbein, in dem das zweite fehlt, ist dann bis zum Knie oder bis an die Hüfte aufgesteckt. Auch Männer mit dunklen Brillen sehe ich, und die tragen diese Brillen, weil sie blind sind – später, als die Sonnenbrillen in Mode kamen, brauchte es lange, bis ich mich daran gewöhnt hatte, dass die Menschen, die ihre Augen hinter dunklen Gläsern versteckten, trotzdem im glücklichen Besitz ihres Augenlichts waren.
Straßenverkehr? Nein, Straßenverkehr gibt es hier Ende der 1940er Jahre kaum. Im Zentrum, ja, in der Stadt, wie man sagt, dort schon. Im ersten Bezirk, in dem die Fahrzeuge aller vier Besatzungsmächte deren Anwesenheit demonstrieren. Aber das ist ein anderer Teil der Welt.
Kein Straßenverkehr also. Jedenfalls so gut wie kein Autoverkehr. Pferdefuhrwerke. Zuallererst der Milchwagen. Früh am Morgen, wenn es draußen noch dämmert. Da liege ich noch im Bett, das höre ich im Halbschlaf; das Getrappel der Pferdehufe hat etwas Trautes.
Der Bierwagen kommt nicht jeden Tag, doch wenn er kommt, ist es meistens am Vormittag. Also zu einer Zeit, zu der ich bereits auf meinem Platz am Erkerfenster wache. Gezogen wird er von stämmigen Haflingerpferden, denen das zottige Fell hübsch über die Hufe hängt. Von der Erdbergstraße her fährt er quer über den Platz, der Kutscher erwartet keinen Gegenverkehr. Dann, bei der Wäscherei, biegt er kurz in die Hainburger Straße ein. Und nun kommt das Wendemanöver, bei dem ich den Wagen vorerst von hinten sehe, mit all den Fässern, die auf der Ladefläche gestapelt liegen und rätselhafter Weise nicht hinunter auf die Straße rollen. Und jetzt sehe ich den Wagen wieder von vorn, sehe, wie der Kutscher kurz an den Zügeln zieht, mit einem lauten Brrr!, das seinen gelblichen Schnauzbart zum Zittern bringt und bedeutet, dass die Pferde nun halten sollen, sodass der Wagen längs des Gehsteigs neben dem Gasthaus zu stehen kommt.
Der Spritzwagen ist das einzige motorisierte Fahrzeug, das in diesen frühen Erinnerungen an den Blick aus dem Erkerfenster auftaucht. Der kommt im Sommer, und jetzt sehe ich wieder die Kinder, die da unten auf dem Platz Verstecken spielen oder Räuber und Gendarm. Wenn der Spritzwagen kommt, ein Lastauto mit einer großen Wassertonne, aus deren Ventilen Wasser in glitzernden Fontänen auf die Straße sprüht und den trockenen Sand befeuchtet, laufen sie johlend hinterher. Sie lassen sich anspritzen, und es macht ihnen nichts, oder es macht ihnen sogar Vergnügen, wenn die Turnhosen oder die leichten Kleider, die sie tragen, dann nass werden und sich an den Körper anlegen, sodass man gewisse Konturen darunter ahnt.
Ist Friedi dabei? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Doch so viel ist gewiss, dass sie sehr gut in dieses Bild passen würde. Friedi, die auch hinter dem Spritzwagen hergelaufen wäre. In ihrem kurzen (grünen?) Kleid, das auch ein paar Spritzer Wasser abbekommen hätte.
Friedi, die Tochter der Hausmeisterin, der Frau Neubauer. Wie sie quer über den Platz zurück zu unserem Haus läuft. Jetzt bleibt sie stehen, vielleicht weil sie meinen Blick spürt oder ganz einfach, weil sie mich am Fenster sieht. Und wendet mir kurz ihr rundes Gesicht zu, verschmitzt, bevor sie um die Ecke verschwindet.
Die Katze steht auf und unternimmt einen Ausflug aufs Sims. Das macht sie öfter. Sie kann das. Sie ist geschickt. Behutsam setzt sie eine Pfote vor die andere. Sie will die Tauben auf dem Dach des Capitol-Kinos aus etwas geringerer Distanz sehen.
Dann sitzt sie da draußen auf diesem extremen Beobachterposten. Ganz Aufmerksamkeit. Ihre Augen spähen. Ihre Ohren lauschen. Völlig fixiert auf das Treiben der Vögel dort drüben. Dabei gerät ihr Unterkiefer in vibrierende Bewegung.
Nach und nach wird diese Bewegung von einem leisen Schnattern begleitet. Das klingt dann fast, als wäre die Katze empört. Aber wahrscheinlich signalisiert dieses Schnattern eher eine gewisse Erregung. Eine durch diese blöden Vögel jenseits der Straße angeregte Jagdlust, die sich nicht unmittelbar befriedigen lässt.
Nein, so denke ich natürlich noch nicht in diesem Alter. Obwohl ich, glaube ich, einiges davon spüre. Ich will nicht behaupten, dass ich mich total ins Fell der Katze versetzen kann. Aber ich fühle mich der Katze, auch wenn sie jetzt einige Meter entfernt von mir sitzt, sehr nah.
Von einem Kind, das gern eine Katze sein wollte. Das heißt, ein Kater. Denn es handelt sich um ein Kind männlichen Geschlechts. Peter. Oder soll ich den kleinen Buben, der am Fenster steht oder kniet, lieber Paul nennen? Peter oder Paul, der sich der Katze, mit der er aus dem Fenster schaut, sehr nahe fühlt.
Fast verwandtschaftlich nahe. Manchmal träumt er, die Katze ist seine Schwester. Sie sind miteinander im Katzenkorb gelegen. Oder war das bloß eine Schachtel, in die ein paar Stofffetzen gebreitet waren? Egal. Es war schön und warm und weich da drinnen.
Besonders warm und weich war die Katzenmutter, die ihnen damals sehr groß vorgekommen ist. Die große Katze, an die man sich schmiegen konnte. Es muss allerdings noch ein paar andere Geschwister gegeben haben. Manchmal war ein wildes Gerangel um die Zitzen.
Dann aber, wenn sie satt und von süßer Milch fast betrunken waren, war alles gut. Die Erinnerung an gemeinsames Schnurren. Das war fast das Schönste. Der Höhepunkt dieser Träume. Aus solchen Träumen wieder aufzuwachen war beinah schade.
Die Tauben benehmen sich übrigens wirklich komisch. Der Eifer, mit dem die Männchen hinter den Weibchen herlaufen … Denen das vorerst, so sieht es jedenfalls aus, nichts als lästig ist … Weshalb sie mit ihren kleinen Füßen immer schneller und schneller trippeln und manchmal unversehens die Richtung ändern, aber nur selten flattern sie auf und davon.
Ja, so ist das auf der Welt!, sagt meine Mutter. Meine Mama, die plötzlich hinter mir steht. Ich habe sie gar nicht ins Zimmer kommen gehört. Aber jetzt ist sie da und streichelt mir übers Haar.
Die Katze, sagt sie, soll nicht so weit hinaus aufs Sims gehen. Murli!, ruft sie. Herein mit dir! Aber schnell! Und die Katze folgt, wenn auch – so sieht es aus, weil das Vibrieren des Unterkiefers und das damit verbundene Schnattern nicht so ohne weiteres abklingt – unter Protest. Na also!, sagt meine Mutter und macht das Fenster zu.
Die Alternative ist das Küchenfenster. Da schauen die Katze und ich hinaus in den Hof. Das ist ein Hof mit Teppichklopfstange und Abfallkübeln. Begrenzt von einer Mauer aus ehemals roten, im Lauf der Zeit grau gewordenen Ziegeln.
Da unten ist es meistens ein bisschen feucht. Man spürt das, die Feuchtigkeit und ein leicht modriger Geruch steigen bis zu uns herauf. In den Winkeln wächst Moos, in einer Ecke wuchern Brennnesseln. Aber die Hausmeisterin wird sich hüten, sie zu jäten – wenn man sie kocht, sind sie fast so gut wie Spinat, und wenn man sie trocknet, kann man sie als Kaffeeersatz verwenden.
Manchmal tauchen im Hof unten interessante Leute auf. Zum Beispiel der dürre alte Mann, der Lumpen und Knochen sammelt, die er in einem Leiterwagen hinter sich herzieht. Fetzen, Bana(Gebeine), ruft er, und deswegen heißt er auch so: der Fetzenbana. So etwas wie die Wegwerfgesellschaft kann man sich damals noch nicht vorstellen: selbst zur Herstellung von Suppe bereits mehrmals ausgekochte Knochen und fadenscheinigste Stoffreste lassen sich noch verwerten.
Und der Scherenschleifer kommt öfter vorbei. Auch er meldet sein Eintreffen durch einen charakteristischen Singsang. Der Scherenschleifer ist da!, singt er mit gutturaler Stimme, während er sein Arbeitsgerät, einen zwischen zwei Eisenklammern fixierten Schleifstein, an einer Stelle aufbaut, an der das Pflaster da unten möglichst wenige Buckel hat. Merkwürdigerweise nennt man ihn den Scherenschleifer, obwohl er doch auch und vor allem Messer schleift: Wenn er den Schleifstein durch ein Pedal, das er mit dem Fuß betätigt, in rasche, vom Schleifgeräusch begleitete Bewegung bringt, springen die Funken.
Und dann die Musikanten: Zum Beispiel der grauhaarige Mann mit der Ziehharmonika. Der spielt und singt Lieder, deren Text ich halbwegs verstehe. Von Matrosen oder Soldaten, die sich irgendwo in der Fremde nach der Heimat sehnen. Oder von einer Frau namens Lili Marleen, die vor oder hinter einer Kaserne unter einer Laterne steht.
Es kommen aber auch welche vorbei, die in einer fremden Sprache singen. Begleitet von Instrumenten, die eher anderswo heimisch sind. Dass ich nicht verstehe, was sie singen, gefällt mir erst recht. Und dass eine Frau dabei ist, die tanzt und mit an Armbändern und Fußkettchen befestigten Glöckchen klingelt.
Für die Musikanten gibt mir meine Mutter ein paar Groschen, die sie fest in Zeitungspapier einwickelt. Die darf ich dann in den Hof hinunterwerfen. Der Ziehharmonikaspieler bedankt sich, indem er den Hut abnimmt und seine von einem grauen Haarkranz umrahmte Glatze glänzen lässt. Die Tänzerin wirft den Kopf in den Nacken und lächelt mit einem Mund, in dem ein paar Vorderzähne fehlen.
Friedi und mir fehlen auch je zwei Vorderzähne. Aber das ist etwas anderes. Das sind die Milchzähne. Danach kommen erst die richtigen Zähne, heißt es. Bei der dunkelhaarigen Tänzerin hingegen werden keine Zähne mehr nachwachsen.
Friedi: die Tochter der Hausmeisterin, der Frau Neubauer. Ein Mädchen mit munteren Augen und runden Wangen. Ihre Mutter, die Frau Neubauer, habe ich eher hager in Erinnerung. Die Wohnung der Familie Neubauer liegt der unseren genau gegenüber, auf der anderen Seite des Hofs – wenn ich am Küchenfenster lehne, sehe ich die Frau Neubauer manchmal in ihrer Küche werken.
Die Frau Neubauer: hager und abgehärmt. Das ist ein Wort, das meine Eltern verwenden, wenn sie, meist mit verhaltenen Stimmen, von ihr reden. Die arme Frau, sie hat es bestimmt nicht leicht! Mit den zwei Kindern (Friedi und ihrem großen Bruder Otti) und dem Mann, der immer wieder arbeitslos ist, weil er trinkt, oder immer wieder trinkt, weil er schon wieder arbeitslos ist – ein Jammer!
Allerdings hat die Frau Neubauer schöne Haare. Jetzt sehe ich, wie sie das Kopftuch abstreift und sich mit dem Unterarm den Schweiß abwischt. Fast kupferrote Haare hat sie, heute würde das als attraktiv gelten. Doch damals sind rote Haare noch etwas, das man lieber versteckt, und die Frau Neubauer, nachdem sie sich den Schweiß abgewischt hat, bedeckt ihre Haare auch gleich wieder, sei es, weil es sich so gehört, sei es, weil sie diese nicht nur ungewöhnlich roten, sondern auch ungewöhnlich langen Haare nicht dem Kochdunst aussetzen mag.
Wenn ich am Küchenfenster lehne und zur Wohnung der Neubauers hinüberschaue, sehe ich aber die rothaarige Frau Neubauer nur nebenbei. Da will ich natürlich vor allem Friedi sehen. Und die taucht ja auch öfter am gegenüberliegenden Fenster auf. Sie schaut womöglich ebenso gern zu mir herüber, wie ich zu ihr hinüber.
Aber gewiss will sie auch die Katze sehen. Murli, die Schwarze mit dem weißen Fleck auf der Brust. In dem Moment, der mir nun sehr gegenwärtig scheint, obwohl er schon so lang vergangen ist, sitzt sie mit geschlossenen, allenfalls blinzelnden Augen neben mir. Unten im Hof gibt es Ratten, die da manchmal recht ungeniert hin und her laufen, doch in diesem schönen Augenblick kümmert sich die Katze nicht um die Ratten im Schatten: sie sonnt sich.
Ja, sie sonnt sich, die Katze, ihr Fell, das ich streichle, ist warm und duftet. Der Hof liegt zwar meistens im Schatten, doch auf unseren Fensterplatz fallen am späten Vormittag oder am frühen Nachmittag ein paar Sonnenstrahlen. Für eine knappe halbe Stunde gibt es sogar unten, vor den vergitterten Kellerfenstern, sonnige Stellen. Dann kommen die Ratten, denen das auch gefällt, noch lieber ans Licht.
Die Ratten spielen. Aber vielleicht ist es nicht nur ein Spiel, das sie treiben. Ich bin vier oder fünf, womöglich bin ich sogar schon fast sechs, ich habe gewisse Ahnungen. Frau Neubauer hat Rattengift gestreut, aber anscheinend hat seine Wirkung schon nachgelassen. Die Ratten vermehren sich, heißt es, so schnell kannst du gar nicht schauen.
Otti, Friedis großer Bruder, der seiner Schwester gar nicht ähnlich sieht, Otti mit dem langen, von Pickeln entstellten Gesicht, erschlägt die Ratten mit Ziegelsteinen. Neben dem Fenster, aus dem sie hervorkommen, drückt er sich an die Wand und lauert. Dann gibt es Blutflecken, die seine Mutter später wegwaschen muss. Doch Otti, der schon vierzehn oder fünfzehn ist und nicht mehr in die Schule, sondern bereits in die Lehre geht, kommt erst am Abend.
Friedi und ich, wir verstehen uns gut, auch ohne Worte. Von Fenster zu Fenster unterhalten wir uns in der Zeichensprache. Kommst du zu mir herüber, frage ich. Ich weiß nicht, ob ich das darf, antwortet sie. Aber warum denn nicht? Sie zuckt mit den Schultern.
Vielleicht ist es der Frau Neubauer nicht ganz recht, wenn ihre Tochter zu oft zu uns kommt. Womöglich ist es ihr peinlich, dass meine Mutter glaubt, sie muss ihr etwas zu essen anbieten. Ein Butterbrot oder gar ein mit zwei dünnen Wursträdern belegtes Brot. Als ob das Margarinebrot, das Friedi daheim bekommt, nicht gut genug wäre.
Vielleicht gibt es allerdings noch einen anderen Grund für die Zurückhaltung der Frau Neubauer. Wer immer bei uns zu Besuch kommt, sieht gleich im Vorzimmer ein paar gerahmte Fotos. Damit präsentiert sich mein Papa, der Fotograf, Besuchern und Kunden. Fotos sind das, auf die er besonders stolz ist.
Fotos, die auf Titelblättern von Illustrierten erschienen sind. Zum Beispiel das, auf dem die ersten Aufräumarbeiten unter dem in den letzten Kriegstagen eingestürzten Dachstuhl des Stephansdoms zu sehen sind. Interessante Perspektive: unten die Menschen, die zupacken, Männer und Frauen, entschlossen, die Trümmer wegzuräumen … Oben die paar übrig gebliebenen, angesengten Dachbalken, durch die man den rauchgeschwärzten Turm und ein Stück hellen Himmel sieht.
Und natürlich die Fotos mit den Szenen von der Ankunft des ersten großen Heimkehrertransports aus Russland. In der Gefangenschaft abgemagerte, hohlwangige Männer, die sich weit aus den Fenstern eines Eisenbahnwaggons beugen, um die Hände zu ergreifen, die sich ihnen entgegenstrecken … Hände von Frauen, Müttern, alten Vätern und Freunden, die jahrelang bang auf sie gewartet haben … Hände von Kindern, die sie vielleicht in diesem Augenblick zum ersten Mal zu Gesicht bekommen.
Solche Fotos hängen in unserem Vorzimmer. Aber da hängen auch ein paar andere Bilder. Mein Vater versteht sich damals, in jenen frühen Nachkriegsjahren, nicht nur als Pressefotograf, sondern auch als Porträtfotograf und nicht zuletzt als künstlerischer Fotograf. Daher hängen in unserem Vorzimmer auch einige Porträtfotos (von meiner Mutter retuschiert, die den Damen und Herren, die da, meist lächelnd, in die Kamera schauen, Glanzlichter in die Augen tupft, die dort in Wirklichkeit nie schimmern), und – ja eben! – einige große Aktfotos.
Vor denen stand Friedi mit offenem Mund, als sie das erste Mal bei uns zu Besuch war.
Ja, sagte ich nonchalant. Das sind die Aktbilder.
Nacktbilder, sagte sie.
Nein, Aktbilder, sagte ich. Man sagt nicht Nacktbilder, sondern Aktbilder, weil das Kunst ist.
Und die hat dein Papa gemacht?
Ja, sagte ich, die hat mein Papa selbst aufgenommen.
Ein Papa, auf den ich stolz bin – wenn er ein paar Scheinwerfer aufstellt und durch die auf einem dreibeinigen Stativ montierte Kamera schaut, bringt er die Damen dazu, sich vor ihm auszuziehen. Und die schauen zwar etwas verschämt hinunter auf den Parkettboden unseres großen Zimmers oder halten den Kopf wenigstens so, dass ein Teil ihres Gesichts nicht im Licht ist, sondern im Schatten bleibt. Aber vor meinem Vater, der eben ein Fotograf ist, genieren sie sich nicht wirklich.
Hatte Friedi ihrer Mama, der Frau Neubauer, von diesen Fotos erzählt? War sie dazu nicht zu verlegen gewesen? Vielleicht hatte sie nicht gleich davon erzählt, nicht, als sie vom ersten Besuch bei uns zurückgekommen war. Doch irgendwann nach dem zweiten oder dritten Besuch, bei dem sie immer noch nicht einfach an den Nackt- oder Aktbildern vorbeigehen konnte, ohne sich mehrere Male nach ihnen umzudrehen, ist es ihr womöglich herausgerutscht, vielleicht wollte sie auch ausprobieren, wie ihre Mutter darauf reagiert – und das hatten wir nun davon.
Auf die Gasse hinunter darf Friedi jedenfalls eher als zu uns herüber. Aber auf die Gasse darf wiederum ich nicht so ohne weiteres. Soll ich ein Gassenbub werden? Nein. Soll ich nicht. Die Gassenbuben sprechen nicht nach der Schrift und werfen mit Steinen.
Jetzt ist Friedi aus ihrem Fenster verschwunden. Darf sie herüberkommen oder darf sie nicht? Ich höre die Stimme der Frau Neubauer, die irgendwas zu ihr sagt, das ich aus der Distanz all der Jahre nicht mehr verstehe. Aber der Ton, in dem sie es sagt, verheißt nichts Gutes.
Ich warte noch eine Weile, möglicherweise hab ich mich ja verhört, und gleich wird meine kleine Freundin, die vielleicht nur ihre Schuhe anziehen soll, wenn sie zu uns auf Besuch kommt, über den Gang laufen und klingeln. Aber nein. Dort drüben geht keine Tür auf und zu. Und sosehr ich auch lausche: auf dem Gang sind keine Friedi-Schritte zu hören. Prompt verschwindet auch die Sonne hinter irgendeinem Schornstein.
Hier scheint noch immer die Sonne zum Fenster herein. Sie wirft einen warmen Lichtfleck auf den Parkettboden. In diesem warmen Lichtfleck streckt sich die Katze. Ihr in der Sonne glänzendes Fell ist nicht schwarz, sondern dreifarbig.
Ein Menschenalter seit damals, als ich ein Kind war. Wie viele Katzenjahre seit der Schwarzen von damals? Dass schwarze Katzen Unglück bringen, ist ein Vorurteil. Dass dreifarbige Katzen Glück bringen, will ich gern glauben.
Die hier haben wir Mimí genannt. Sie ist uns zugelaufen. So kommt das Glück. Genau genommen ist sie uns nicht zugelaufen, sondern sie ist manchmal bei uns vorbeigekommen. Die dreifarbige Katze, die ab und zu im Innenhof aufgetaucht ist.
Das war in dem Sommer, in dem ich diese Wohnung zuerst einmal probeweise bewohnt habe. Um zu testen, wie es sich hier lebt und schreibt. Was das Schreiben betraf, ging es jedenfalls gut. Ich stand am Küchenfenster, das ein breites Fensterbrett hat, schaute hinaus in den Hof, über den der Kastanienbaum damals noch hoch hinauswachsen durfte, und tippte auf dem Laptop.
Und da kam die Katze über die Mauer. Das heißt, ich sah sie zuerst auf der Mauerkrone. Wie sie eine Pfote vor die andere setzte, ihrer selbst und ihrer Balance sicher. Und wie sie gekonnt den Stamm des Maulbeerbaums benutzte, der an die Mauer gelehnt steht, um in den Hof hinunter zu kommen, zwei Sprünge mit einer kurzen Zwischenlandung auf einem günstig gewachsenen Ast, und schon war sie unten, auf diesem Terrain, das sie offenbar gut kannte, denn sie bewegte sich darauf mit unbefangener Selbstverständlichkeit.
Das ist nun schon wieder beinahe zehn Jahre her. Jetzt ist sie auch nicht mehr die Jüngste, Mimí. Aber sie benimmt sich wie ein junges Ding. Sie weiß, was gut ankommt bei Menschen, die Katzen mögen.
Oder liegt sie nur so entspannt, halb auf dem Rücken, weil sie sich wohlfühlt und weil es ihr so gefällt? Und wir dichten ihr die Koketterie, die wir dahinter vermuten, bloß an?
Nein, sie blinzelt. Sie wartet, dass ich sie streichle. Und ich beuge mich zu ihr nieder, nein, ich knie neben ihr nieder, obwohl mir das in meinem gegenwärtigen Zustand gar nicht leichtfällt, und streichle sie, streichle sie vom Kopf am Rückgrat entlang bis an die Schwanzspitze, streichle sie unter dem Kinn und auf dem Bauch, wo sich ihre Haare immer noch anfühlen wie Flaumfedern.
Damals, als ich Mimí zum ersten Mal sah. Sie hieß noch nicht so. Für mich war sie noch eine Katze ohne Namen. Frau M., die in der Wohnung auf der anderen Hofseite wohnt, Frau M., die Pianistin, die ihr und den anderen Katzen, die gern bei ihr vorbeikamen, Schalen mit Futter und Wasser vor die Tür stellte, nannte sie Funny Face