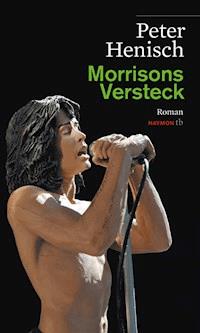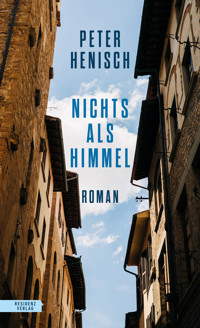
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Nichts als Himmel" verbindet Peter Henisch souverän südliche Idylle mit politischer Aktualität und erzählt von einer ungewöhnlichen Freundschaft. Mit "Nichts als Himmel" kehrt Peter Henisch an seinen Sehnsuchtsort San Vito zurück, in die versteckte Wohnung unter den Dächern der italienischen Kleinstadt. Für den Musiker Paul Spielmann, der vor Pandemie und Lebenskrise aus Wien flüchtet, wird sie zum Refugium. Abends auf seiner Terrasse kommt Paul zur Ruhe, er beginnt Wolkenmetamorphosen und Vogelschwarmflüge zu fotografieren, bis plötzlich ein Mann über die Dächer kommt, einer der Clandestini, der Flüchtlinge aus Afrika, gegen die die rechte Hetze in Italien immer lauter wird. "Gimme shelter", fleht der Mann, und Paul nimmt ihn auf und hilft ihm. Und schon wird er hineingezogen in einen Strudel aus zwiespältigen Gefühlen, politischer Stimmungsmache – und in die wachsende Freundschaft mit Abdallah …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Henisch
Nichts als Himmel
Roman
Residenz Verlag
© 2023 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Boutiquebrutal.com
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Jessica Beer
ISBN ePub:9783701747054
ISBN Printausgabe:9783701717767
Für Eva. In Liebe.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1
WIE LANG ist das nun schon her, dass ich hier bin.
Via Boccaccio 33, ultimo piano.
Als ich hier angekommen bin, auf dem Parkplatz vor der Stadtmauer, hat die Luft über dem Asphalt gezittert.
Jetzt fallen dort schon die Blätter von den Platanen.
Als ich hier angekommen bin … Wie ich hier angekommen bin …
Ich hatte den Koffer vom Rücksitz genommen, ich hatte die Autotür zugeschlagen.
Ich hatte die Straße überquert, die mich, wäre ich weitergefahren, nach Rom geführt hätte.
Und da waren die paar Stufen zwischen Kakteen und Agaven, von denen Julia gesprochen hatte.
Und dann gehst du zirka hundert Meter an der Mauer entlang und dann kommst du an die Porta Nuova.
Dieser Weg war nicht weit und der Koffer, den ich hinter mir herzog, nicht schwer. Ich war überstürzt aufgebrochen und hatte nur wenig eingepackt. Aber als ich an die Porta Nuova kam, spürte ich, wie mir der Schweiß in zwei Bächen den Rücken hinunterrann.
Und dann kommst du auf die Piazza mit der Bar Centrale.
Dort sah ich mich schon ein großes Glas Acqua Minerale auf einen Zug austrinken.
Aber um diese Stunde war das Lokal natürlich geschlossen. Um diese Stunde sind die Piazza und die Straßen von San Vito immer leer.
Ich war am späten Abend aus Wien losgefahren, ich hatte gehofft, am frühen Vormittag hier zu sein. Aber ich hatte die Distanz unterschätzt und mein Durchhaltevermögen hinter dem Lenkrad überschätzt. Wiederholt hatte ich an eine der Ausweichstellen am Straßenrand fahren und pausieren müssen, um meine Augen fünf Minuten auszuruhen. Meist waren es mehr als fünf Minuten geworden.
Und nun war schon hoher Nachmittag. Gegen drei.
Nein, daran erinnere ich mich genauer: Es war Punkt drei.
Als ich über die Piazza ging, läuteten die Glocken im Kirchturm drei Mal.
Ein Schwarm Tauben flatterte auf.
Es war ein Tag Ende Mai.
Und dann biegst du rechts von der Piazza ab und da bist du gleich am Ziel. Dann hast du auf der linken Straßenseite ein Lokal (Osteria Osenna) und auf der rechten eine Antiquitätenhandlung (Otium). Und gleich daneben stehst du vor unserer Haustür. Genau. So hatte es Julia beschrieben. Und so war es.
Dann aber das Problem mit den Schlüsseln. Der mit dem grünen Band ist der Wohnungsschlüssel, hatte Marco gesagt, und der mit dem roten Band ist der Hausschlüssel. Ich steckte also den Schlüssel, den ich für den Hausschlüssel hielt, ins Schloss, aber das Schloss leistete Widerstand. In diesem Schloss ließ sich der Schlüssel mit dem roten Band nicht umdrehen.
Doch vielleicht hatte sich die Erinnerung in meinem schwindligen Kopf verdreht und es verhielt sich gerade umgekehrt. Dann wäre der Schlüssel mit dem roten Band der zur Wohnung gewesen und der mit dem grünen Band der fürs Haustor. Ich probierte es also mit diesem Schlüssel, aber je heftiger ich ihn umzudrehen versuchte, desto weniger gab er nach. Schließlich steckte er fest und ließ sich nicht mehr aus dem Schloss ziehen.
Konnte es sein, dass mir Marco die falschen Schlüssel gegeben hatte? Nicht mit Absicht natürlich, aber aus Versehen? War er mir nicht gleich etwas zerstreut vorgekommen, am vorangegangenen Abend? Gar nicht recht da (also dort), im Café Wortner, in dem wir uns verabredet hatten – in Gedanken noch immer in seiner Ordination.
Das war wieder einmal ein harter Tag, hatte er gesagt … Die vielen Patienten, und die Vorsichtsmaßnahmen, die wir nach wie vor treffen müssen … Von früh bis spät diese Maske vor dem Gesicht … Meine Ordinationshilfe ist auch schon ganz fertig – ich kann nur hoffen, dass sie mir nicht ausfällt.
Marco. Ich hatte ihn schon eine Zeitlang nicht mehr gesehen. Der Tennisplatz, auf dem wir uns für gewöhnlich samstagvormittags getroffen hatten, war bis auf weiteres nicht zugänglich. Marco sah nicht gut aus. Die Haut unter seinem Dreitagebart war fahl. An dem Glas Wein, das er bestellt hatte, nippte er nur.
Die Präsentation deiner neuen CD, sagte er, haben wir leider versäumt, Julia und ich. Sie ist ja jetzt auch am Limit. Zu viele Klientinnen und Klienten, die ihre Depressionen bei ihr abladen wollen. Ihr habt nichts versäumt, sagte ich, die Präsentation hat nicht stattgefunden.
Aber das überhörte Marco anscheinend. Dein Comeback als Liedermacher nach all den Jahren … Das ist schon beachtlich, das soll dir erst mal einer nachmachen … Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber, tanti auguri.
Er hob sein Glas und stellte es wieder hin, ohne getrunken zu haben.
Und jetzt willst du also ein bisschen weg von all dem Rummel.
Da war kein Rummel, sagte ich. Aber das überhörte Marco wieder.
Also grüß mir San Vito. Und fühl dich wohl in unserem Nest.
Es ist wahrscheinlich nicht perfekt aufgeräumt. Die Signora, die das einmal im Monat gemacht hat – Graziella heißt sie –, hat Wasser in den Beinen und schafft es, mailt uns ihr Mann – Romano heißt er –, immer seltener hinauf ins Dachgeschoss. Wir werden uns nach jemand anderem umsehen müssen, stimmt, aber dafür haben wir in den vergangenen Monaten einfach keinen Kopf gehabt. Es ist ein Jammer, wie lang wir nun schon nicht dort waren, Julia und ich.
Aber du fährst jetzt los und bist zu beneiden … Und recht hast du, dass du akkurat jetzt aufbrechen willst … Jetzt ist fast die schönste Zeit: Der Ginster und die Mohnblumen blühen … Und es ist klug, die Gunst der Stunde zu nutzen …
Die Zahl der Coronafälle in Italien ist stark zurückgegangen … Die Siebentages-Inzidenz dort ist nun deutlich geringer als hierzulande … Wer hätte das noch vor ein paar Monaten gedacht? … Also nichts wie los, du Glücklicher, das schöne Licht in der Toskana wird dir guttun.
Was wollte ich noch sagen – ach ja – für den Fall, dass der Strom ausfällt … Kerzen und Streichhölzer sind, glaube ich, in der Küchentischlade … Der Sicherungskasten für alle Wohnungen ist im Erdgeschoss … Der Abschnitt mit unseren Sicherungen ist grün markiert.
Aber du wirst dich schon zurechtfinden, nicht wahr? Wenn irgendetwas nicht funktioniert, ruf uns an … Und schon rief Marco den Kellner und bezahlte den Wein für uns beide. Tut mir leid, sagte er, dass ich nicht mehr Zeit zum Plaudern habe, aber ich muss jetzt noch einmal in die Ordination. Bürokratisches Zeug erledigen, als hätte man als niedergelassener Arzt nicht genug mit seinen Patienten zu tun! Und schon hatte er sich die Maske vors Gesicht gezogen. Man bekommt ohnehin kaum Luft zum Atmen. Und dann schütten sie einen noch zu mit diesem Papierkram!
Und war schon im Aufbruch, Marco. Also ciao, machs gut! …
Aber die Schlüssel, sagte ich.
Ach ja, natürlich! Die Schlüssel …
Mit diesen Worten zog er einen Schlüsselbund aus der ausgebeulten Sakkotasche. Also der hier, das ist der Wohnungsschlüssel. Und der da, das ist der Haustorschlüssel.
Die Schlüssel, mit denen ich nun dastand wie ein Idiot.
Schwitzend. Durstig. Und wütend. So wütend, dass ich dem Schlüssel, der jetzt feststeckte, womöglich noch den Bart abgebrochen hätte.
Doch da stand plötzlich diese Frau neben mir.
Non per forza, sagte sie. Per sensibilità!
Und zeigte mir, wie leicht sich der Schlüssel im Schloss drehen ließ.
Sehen Sie, so! … Aber wer sind Sie eigentlich?
Ich bin Paul, sagte ich. Ein Freund von Marco und Julia.
Sono Valeria, sagte sie. Und war schon verschwunden.
Dann war ich im Hausflur: Ich atmete auf … Angenehm kühl … Die Versuchung, mich gleich auf den ersten Stufen der Treppe hinzusetzen … Es roch nach irgendeinem Putzmittel mit Essig, aber auch nach den Reifen der zwei Fahrräder, die am Treppenabsatz lehnten … Daneben ein zusammengeklappter Kinderwagen – vielleicht war es auch ein Rollstuhl … Plastikkisten mit leeren Colaflaschen … Ein Einkaufskorb, an einem Strick befestigt … Wie praktisch, dachte ich, damit kann man Lebensmittel nach oben ziehen … Nach irgendwo oben … Wie viele Stockwerke hat dieses Haus eigentlich?
Nicht mehr als drei, wie ich inzwischen sehr gut weiß … Ich bin ja oft genug hinaufgestiegen … Aber damals, beim ersten Mal, kam es mir vor, als wären es mindestens vier … Und von Stockwerk zu Stockwerk schien die Schwerkraft zuzunehmen …
Die Temperatur nahm tatsächlich zu … Ganz oben heizte die Sonne durch ein Glasdach mit verzweigtem Sprung … Und nun konnte ich nur hoffen, dass ich mit dem Wohnungsschlüssel nicht ähnliche Probleme haben würde wie zuvor mit dem Hausschlüssel … Die Frau, die mir unten behilflich gewesen war, hatte mich nicht nach oben begleitet – also musste ich mir selbst helfen.
Aber vielleicht nützte es ja, an sie und ihren guten Rat zu denken:
Non per forza, ma per sensibilità: nicht mit Gewalt, sondern mit Gefühl.
Und wirklich, das nützte auch hier – das Schloss leistete nur geringfügigen Widerstand. Der Schlüssel ließ sich umdrehen und die Tür ging auf.
Die Tür zu der Wohnung, in der ich vielleicht einige Zeit bleiben würde … Oder auch nicht – das würde ich noch sehen … Vorerst sah ich allerdings nur wenig – die Fenster in dem Raum, den ich halbblind betrat, waren geschlossen … Lichteinfall gab es bloß durch die Fugen in den Läden.
Die Luft stand gestockt, ich roch zuerst einmal nur Staub … Doch da war auch ein Geruch nach warmem, wie von der Sonne aufgeheiztem Holz … Vielleicht sogar die Spur eines Dufts nach Harz … Das musste von den Balken kommen, die das Dach trugen.
Ich stellte den Koffer ab und öffnete ein Fenster. Der Innenhof war grau, aber auf einer Leine trocknete bunte Wäsche. An einem Fenster einen Stock tiefer hing klingelnd ein Mobile aus feinen Metallplättchen. Aus einem anderen Fenster lärmte ein Fernseher.
Der kleine Vorraum (Kleiderablage mit einer Wirrnis von Jacken, Hüten und Kappen an den Haken, unten Paare abgenützt wirkender Turnschuhe und Sandalen), dieser kleine Vorraum war nur durch ein niedriges Mäuerchen von der Küche getrennt. Und stimmt schon – das ist eine Küche mit einer gewissen Atmosphäre. Ein massiver Tisch mit einer Vase voll zart vertrockneter Gräser und an der Wand Poster und Bilder. Aber die nahm ich vorerst nur flüchtig wahr – mein Blick suchte etwas anderes.
Nämlich den Kühlschrank. Und tatsächlich: Da war er. Grün mit Nickelbeschlägen – erinnerte ein wenig an die Karosserie eines Oldtimers. Wie schön! Ich öffnete ihn. Aber ich hatte mir falsche Hoffnungen gemacht. Natürlich war dieser Kühlschrank seit langer Zeit abgesteckt.
Abgetaut.
Ich steckte ihn wieder an. Er bebte.
Das Lämpchen im Inneren wachte zwinkernd auf. Und nun sah und roch ich ein paar Stückchen Käse und eine Packung Butter, die ich demnächst wegwerfen musste. Aber auch ein paar Flaschen Birra Moretti und – Gott sei Dank! – eine Flasche Mineralwasser.
Das schmeckte allerdings brackig – ich spuckte den Schluck, den ich probiert hatte, gleich ins Spülbecken. Trank lieber ein paar Schluck Leitungswasser aus dem darüber angebrachten Hahn. Wahrscheinlich enthielt das ein paar Bakterien, die mein Darm noch nicht kannte. Da traf es sich, dass eine immerhin noch halbvolle Flasche Grappa auf der Anrichte stand.
Und ich setzte mich mit der Flasche an den großen Tisch, in dessen dunkel gebeizter Platte Spuren von alten Holzwurmbewegungen nicht nur zu sehen, sondern auch zu ertasten waren. Und saß den Bildern und Postern an der Wand gegenüber. Da war die Kopie eines Freskos, das mir bekannt vorkam – eine Madonna mit tiefhängenden Augenlidern … Und ein Aquarell, das den amputierten Flügel eines großen Vogels zeigte – oder war das der Flügel eines Engels?
Die Wohnung ist um den Hof herum angeordnet, hatte Julia gesagt. Biegst du aus der Küche nach rechts ab, so kommst du in den Raum, den wir scherzhaft Bibliothek nennen. Das ist ein kleines Zimmerchen mit Büchern, nicht nur im Regal, sondern eigentlich überall, mein Mann Marco neigt zur Bildung von Bücherhaufen. Du musst also keine Bücher mitnehmen, dort wirst du genug zum Lesen finden. Da steht auch ein Piano, das wird sicher verstimmt sein. Aber vielleicht kannst du trotzdem darauf spielen. Obenauf ein paar Gläser mit Stachelschweinstacheln, die wir im Lauf der Jahre beim Spazierengehen gefunden haben. Darüber ein Foto mit grünen Fischen, die von links nach rechts schwimmen, und einem roten Fisch, der schwimmt von rechts nach links.
Julia, meine ehemalige Therapeutin – ich hatte ihr viel von mir erzählt. Aber sie hatte mir auch von sich erzählt. Das hatte sich so ergeben, doch so geht das nicht weiter, hatte sie gesagt. So ein Verhältnis zwischen einer Therapeutin und ihrem Klienten darf nicht sein.
Das ist aber schade, hatte ich gesagt, unsere Gespräche werden mir abgehen.
Wir können uns ja privat treffen, hatte sie gesagt.
So hatte sich das entwickelt. Und wir hatten uns öfter getroffen. Auf einen Kaffee oder einen Prosecco in einem der Lokale am Spittelberg, wo sie ihre Praxis hatte, auf einen Spaziergang durch Volks- und Burggarten, die nicht weit von dort entfernt waren, schließlich in der Laube eines kleinen Heurigenlokals in Sievering.
Und dann kommst du in den schmalen Gang, in dem linker Hand mein Schreibtisch steht, mit ein paar Erinnerungsfotos und Nippes, die mir Marco geschenkt hat. Und mit diversen Papieren, die du mir bitte nicht anrührst. Lass meinen Schreibtisch am besten links liegen. Übrigens Achtung! Du musst dich bücken wegen der Dachschräge!
Ich hatte Julias Stimme im Ohr. Aber ich schlug mir trotzdem den Kopf an.
Mach dir nichts draus, sagte sie, du bist nicht der Erste.
Und dann öffnest du die Glastür zur Terrasse und schiebst den Vorhang zur Seite. Und da wirst du verstehen, warum wir diese Wohnung gekauft haben.
Tatsächlich? – Nach den ersten zwei Schritten auf die Terrasse verstand ich das noch nicht. Die Fliesen stellenweise von Flechten überwachsen, die Balustrade vermoost, die Pflanzen in den Blumengeschirren verdorrt … Ein zerfetzter Sonnenschirm, wie ein geknicktes Segel … Und die Ecke unter der verrosteten Antenne, deren Arme vom Dach des Nebenhauses herüberreichten, voll Taubendreck.
Doch dann die Aussicht! Der Blick auf den Garten da unten … Die raffinierte Geometrie der Beete … Von niedrigen Buchsbaumhecken eingefriedete Felder … Dreieckige Felder außen, trapezförmige Felder innen … Dahinter ein schmales, hohes Haus in der Mauer … (Anscheinend war die Parkmauer dort identisch mit der Stadtmauer.) Ein Haus, das aussah, als wüchse es aus dieser Mauer heraus … Und ein dunkelgrüner Strauch oder Baum mit blauen Blüten, der sich an die sienabraunen Ziegel schmiegte …
Und dahinter die Hügellandschaft – wie hingemalt in zartesten Farben, Schicht um Schicht … Bis meine Augen nicht mehr sicher waren, ob das, was sie dort sahen, noch Hügel waren oder schon Wolken … Oder war das ein Streifen Meer? – Konnte das sein? – Wie weit war die Küste von hier entfernt? … Ich musste mir das auf einer Landkarte ansehen.
Und ich wandte den Blick nach rechts und sah die ziegelrote Dachlandschaft … Und begriff erst jetzt, dass ich mittendrin war … Ein Dach grenzte ans nächste, Schornsteine, Antennen, auf denen Vögel saßen, als hätte man diese Antennen just für sie gepflanzt. Spontan der Gedanke, dass man auf den Dächern über den ganzen Ort gehen könnte, allerdings vorsichtig, mit langen Beinen, auf Zehenspitzen, um möglichst wenige Dachziegel zu beschädigen.
Und ich wandte den Blick nach links und sah die Reihe hoher, schlanker Bäume, die dort den Garten zu begrenzen schienen. Steineichen, lecce, die ich damals noch nicht bei diesem Namen zu nennen wusste. Wie sie mich ansprachen, die Gebärden dieser Bäume … Wie sich ihre Zweige sanft bewegten, obwohl kaum Wind wehte …
Was dahinter war, zeigte sich mir noch nicht … Aber von dort her kam ein großes Vibrieren … Manchmal setzte es abrupt aus, kurz darauf setzte es wieder ein – die Intervalle waren nicht berechenbar … Das war das Gerassel der Zikaden, die, von der Hitze aufgeladen, dieses Geräusch verursachten, dieses Geräusch, das dem Tinnitus ähnelte, der mir manchmal zu schaffen machte, obwohl ich ihn eigentlich mochte.
Und ich fühlte mich wieder ein bisschen schwindlig. Es war wohl besser, wenn ich nicht wie hypnotisiert an der Balustrade stehen blieb. Ich musste dringend duschen, am besten kalt. Als ich aus der grellen Sonne der Terrasse wieder ins Dunkel unter dem Dach tauchte, schlug ich mir zum zweiten Mal den Kopf an.
Und ich suchte das Bad und fand es und zog mich aus … Und suchte den Lichtschalter, fand ihn aber nicht … Okay, so würde ich eben im Halbdunkel duschen … Ein bisschen Licht fiel durch ein kleines Fensterchen, durch das auch etwas Luft hereinkam.
Aber als ich einen Fuß in die Duschnische setzte, sah ich etwas auf den Fliesen liegen.
Und ich erschrak. Was ist das? – etwas Ekliges? – etwas Gefährliches?
Aber nein, dachte ich – vielleicht ist das bloß ein etwas seltsam geformtes Shampoofläschchen, das da auf den Fliesen liegengeblieben ist … Ich bückte mich, um es aufzuheben – aber das fühlte sich nicht an wie Kunststoff oder Glas.
Es fühlte sich weich an und glatt, es fühlte sich an wie Gefieder! – Und meine Hand erschrak – ein toter Vogel? – Wie traurig! Aber auch wie unangenehm! – Ich lief in die Küche, streifte ein Paar von den Gummihandschuhen über, die da auf dem Bord neben dem Herd hingen, griff nach einer Tragtasche mit der Werbeaufschrift einer Supermarktkette, die, so viel ich verstand, zum Respekt vor der Natur aufforderte, und lief ins Badezimmer zurück.
Und kniete nieder vor dem Vogelkadaver … Aber jetzt spürte ich: Was ich da anfassen wollte, war gar nicht tot … Es regte sich, es rührte sich … Und nun merkte ich, dass es einen Flügel zu bewegen versuchte … Und da konnte ich es natürlich nicht in die Tragtasche stecken, in der ich es beinah entsorgt hätte …
Was tun? – Ich musste etwas finden, um den Vogel aus der Duschwanne herauszubekommen – Und da fiel mein Blick durch die Tür, die hinter mir offengeblieben war, auf die Kleiderablage im Vorraum – diese Kleiderablage mit den vielen Kappen und Hüten – Und schon war ich dort und griff nach einem gelben Strohhut mit blauem Band …
Und schon war ich zurück und stülpte den Hut über den Vogel – Den Vogel, der nun mit beiden Flügeln schlug – Und nun brauchte ich nur noch etwas, um es unter den Hut zu schieben – Und, schau! Da lag ja ein Stapel alter Zeitungen neben dem Bidet …
Leicht ist es nicht, mit dem linken Arm dort hinzulangen, während die rechte Hand auf dem Hut liegenbleiben muss, unter dem der Vogel flattert … Aber ich schaffe es und schiebe die Hochglanzhülle einer bunten Wochenendbeilage unter die Krempe … Behutsam, behutsam, um den ja höchstwahrscheinlich verwundeten Vogel nicht noch zusätzlich zu verletzen … Ich glaube, ich höre seine Krallen auf dem Papier kratzen.
Es gelingt mir, ihn auf die Terrasse zu tragen … Doch wohin jetzt mit ihm? … Hier zittert ja nach wie vor alles unter der Sonnenglut … Nur ganz links, wo ein starker Oleanderbusch trotzigen Widerstand gegen das Verdorren leistet, wirft die Feuermauer des Nebenhauses einen Streifen Schatten … Dort setze ich meine fragile Last auf der Balustrade ab und hebe den Hut weg.
Und da liegt er, der Vogel: eine schöne, große Rauchschwalbe … Aber matt liegt sie da, grau auf dem bunten Zeitungsblatt … Sie liegt auf der Seite, die Schwalbe – ist sie schwer verletzt? … Jetzt öffnet und schließt sie den Schnabel – Ach ja klar, sie hat Durst – Und schon laufe ich wieder in die Küche.
Und komme mit Wasser zurück … Ein wenig Wasser in einer Untertasse … Stelle die Untertasse neben die Schwalbe auf die Balustrade … Und warte … Bemerkt sie das Wasser überhaupt? … Ich weiß es nicht … Sie richtet sich nicht auf, sie hebt nicht einmal das Köpfchen.
Wird sie es schaffen? – Eher nicht. – Ich will ihr nicht beim Sterben zusehen.
Jetzt kommt ein kühler Wind auf, und da wird mir bewusst, dass ich nackt bin.
Und ich gehe zurück zur Dusche und werfe einen Bademantel über. Er riecht gut. Nach Mandelöl. Bestimmt gehört er Julia.
Als ich wieder auf die Terrasse komme, sitzt die Schwalbe vor der Untertasse und trinkt … Bedächtig trinkt sie, berührt mit dem Schnabel das Wasser, hebt den Kopf, lässt den Tropfen durch ihre Kehle rinnen, wartet ein paar Sekunden … Und dann trinkt sie wieder … Und wieder … Und noch einmal … Und jetzt breitet sie die Flügel aus – und fliegt.
Ich war geneigt, das als gutes Omen aufzufassen. Aber jetzt spürte ich wieder, wie müde ich war. Unter der Dusche wäre ich fast im Stehen eingeschlafen. Das Wasser war nicht kalt, sondern warm, auf dem Weg hier herauf verliefen die Leitungsrohre wahrscheinlich in der prallen Sonne.
Gleich neben dem Bad war das Zimmer, in dem offenbar Marco und Julia schliefen, wenn sie hier waren. Das letzte Mal musste schon eine Weile her sein, aber es sah aus, als hätten sie diesen Raum erst gestern verlassen. Das Bett nicht gemacht, sondern nur rasch mit einem Überwurf bedeckt. Ein relativ schmales Doppelbett – ein Lager für Liebende.
An den Wänden Fotos, auf denen die beiden um einiges jünger waren, als ich sie kannte. Marcos Augen noch nicht so verkniffen, sondern lebens- und unternehmungslustig, Julia mit offenem, langem Haar, in schöner Halbkreisbewegung, ein wenig wie im Tanz. Auf einem etwas abseits hängenden Foto waren sie irgendwo am Strand, Julia im Badeanzug in der Mitte, rechts Marco, links ein Mann mit graumeliertem Bart und Pfeife. Auf diesem Foto stand etwas mit Kugelschreiber geschrieben, aber ich konnte es nicht entziffern.
Irgendwo musste doch das Gästezimmerchen sein, von dem Julia gesprochen hatte. Aber ich war jetzt zu müde, um es zu suchen. Hier war ein Bett. Hier konnte ich mich fallen lassen. Auf dem Dach über meinem Kopf Getrippel – waren das Vögel oder kleine Nagetiere? – Egal. Ich schlief schon.
Als ich erwachte, wusste ich eine Weile nicht, wo ich war. Ein kleiner Raum unter der Dachschräge, ein winziges Fensterchen, durch das nur wenig Licht hereinkam, ein Geräusch in meinen Ohren, das mir im Halbschlaf eine Bootsfahrt vorgegaukelt hatte. Auf einem alten Ruderboot, am ehesten war es ein Fischerboot. Und was ich gehört hatte, war das Reiben der Ruderzapfen in den Dollen.
Ich erhob mich, ein wenig wankend, tastete mich die Wand entlang. Und da war die Glastür und da war der Vorhang und dann stand ich wieder auf der Terrasse. Unter dem großen, immer noch blauen Himmel. Auf Augenhöhe mit einem Engel, der, flach aus Blech geschnitten wie ein Wetterhahn, an der Spitze des Kirchturms montiert war und dessen Bewegung im Wind ein rostiges Quietschen verursachte.
Genau, das war es, was ich im Traum gehört hatte. Oder hatte ich auch die Schwalben gehört? Schwärme von Schwalben über dem Garten, zwischen den roten Dächern hüben und der grauen Stadtmauer drüben. Mit welcher Gewandtheit, mit welchem Tempo sie sich drehten und wendeten, wie sie schrill jauchzten vor Jagd- und Lebenslust!
Ob die Schwalbe, die ich schon für tot gehalten hatte, da mitflog? Jetzt kurvte eine ganz knapp an meinem Kopf vorbei … Ein heftiger Luftzug … Optisch nahm ich sie kaum wahr, allenfalls als blauschwarzen Streifen … Aber akustisch: als schrie sie mir etwas ins Ohr.
Doch dann sind auf einmal diese zwei Tauben da. Sie sitzen auf der Balustrade und schauen mich an.
Wer bist / DU?, fragen sie mich, wer bist / DU? Wer bist / DU?
Graues Gefieder, gelbe Schnäbel, rote Augen.
Wer bist / DU?, wiederholen sie, wer bist / DU? Wer bist / DU?
Ich bin Paul, sage ich, aber sie scheinen mir nicht zu glauben.
Ich glaube, ich bin Paul, sage ich und klatsche in die Hände.
Da flattern sie weg.
Was glauben diese Tauben?
Ich hatte Hunger. Wie spät war es eigentlich? Gegen sieben vielleicht. Wo hatte ich meine Uhr abgelegt? Ich hätte längst, fiel mir jetzt ein, meine Medikamente nehmen sollen. War es dazu schon zu spät? Besser spät, dachte ich, als gar nicht. Ich würde sie eben jetzt nehmen. Aber nicht auf leeren Magen. Ich ging in die Küche und suchte nach etwas Essbarem. Ich fand eine Packung Grissini, anscheinend noch nicht verschimmelt. Ich füllte ein Glas mit Wasser aus dem Hahn über dem Spülstein und schluckte die Pillen.
Dann schlüpfte ich in Hose und T-Shirt. Ob es draußen im Lauf des Abends etwas frischer werden würde? Ich war sicher, einen Pullover in den Koffer gepackt zu haben, aber ich fand ihn nicht. Also nahm ich eine der Jacken von der Kleiderablage, warf sie mir über die Schulter und ging.
Unter dem Glasdach im Stiegenhaus war es immer noch heiß, aber die Temperatur nahm von Stockwerk zu Stockwerk ab. Unten im Flur war es wieder angenehm kühl. Da blieb ich stehen und sah mich ein wenig um. Im Halbdunkel, das hier herrschte, war die Frau, die mir vor ein paar Stunden beim Aufsperren des Haustors geholfen hatte, verschwunden.
Aber wohin? Da war ein kleiner Raum unter der Treppe, in dem grindige Koffer und Körbe standen. Da war der Verschlag mit den Sicherungen, von dem Marco gesprochen hatte. Dann war da eine Wand, von der, als ich mich an ihr entlangtastete, der Verputz abbröckelte. Und – ja – dann war da eine Tür, die ich vorerst für verschlossen hielt, doch sie war nur verzogen und gab schließlich nach.
Unter meinen Füßen Kopfsteinpflaster, in den Fugen zwischen den Steinen Gras. Über meinem Kopf ein quadratischer Ausschnitt des Himmels. Und dazwischen die Leine mit der Wäsche. Bunte Fähnchen, die ich nun von unten sah.
Auf der anderen Seite war der Hof nicht abgeschlossen, sondern mündete in einen schmalen Gang … An der Ziegelwand gab es zwar einen Schalter, den ich mit etwas Überwindung berührte, aber die Glühbirne, die nackt vom Plafond hing, reagierte nicht … Ich ging trotzdem ein paar Schritte weiter, aber da lag ein Berg Sand im Weg … Umringt von ein paar großen, rauen Papiersäcken, vermutlich voller Kalk oder Zement … Da raschelte es … Waren das Mäuse? … Oder gar Ratten? … Dann wurde es immer dunkler … Da ging ich nicht weiter … Denn was sollte denn das? Was wollte ich denn? … Dass die Frau, die mir mit dem Schlüssel geholfen hatte, hier verschwunden war, schien mir doch sehr unwahrscheinlich.
Sono Valeria, hatte sie gesagt – und weg war sie gewesen.
Ich versuchte mich an ihr Aussehen zu erinnern.
Haare: dunkelblond oder brünett? … Gesicht: rund.
Oder oval? … Augen: braun. Oder grau?
Hatte ich ihr überhaupt ins Gesicht geschaut? … Allenfalls erinnerte ich mich an ihre Hände …
Schmale, aber kräftige Hände, starke Adern und Sehnen … Also eine Person, die mit ihren Händen arbeitete … Doch vielleicht war es bloß mein Kopf, der solche Details konstruierte und in Versuchung kam, sich Geschichten dazu auszudenken … Wahrscheinlich würde ich diese Frau nicht einmal wiedererkennen, wenn sie mir noch einmal über den Weg liefe.
Und erst recht nicht, wenn sie eine Maske trug. Draußen trugen nämlich die meisten Masken. Das überraschte und befremdete mich. Nach dem Gespräch mit Marco im Café Wortner hatte ich das nicht erwartet.
Darüber hinaus irritierte mich die Menge. Als ich am Nachmittag angekommen war und meinen Koffer vom Parkplatz hierher in die Via Boccaccio gerollt hatte, war doch kaum ein Mensch zu sehen gewesen. Jetzt aber so viele. Und fast alle maskiert. Mit meinem nackten Gesicht fühlte ich mich hier als Fremdkörper.
Ein Glück, dass da gleich eine Apotheke war. Geduckt schlüpfte ich durch die Tür, hielt mir ein Papiertaschentuch vor Nase und Mund. C’e l’avete mascherine? Selbstverständlich gab es hier Masken. Zwei Minuten später, eine garantiert sterile FFP2-Maske, Made in China, vor Nase und Mund, reihte ich mich ein in den Korso der Maskierten.
Auf der Piazza wurde alles noch dichter. Ein absurdes Gewimmel von Menschen mit Masken. Die mit den weißen sahen aus wie Ärzte, die mit den schwarzen wie Räuber. Das wogte und summte wie ein makabrer Karneval.
Oft hatte mir Julia vom abendlichen Treiben auf der Piazza erzählt. Auf der Piazza della Libertà mit der alten Bar Centrale. Ein bisschen abgenutzt sei die gewesen, nicht auf Hochglanz geputzt, aber sympathisch. Drinnen eine Theke im Stil der Fifties, dunkles Holz mit Messingbeschlägen, draußen ein Vorgarten mit einer grün-weiß-rot gestreiften Markise.
Habe man weder drinnen noch draußen einen freien Sessel gefunden, so habe man einfach sein Glas Bier, Wein oder Cola genommen und sich damit auf die Stufen der gegenüberliegenden Kirche gesetzt. Der Padrone, Gianfranco habe der geheißen, sei nicht auf die Idee gekommen, Einsatz für die Gläser zu verlangen – er habe doch die meisten seiner Gäste beim Vornamen gekannt. Schon bald auch sie beide, das junge Paar Julia und Marco. Und wenn ab und zu ein Glas zerbrochen oder verschwunden sei – non importa, na wenn schon!
Wie schön, auf den Stufen der Kirche zu sitzen und dem Treiben auf der Piazza zuzusehen. Vor allem dem Treiben der Kinder, die sich hier, von angeregt plaudernden Eltern nur nebenbei und meist sorglos beaufsichtigt, herumtummeln durften bis in den späten Abend. Mit einer Unbefangenheit, die Kindern jenseits der Alpen meist nicht gegönnt war. Diese schöne Bewegungsfreiheit der Kinder auf dem Freiheitsplatz!
Davon hatte Julia besonders gern erzählt. Julia, eine überbehütete Kindheit lang von einer überängstlichen Mutter an fast jeder Aktivität gehindert, bei der sie sich schmutzig machen oder gar wehtun konnte, Julia wäre gern so ein Kind gewesen. Die Bewegungsfreiheit der Kinder von San Vito war ihr beneidenswert erschienen. Aber wie lang war das her? Und was war davon übriggeblieben?
So viel traf ja zu: Kinder tummelten sich hier nach wie vor viele. Auf beneidenswert flinken Füßen flitzten sie hin und her, kurvten auf Laufrädern, Dreirädern, Fahrrädern, Rollschuhen, Skateboards … Doch bei der Dichte, in der überall Erwachsene im Weg standen, in immer der gleichen dummen Pose ihre Handys vor sich hinhaltend, und bei der Rücksichtslosigkeit, mit der immer neue Scharen den Platz kreuzten und querten, sodass auch die geschicktesten Slalomfahrer unter den ragazzi und ragazze kaum ausweichen konnten – bei dieser Bevölkerungsdichte war die Bewegungsfreiheit, von der Julia geschwärmt hatte, sehr eingeschränkt.
War das wirklich der Ort, von dem sie mir erzählt hatte? Das war vielleicht einmal dieser Ort gewesen. Hätte ich noch etwas von jenem Flair mitbekommen wollen, so hätte ich früher kommen müssen. Und das hätte ich ja können – Julia und Marco hatten mir ja schon eher angeboten, mich für ein paar Wochen in ihr toskanisches Refugium zurückziehen.
Warum war ich damals nicht auf dieses Angebot eingegangen? Vielleicht, weil ich das Gefühl gehabt hatte, dass sie mich, der ich nach und nach zu einer Art Hausfreund bei ihnen geworden war, damit auf elegante Weise wenigstens für eine Weile loswerden wollten. Dann hatte ich mich zusammengenommen und mich selbst für einige Zeit von ihnen ferngehalten. Erst jetzt, nach der Absage meines Comebacks als Musiker, nach dieser Enttäuschung, von der ich Abstand gewinnen wollte, musste, war ich darauf zurückgekommen.
Aber nun war ich eben zu spät dran. San Vito war nicht mehr das, was es einmal gewesen war. Die Bar Centrale, in der ich jetzt trotzdem gern einen Aperitivo getrunken hätte, zum Trost, hatte offenbar längst einen neuen Besitzer, der ihr ein Lifting verordnet hatte. Girlanden von LED-Lämpchen blinkten in wechselnden Farben, Düfte rieselten aus glitzernden Röhrchen, Musik aus bebenden Boxen erstickte allfällige Gespräche.
Der Vorgarten war adrett – aber wie hatte ich bloß glauben können, ich dürfe ihn einfach betreten? Da prangte ein Schild mit der Aufschrift WAIT TO BE SEATED. Und daneben stand ein Kellner wie ein Wachsoldat in einer metallisch schillernden Jacke. Mit vor der breiten Brust verschränkten Armen.
Ich entkam in eine Seitengasse. Da wurde es nach und nach immer stiller. Aber auch dunkler. Nur ab und zu eine mit gedämpft gelbem Licht leuchtende Laterne. Diese Folge von Laternen erinnerte mich an Bilder, die ich einmal in einer Ausstellung gesehen hatte.
Wo war das gewesen? Bilder aus einer kühleren Weltgegend. Amsterdam, Brügge, Brest oder Le Havre? In einem Roman von Georges Simenon? In einem Chanson von Jacques Prévert? Manchmal habe ich diese Bilder geträumt.