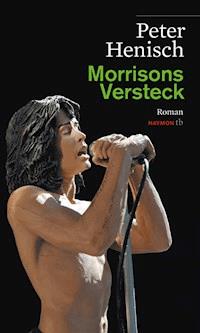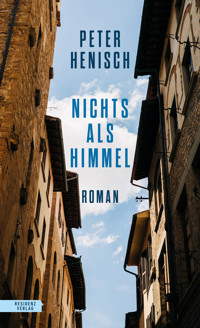Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman mit Knalleffekt und voll leiser Ironie: komisch, tragisch, furios! Novak entdeckt die Welt der großen Gefühle spät und ausgerechnet im Krankenhaus. Weil ihm sein Zimmergenosse Nacht für Nacht den Schlaf raubt, leiht ihm die indonesische Krankenschwester Manuela ihren Walkman samt Kassetten und infiziert ihn so mit ihrer Liebe zur Oper. Aus dem Krankenhaus entlassen, findet er nicht so recht in sein gewohntes, gewöhnliches Leben zurück. Manuela hat ihm die Ohren geöffnet, allerdings auch für die Zumutungen des lärmenden Alltags, für Rasenmäher, Pressluftbohrer und seine Frau Herta. Während er weiter seinem Laster frönt und Opern hört, vermutet sie hinter seiner Leidenschaft die Liebe zu einer anderen Frau. So falsch liegt sie damit auch nicht. Doch Manuela ist plötzlich verschwunden. War sie nur ein Trugbild auf der Bühne von Novaks späten Träumen? Oder hat Herta etwas mit ihrem stillen Abgang zu tun? Das Finale ist auch ohne sie große Oper: grausam dramatisch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Henisch Großes Finale für Novak
Peter Henisch
Großes Finale für Novak
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2011 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:
978-3-7017-4223-3
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1547-3
I
NIE WÄRE NOVAK auf die Idee gekommen, daß ihm Opernmusik einmal etwas bedeuten könnte. Bis an sein fünfundfünfzigstes Lebensjahr hatte er sie, so weit er sich erinnerte, nur aus Versehen gehört. Und das selten länger als wenige Sekunden. Maximal (wenn seine Reaktionszeit infolge der zunehmenden Müdigkeit, die er nicht zugeben wollte, aber vor sich selbst nicht verleugnen konnte, etwas länger war) ein paar Minuten.
Spätestens, sobald aus dem Gewoge von Orchesterklängen auch noch Stimmen auftauchten – peinlich gekünstelt oder jenseitig pathetisch die männlichen, befremdlich glukkenhaft oder absurd schrill die weiblichen –, hatte er einen anderen Sender gesucht. War seine Reaktionszeit zu lang, so machte ihn seine Frau auf die Unzumutbarkeit solcher Klänge aufmerksam. Herta hieß sie – er war seit dreißig Jahren mit ihr verheiratet. Das kann man doch nicht anhören, sagte sie, dieses Geschrei ist ja nicht auszuhalten!
Sie hatte zwar selbst eine Stimme, die sich leicht in Bereiche erhob, in denen sie nicht angenehm klang. Aber Herta selbst schien das nicht so zu hören. Ab und zu fragte sich Novak, ob sie diese Stimme schon gehabt hatte, als sie einander kennen- und – wie man so sagt – lieben lernten, und wenn ja, wieso ihm das damals nicht aufgefallen war. Doch diese Frage hatte jetzt keinen Sinn mehr – das hättest du dir früher überlegen müssen, war eine der Wendungen, die seine Frau ihm gegenüber gern anwandte.
Im übrigen geriet Hertas Stimme nur in die schlimmen Bereiche, wenn sie verärgert oder empört war. Allerdings war sie leicht und – diesen Eindruck hatte Novak im Lauf der Jahre immer häufiger – manchmal geradezu gern empört. Was ihn betraf, so gab er ihr möglichst wenig Anlaß dazu. Novak war ein harmoniebedürftiger Mensch.
Er vermied es, zu streiten, sowohl im Postamt, in dem er Montag bis Freitag von 8 bis 13 und von 15 bis 18 Uhr arbeitete, als auch im Gasthaus, in dem er jeden Donnerstagabend Schach spielte. Stimmt, bei den Sektionsabenden der Partei, der er treu geblieben war, obwohl sie ihn seit Jahrzehnten enttäuschte, hatte er manchmal, als er noch hin ging, einen roten Kopf bekommen, und das letzte Mal, bevor er die Tür hinter sich zugeschlagen hatte, da hatte er den jämmerlichen Figuren dort wirklich seine Meinung gesagt. Ihr wollt Sozialdemokraten sein, ihr wißt ja gar nicht mehr, was das heißt, hatte er gesagt. Daran erinnerte er sich mit einer gewissen Genugtuung, aber er war nicht sicher, ob er das gesagt hatte, als er noch drinnen im Lokal gewesen war oder schon draußen auf der Straße.
Mit seiner Frau wollte er am allerwenigsten streiten, die paar Mal, die er in den drei Jahrzehnten ihres Ehelebens mit ihr gestritten hatte, waren ihm in besonders unangenehmer Erinnerung. Danach war nach außen hin Abwehr gewesen, Verhärtung, Krampf, aber innen ein wundes Gefühl, bei Tisch, im Bett, wo man nichts miteinander sprach, sich voneinander abwandte. Er wollte das nicht, es tat ihm nicht gut, also vermied er Konflikte, die zu so etwas führen konnten. Auch wenn er sich manchmal seinen Teil dachte über gewisse Äußerungen und Kommentare, die sie etwa beim Durchblättern der Zeitung oder beim Ansehen der Fernsehnachrichten von sich gab – im großen und ganzen vermied er es, Herta zu widersprechen.
Und oft war er ja wirklich ihrer Meinung oder bildete sich das zumindest ein.
In einer Ehe, hatte er zu Bernd gesagt, dem Sohn, ihrem einzigen, als der schon längst aus dem Haus, ja aus dem Land, nämlich in Kanada, aber einmal, nach langem, wieder daheim zu Besuch war und den Vater in irgendeiner kleinen Auseinandersetzung mit der Mutter, einer Auseinandersetzung, deren Anlaß und Inhalt Novak inzwischen längst vergessen hatte, zu nachgiebig fand, in einer Ehe muß man halt aufeinander Rücksicht nehmen. Ja, ja, hatte Bernd gesagt, aber alles hat seine Grenzen. Bei ihm, der früh weggegangen war, sowohl aus dem Elternhaus als auch aus dem Land, das ihm zu eng schien, brauchte es nicht lang, bis er an die Grenzen kam: Mit noch nicht dreißig war er schon zwei Mal geschieden.
Sein Vater war anders. Franz Novak war duldsam. Zuallererst seiner Frau gegenüber, und das hielt er für richtig. Sie war die Person, die ihm am nächsten stand, mit ihr wollte oder mußte er gut auskommen. Oft war er ja wirklich ihrer Meinung – in bezug auf die Opernmusik, die man nicht anhören, nicht aushalten konnte, weswegen man rasch einen anderen Sender suchen oder das Radio überhaupt ausschalten mußte, war das jedenfalls die reine Wahrheit.
So war das bis zu Novaks Spitalsaufenthalt. Es ist richtig, von seinem Spitalsaufenthalt zu sprechen, dem Spitalsaufenthalt, denn er war ein Mann, der vorher nie ins Spital gemußt hatte. Diesmal aber, zwei Tage nach seinem 55. Geburtstag, war es höchste Zeit gewesen. Allerhöchste Zeit, hieß es nach der Operation, die man nach einer bedenklich langen und bei jedem Bremsen und Wiederlosfahren des Rettungsautos, das trotz eingeschalteter Sirenen im Morgenverkehr nicht recht vorankam, für Novak schmerzhaften Irrfahrt dann sehr rasch an ihm durchführte, in einem kleinen Spital, einem von jenen, die man demnächst zusperren würde, weil sie, so hieß es, den Staat oder den Steuerzahler zu teuer kamen, aber für Novak war dieses Spital lebensrettend.
Waren Sie nie beim Arzt, haben Sie sich nie untersuchen lassen? sagte der Oberarzt, der ihn operiert hatte, am folgenden Tag zu ihm. Sie müssen doch schon seit Jahren Schmerzen im Gallenbereich gehabt haben! So groß, wie die Steine in Ihrem Bauch waren, und besonders dieser eine! Bei diesen Worten hielt er einen Plastikbeutel hoch, in dem er Novak seine Gallensteine mitgebracht hatte.
Er hängte den Beutel an den Bügel, an dem auch der Schlauch hing, der am anderen Ende in Novaks rechte Seite mündete. Die Steine darin hatten ungefähr die Farbe von Lebertran. Genau. An Lebertran erinnerte sich Novak beim Betrachten seiner Gallensteine. Daran hatte er schon ewig nicht gedacht, das war eine Szene, die eigentlich längst über den Horizont seiner Erinnerung hinabgesunken war, doch jetzt war sie wieder da: Seine Mutter, wie sie diese ölige Flüssigkeit aus einer Flasche auf einen Eßlöffel rinnen ließ, den sie ihm, ihrem vier- oder fünfjährigen Kind, dann so rasch in den Mund steckte, daß er immer wieder, Morgen für Morgen (oder war es Abend für Abend?) an den Zähnen ankam, sehr unangenehm, zu schweigen vom üblen Geschmack, aber angeblich war das gut für den Aufbau der Knochen.
Das sieht dir wieder einmal ähnlich, sagte Herta. Warum hast du denn die ganze Zeit über nichts gesagt? Da hat der Mann Gallensteine im Bauch, aber sagt nichts! Wenn ich dich nicht noch rechtzeitig ins Spital gebracht hätte, weil du in der Nacht derart gestöhnt hast, wärst du mir, ohne ein Wort zu sagen, gestorben.
Aber jetzt laß gut sein, sagte sie, es ist ja noch einmal gutgegangen. Bist dem Tod noch einmal von der Schaufel gesprungen, bei diesen Worten tätschelte sie seine Hand. Seine rechte Hand, die auf der Bettdecke lag, während sie, seine Frau, am Bettrand saß. Von der Geburtstagstorte, sagte sie, ist noch die Hälfte übrig, aber die muß ich jetzt halt allein essen.
So war sie, Herta. Sie sagte geradeheraus, was sie meinte. Das schätzte sie an sich selbst. Und das schätzte auch er an ihr. Sie war unsentimental. Sie war praktisch. Ihr Humor war vielleicht nicht jedermanns Sache, aber im Grunde genommen herzlich. Er konnte froh sein, daß er so eine Frau hatte.
Eine gute Gefährtin war sie, das hatte er ihr damals, als er sie kennengelernt hatte, gleich angesehen. Eine Frau, mit der man im Frühling und im Herbst wandern, ja sogar klettern konnte und im Sommer Boot fahren und schwimmen. Keine von diesen Tussis, stimmt, dieses Wort war damals noch nicht in Umlauf, keins von diesen dick bemalten und dünn bekleideten Mädchen, obwohl auch sie, das schon, ihr Haar blondiert und die Wimpern dunkel getuscht hatte. Im Badeanzug hatte sie sogar eine ziemlich gute Figur gemacht, besonders die schwungvoll geformte Partie zwischen Taille und Hüften hatte ihm gefallen, aber das war nun halt schon dreißig Jahre her, und darauf kam es auf die Dauer auch nicht an.
Sondern? Worauf kam es an? Daß man miteinander auskommt, hätte Novak gesagt. In guten wie in schlechten Zeiten. Da ist schon etwas Wahres dran. Was man verspricht, soll man auch halten. Bis daß der Tod euch scheidet. Na bitte, jetzt wäre es beinah so weit gewesen.
Etwas verfrüht allerdings. Heutzutage stirbt man nicht mit fünfundfünfzig. Hast du geglaubt, sagte Herta, du kannst mich mir nichts, dir nichts allein lassen? Nichts da! So haben wir das nicht ausgemacht! Wir zwei, wir haben doch noch einiges miteinander vor!
Anfang September den Urlaub in der Türkei zum Beispiel. Bis dahin werde er doch längst wieder fit sein. Stimmt, mit der Narbe am Bauch werde er keinen Schönheitspreis mehr gewinnen. Aber wegen der Schönheit habe sie ihn ohnehin nicht geheiratet.
Die Narbe war spürbar, seit die Wirkung der Narkose nachgelassen hatte. Wenn Novak seine Lage im Bett ein wenig zu verändern versuchte, spürte er, wie sie zog. Auch wenn er hustete oder zu lachen versuchte. Man hatte ihn nach der klassischen Methode operiert, eine Zertrümmerung der Steine durch Laserstrahlen wäre wegen der fortgeschrittenen Entzündung im Unterbauch nicht in Frage gekommen.
Es sei höchste Zeit gewesen, hatte der Oberarzt gesagt. Wieso Novak die Schmerzen, die er gehabt haben müsse, nicht eher geäußert habe? Ja, wieso nicht? Sie seien ihm nicht so dramatisch vorgekommen. Er war ganz einfach kein besonders wehleidiger Mensch.
Hätte Ihre Frau gestern früh nicht die Rettung gerufen, so wäre es zu spät gewesen. Da siehst du, sagte Herta, was du mit mir für ein Glück hast! Und überhaupt hast du Glück! Mehr Glück als Verstand! Zuerst, sagte sie, haben wir dich noch rechtzeitig erwischt, bevor du dich weiß der Teufel wohin davonmachst, und jetzt liegst du in diesem Zimmer wie ein Klassenpatient.
Tatsächlich: Obwohl Novak keine Zusatzversicherung hatte, lag er in einem Zweibettzimmer. In den größeren Zimmern war gerade kein Bett frei gewesen. Noch dazu war das zweite Bett vorläufig nicht belegt. Das ist ja schon jetzt fast wie Urlaub, sagte Herta, darum beneide ich dich direkt ein bißchen, nütz die Gelegenheit und schlaf dich ordentlich aus.
Und das tat er denn auch in den ersten zwei Tagen. Er schlief oder dämmerte. Auch als Stimmung kam ihm, wenn er sich nachher an diese ersten zwei Tage zu erinnern versuchte, vor allem Dämmerung in den Sinn. Morgen- oder Abenddämmerung, an helles Tageslicht erinnerte er sich kaum. Vielleicht lag es auch daran, daß die Schwestern die Rolläden an den Fenstern meistens herunterließen, aber draußen im Garten, den er, solang er noch nicht aufstehen durfte, nicht sah, sondern nur ahnte, sangen in seiner Erinnerung ständig die Amseln.
Vielleicht kündigte sich seine neue Sensibilität für das Hörbare schon damit an. Daß ihm der Amselgesang auf einmal so auffiel. Doch womöglich kam es einfach davon, daß er so viel mit geschlossenen Augen da lag. Und daß die Amseln den kommenden Frühling spürten.
Daß er trotz allen Dämmerns in dieser Phase die Schwestern nicht schon wahrgenommen hat, ist unwahrscheinlich. Sie waren ja um ihn, hilfreich bei körperlichen Verrichtungen, die er lieber allein erledigt hätte, aber es nützte nichts, anfangs mußte er sich ihre Hilfe dabei gefallen lassen. Vielleicht sah er sie bei dieser Gelegenheit nicht richtig an, weil ihm das peinlich war. Aber es gab ja auch andere Gelegenheiten, etwa wenn sie ihm das Fieberthermometer reichten oder wenn sie ihm das Essen brachten, auf einem Tablett, von dem er, immerhin schon halb sitzend im Bett, mit Bedacht aß.
Diese Schwestern! Nichts als Ausländerinnen! Ob das wirklich notwendig sei, ob es keine einheimischen Krankenschwestern gebe? Das sagte Herta bei ihrem zweiten Besuch. Wo sind wir denn? Man kommt sich ja vor wie in der Dritten Welt!
Ob es schon Manuela war, die für die Blumen, die Herta gebracht hatte, eine Vase mit Wasser füllte? Gut möglich, jedenfalls hätte die Idee etwas für sich, daß Herta die Abneigung gegen die ausländischen Schwestern just bei ihrem Anblick artikulierte. Für Novak jedenfalls war sie noch nicht Manuela, zu diesem Zeitpunkt sahen die Schwestern einander auch für seine Augen noch zum Verwechseln ähnlich. Erst ein paar Tage später lernte er sie von den anderen zu unterscheiden.
Ein paar Tage später. Das war der Tag, an dem Kratky kam. Novak hatte ja wirklich nicht erwarten können, daß das zweite Bett die ganze Zeit über unbelegt bleiben würde. All die vierzehn Tage, die er, so hatte es der Oberarzt angekündigt, im Krankenhaus bleiben sollte. Kratky, ein korpulenter Mann, kam am vierten oder fünften Tag.
Kratky! Mein Gott, womit hatte er sich den verdient? Bis dahin hatte Novak in diesem Zimmer, das ihm eigentlich nicht zustand, seine heilige Ruhe gehabt. Eine Ruhe allerdings, die er noch gar nicht so richtig wahrnahm. Zu sehr beschäftigten ihn in dieser Phase die doch recht unangenehmen Folgen der Operation und die damit verbundene Hilfsbedürftigkeit.
Dann aber, als er sich seines kleinen Glücks bewußt wurde …, daß er hier einen Komfort genießen durfte, den er zu Hause nicht hatte, daß er sich mit etwas Phantasie vorkommen konnte wie in einem Hotel … Auch wenn das Essen, das man ihm brachte, langweilig war (aber es bestand Hoffnung, daß es nach und nach besser würde) … Akkurat dann, als er diesem Spitalsaufenthalt etwas abzugewinnen begann, wurde das zweite Bett in dem Zimmer, das er bei sich schon das seine nannte, belegt.
Ausgerechnet mit Kratky! Es waren ja auch andere Bettnachbarn vorstellbar. Still vor sich hindämmernde, kultiviert lesende, angeregt plaudernde. Schon richtig, Novak hätte sich selbst als eher schweigsamen Menschen bezeichnet. Doch die Tage im Spital waren lang, und einem netten Gespräch ab und zu hätte er durchaus etwas abgewinnen können.
Nur war Kratky halt nicht der Typ für so was. Nicht Novaks Typ als Gesprächspartner, nein, absolut nicht. Zwar redete er, kaum daß er da lag, den halben Tag, an dem er auf seine Operation wartete, legte darauf Wert, sich als Veteran zu erkennen zu geben, der schon eine lange Reihe von Eingriffen hinter sich hatte – sein ganzer Bauch, sagte er stolz, sei kreuz und quer von Narben durchfurcht, das sei, lachte er, sehenswert, da schauen Sie her (er hob tatsächlich sein Nachthemd), zuerst haben sie mir die Gallensteine herausgenommen, dann die Nierensteine, dann die Blasensteine … Aber das wollte Novak nicht hören (nebenbei hatte er nie begriffen, weder vor noch nach der Operation Kratkys, was für eine Art von Stein oder welches Organ seines Nachbarn jetzt an der Reihe war).
Was ihn von Anfang an störte, war Kratkys Masse. Nicht daß er etwas gegen dicke Leute hatte! Einer seiner liebsten Partner im Schachklub, Potz, war ein durchaus beleibter Mensch. Von Kratky aber, dessen Körper nicht nur viel Luft verbrauchte, sondern – Novak bildete sich ein, das regelrecht zu spüren – vorweg schon verdrängte, von diesem Kratky fühlte er sich bedrängt.
Seine Umwälzungen brachten die Federn des Betteinsatzes zum Ächzen. Schon diese in Abständen von nur wenigen Minuten wiederholten Elementarbewegungen hätten genügt, Novak in eine unbehagliche Unruhe zu versetzen. Dazu kam jedoch ein Stöhnen, das diese Bewegungen häufig begleitete. Zu schweigen von den Fürzen, die dem Mann im Zuge solcher Anstrengungen entkamen.
Daß Kratky schnarchte, war nach alldem nicht mehr überraschend. Kaum hatte sich sein Körper auf Schlafatmung umgestellt, ging es damit los. Und wie! Um sein Problem zu verdeutlichen, versuchte Novak dieses Schnarchen nachzumachen. Manuela hatte ein liebes Lachen.
Das war auf dem Gang. Es gab dort eine kleine, weiß gestrichene Bank. Eine Bank, auf der sich auch die Schwestern manchmal ausruhten. Da saß Manuela. Er hatte gerade erst mitbekommen, daß sie so hieß. Schwester Manuela. Der Name stand auf dem kleinen, über der linken Brust aufgenähten Etikett.
Daß Novak um 11 Uhr nachts hier draußen auftauchte, war natürlich nicht in Ordnung. Die paar Schritte, die er tun sollte, um wieder ein bißchen in Schwung zu kommen, hatte er schon untertags getan. Aber die Schwester Manuela verstand ihn. Daß er unter diesen Umständen nicht schlafen konnte, war kein Wunder.
Sie ging also ins Schwesternzimmer, um ein Schlafmittel zu holen. Mit einem Glas in der Linken und der Tablette auf der flachen Rechten kam sie zurück. Er schluckte die Tablette und trank einen Schluck Wasser nach. Ob sie etwas dagegen hatte, wenn er sich mit dem halb ausgetrunkenen Glas noch einen Moment neben sie auf die Bank setzte?
Anscheinend nicht. Sie war eine freundliche Person. Kurz sah er sie von der Seite an. Er sah den sanften Schwung ihrer Wange. Aber er konnte sie nicht einfach nur ansehen. Obwohl ihm das genügt hätte. Er mußte irgend etwas sagen.
Woher kommen Sie? fragte er also.
Aus Indonesien, sagte sie.
Ah ja, Indonesien, sagte er. Von dort habe er einige Postwertzeichen.
Sammeln Sie Briefmarken? fragte sie.
Ja, sagte er. Ein wenig … Er sei bei der Post. Da habe sich das ergeben.
Er räusperte sich. Sollte er sie etwas über Indonesien fragen? Er erinnerte sich vage, daß es dort ein übles Regime gegeben hatte. Was man so mitbekommt aus den heimischen Zeitungen. Eine Diktatur da, ein Putsch dort, gottlob immer noch weit weg, man neigt dazu, das zu überblättern. Eine ungefähre Erinnerung an den runden, aber mit einem kantigen Kinn ausgestatteten Kopf eines Politikers. So einer läßt sich gern auf Briefmarken abbilden. Aber wie lang war das her? Und wie alt war Manuela? Er wollte sich mit seiner Unkenntnis der Verhältnisse nicht blamieren, also schwieg er.
Außerdem wurde er müde. Das Schlafmittel begann zu wirken. Einem gewissen Anlehnungsbedürfnis, das in ihm aufstieg, gab er nicht nach. Sie sollten jetzt schlafen gehen, sagte Manuela. Ja, sagte er. Sie haben recht. Dankeschön. Gute Nacht.
Als wären die Geräusche, die er selbst verursachte, nicht genug, hatte Kratky damit begonnen, Radio zu hören. Das Koffergerät, das aussah wie ein großes Überraschungsei, hatte ihm seine Frau nach der Operation mitgebracht. Eine kleine, dürre Person – Novak ertappte sich dabei, daß er sich fragte, wie sie ihren Mann aushielt. Die Frage, wie er ihn selbst aushalten sollte, lag allerdings näher.
Nicht daß er prinzipiell etwas gegen ein unterhaltendes Radioprogramm gehabt hätte. Doch Kratky hörte mit Vorliebe Regionalsender. Dieser falsche Hüttenzauber schon in aller Früh, dieser verlogen launige Dialekt, in dem sich die Sprecherinnen und Sprecher einer imaginären Landbevölkerung anbiederten! Und darüber hinaus (auch was die Lautstärke betraf) das fröhliche Gedröhne der Blasmusik!
Zwar reduzierte Kratky, auf höfliches Ersuchen, das anfangs schmetternde Klangvolumen. Aber so ganz schien er nicht einzusehen, was man gegen die sogenannte Volksmusik und die witzigen Kommentare haben könne, die einfach dazugehörten wie der Senf zur Wurst. Nach und nach drehte er die Lautstärke wieder höher und höher. Im Endeffekt war der Raum erfüllt von gnadenloser Gemütlichkeit.
Manuela verschaffte Novak Ohropax, aber das half nicht wirklich. So tief konnte er sich die Stöpsel gar nicht in die Ohren stecken. Die Klänge und Stimmen wirkten zwar weiter entfernt. Doch sie blieben auf ärgerliche Art vorhanden.
Man müßte etwas anderes haben, um das zu übertönen. Egal was, sagte Novak. Nur bitteschön etwas anderes. Am nächsten Tag brachte ihm Manuela den kleinen Kassettenrekorder mit den großen Kopfhörern. Und das grüne Köfferchen mit den Kassetten.
Alles selbst überspielt, sagte sie, in ihrem Auto habe sie keinen CD-Player. Und sie höre besonders gerne beim Fahren. Der Ort, in dem sie wohne, sei fast eine Stunde vom Spital entfernt, die Strecke dazwischen sei häßlich verbaut durch Industriecontainer und Einkaufszentren. Da sei es gut, wenigstens etwas Schönes zu hören.
Mögen Sie Opernmusik? fragte sie. Ich mag sie sehr! Als sie das sagte, berührte sie mit der rechten Hand die linke Brust. Die wölbte sich sanft unter dem Stoff der Schwesterntracht. Da konnte Novak natürlich nicht einfach nein sagen.
Da lag er dann also, Franz Novak, schicksalsergeben. Und ließ sich von hohen Musikwogen überfluten. Manchmal schlief er ein, aber meist wurde er recht bald wieder geweckt. Warum waren diese imaginären Personen so aufgebracht?
Was erregte sie so? Meist sangen sie in fremden Sprachen. Das meiste klang italienisch, manches französisch. Einiges klang russisch, anderes war vermutlich tschechisch. Auf einer der Kassetten sangen die Stimmen deutsch, aber es dauerte lang, bis er das erkannte.
Na, sagte Manuela tags darauf. Wie geht es Ihnen heute?
Besser, sagte Novak. Von Kratky hatte er tatsächlich weniger gehört.
Manuela lächelte. Und wie gefallen Ihnen die Aufnahmen? Das war eine Frage, die ihn in Verlegenheit brachte.
Was sollte er sagen? Gewiß wollte er sich keine Blöße geben. Nicht eingestehen, daß ihm Opern ein spanisches Dorf waren. Aber vor allem wollte er Manuela nicht verletzen. Die Geste, mit der sie am Vortag von ihrer Neigung zur Opernmusik gesprochen hatte (Hand aufs Herz), diese Geste hatte ihn beeindruckt.
Diese Musik und dieser Gesang schienen ihr wirklich viel zu bedeuten. Und sie schien sich sehr gut damit auszukennen. Nicht wahr, die Soundso, sagte sie, ist doch phantastisch! Und der Soundso! In der Soundso-Arie!
Natürlich wußte Novak nicht, welche Sängerinnen und Sänger sie meinte, und von welchen Arien sie sprach, davon hatte er erst recht keine Ahnung. Aber er stimmte ihr zu, er konnte nicht anders. Ja, ja, sagte er, manchmal nickte er auch nur, aber das reichte schon. Wenn Sie wollen, sagte sie, kann ich Ihnen morgen noch ein paar andere Kassetten mitbringen!
Konnte er dieses Angebot ausschlagen? Selbstverständlich konnte er das nicht! So kam es, daß er in der folgenden Woche einen Querschnitt durch das Repertoire der Opernmusik hörte. Manuela’s Digest sozusagen, gar keine schlechte Auswahl. Das zu beurteilen war er allerdings erst später imstande.
Als er längst wieder aus dem Spital draußen und daheim war. Zurück in seinem normalen, alltäglichen Leben. Das heißt, eben nicht zurück, jedenfalls nicht ganz zurück. Und auch nicht wirklich daheim, jedenfalls nicht ganz daheim.
Dort im Spital empfand er die Opernmusik anfangs bloß als das kleinere Übel. Auch wenn er das Schwester Manuela nicht sagte. Als Mann, der es gewohnt war, sich in Verhältnissen einzurichten, die eben so waren, wie sie waren, dachte er zuallererst und fast schon instinkthaft praktisch. War der Orchesterklang kompakt und der Gesang dramatisch genug, so verschwanden die von Kratky und seinem Radio ausgehenden akustischen Zumutungen in einem kaum mehr hörbaren Hintergrund.
Zwar gab es auch lyrische Passagen, in denen er die oft grotesk an Blähungen erinnernden Bässe aus dem Bereich des Nachbarbetts wieder wahrnahm. Aber wenn dann das Opernorchester aufs neue einsetzte, mit all den ihm zur Verfügung stehenden Instrumenten, dann war es doch stärker. Das war ihm, zugegeben, eine Genugtuung. Trugen dann auch noch die Sänger und Sängerinnen dazu bei, Kratkys Furzmusik triumphal zu übertönen, so konnte er sogar ihrem Geschmetter und Gegirre etwas abgewinnen.
Und manchmal klang es ja wirklich gar nicht so schlecht. Es war wohl auch so, daß sein Gehör und sein Gemüt anfingen, sich auf die Opernmusik einzustellen. Manchmal bekam er eine Tonfolge mit, eine Melodie, die ihm, wäre sie nur etwas weniger aufwendig arrangiert gewesen, und etwas, so empfand er das, etwas natürlicher gesungen, durchaus gefallen hätte. Und manchmal, da wurde er unversehens durch ein Gefühl berührt, das da, vermittelt durch Manuelas Kopfhörer, an sein Ohr drang.
Das war die Lage: Außen spürte er die Berührung durch die Kopfhörer, die ihm etwas zu eng waren. Doch innen (in der Brust oder im Bauch, so genau ließ sich das nicht lokalisieren) spürte er die Berührung durch Gefühle. Diese Gefühle flossen zweifellos aus den Geschichten, die da durch Musik und Gesang an ihn herangespült wurden, Geschichten, auf die er sich zwar seinen Reim zu machen versuchte, deren Verlauf ihm aber meist unklar blieb. Nur eins wurde ihm vorläufig klar: Daß ihm diese Gefühle manchmal zu nahe kamen.
Daß es ihm zuweilen, im Dunkeln, die Tränen in die Augen trieb – sollte er das einfach geschehen lassen? Durfte er sich der Irrationalität, aus der das alles kam, einfach aussetzen? Nein, er brauchte ein wenig Rationalität, um sich davor zu schützen. Also mußte er wissen, worum es in diesen Geschichten ging.
Was lag näher, als Manuela darauf anzusprechen? Ihr nächster Nachtdienst gab ihm die Gelegenheit dazu. Es war wieder gegen 11. Um diese Zeit war für gewöhnlich kaum mehr jemand draußen auf dem Gang. Aber sie, das hatte er gehofft, saß wieder auf der kleinen, weißen Bank.
Darf ich mich kurz zu Ihnen setzen? fragte er.
Sie sagte nicht nein.
Es ist so, sagte er. Ich hätte da eine Frage.
Ja? sagte sie.
Oder eigentlich ist es eine Bitte.
Es fiel ihm nicht leicht, die richtigen Worte zu finden.
Einerseits wollte er sich nicht als totaler Banause zu erkennen geben. Anderseits mußte er, wenn er von der jungen Frau, neben der er nun wieder saß, eine gewisse Orientierungshilfe in einer ihm bis dahin sehr fremden Welt erhoffte, eingestehen, daß er sich darin nicht auskannte. Der Kontinent Oper – bis dahin ein weißer Fleck auf seiner Landkarte. Doch so drastisch wollte er das nicht darstellen.
Es sei schön, was sie ihm alles zu hören gegeben habe, sagte er also, er genieße es. Das bringe manches in seinem Gedächtnis wieder zum Klingen. Früher, als junger Mann, habe er ja noch mehr Gelegenheit gefunden, sich mit Opernmusik zu beschäftigen. Aber wie das so sei, habe man für manches, das man ehemals gern getan hätte, immer weniger Zeit.
Nun sei ihm Verschiedenes nicht mehr ganz gegenwärtig. Und dieses und jenes verwechsle er möglicherweise … Etwa Opern wie La Bohème und La Traviata. Wie war denn das bloß? Vielleicht können Sie meiner Erinnerung ein bisschen auf die Sprünge helfen.
La Traviata und La Bohème – er hatte eine Weile gebraucht, um Manuelas Schrift auf den Kassettenhüllen zu enträtseln. Aber dann war auf einmal der Groschen gefallen. Mit manchen Titeln konnte er gar nichts anfangen. Zu diesen beiden hatte er immerhin Assoziationen.
Beim Hören der Querschnitte kam ihm sogar die eine oder die andere Arie bekannt vor. Erstaunlich. Anscheinend hatte er das Radio also doch nicht immer gleich abgedreht. Vielleicht an Abenden, an denen Herta später nach Hause gekommen war als er. (Was vorkam, denn der kleine Friseurladen, den sie betrieb, konnte nicht immer so pünktlich schließen, wie das Postamt.) Oder an Sonntagen, wenn sie eine Freundin besuchte, mit der sie, wie sie das nannte, reine Weibergespräche führen wollte. (Was er ihr gerne gönnte, er mußte nicht überall dabeisein.) Vielleicht aber hatte er diese oder jene Nummer auch bei irgendeiner Betriebsfeier gehört. (Allerdings nicht ernsthaft gesungen, sondern eher dumm parodiert – eine Zeitlang hatte sich einer der älteren Kollegen, dessen Name ihm nicht mehr einfiel, und inzwischen war dieser komische Vogel wahrscheinlich gestorben, als launiger Pianist und Sänger produziert.)
Die eine oder andere Arie also glaubte er wiederzuerkennen. Zum Beispiel den Ohrwurm mit dem eiskalten Händchen. Auch wenn der Text auf Manuelas Kassetten italienisch gesungen wurde.
Nicht wahr, das ist es doch? fragte er.
Ja, lächelte sie. Das ist es.
Auf Italienisch klingt es nicht halb so kitschig. Und nicht so weit weg von der gesprochenen Sprache. Sie könne das einschätzen, sagte Manuela. Bevor sie hierher gekommen sei, habe sie zwei Jahre in Italien gearbeitet.
Aha, sagte er, dann können Sie also perfekt Italienisch.
Nicht perfekt, sagte sie. Ungefähr so unvollkommen wie Deutsch.
Aber deutsch, sagte er, sprechen Sie doch sehr gut.
Na ja, sagte sie. Ich mache immer noch Fehler.
Ach was, sagte er. Manche Inländer und Inländerinnen … (Zum Beispiel meine Frau, hätte er sagen können, aber das sagte er nicht.) … Ich meine, manche von denen könnten froh sein … (Was Herta betraf, so hatte er den Eindruck, daß sie öfter die Fälle verwechselte, den zweiten mit dem dritten oder auch den dritten mit dem vierten, aber auf diesem Gebiet war auch er nicht recht sattelfest.)
Gewiß, Manuela sprach mit leichtem Akzent. Doch dieser Akzent hatte ja etwas ausgesprochen Nettes. Sehr zum Unterschied von Hertas Akzent. Seine eigene Sprachfärbung war der seiner Frau zwar verwandt, aber ganz so schlimm war sie hoffentlich nicht.
Wenn er mit Manuela redete, gab er sich jedenfalls Mühe. Aber er redete nicht allzuviel. Es reichte ja, wenn er sie zum Reden brachte. Es gefiel ihm einfach, ihr zuzuhören.
Ihr zuzuhören und neben ihr zu sitzen. Ja. Das war schön. Daran dachte er später oft zurück. In Wirklichkeit waren es ja nur ein paar Minuten, in denen ihm das vergönnt war, maximal waren es Viertelstunden. Doch in seiner Phantasie gewannen diese kurzen Zeiträume durch die oftmalige Wiederholung eine andere Dimension.
Ach Gott, diese Übersetzung: Wie eiskalt ist dies Händchen. Im Original heißt es einfach: Che gelida manina. Also etwa: Was für eine eiskalte, kleine Hand. Das klinge bei weitem nicht so abgehoben.
Nicht so altväterlich – oder wie heißt das?
Altväterisch, sagte Novak. Beinahe hätte er altvaterisch gesagt, aber um Manuela entgegenzukommen, sprach er den Umlaut.
Gar nicht so altväterisch wiederholte Manuela. Daß ein junger Mann so etwas zu einem jungen Mädchen sagt, kann man sich durchaus vorstellen.
Nämlich in so einer Situation: Sie klopft ja an seine Tür, weil ihr das Licht ausgegangen ist … Nein, kein Kurzschluß. Die Geschichte spielt im 19. Jahrhundert … Noch dazu unter sehr einfachen Verhältnissen … In einem Viertel, in dem erfolglose Künstler und arme Heimarbeiterinnen wohnen … Sie bittet ihn, ihre verloschene Kerze wieder anzuzünden … Sie sieht aber sehr blaß aus, anscheinend hat sie das Treppensteigen überanstrengt … Offenbar wohnt sie in der Wohnung unter ihm … Und er bittet sie kurz zu sich herein, aber da wird ihr gleich schwindlig.
Und so weiter. Irgendwann tauchte am Ende des Ganges eine andere Schwester auf. Novak räusperte sich, auch überlegte er kurz, ob er ein Stück von Manuela abrücken oder von der Bank aufstehen sollte. Aber er überlegte einen Moment zu lang. Und dann hätte ein Abrücken von Manuela oder gar ein Aufstehen von der Bank eher einen falschen Eindruck gemacht als sein Sitzenbleiben.
Die andere Schwester, Indonesierin wie Manuela, schien die Tatsache, daß ein Patient, statt im Bett zu liegen und um diese Zeit längst zu schlafen, hier draußen auf dem Gang neben ihrer Kollegin saß, allerdings nicht wirklich zu kümmern. Sie lächelte zwar, aber vielleicht tat sie das nur aus Höflichkeit. Und Manuela nickte ihr nebenbei zu. Sonst schenkte sie diesem Zwischenfall keine Beachtung.
Sie war bis dahin nämlich ziemlich in Schwung gekommen. Ihm die Handlung von Opern näherzubringen, machte ihr offenbar Freude. Vielleicht spielte da ein gewisser sozusagen missionarischer Eifer eine Rolle. Aber wahrscheinlich hatte die Bereitwilligkeit, mit der sie auf seine Bitte eingegangen war, mehr mit ihr zu tun als mit ihm.
Ihr bedeuteten Opern ganz einfach etwas. Wieder erinnerte er sich an die schöne Geste, mit der sie ihr Bekenntnis begleitet hatte. Hand an der Brust, so einfach wie überzeugend. Er stellte sich ihre Hand übrigens nicht kalt vor, sondern von innen her erwärmt.
Von Manuela ging ja insgesamt eine gewisse Wärme aus. Eine schöne, freundlich strahlende Wärme. Vielleicht hing das mit ihrer Herkunft zusammen, vielleicht waren die Menschen dort, wo sie herkam, doch etwas anders temperiert als hier. Aber wenn sie bloß von Opern sprach oder, wie eben jetzt, die Handlung einer Oper wiederzugeben versuchte, wobei sie, so kam es Novak jedenfalls vor, die Musik von irgendwoher hörte, ihr in den kleinen Pausen, die sie beim Sprechen machte, nachlauschte, dann nahm diese Wärme noch zu, nicht die Körpertemperatur, aber die Gemütstemperatur, die wahrscheinlich mit keinem Fieberthermometer meßbar war, aber spürbar, namentlich, wenn man so nah neben ihr saß.
Ja, ihr bedeuteten Opern etwas, ihre Beziehung zu dieser Musik hatte, so viel bekam Novak schon mit, obwohl er es vorläufig noch nicht verstehen konnte, etwas von einer Liebesbeziehung. Vielleicht hatte das mit einer besonderen Musikalität zu tun oder auch mit einer besonderen Geschichte, von der er nichts wußte und die ihn ja eigentlich auch nichts anging. Ihm hingegen bedeutete diese Art von Musik doch in Wirklichkeit gar nichts oder – zumindest war das bis vor kurzem so gewesen – etwas Fremdes (wenn er überhaupt eine Beziehung dazu gehabt hatte, so war es eine aus Ignoranz abwehrende). War es da nicht geradezu gemein von ihm, ihr diesbezüglich etwas vorzumachen?
Und worauf sollte denn das hinauslaufen? Daß er da neben ihr saß und ihren Erklärungen lauschte … War das nicht bloß ein Vorwand? Ging es nicht um etwas ganz anderes? … Vielleicht war es besser, wenn er sich nun doch noch rasch zurückzog.
Aber wie? Unhöflich sein wollte er auch nicht. Und sie fing gerade damit an, ihm die Traviata zu erläutern. La Traviata, sagte sie, wissen Sie eigentlich, was das heißt? Tra-viare. Das heißt, jemanden vom Weg abbringen.
Also jedenfalls ist da diese schöne Frau … Das heißt, sie war einmal schön, jetzt ist sie ihrer Schönheit nicht mehr so sicher … Und weil ihr Selbstbewußtsein vor allem mit dieser Schönheit verbunden war, ist sie ihrer selbst nicht mehr sicher … Doch sie überspielt das, auf dem Fest, mit dem die Oper beginnt, gibt sie sich betont ausgelassen … Man trinkt, man singt, und gerade schlägt sie ihren Gästen vor, zum Tanzen in einen anderen Raum zu gehen … Aber da wird ihr auf einmal recht seltsam zumute … Ein kleiner Schwächeanfall, denkt sie, es ist gleich vorbei … Geht nur voraus, sagt sie, ich werde gleich nachkommen.
Sie bleibt also allein zurück, das heißt, sie glaubt zuerst, daß sie allein ist … Und da sieht sie sich im Spiegel, und da sieht sie, wie blaß sie ist … Ja, blaß, totenblaß ist auch sie, so was scheint damals öfter vorgekommen zu sein … Und sie steht also vor dem Spiegel, und vielleicht ist es nicht nur die Blässe, vor der sie erschrickt.
Und im selben Moment tritt dieser junge Mann hinter sie … Und er sagt ihr, sie soll auf sich aufpassen, sie muß auf ihre Gesundheit schauen … Und sie sagt: Ach was, wie kann ich denn das, und warum soll ich denn das? … Aber dann sagt ihr dieser Verrückte, daß er sie liebt.
Und dann sprach Manuela von einem Duett, in dem davon die Rede ist, daß die Liebe durchs Universum pulsiert. Und auch das kam ihm bekannt vor, ja, natürlich! Obwohl er nicht sicher war, ob er dabei nicht eher den Text eines früher oft gespielten, deutschsprachigen Hits im Ohr hatte. Darin ging es um ein Raumschiff, das schwerelos durchs All flog, aber die Liebe als kosmische Energie war auch irgendwie im Spiel.
Der Text war zwar halblustig, aber Novak war drauf und dran, ernsthaft darüber nachzudenken. Erstens über den genauen Wortlaut und zweitens über den Sinn, der möglicherweise doch dahintersteckte. War die Liebe die Triebkraft des Raumschiffs oder flog sie einfach daneben her? Aber das führte vielleicht zu weit, ja, bestimmt führte das zu weit, das war eine Abschweifung.
Er versuchte sich wieder auf die Opern zu konzentrieren, deren Handlung ihm Manuela erzählte. Also, wie war das? Er hatte mitbekommen, daß Violetta von Alfredo geliebt wurde. Oder war das Rodolfo? Nein, Rodolfo war der, welcher Mimì liebte. Aber diese beiden romantischen jungen Männer waren ja wirklich schwer auseinanderzuhalten.
Und auch die beiden von ihnen angeschwärmten Frauen hatten ihre Ähnlichkeiten. Obwohl die eine vielleicht etwas jünger war und die andere etwas älter. Vor allem hatten es beide auf der Lunge. Das war auf die Dauer nicht zu verbergen, das hatte Novak schon beim ersten Anhören der Kassetten geahnt.
Und er saß immer noch auf der kleinen weißen Bank neben Manuela. (Vielleicht war es an jenem Abend doch etwas länger als eine Viertelstunde.) Und die Distanz zwischen ihnen betrug nur wenige Zentimeter. Und eigentlich war das keine Distanz mehr, sondern eine Nähe.
Eine Nähe, die sich nicht leugnen ließ. So alt war er nicht, daß er diese Nähe nicht wahrnahm. Deutlich. Sie verursachte ihm Herzklopfen, diese Nähe, wahrscheinlich erhöhte sie seinen Blutdruck. Hätte er seine Hand nur ein wenig nach rechts bewegt, so hätte er die junge Frau neben sich berührt.
Aber er tat es nicht. Wie sollte sie denn das finden? Du alter Esel! dachte er. Was sind denn das für Ideen?! Zwar bekam er manchmal sogar ein Stückchen Haut zu sehen, ein Stückchen hellbrauner Haut, das unter dem hellblauen Stoff der eigentlich erstaunlich kurz geschnittenen Schwesterntracht eine Handbreit über Manuelas Knie frei lag. Aber obwohl das ein sehr hübscher Kontrast war, sah er nur kurz hin, und dann sah er lieber darüber hinweg, denn er wollte weder sie in Verlegenheit bringen noch sich selbst.
Daß er allerdings von ihr träumte, sobald er wieder im Bett lag, dagegen konnte er oder wollte er nichts tun. Zumindest fühlte er sich nicht voll dafür verantwortlich. Manuelas Kopfhörer an den Ohren, schloß er die Augen. Und ließ sich versinken in einen Strudel von Klängen.
Diese Klänge verbanden sich mit anderen Sinneseindrücken. Im Halbschlaf war ihm noch halbwegs bewußt, daß diese Eindrücke, sowohl optische als auch haptische, nicht echt waren. Daß er sich da etwas vorgaukeln ließ oder selbst vorgaukelte. Doch dieser Rest von wachem Bewußtsein blieb sozusagen an der Oberfläche, und es war gut, ihn dort zurückzulassen.
In solchen Träumen waren Manuela und er ganz eingehüllt in Musik. Und er hatte den Eindruck, daß er sie schon ewig lang kannte. Obwohl es noch gar nicht so lang sein konnte, denn er war jung in diesen Träumen. Und sie war vielleicht seine Schwester, natürlich, so mußte es sein, sie hieß ja Schwester Manuela, im Traum schien ihm das plötzlich wie eine Erklärung für die Intimität ihres Verhältnisses, obgleich sich das dann erst recht nicht gehörte, doch es war ohnehin ihr und sein Geheimnis.
Oder nur sein Geheimnis. Denn zwischen der Manuela, die er im Traum traf, und der Manuela, die er im wachen Zustand wiedersah, namentlich wenn sie Tagdienst hatte und nur kurz ins Zimmer hereinschaute, ihm zulächelnd zwar, aber der Situation entsprechend flüchtig, bestand natürlich ein Unterschied. Und auch wenn sie wieder Nachtdienst hatte und ihm noch ein paar Operngeschichten erzählte, etwa, als nächstes, Manon oder Tosca, ein bißchen amüsiert wohl über sein heftiges Interesse, aber nach wie vor freundlich entgegenkommend, auch oder gerade dann war es wichtig, diesen Unterschied nicht zu vergessen. Zu jener Manuela hatte er eine Traumbeziehung, aber über die Beziehung zu dieser hier durfte er sich keine Illusionen machen. Letzten Endes war es ja doch nur die Beziehung einer Krankenschwester zu einem Patienten.
Gewiß war da eine etwas ungewöhnliche Konstellation zwischen ihnen entstanden. Und zwar aufgrund einer etwas skurrilen Verkettung von Umständen. Und Manuela hatte auch ihren Spaß dran. Sie liebte Opern, sie redete gern davon, und er gab ihr die Gelegenheit dazu.
Das war es. Nicht mehr und nicht weniger. Darüber hinaus mußte er sich nichts vormachen. Sich nicht und ihr nicht. Sie hatte doch längst durchschaut, woran sie mit ihm war. Mit ihm als Opernfreak. Nicht mit ihm als Mann. Falls sie sich dafür überhaupt interessierte.
Was wiederum eher unwahrscheinlich war.
Obwohl … Sie war ja eine sensible Person.
Vielleicht ahnte sie ein wenig davon, wie es ihm als Mann erging. Aber hoffentlich nicht zu viel. Und das sollte besser so bleiben.
So gingen die weiteren Krankenhaustage dahin. Meist hatte Novak die Kopfhörer an den Ohren. Eigentlich nahm er sie nur ab, wenn die Schwestern die Mahlzeiten brachten. Und wenn – gegen 11 Uhr vormittag – die Visite durchkam.
Was hören Sie denn da die ganze Zeit? fragte Kratky. Mit Ihnen kann man ja fast überhaupt nichts reden!
Ernste Musik, sagte Novak unbestimmt.
Oje! sagte Kratky.
Ja, sagte Novak. So ist das.
Manchmal tat ihm Kratky dennoch leid, und er ließ sich auf ein Gespräch mit ihm ein. Das bereute er dann allerdings meistens. Wenn er nicht von seinen Operationen schwadronierte, mit allen möglichen und unmöglichen Details, so erzählte sein Nachbar gern Witze von Mann zu Mann, wie er das nannte. Und die Art, wie er diese Witze erzählte, paßte zu seiner gesamten Erscheinung.
Über die Opern wollte Novak jedenfalls nicht mit ihm reden. Nein, das wollte er auf keinen Fall. Der Mensch war ja neugierig, irgendwie, so schien es, wollte er doch herauskriegen, was seinen Zimmergenossen so intensiv beschäftigte. Einen schönen Haufen Kassetten, sagte er, haben Sie da auf dem Nachtkastel liegen!
Ja, sagte Novak wieder. Und dabei blieb es. Allerdings fing er dann an, eine gewisse Ordnung in die Kassetten zu bringen. Das konnte nichts schaden. Vorerst hatte er wahllos in die Aufnahmen hineingehört. Doch inzwischen wußte er schon ein wenig Bescheid über seine Bestände.
Es war ja erstaunlich, was es da alles gab. Arien, große und kleine Querschnitte, sogar die eine oder die andere Gesamtaufnahme. Er begann also damit, die Kassetten zu kleinen Türmen zu stapeln, das erleichterte den Überblick. Nebenbei würde es wahrscheinlich auch bei den Visiten einen besseren Eindruck machen.
Vor den Besuchszeiten, zu denen Herta kommen sollte, baute er diese Türme jedoch ab. Ja, nicht nur das. Da schien es ihm auch angebracht, die Kopfhörer und den Rekorder beiseite zu räumen. In diesem Krankenzimmer, das ja für gewöhnlich Patienten mit einer privaten Zusatzversicherung vorbehalten war, gab es für jeden der beiden einen recht geräumigen Spind. Dort, unter der Wäsche, deponierte er seine Schätze.
Nicht daß er sie geradezu versteckte, das wäre ihm übertrieben erschienen. Doch einfach im Weg liegen sollten sie besser auch nicht. Für den wahrscheinlichen Fall, daß Herta wieder mit Blumen daherkam. Und, darüber hinaus, mit einem selbst gebackenen Kuchen.
Was die Blumen betraf, so gefielen ihm die, welche ihr gefielen, zwar selten (sie hatte eine Vorliebe für übergroße Blüten in Farbtönen zwischen Rosa und Lila, die er nicht ausstehen konnte). Und was die Kuchen anlangte, so hatte er sich nie viel daraus gemacht (eigentlich schmeckte ihm eher Pikantes als Süßes, aber das hatte er seiner Frau, für die das Backen und Auftischen von Mehlspeisen eine der wenigen Formen der Zuwendung war, die sie ungehemmt zustande brachte, nie gesagt). Außerdem hatte er schon vor der Operation manchmal bezweifelt, daß ihm die guten Sachen, mit denen sie ihn verwöhnte, guttaten. Nun, nach der Operation, hatte er Gründe, das noch eher zu bezweifeln, aber er wollte ihr nicht die Freude verderben.
Sie buk einfach gern, seine Herta, das Backen war ihr sowohl Freude als auch Selbstbestätigung. Wenn sie einen wohl gelungenen, duftenden Kuchen aus dem Backrohr nahm, strahlte sie nicht nur von der Hitze, die sich dabei auf sie übertrug. Sie pflegte die süßen Geschenke, die sie Verwandten oder Bekannten anläßlich festtäglicher Besuche mitbrachte, auch stilvoll zu verpacken. In Seidenpapier gehüllt und mit Maschen und Schleifen versehen, sahen sie dann fast aus wie aus der Konditorei.
Und nun hatte sie ihm den Kuchen, der ihm blühte, sogar schon angekündigt. Eine Freundin, das hatte sie am Telefon nicht für sich behalten können, habe ihr ein wunderbares Rezept für etwas zwar Süßes, dabei aber garantiert Gesundes gegeben. Aus Dinkel- statt Weizenmehl, mit Honig gesüßt statt mit Zucker. Ich komm Freitag zur Besuchszeit, hatte sie gesagt, ich bring dir was Schönes und was Gutes mit, darauf kannst du dich schon jetzt freuen.
Blumen und Kuchen, das war also zu erwarten. Und dafür würde man auf dem Nachtkästchen Platz brauchen. Novak war eben ein vorausblickender Mensch. Er fand es nicht falsch, diesen Platz beizeiten zu schaffen.
Natürlich, so viel gestand er sich schon ein, wollte er sich auch heikle Erklärungen ersparen. Die Kassetten betreffend und alles, was damit zusammenhing. Daß er plötzlich stundenlang eine Musik hörte, die halbwegs normale Menschen bestenfalls ein paar Sekunden lang ertragen konnten, wäre ihr schon bedenklich genug erschienen. Daß er jedoch darüber hinaus die Kassetten, auf denen diese Musik gespeichert war, das Gerät, mit dem er sie abspielte, und die Kopfhörer, die sie ihm so besonders nahebrachten, ausgerechnet von Manuela hatte – nein, es war besser, wenn das erst gar nicht zum Thema wurde.
Wenn seiner Frau im Lauf der Jahre auch sonst einiges an Weiblichkeit verlorengegangen war, so manches, das er geschätzt und geliebt hatte – den sogenannten weiblichen Instinkt hatte sie sich erhalten. Ja, sie hatte von Anfang an etwas gewittert. Ihr war Manuela unter all den auf den ersten Blick verwechselbaren Schwestern gleich aufgefallen. Diese Schwarze, wie sie Manuela nannte, obwohl ihre Haut-und Haarfarbe kaum dunkler war als die der anderen, war ihr sofort verdächtig gewesen.
Was schaut denn die so? hatte Herta gefragt. Was will denn die von dir?
Welche? Zum Unterschied von ihr war Novak zu diesem Zeitpunkt wirklich noch ahnungslos.
Na, die dort! Die Schwarze mit dem Muttermal.
Er hatte das Muttermal bis dahin gar nicht wahrgenommen.
Manuelas Muttermal. Es war übrigens recht apart. Kein Schönheitsfehler, eher im Gegenteil. Man hätte es für aufgeschminkt halten können. Wenn er links neben ihr saß, sah er es, wenn er rechts neben ihr saß, sah er es nicht.
Auf der kleinen, weißen Bank auf dem Gang. Zwei Mal durfte er dort noch neben ihr sitzen. Ursprünglich hatte es geheißen, daß er nach längstens zwei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen würde. Aber dann war der Oberarzt, der ihn operiert hatte, auf Schiurlaub gefahren, in den Alpen, hatte er gesagt, sei es gerade jetzt, im Vorfrühling, am schönsten, und der Arzt, der ihn vertrat, ein nüchterner, an persönlichen Gesprächen deutlich weniger interessierter Mensch, der mit sehr unzarten Fingern Novaks Unterbauch betastete, war der Ansicht, es sei besser, den Heilungsprozeß noch ein paar Tage zu beobachten.
Das brachte Herta auf. Aber der Herr Oberarzt hat doch versprochen …!
Ihre Stimme wurde schrill. Der Vertreter des Oberarztes hob reflexartig die Hände an die Ohren. Novak – obwohl ihm der Mann unsympathisch war – konnte ihm das nachfühlen. Auch ihm tat Hertas Stimme in dieser Tonlage in den Ohren weh, und er genierte sich ein wenig für sie.
Natürlich sagte er das nicht. Aber er versuchte, seine Frau zu beschwichtigen.
Es sei doch halb so schlimm, er würde es schon noch ein paar Tage hier aushalten.
Ein paar Tage und ein paar Nächte. Bei diesem Gedanken spürte er wieder sein Herz klopfen.
Der Arzt war zwar unsympathisch, doch er machte ihm, ohne es zu wissen, ein Geschenk.
Herta sah das naturgemäß etwas anders. Wie komme ihr Mann dazu? Und wie komme sie dazu? Daß sie ihn noch länger entbehren müsse. Ob du es glaubst oder nicht, sagte sie an ihn gewandt, du fehlst mir.
Komisch, nicht? Zum Beispiel am Abend beim Fernsehen … Ich bin es ganz einfach gewöhnt, daß du neben mir sitzt … Auch wenn es mich manchmal ärgert, daß du dann mitten im Film einschläfst … Jetzt, wo du nicht da bist, geht mir etwas ab.
Aus Hertas Mund war das fast eine Liebeserklärung.
Danach bekam Novak beinah ein schlechtes Gewissen.
Und trotzdem saß er so gern neben Manuela. Auf der Seite mit dem Muttermal saß er womöglich noch etwas lieber als auf der Seite ohne.
Zwei Mal, wie gesagt, durfte Novak das noch genießen. Neben der wirklichen Manuela zu sitzen. Die zwar nicht identisch war mit der Traum-Manuela. Aber zweifellos wurde die Batterie, die jene in seinen Träumen lebendig machte, durch diese, die da in der Realität neben ihm saß, aufgeladen.
Doch das würde nun bald ein Ende haben. Er dachte das schon beim vorletzten Mal, aber beim letzten Mal konnte er diesen Gedanken kaum mehr ausblenden. Sonst hatte er sie immer gebeten, ihm diese oder jene Opernhandlung zu erläutern. Diesmal jedoch fielen ihm einfach keine diesbezüglichen Fragen mehr ein.
Vielleicht hatte er auch Hemmungen, solche Fragen nun noch einmal als Vorwand zu gebrauchen. Nur um den Wunsch, noch ein paar Minuten neben ihr zu sitzen, zu motivieren. In diesen Minuten wurde ihm bewußt, wie wenig er eigentlich von ihr wußte. Daß sie aus Indonesien kam, daß sie eine gewisse Zeit in Italien gearbeitet hatte, bevor sie hierher gekommen war, und daß sie eine geradezu innige Beziehung zur Opernmusik hatte, keine Ahnung woher und warum.
Und er hatte das Gefühl, daß er sie noch so viel zu fragen hätte. Aber es gelang ihm nicht, auch nur eine einzige Frage zu formulieren. So saß er neben ihr und spürte nur ihre Nähe und schwieg. Und sie ließ sich das gefallen, jedenfalls lächelte sie und hielt still, wenn er sie, ohne etwas zu sagen, von der Seite ansah.
Na, sagte sie schließlich, freuen Sie sich nicht, daß Sie morgen wieder nach Hause kommen?
Er zuckte die Achseln. Was sollte er darauf antworten?
Jedenfalls würde es so sein. Am nächsten Vormittag würde er das Spital verlassen. Gleich nach der Visite würde ihn Herta abholen.
Diese Visite war nur mehr Routinesache. Ein Ritual sozusagen, das noch vollzogen werden mußte. Der Oberarzt war vom Schiurlaub zurückgekehrt. Er hatte schon vor zwei Tagen festgestellt, daß nun alles in Ordnung war.
Jetzt sollten Sie aber ins Bett gehen, sagte Manuela. Das hatte sie sonst auch immer gesagt, aber da hatte die Aussicht auf ein nächstes Mal bestanden. Außerdem hatte er sich dann, kaum war er im Bett gelegen, die Kopfhörer aufgesetzt. Und wenn er dann die Musik gehört hatte, ihre Musik, wie er sie bei sich nannte, war er ihr in gewisser Hinsicht noch näher gewesen als hier auf der kleinen, weißen Bank.
Diese Aussicht jedoch bestand heute nicht. Den Rekorder,