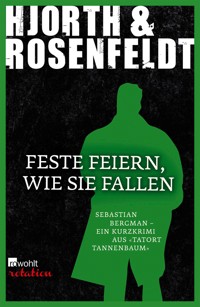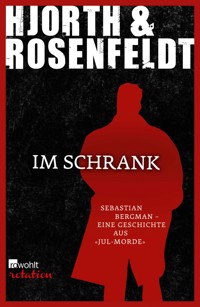Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Sebastian Bergman
- Sprache: Deutsch
Sebastian Bergman, Kriminalpsychologe. Hochintelligent. Unausstehlich. In einem Waldstück bei Västerås wird die Leiche eines Jungen entdeckt – brutal ermordet, mit herausgerissenem Herzen. Der Tote ist Roger, Schüler eines Elitegymnasiums. Die Polizei vor Ort ist überfordert, und so reist Kommissar Höglund mit seinem Team aus Stockholm in die Provinz. Dort trifft er überraschend einen alten Bekannten: Sebastian Bergman, ein brillanter Kriminalpsychologe und berüchtigter Kotzbrocken. Er bietet Höglund seine Hilfe an. Das Team ist wenig begeistert, doch schon bald ist der hochintelligente Bergman unverzichtbar. Denn in Västerås gibt es mehr als eine zerstörte Seele ... «Der beste Schwedenkrimi des Jahres.» (Die Welt) «Ein beeindruckendes Krimidebüt ... psychologisch dicht, mit unerwarteten Wendungen und einem ungewöhnlichen Ermittler.» (3sat, Kulturzeit-Krimibuchtipps) «Spannung über die gesamte Distanz - Bergman & Co, gerne wieder!» (Krimi-Couch.de) «Was für ein Buch! ... Schlaflose - weil durchlesene - Nächte sind garantiert.» (Leser-Welt) «Verblüffend intelligent.» (De Telegraaf, Niederlande) «Sensationell gut!» (Hallands Nyheter, Schweden) «Fesselnd!» (Sandefjords Blad, Norwegen) Der Mann beugte sich vor und fasste den Jungen an den Schultern. Mühsam zog er den leblosen Körper in eine halb aufrechte Position hoch. Für einen Moment sah er dem Jungen direkt in die Augen.Was war sein letzter Gedanke gewesen? Hatte er überhaupt Zeit gehabt, etwas zu denken? Hatte er begriffen, dass er sterben würde? Und sich gefragt, warum? Hatte er an all das gedacht, wofür er in seinem kurzen Leben keine Zeit mehr gehabt hatte? Oder an das, was er geschafft hatte? Es spielte keine Rolle. Warum quälte er sich dann so? Er hatte keine Wahl. Er durfte nicht versagen, nicht noch einmal. Dennoch zögerte er. Nein, sie würden es nicht verstehen. Ihm nicht verzeihen. Nicht wie er die andere Wange hinhalten. Er gab dem Jungen einen Stoß, und der Körper fiel mit einem lauten Platsch ins Wasser. Überrascht von dem plötzlichen Geräusch in der Stille der Dunkelheit, fuhr der Mann zusammen. Die Leiche des Jungen versank im Wasser und verschwand. Der Mann, der kein Mörder war, kehrte zu seinem Auto zurück, das er auf einem kleinen Waldweg geparkt hatte, und fuhr nach Hause.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Hjorth • Hans Rosenfeldt
Der Mann, der kein Mörder war
Über dieses Buch
Sebastian Bergman, Kriminalpsychologe. Hochintelligent. Unausstehlich.
In einem Waldstück bei Västerås wird die Leiche eines Jungen entdeckt – brutal ermordet, mit herausgerissenem Herzen. Der Tote ist Roger, Schüler eines Elitegymnasiums. Die Polizei vor Ort ist überfordert, und so reist Kommissar Höglund mit seinem Team aus Stockholm in die Provinz. Dort trifft er überraschend einen alten Bekannten: Sebastian Bergman, ein brillanter Kriminalpsychologe und berüchtigter Kotzbrocken. Er bietet Höglund seine Hilfe an. Das Team ist wenig begeistert, doch schon bald ist der hochintelligente Bergman unverzichtbar. Denn in Västerås gibt es mehr als eine zerstörte Seele ...
«Der beste Schwedenkrimi des Jahres.» (Die Welt)
«Ein beeindruckendes Krimidebüt ... psychologisch dicht, mit unerwarteten Wendungen und einem ungewöhnlichen Ermittler.» (3sat, Kulturzeit-Krimibuchtipps)
«Spannung über die gesamte Distanz - Bergman & Co, gerne wieder!» (Krimi-Couch.de)
«Was für ein Buch! ... Schlaflose - weil durchlesene - Nächte sind garantiert.» (Leser-Welt)
«Verblüffend intelligent.» (De Telegraaf, Niederlande)
«Sensationell gut!» (Hallands Nyheter, Schweden)
«Fesselnd!» (Sandefjords Blad, Norwegen)
Der Mann beugte sich vor und fasste den Jungen an den Schultern. Mühsam zog er den leblosen Körper in eine halb aufrechte Position hoch. Für einen Moment sah er dem Jungen direkt in die Augen.Was war sein letzter Gedanke gewesen? Hatte er überhaupt Zeit gehabt, etwas zu denken? Hatte er begriffen, dass er sterben würde? Und sich gefragt, warum? Hatte er an all das gedacht, wofür er in seinem kurzen Leben keine Zeit mehr gehabt hatte? Oder an das, was er geschafft hatte?
Es spielte keine Rolle.
Warum quälte er sich dann so?
Er hatte keine Wahl. Er durfte nicht versagen, nicht noch einmal.
Dennoch zögerte er. Nein, sie würden es nicht verstehen. Ihm nicht verzeihen. Nicht wie er die andere Wange hinhalten.
Er gab dem Jungen einen Stoß, und der Körper fiel mit einem lauten Platsch ins Wasser. Überrascht von dem plötzlichen Geräusch in der Stille der Dunkelheit, fuhr der Mann zusammen.
Die Leiche des Jungen versank im Wasser und verschwand.
Der Mann, der kein Mörder war, kehrte zu seinem Auto zurück, das er auf einem kleinen Waldweg geparkt hatte, und fuhr nach Hause.
Vita
Michael Hjorth, geboren 1963, ist ein erfolgreicher TV-Produzent, Regisseur und Drehbuchautor. Er schrieb u.a. Drehbücher für die Verfilmungen der Romane von Henning Mankell.
Hans Rosenfeldt, Jahrgang 1964, ist Drehbuchautor und in Schweden ein bekannter Radio- und Fernsehmoderator.
«Der Mann, der kein Mörder war», ihr gemeinsames Romandebüt, ist Auftakt einer Reihe um den Kriminalpsychologen Sebastian Bergman, die vom schwedischen Fernsehen in Kooperation mit dem ZDF verfilmt wird.
«Ein unkonventionelles Duo: Diese Autoren beherrschen ihr Handwerk.» (Politiken)
«Das wahrscheinlich beste schwedische Krimidebüt seit Larsson.» (Kristianstadsbladet)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg // «Det Fördolda» Copyright © 2010 by Michael Hjorth & Hans Rosenfeldt
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung plainpicture/Bildhuset
ISBN 978-3-644-90111-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Der Mann war ...
Polizei Västerås, Sie ...
Der Traum kehrte ...
Es ging alles ...
Eine Taxifahrt später ...
Der Zug verließ ...
Es war bereits ...
Torkel saß im ...
Fredrik hatte geglaubt, ...
Der Mann, der ...
Leonard! Clara Lundin ...
Warum bist du ...
Vanja hatte länger ...
Was würdest du ...
Sebastian erwachte aus ...
Es war reiner ...
Die nächste musst ...
Sie schwiegen während ...
Ach, dieser bedauerliche ...
Beatrice Strand war ...
Haraldsson saß in ...
Es war zwanzig ...
Die Praxis lag ...
Vanja zeigte ihre ...
In dem großen ...
Alle fünf spürten, ...
Genau genommen wohnte ...
Nachdem sie eine ...
Um kurz nach ...
Lena Eriksson saß ...
Cia Edlund besaß ...
Den Rest des ...
Die Durchsuchung von ...
Sebastian stand vor ...
Sebastian konnte nicht ...
Vanja und Torkel ...
Haraldsson stand unter ...
Waffe!»
Vanja stand nervös ...
Der Zug, der ...
Storskärsgatan 12.
Titelverzeichnis
Der Mann war kein Mörder.
Er redete es sich selbst ein, während er den toten Jungen den Abhang hinunterschleifte: Ich bin kein Mörder.
Mörder sind Kriminelle. Mörder sind schlechte Menschen. Die Finsternis hat ihre Seele verschlungen, sie haben die Schwärze umarmt und willkommen geheißen, dem Licht ihren Rücken zugewandt. Er war kein schlechter Mensch. Ganz und gar nicht.
Hatte er in letzter Zeit nicht sogar genau das Gegenteil bewiesen? Hatte er nicht zum Wohl anderer seine eigenen Gefühle, seinen eigenen Willen zurückgestellt und sich damit beinahe selbst Gewalt angetan? Die andere Wange hingehalten, das hatte er. War nicht die Tatsache, dass er hier, in dieser sumpfigen Senke mitten im Nirgendwo, mit einem toten Jungen stand, ein weiterer Beweis dafür, dass er das Richtige tun wollte? Es tun musste. Dass er nie wieder versagen durfte.
Der Mann blieb stehen und verschnaufte. Der Junge war nicht sonderlich groß, aber er war schwer. Trainiert. Viele Stunden im Fitnessstudio. Doch nun war es nicht mehr weit. Er packte das Hosenbein, das einmal weiß gewesen war, in der Dunkelheit jedoch fast schwarz aussah. Der Junge hatte so stark geblutet.
Ja, es war falsch, einen Menschen umzubringen. Fünftes Gebot. Du sollst nicht töten. Doch es gab Ausnahmen. An vielen Stellen forderte die Bibel sogar zum Töten auf, wenn es gerechtfertigt war. Es gab jene, die es verdient hatten. Aus falsch konnte richtig werden. Nichts war absolut.
Wenn das Motiv nicht egoistisch war. Wenn der Verlust eines Menschenlebens andere retten würde. Ihnen eine Chance gäbe, ein neues Leben schenkte. Dann konnte die Tat doch unmöglich schlecht sein? Wenn die Absicht gut war?
Als er das dunkle Gewässer erreicht hatte, blieb der Mann stehen. Die Regenfälle der letzten Tage hatten den Boden durchweicht, sodass der Tümpel, der sonst nur wenige Meter tief war, sich nun wie ein kleiner See über die gestrüppreiche Senke erstreckte.
Der Mann beugte sich vor und fasste den Jungen an den Schultern. Mühsam zog er den leblosen Körper in eine halb aufrechte Position hoch. Für einen Moment sah er dem Jungen direkt in die Augen. Was war sein letzter Gedanke gewesen? Hatte er überhaupt Zeit gehabt, etwas zu denken? Hatte er begriffen, dass er sterben würde? Und sich gefragt, warum? Hatte er an all das gedacht, wofür er in seinem kurzen Leben keine Zeit mehr gehabt hatte? Oder an das, was er geschafft hatte?
Es spielte keine Rolle.
Warum quälte er sich dann so?
Er hatte keine Wahl.
Er durfte nicht versagen, nicht noch einmal.
Dennoch zögerte er. Nein, sie würden es nicht verstehen. Ihm nicht verzeihen. Nicht wie er die andere Wange hinhalten.
Er gab dem Jungen einen Stoß, und der Körper fiel mit einem lauten Platsch ins Wasser. Überrascht von dem plötzlichen Geräusch in der Stille der Dunkelheit, fuhr der Mann zusammen.
Die Leiche des Jungen versank im Wasser und verschwand.
Der Mann, der kein Mörder war, kehrte zu seinem Auto zurück, das er auf einem kleinen Waldweg geparkt hatte, und fuhr nach Hause.
Polizei Västerås, Sie sprechen mit Klara Lidman.»
«Ich möchte meinen Sohn vermisst melden.»
Die Frau klang beinahe entschuldigend. Als wäre sie nicht sicher, ob sie die richtige Nummer gewählt hatte, oder als erwartete sie im Grunde nicht, dass man ihr glauben würde. Klara Lidman zog ihren Notizblock heran, obwohl das Gespräch ohnehin auf Band aufgezeichnet wurde.
«Wie ist Ihr Name?»
«Lena Eriksson. Mein Sohn heißt Roger. Roger Eriksson.»
«Und wie alt ist Ihr Sohn?»
«Sechzehn. Ich habe ihn seit gestern Nachmittag nicht mehr gesehen.»
Klara notierte das Alter und begriff, dass sie diese Angelegenheit sofort an die Kollegen weiterleiten musste. Vorausgesetzt, der Junge war tatsächlich verschwunden.
«Seit wann genau gestern Nachmittag?»
«Er hat sich so gegen fünf aus dem Staub gemacht.»
Vor zweiundzwanzig Stunden. Zweiundzwanzig wichtige Stunden, wenn ein Mensch vermisst wurde.
«Wissen Sie, wohin er gegangen ist?»
«Ja, zu Lisa.»
«Wer ist das?»
«Seine Freundin. Ich habe heute bei ihr angerufen, aber sie hat gesagt, dass er gestern Abend gegen zehn wieder gegangen ist.»
Klara strich die beiden Zweien auf dem Notizzettel durch und ersetzte sie durch eine Siebzehn.
«Wohin ist er dann gegangen?»
«Das wusste sie nicht. Nach Hause, dachte sie. Aber er kam hier nicht an. Die ganze Nacht nicht. Und jetzt ist fast schon ein Tag vergangen.»
Und da rufst du erst jetzt an, dachte Klara.
Die Frau am anderen Ende wirkte nicht sonderlich aufgeregt, das fiel ihr nun auf. Eher gedämpft. Resigniert.
«Wie heißt Lisa weiter?»
«Hansson.»
Klara notierte den Namen.
«Besitzt Roger ein Handy? Haben Sie schon versucht, ihn zu erreichen?»
«Ja, aber er geht nicht ran.»
«Und Sie haben keine Ahnung, wo er hingegangen sein könnte? Hat er vielleicht bei einem Freund übernachtet?»
«Nein, dann hätte er angerufen.»
Die Frau machte eine kurze Pause, und Klara vermutete zunächst, ihr hätte die Stimme versagt, bis sie am anderen Ende der Leitung ein Inhalieren hörte. Sie hatte lediglich einen tiefen Zug von ihrer Zigarette genommen.
Die Frau stieß den Rauch aus.
«Er ist einfach weg.»
Der Traum kehrte jede Nacht wieder. Er ließ ihm keine Ruhe. Der immer gleiche Traum, die immer gleichen Szenen der Angst. Das irritierte ihn. Machte ihn wahnsinnig. Sebastian Bergman war einfach zu gut dafür. Wer, wenn nicht er, wusste, was Träume bedeuteten; wer, wenn nicht er, müsste diese fieberhaften Erinnerungen zu verkraften lernen. Doch so gut er auch gewappnet war, so klar er diesen Traum zu interpretieren vermochte, er konnte nicht verhindern, von ihm verfolgt zu werden. Es schien, als könne der Traum seine Professionalität austricksen, um ihm vor Augen zu führen, was auch ein Teil von ihm war.
4:43 Uhr.
Es dämmerte. Sein Mund war trocken. Hatte er geschrien? Vermutlich nicht, denn die Frau, die neben ihm lag, war nicht aufgewacht. Sie atmete ruhig, er sah, wie ihr langes Haar über ihre nackte Brust fiel und sie zur Hälfte bedeckte. Sebastian streckte seine verkrampften Finger, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Er hatte sich bereits daran gewöhnt, dass seine rechte Faust fest geballt war, wenn er aus dem Traum erwachte.
Er versuchte, sich an den Namen des Wesens zu erinnern, das neben ihm schlief. Katarina? Karin?
Sie musste ihn gestern Abend irgendwann genannt haben. Kristina? Caroline?
Nicht, dass es irgendeine Rolle spielte, er hatte nicht vor, sie jemals wieder zu treffen. In seinem Gedächtnis zu wühlen, half ihm jedoch, die verschwommenen Reste des Traumes zu verjagen, die an all seinen Sinnen zu haften schienen.
Dieses Traumes, der ihn seit mehr als fünf Jahren verfolgte. Jede Nacht der gleiche Traum, die gleichen Bilder. Sein Unterbewusstsein war hellwach und verarbeitete, was ihm tagsüber nicht gelang: mit seiner Schuld fertigzuwerden.
Sebastian erhob sich langsam aus dem Bett, unterdrückte ein Gähnen und nahm seine Kleider von dem Stuhl, auf dem er sie vor einigen Stunden abgelegt hatte. Während er sich anzog, blickte er sich desinteressiert in dem Zimmer um, in dem er die Nacht verbracht hatte. Ein Bett, zwei Wandschränke, einer davon mit Spiegeltür, ein einfacher, weißer Nachttisch von IKEA, darauf ein Wecker und eine Ausgabe Fit for Fun. Außerdem ein Tisch mit einem Foto vom Scheidungskind und allerlei Kleinkram neben dem Stuhl, von dem er gerade seine Kleider genommen hatte. Nichtssagende Kunstdrucke hingen an den Wänden, die ein gewiefter Makler sicherlich als «Latte-farben» bezeichnet hätte, dabei waren sie einfach nur schmutzigbeige. Das Zimmer war genau wie der Sex, den er hier gehabt hatte: phantasielos und ein wenig langweilig, aber er erfüllte seinen Zweck. So wie immer. Leider hielt die Befriedigung nie besonders lange an.
Sebastian schloss die Augen. Dies war der Moment, der am meisten schmerzte. Der Übergang zur Wirklichkeit. Der U-Turn der Gefühle, den er so gut kannte. Er konzentrierte sich auf die Frau im Bett, insbesondere auf die eine Brustwarze, die nicht bedeckt war.
Wie hieß sie bloß? Er wusste, dass er sich vorgestellt hatte, als er mit den Drinks zu ihr zurückkam, das machte er immer so. Nie in dem Moment, wenn er sich erkundigte, ob der Platz neben ihr noch frei sei, was sie trinken wolle und ob er sie zu etwas einladen dürfe. Immer erst dann, wenn er das Glas vor ihr abstellte.
‹Ich heiße übrigens Sebastian.›
Und was hatte sie geantwortet? Irgendwas mit K, da war er sich ziemlich sicher. Er zog den Gürtel durch die Schlaufen seiner Hose. Ein kurzes, metallisches Klirren von der Schnalle.
«Du gehst?» Ihre Stimme war schläfrig-heiser, ihr Blick suchte nach dem Wecker auf dem Nachttisch.
«Ja.»
«Ich dachte, wir frühstücken noch zusammen. Wie viel Uhr ist es?»
«Kurz vor fünf.»
Die Frau stützte sich auf einen Ellbogen. Wie alt war sie? Knapp vierzig? Sie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Die Reste des Schlafs wurden von der Erkenntnis vertrieben, dass der Morgen nicht so verlaufen würde, wie sie es sich vorgestellt hatte.
Sebastian hatte sich aus dem Bett geschlichen, angezogen und gehen wollen, ohne sie zu wecken. Sie würden weder gemeinsam frühstücken, noch Zeitung lesen, noch einen Sonntagsspaziergang machen. Er würde sie nicht näher kennenlernen wollen und nicht wieder anrufen, was auch immer er behauptet hatte. Das wusste sie.
Deshalb sagte er nur: «Mach es gut.»
Sebastian bemühte sich nicht einmal mehr, ihren Namen zu erraten. Plötzlich war er sich sogar unsicher, ob er überhaupt mit K anfing.
In der Morgendämmerung war es noch ruhig auf der Straße. Der Vorort schlummerte, und alle Geräusche wirkten so dezent, als wollten sie ihn nicht wecken. Sogar der Verkehr auf dem nahe gelegenen Nynäsvägen klang geradezu respektvoll gedämpft. Sebastian blieb vor dem Straßenschild an der nächsten Kreuzung stehen. Varpavägen. Irgendwo in Gubbängen. Ein gutes Stück bis nach Hause. Fuhr die U-Bahn so früh schon? Heute Nacht hatten sie ein Taxi genommen. Unterwegs bei einem 7-Eleven gehalten und Brötchen fürs Frühstück gekauft, weil ihr eingefallen war, dass sie nichts mehr im Haus hatte. Denn er habe doch wohl vor, zum Frühstück zu bleiben? Brötchen und Saft hatten sie gekauft, er und … es war einfach zum Verzweifeln. Wie hieß diese Frau? Sebastian setzte seinen Weg auf der menschenleeren Straße fort.
Er hatte sie verletzt, wie auch immer sie hieß.
In vierzehn Stunden würde er nach Västerås fahren und erledigen, was zu tun war. Diese Frau würde ihn nichts mehr angehen.
Es begann zu regnen.
Was für ein beschissener Morgen.
In Gubbängen.
Es ging alles schief, was nur schiefgehen konnte. Die Schuhe von Polizeikommissar Thomas Haraldsson waren undicht, sein Funkgerät funktionierte nicht, und obendrein hatte er seinen Suchtrupp verloren. Die Sonnenstrahlen blendeten ihn so sehr, dass er blinzeln musste, um nicht über die niedrigen Büsche und Wurzeln zu stolpern, die auf dem sumpfigen Boden wucherten. Haraldsson fluchte vor sich hin und sah auf die Uhr. In knapp zwei Stunden begann Jennys Mittagspause im Krankenhaus. Sie würde sich ins Auto setzen und nach Hause fahren in der Hoffnung, dass er ebenfalls käme. Doch er würde es nicht schaffen. Er würde noch immer in diesem verfluchten Wald umherstapfen.
Haraldsson sank mit dem linken Fuß ein und spürte, wie die Tennissocke das Wasser in seinen Schuh hineinsog. In der Luft lag bereits die junge, flüchtige Wärme des Frühjahrs, aber das Wasser bewahrte noch die Kälte des Winters. Ihn schauderte, doch es gelang ihm, den Fuß aus dem sumpfigen Untergrund herauszuziehen und festen Boden zu erreichen.
Haraldsson sah sich um. In diese Richtung musste Osten sein. Waren dort nicht die Soldaten unterwegs? Oder die Pfadfinder? Es war allerdings auch möglich, dass er im Kreis gelaufen war und völlig die Orientierung verloren hatte. Ein Stück entfernt erblickte er jedoch einen Hügel, der trockenen Boden versprach, eine kleine Oase in diesem Höllenpfuhl. Er begann, dorthin zu stapfen. Sein Fuß sank erneut ein. Diesmal der rechte. Eine schöne Scheiße.
Es war alles Hansers Schuld.
Er müsste hier nicht bis zu den Waden durchnässt stehen, hätte Hanser nicht unbedingt Handlungsstärke demonstrieren wollen. Dazu hatte sie auch allen Grund, denn eigentlich war sie ja noch nicht einmal eine richtige Polizistin. Sie gehörte zu jenen Juristen, die sich bis zur Führungsebene durchmogelten, ohne sich je die Hände schmutzig zu machen oder, wie in seinem Fall, die Füße nass.
Nein, hätte die Entscheidung bei Haraldsson gelegen, wären sie die Sache vollkommen anders angegangen. Sicher, der Junge war seit Freitag verschwunden, und laut Vorschrift war es richtig, das Suchgebiet auszuweiten, insbesondere, weil ein Anrufer an dem betreffenden Wochenende «nächtliche Aktivitäten» und «Licht im Wald» in der Gegend um Listakärr beobachtet hatte. Doch Haraldsson wusste aus Erfahrung, dass diese Aktion völlig sinnlos war. Der Junge war in Stockholm und lachte über seine besorgte Mutter. Er war sechzehn Jahre alt. Und sechzehnjährige Jungs taten das nun mal – über ihre Mütter lachen.
Hanser.
Je nasser Haraldsson wurde, desto mehr hasste er sie. Sie war das Schlimmste, was ihm je passiert war. Jung, attraktiv, erfolgreich, politisch, eine Repräsentantin der neuen, modernen Polizei.
Hanser war ihm in die Quere gekommen. Schon als sie das erste Mal bei der Polizei in Västerås vorsprach, war Haraldsson klar geworden, dass seine Karriere eine Vollbremsung hingelegt hatte. Er bewarb sich um den Posten. Sie bekam ihn. Mindestens fünf Jahre lang würde sie dort Chefin sein. Seine fünf Jahre. Man hatte ihm die Leiter nach oben weggezogen. Stattdessen hatte sich seine Karriere langsam auf dem jetzigen Niveau eingependelt, und es schien nur noch eine Frage der Zeit, bis sie eine Talfahrt machte. Es war geradezu symbolisch, dass er nun ein paar Kilometer von Västerås entfernt in einem Wald bis zu den Knien im stinkenden Schlamm steckte.
«HEUTE KUSCHELIGE MITTAGSPAUSE» war in Großbuchstaben in der SMS zu lesen gewesen, die er vorhin erhalten hatte. Was bedeutete, dass Jenny über Mittag nach Hause kommen würde, um mit ihm zu schlafen, und abends würden sie es dann noch ein- oder zweimal tun. So sah ihr Leben zurzeit aus. Jenny war in Behandlung, weil sie nicht schwanger wurde, und sie hatte gemeinsam mit dem Arzt einen Zeitplan ausgearbeitet, um die Befruchtungschancen zu optimieren. Und heute war ein optimaler Tag. Daher die SMS. Haraldsson war zwiegespalten. In gewisser Hinsicht wusste er es zu schätzen, dass ihr Sexleben in der letzten Zeit eine Aktivitätssteigerung von mehreren hundert Prozent erfahren hatte, dass Jenny ihn ständig wollte. Gleichzeitig wurde er den Gedanken nicht los, dass sie im Grunde gar nicht ihn wollte, sondern nur seine Spermien. Ohne ihren Kinderwunsch wäre sie niemals auf die Idee gekommen, für einen Quickie über Mittag nach Hause zu fahren. Das Ganze erinnerte ein wenig an Tierzucht. Sobald eine Eizelle ihre Wanderung in Richtung Gebärmutter antrat, legten sie los wie die Kaninchen. Und zwischendurch auch, nur um auf der sicheren Seite zu sein. Doch es ging nie mehr um Genuss, nie mehr um Nähe. Was war aus der Leidenschaft geworden? Der Lust? Und jetzt würde sie mittags in ein leeres Haus kommen. Vielleicht hätte er sie anrufen sollen, um zu fragen, ob er in ein Glas ejakulieren und es in den Kühlschrank stellen sollte, bevor er ging. Und das Schlimmste: Er war sich nicht einmal sicher, ob Jenny das für eine gänzlich schlechte Idee gehalten hätte.
Alles hatte am Samstag begonnen.
Gegen 15 Uhr hatte die Notrufzentrale ein Gespräch zur Polizei Västerås durchgestellt. Eine Mutter hatte ihren sechzehnjährigen Sohn vermisst gemeldet. Da es sich um einen Minderjährigen handelte, wurde die Vermisstenmeldung mit der höchsten Priorität versehen. Ganz vorschriftsgemäß.
Leider blieb die dringende Meldung dann allerdings bis Sonntag liegen, als eine Streife damit beauftragt wurde, der Sache nachzugehen – mit dem Ergebnis, dass die Mutter gegen 16 Uhr Besuch von zwei uniformierten Beamten bekam. Ihre Angaben wurden nun ein zweites Mal aufgenommen und registriert, bevor die Beamten am späteren Abend ihren Dienst beendeten. Noch immer hatte man keinerlei Maßnahmen ergriffen, abgesehen davon, dass nun zwei sorgfältige, nahezu identische Vermisstenmeldungen zum selben Vermissten vorlagen. Beide mit dem Vermerk «höchste Priorität» gekennzeichnet.
Erst am Montagmorgen, als Roger Eriksson bereits seit achtundfünfzig Stunden verschwunden war, fiel dem diensthabenden Beamten auf, dass die Vermisstenmeldung ohne weitere Konsequenzen geblieben war. Leider zog sich eine Fachsitzung über den Vorschlag des Reichspolizeiamtes zum Thema neue Uniformen so sehr in die Länge, dass man Haraldsson den aufgeschobenen Fall erst nach der Mittagspause zuteilte. Als er das Eingangsdatum sah, dankte Haraldsson seinem Schutzengel, dass die Streife Lena Eriksson am Sonntagabend besucht hatte. Dass die Beamten lediglich eine weitere Meldung geschrieben hatten, musste Rogers Mutter ja nicht erfahren. Nein, die Ermittlungen hatten bereits am Sonntag ernsthaft begonnen, aber noch zu keinem Ergebnis geführt. An dieser Version würde Haraldsson festhalten.
Er sah ein, dass er gezwungen war, zumindest einige zusätzliche Informationen einzuholen, bevor er mit Lena Eriksson sprach. Also versuchte er, Lisa Hansson zu erreichen, die jedoch noch in der Schule war.
Er suchte im Polizeiregister sowohl nach Lena Eriksson als auch nach ihrem Sohn. Bei Roger tauchten einige Anzeigen wegen Ladendiebstahls auf. Die letzte war bereits ein Jahr her und nur schwer mit seinem Verschwinden in Verbindung zu bringen. Zur Mutter gab es nichts.
Haraldsson rief bei der Gemeindeverwaltung an und erfuhr, dass Roger auf die Palmlövska-Schule ging.
Nicht gut, dachte Haraldsson.
Dieses Gymnasium war eine Privatschule mit angeschlossenem Internat. Ranglisten zufolge eine der besten Schulen des Landes. Auf die Palmlövska gingen begabte und äußerst motivierte Kinder reicher Eltern. Eltern mit guten Kontakten. Man würde einen Sündenbock dafür suchen, dass die Ermittlungen nicht sofort aufgenommen worden waren, und in diesem Zusammenhang machte es keinen guten Eindruck, am dritten Tag rein gar nichts erreicht zu haben. Haraldsson beschloss, alles andere beiseitezulegen. Seine Karriere war bereits zum Stillstand gekommen, und es wäre dumm, weitere Risiken einzugehen.
Also hatte er an jenem Nachmittag hart gearbeitet und der Schule einen Besuch abgestattet. Sowohl Rektor Ragnar Groth als auch Roger Erikssons Klassenlehrerin Beatrice Strand reagierten äußerst besorgt und bestürzt, als sie erfuhren, dass Roger vermisst wurde, konnten davon abgesehen allerdings nicht weiterhelfen. Zumindest hatten sie nichts Ungewöhnliches bemerkt. Roger habe sich verhalten wie immer, ganz normal die Schule besucht, Freitagnachmittag eine Klausur in Schwedisch geschrieben, und laut seinen Mitschülern war er hinterher gut gelaunt gewesen.
Immerhin konnte Haraldsson hier mit Lisa Hansson sprechen, die Roger am Freitagabend als Letzte gesehen hatte. Sie ging in die Parallelklasse und wurde ihm in der Cafeteria des Gymnasiums vorgestellt. Sie war ein hübsches, wenn auch ziemlich durchschnittliches Mädchen. Glattes, blondes Haar, den Pony mit einer einfachen Haarspange hochgesteckt. Ungeschminkte blaue Augen. Eine bis zum vorletzten Knopf geschlossene, weiße Bluse, darüber eine Weste. Haraldsson musste unmittelbar an die Freikirche denken, als er ihr gegenüber Platz nahm. Oder an das Mädchen aus dieser Serie, «Der weiße Stein», die im Fernsehen gelaufen war, als er noch ein Kind war. Er fragte, ob sie etwas trinken wolle. Sie schüttelte den Kopf.
«Erzähl mir von dem Freitag, als Roger bei dir war.»
Lisa sah ihn an und zuckte kurz mit den Achseln.
«Er ist vielleicht so um halb sechs gekommen, wir haben in meinem Zimmer gesessen und ferngesehen, und dann ist er gegen zehn nach Hause gegangen. Jedenfalls hat er gesagt, er würde nach Hause gehen …»
Haraldsson nickte. Viereinhalb Stunden auf ihrem Zimmer. Zwei Sechzehnjährige. Ferngesehen, das konnte sie vielleicht ihrer Großmutter erzählen. Oder schloss er zu sehr von sich auf andere? Wie lange war es her, seit Jenny und er das letzte Mal einen ganzen Abend lang ferngesehen hatten? Ohne Quickie in der Werbepause? Monate.
«Und etwas anderes ist nicht passiert? Ihr habt euch nicht gestritten oder vielleicht sogar Schluss gemacht?»
Lisa schüttelte den Kopf. Sie kaute an einem kaum noch vorhandenen Daumennagel. Haraldsson sah, dass die Nagelhaut entzündet war.
«Ist er schon mal einfach so verschwunden?»
Lisa schüttelte erneut den Kopf.
«Nicht dass ich wüsste, aber wir sind auch noch nicht so lange zusammen. Haben Sie denn nicht mit seiner Mutter gesprochen?»
Für einen kurzen Moment fasste Haraldsson die Frage als Vorwurf auf, bevor er begriff, dass sie natürlich keineswegs so gemeint war. Hansers Schuld. Sie hatte ihn dazu gebracht, an sich selbst zu zweifeln.
«Es waren schon andere Polizisten bei ihr, aber wir müssen mit allen sprechen. Uns ein Gesamtbild machen.» Harald räusperte sich.
«Was für eine Beziehung hat Roger zu seiner Mutter? Gibt es da irgendwelche Probleme?»
Lisa zuckte erneut mit den Achseln. Haraldsson fand ihr Repertoire etwas beschränkt. Kopfschütteln und Achselzucken.
«Haben sie sich manchmal gestritten?»
«Ja, wohl schon. Ab und zu. Ihr gefällt die Schule nicht.»
«Diese Schule?»
Lisa nickte.
«Sie findet sie versnobt.»
Womit sie den Nagel auf den Kopf trifft, dachte Haraldsson.
«Wohnt Rogers Vater auch hier in der Stadt?»
«Nein. Ich habe keine Ahnung, wo er wohnt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Roger das überhaupt weiß. Er spricht nie über ihn.»
Haraldsson machte sich eine Notiz. Interessant. Möglicherweise hatte sich der Sohn auf die Suche nach seinen Wurzeln begeben. Um seinen abwesenden Vater zur Rede zu stellen. Und vor der Mutter hielt er das geheim. Es waren schon ganz andere Dinge geschehen.
«Was ist Ihrer Meinung nach passiert?»
Haraldsson wurde aus seinen Gedanken gerissen. Er sah Lisa an und bemerkte zum ersten Mal, dass sie den Tränen nahe war.
«Ich weiß es nicht. Aber er wird sicher wieder auftauchen. Vielleicht ist er einfach eine Zeitlang nach Stockholm gefahren oder so. Ein kleines Abenteuer, du weißt schon.»
«Warum sollte er das tun?»
Haraldsson betrachtete ihre aufrichtig ratlose Miene. Den unlackierten, abgekauten Daumennagel zwischen ihren ungeschminkten Lippen. Nein, dieses kleine Freikirchenfräulein konnte sich wohl kaum einen Grund vorstellen. Haraldsson hingegen war sich zunehmend sicher, dass der Vermisste eher ein Ausreißer war.
«Manchmal kommt man plötzlich auf merkwürdige Ideen und setzt sie dann einfach in die Tat um. Er wird sicher wieder auftauchen, du wirst schon sehen.»
Haraldsson setzte ein überzeugendes und vertrauenerweckendes Lächeln auf, doch er sah Lisa an, dass es seine Wirkung verfehlte.
«Ich verspreche es», fügte er hinzu.
Bevor er ging, bat er Lisa um eine Liste von Rogers Freunden und allen anderen, mit denen er zu tun hatte. Lisa überlegte lange, schrieb dann etwas auf und reichte ihm den Zettel. Zwei Namen: Johan Strand und Sven Heverin. Ein einsamer Junge, dachte Haraldsson, und einsame Jungs hauen von zu Hause ab.
Als er sich am Montagnachmittag ins Auto setzte, war Haraldsson ziemlich zufrieden mit seinem Tagwerk. Zwar hatte das Gespräch mit Johan Strand nicht viel ergeben; Johan hatte Roger zum letzten Mal am Freitag gesehen, nach der Schule. Soweit er wisse, habe Roger am Abend Lisa besuchen wollen. Er habe keine Idee, wo er danach hingegangen sein könne. Was Sven Heverin betraf, so hatte dieser offenbar gerade Langzeitferien. Sechs Monate in Florida. Er war bereits seit sieben Wochen verreist. Die Mutter des Jungen hatte einen Beratungsauftrag in den USA angenommen, und die ganze Familie begleitete sie. Manchen Menschen geht es einfach zu gut, dachte Haraldsson und überlegte, an welche exotischen Orte ihn seine Arbeit schon geführt hatte. Das Seminar in Riga war das Einzige, was ihm unmittelbar einfiel, doch da hatte er die ganze Zeit mit einer Magengeschichte im Bett gelegen. Er konnte sich nur noch daran erinnern, dass seine Kollegen eine verdammt gute Zeit gehabt hatten, während er in einen blauen Plastikeimer gestarrt hatte.
Dennoch war Haraldsson heute ganz zufrieden. Er war mehreren Spuren nachgegangen und das Wichtigste: Er hatte einen möglichen Konflikt zwischen Mutter und Sohn aufgespürt, der vermuten ließ, dass dies bald kein Fall mehr für die Polizei wäre. Hatte die Mutter bei ihrer Meldung nicht sogar gesagt, ihr Sohn habe sich «aus dem Staub gemacht»? Doch, hatte sie. Haraldsson erinnerte sich, dass ihm das aufgefallen war, als er sich die Aufzeichnung angehört hatte. Ihr Sohn «ging» nicht etwa oder «verschwand», sondern er «machte sich aus dem Staub». Deutete das nicht darauf hin, dass er im Zorn gegangen war? Eine Tür, die vor der Nase einer resignierten Mutter zugeschlagen worden war. Haraldsson war immer mehr davon überzeugt. Der Junge war in Stockholm und erweiterte seinen Horizont.
Nur zur Sicherheit hatte er jedoch vor, noch einen kurzen Abstecher zu Lisas Haus zu machen. Er wollte sich in der Öffentlichkeit zeigen und einige Leute abklappern, die ihn wiedererkennen würden, falls jemand fragen sollte, wie es mit den Ermittlungen voranging. Vielleicht war Roger ja auch wirklich gesehen worden, bestenfalls sogar auf dem Weg in Richtung Zentrum und Bahnhof. Danach weiter zur Mutter, um sie ein wenig unter Druck zu setzen, damit sie zugab, dass sie sich häufig mit ihrem Sohn stritt. Guter Plan, dachte er und startete den Motor.
In dem Moment klingelte sein Handy. Ein kurzer Blick auf das Display ließ ihn erschaudern. Hanser.
«Was ist denn nun schon wieder», brummelte Haraldsson vor sich hin und stellte den Motor ab. Sollte er das Gespräch wegdrücken? Ein verlockender Gedanke, aber vielleicht war der Junge ja zurückgekehrt. Vielleicht wollte Hanser ihm genau das mitteilen. Dass er die ganze Zeit richtiggelegen hatte. Er ging ran.
Das Gespräch dauerte nur achtzehn Sekunden, in denen Hanser insgesamt sechs Wörter von sich gab.
«Wo bist du?», lauteten die ersten drei.
«Im Auto», antwortete Haraldsson wahrheitsgemäß. «Ich war gerade in der Schule des Jungen und habe mit seiner Freundin und den Lehrern gesprochen.»
Zu seinem Verdruss bemerkte Haraldsson, dass er sofort in Verteidigungsstellung ging. Seine Stimme wurde ein wenig gefügiger. Höher. Verdammt, er hatte doch alles so gemacht, wie er sollte.
«Komm sofort her.»
Haraldsson wollte gerade erklären, wohin er eigentlich auf dem Weg war, und fragen, was denn so wichtig sei, doch Hanser hatte bereits aufgelegt. Blöde Kuh. Er drehte erneut den Zündschlüssel, wendete und fuhr zum Präsidium.
Dort erwartete Hanser ihn bereits. Diese kühlen Augen. Die etwas zu makellose blonde Haarpracht. Das perfekt sitzende und garantiert teure Kostüm. Sie habe gerade einen Anruf von einer aufgebrachten Lena Eriksson erhalten, die sich frage, was eigentlich unternommen werde, und müsse sich nun dasselbe fragen. Was wurde unternommen?
Haraldsson referierte kurz seine Aktivitäten des Nachmittags, wobei es ihm gelang, ganze viermal zu erwähnen, dass der Fall erst nach der heutigen Mittagspause auf seinem Schreibtisch gelandet war. Falls sie plane, sich zu beschweren, solle sie sich bitte an die Verantwortlichen vom Wochenende wenden.
«Das werde ich auch tun», entgegnete Hanser ruhig. «Aber warum hast du mich nicht darüber informiert, dass der Fall so lange liegengeblieben ist? Über genau solche Angelegenheiten muss ich unbedingt Bescheid wissen.»
Haraldsson spürte, dass das Gespräch eine Wendung nahm, mit der er nicht gerechnet hatte. Er versuchte nur noch, sich herauszureden.
«So was kann doch mal passieren. Ich kann nicht jedes Mal zu dir rennen, wenn es gerade ein bisschen im Getriebe knirscht. Du hast garantiert Wichtigeres zu tun.»
«Wichtigeres, als auf der Stelle nach einem verschwundenen Kind zu suchen?»
Sie blickte ihn fragend an. Haraldsson verstummte. Das Gespräch verlief nicht nach seinem Plan. Ganz und gar nicht.
Das war am Montag gewesen. Jetzt stand er mit durchnässten Socken in der Nähe von Listakärr. Hanser hatte das ganze Register gezogen: Befragung der Nachbarn und Suchtrupps, die ein Gebiet durchkämmten, das jeden Tag ausgeweitet wurde. Bisher ohne Ergebnis. Gestern war Haraldsson auf dem Präsidium dem Kreispolizeidirektor in die Arme gelaufen und hatte ihn in scherzhaftem Ton darauf hingewiesen, dass die ganze Aktion nicht ganz billig werden würde. Viele Männer, die viele Stunden arbeiteten, um einen Jungen zu suchen, der sich lediglich in der Hauptstadt vergnügte. Haraldsson hatte die Reaktion des Polizeidirektors nicht zweifelsfrei deuten können, doch spätestens wenn Roger von seinem kleinen Ausflug zurückkehrte, würde sich der Vorgesetzte wohl an Haraldssons Worte erinnern. Dann würde er begreifen, welche Unsummen Hanser verschwendet hatte. Bei der Vorstellung musste Haraldsson grinsen. Dienstvorschriften waren eine Sache, die Intuition eines Polizisten etwas ganz anderes. Man lernte nie aus.
Haraldsson blieb stehen. Auf halbem Weg zum Hügel. Er war erneut eingesunken. Und diesmal richtig. Er zog den Fuß hoch. Ohne Schuh. Er konnte gerade noch sehen, wie sich der Schlamm gierig über dem schwarzen Exemplar Größe dreiundvierzig zusammenzog, während die Socke an seinem linken Fuß weitere Milliliter des kalten Wassers aufsog.
Jetzt hatte er genug.
Es reichte.
Dies war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Auf die Knie, mit der Hand hinein in den Morast, hoch mit dem Schuh. Und dann würde er nach Hause fahren. Sollten die anderen doch mit ihren dämlichen Suchtrupps hier herumrennen. Er hatte eine Frau zu befruchten.
Eine Taxifahrt später und um dreihundertachtzig Kronen ärmer stand Sebastian vor seiner Wohnung in der Grev Magnigatan in Östermalm. Eigentlich wollte er sich schon seit langem von ihr trennen, sie war teuer und luxuriös, wie geschaffen für einen erfolgreichen Autor und Akademiker, der ständig zu Vorträgen eingeladen wurde und über ein großes soziales Netzwerk verfügte. All das, was er jetzt nicht mehr war oder hatte. Aber schon bei dem Gedanken daran, auszumisten, zu packen und sich um die Sachen zu kümmern, die sich über Jahre hinweg angesammelt hatten, erschien ihm die Aufgabe unüberwindbar. Daher hatte er einfach große Teile der Wohnung abgeschlossen und benutzte nur noch die Küche, das Gästezimmer und ein kleineres Badezimmer. Der Rest blieb unberührt. In Erwartung von … ja, irgendwas.
Sebastian warf einen schnellen Blick auf sein ungemachtes Bett, entschied sich dann aber für eine Dusche. Warm und ausgiebig. Die Intimität der letzten Nacht war schon lange vergessen. War es ein Fehler gewesen, so schnell zu verschwinden? Hätte sie ihm in den folgenden Stunden noch etwas geben können? Mehr Sex vermutlich. Und ein Frühstück. Saft und Brötchen. Aber dann? Der endgültige Abschied war unausweichlich gewesen. Es hätte nie auf eine andere Weise enden können. Also konnte man es ebenso gut kurz machen. Dennoch. Den Augenblick der Zusammengehörigkeit, der ihn für kurze Zeit abheben ließ, vermisste er tatsächlich. Er fühlte sich schon wieder schwerfällig und leer. Wie lange hatte er letzte Nacht eigentlich geschlafen? Zwei Stunden? Zweieinhalb? Verkatert war er jedenfalls nicht. Er betrachtete sich im Spiegel. Seine Augen wirkten müder als gewöhnlich, und er bemerkte, dass er dringend etwas an seiner Frisur ändern musste. Vielleicht ein Stoppelschnitt? Nein, das würde ihn zu sehr an früher erinnern. Und früher war eben nicht jetzt. Aber er könnte seinen Bart stutzen, die Haare in Form schneiden und sich vielleicht sogar ein paar Strähnchen färben lassen. Er lächelte sich selbst zu, sein charmantestes Lächeln. Unglaublich, dass es immer Erfolg hat, dachte er. Mit einem Mal fühlte er sich schrecklich müde. Der U-Turn war vollendet. Die Leere war wieder da. Er sah auf die Uhr. Eine Weile sollte er sich auf jeden Fall noch hinlegen. Er wusste, dass der Traum wiederkehren würde, aber er war zu müde, um sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Er kannte seinen ständigen Begleiter mittlerweile so gut, dass er ihn hin und wieder sogar vermisste, wenn er ausnahmsweise geschlafen hatte, ohne von ihm geweckt zu werden.
Anfangs war das anders gewesen. Als der Traum ihn monatelang gequält hatte, war Sebastian das ewige Aufwachen leid gewesen, diesen ständigen Wechsel von Angst und Atemnot, Hoffnung und Verzweiflung. Er hatte begonnen, einen nicht zu knapp bemessenen Schlummertrunk einzunehmen, Problemlöser Nummer eins für männliche, weiße Akademiker mittleren Alters mit einem komplizierten Gefühlsleben. Eine Zeitlang war es ihm gelungen, das Träumen völlig zu umgehen, doch sein Unterbewusstsein fand allzu schnell einen Weg an den alkoholischen Sperren vorbei, sodass er immer größere Mengen zu immer früheren Zeiten trinken musste, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen. Am Ende musste Sebastian einsehen, dass er den Kampf verloren hatte. Er hörte von einem Tag auf den anderen damit auf. Wollte die Schmerzen stattdessen aushalten. Den Dingen Zeit lassen zu heilen.
Das funktionierte überhaupt nicht. Nach einer weiteren Phase, in der er nie durchschlief, begann er, sich mit Medikamenten zu behandeln. Was er sich niemals zu tun geschworen hatte. Aber man konnte nicht all seine Versprechen halten, das wusste er aus eigener Erfahrung und besser als die meisten. Insbesondere, wenn man mit den wirklich großen Fragen des Lebens konfrontiert wurde. Da musste man flexibler sein. Er rief einige seiner eher schamlosen alten Patienten an und entstaubte einen Rezeptblock. Der Deal war einfach. Sie teilten halbe-halbe.
Natürlich meldete sich das Zentralamt für Gesundheit und Soziales bei ihm, verwundert darüber, dass er plötzlich so große Mengen an Psychopharmaka verschrieb. Aber Sebastian gelang es, alles mit einigen wohlkonstruierten Lügen über eine «wiederaufgenommene Tätigkeit» mit «intensiver Einleitungsphase» für «Patienten im Stadium der Selbstfindung» zu begründen. Zudem erhöhte er die Zahl seiner Patienten, damit nicht ganz so offensichtlich wurde, was er eigentlich trieb.
Zu Beginn hatte er hauptsächlich mit Propavan, Prozac und Di-Gesic experimentiert, doch die Wirkung war irritierend kurz. Daher versuchte er es stattdessen mit Dolcontin und anderen Substanzen auf Morphiumbasis.
Wie sich herausstellte, war das Zentralamt sein geringstes Problem. Viel belastender waren die Nebenwirkungen seiner Versuche. Der Traum verschwand zwar, aber mit ihm auch sein Appetit, fast alle Aufträge als Dozent und sein Sexualtrieb – eine vollkommen neue und erschreckende Erfahrung. Am schlimmsten war jedoch die chronische Müdigkeit. Es kam ihm vor, als könne er seine Gedanken nicht mehr zu Ende führen, als würden sie mittendrin abgeschnitten. Ein alltägliches Gespräch konnte er mit einer gewissen Anstrengung führen, eine Diskussion oder eine längere Ausführung waren hingegen völlig undenkbar.
Da Sebastian seine gesamte Existenz auf einem intellektuellen Selbstbild aufbaute, auf der Illusion seiner messerscharfen Gedanken, war dieser Zustand entsetzlich. Ein betäubtes Leben zu führen, mit betäubten Schmerzen, gewiss, aber alles andere ebenfalls nur gedämpft wahrzunehmen, sogar das Leben selbst, und den eigenen Scharfsinn nicht mehr spüren zu können: Hier verlief für ihn die Grenze. Er war gezwungen, eine Entscheidung zu treffen, zu wählen zwischen Angstzuständen mit vollständigen Gedanken oder einem trägen, stumpfen Leben mit halbierter Erkenntnis. Als er begriff, dass er sein Dasein vermutlich so oder so hassen würde, egal, was er tat, entschied er sich für die Angst und hörte auch mit den Medikamenten von einem Tag auf den anderen auf.
Seither hatte er weder Alkohol noch Drogen angerührt. Nicht einmal mehr eine Kopfschmerztablette. Doch er träumte. Jede Nacht.
Aber warum musste er eigentlich gerade darüber nachdenken, fragte er sich, während er sich im Badezimmerspiegel betrachtete. Warum jetzt? Der Traum begleitete sein Leben nun schon seit vielen Jahren. Er hatte ihn studiert und analysiert. Hatte ihn mit seinem Therapeuten diskutiert. Gelernt, damit zu leben.
Warum also jetzt?
Es lag an Västerås, dachte er, hängte sein Handtuch auf und verließ nackt das Badezimmer. Västerås war schuld. Västerås – und seine Mutter. Aber heute würde er dieses Kapitel seines Lebens beenden. Für immer.
Heute könnte ein guter Tag werden.
Es war der beste Tag seit langem für Joakim, dort im Wald außerhalb von Listakärr, und er wurde noch besser, als er schließlich zu den Auserwählten gehörte, die von dem Polizisten direkt angewiesen wurden, wie und wohin sie gehen sollten. Das sonst eher triste Pfadfindertreffen hatte sich plötzlich zu einem richtigen Abenteuer entwickelt. Joakim warf einen verstohlenen Blick auf den Polizisten, der vor ihm stand, besonders auf seine Pistole, und er beschloss, selber Polizist zu werden. Mit Uniform und Pistole, fast wie die Pfadfinder, aber ordentlich aufgerüstet. Das wäre gut. Denn wenn man ehrlich war, war das Pfadfinderleben nicht unbedingt die interessanteste Beschäftigung, die man sich vorstellen konnte, fand Joakim. Nicht mehr. Er war gerade vierzehn geworden, und diese Freizeitbeschäftigung, der er seit seinem sechsten Lebensjahr nachging, verlor allmählich ihren Reiz. Die Faszination, die das Leben im Freien, das Überleben, Tiere und Natur auf ihn ausgeübt hatten, war weg. Dabei fand er es keinesfalls albern, so wie alle anderen Jungs in seiner Klasse, nein, er hatte lediglich damit abgeschlossen. Danke, es war nett, aber jetzt war die Zeit für etwas Neues gekommen. Etwas Richtiges.
Vielleicht wusste ihr Leiter Tommy das.
Vielleicht war er deshalb auf die Polizei und die Soldaten zugegangen und hatte sich erkundigt, was vor sich ging, als sie in Listakärr angekommen waren.
Was auch immer Tommys Beweggrund gewesen war – der Polizist, der Haraldsson hieß, hatte jedenfalls über die Sache nachgedacht und nach einigem Zögern beschlossen, dass es auf keinen Fall schaden konnte, weitere neun Augenpaare im Wald zur Verfügung zu haben. Sie bekamen ein eigenes kleines Suchgebiet, in dem sie umherstapfen durften. Haraldsson hatte Tommy gebeten, die Gruppe in drei Trupps aufzuteilen, je einen Anführer auszuwählen und zur Einweisung zu ihm zu schicken. Joakim zog das große Los. Er durfte eine Gruppe mit Emma und Alice bilden, den hübschesten Mädchen des ganzen Pfadfinderverbandes. Und obendrein wurde er auch noch zum Gruppenleiter erkoren.
Jetzt ging Joakim zu den Mädchen zurück, die auf ihn warteten. Dieser Haraldsson war genauso einsilbig und entschlossen gewesen wie die Polizisten aus den Kommissar-Beck-Filmen, und Joakim fühlte sich ungemein wichtig. Er stellte sich bereits vor, wie der Rest dieses phantastischen Tages aussehen würde: Er würde den vermissten Jungen schwerverletzt finden, und der Junge würde Joakim so flehend ansehen, wie nur Sterbende es konnten. Er wäre zu schwach zum Sprechen – doch seine Augen würden alles sagen. Joakim würde ihn hochheben und zum Treffpunkt schleppen, total dramatisch. Die anderen würden ihn sehen und anfangen zu applaudieren, zu jubeln, und alles wäre perfekt.
Wieder bei seiner Gruppe angelangt, ordnete Joakim seine Gruppenmitglieder so, dass Emma links von ihm stand und Alice rechts. Haraldsson hatte sie strengstens ermahnt, die Kette nicht aufzulösen, und Joakim sah die Mädchen mit ernstem Blick an und erklärte, sie müssten unbedingt zusammenbleiben. Jetzt war es ernst! Nach einer gefühlten Ewigkeit gab Haraldsson ihnen einen Wink, und die Suchmannschaft konnte sich endlich in Bewegung setzen.
Joakim merkte schnell, dass es ziemlich schwierig war, eine Suchkette zusammenzuhalten, auch wenn sie lediglich aus drei Gruppen mit je drei Personen bestand. Besonders, als sie tiefer in den Wald eindrangen und wegen des sumpfigen Bodens gezwungen waren, von ihrem vorbestimmten Kurs abzuweichen. Die eine Gruppe hatte Schwierigkeiten mitzuhalten, die andere verlangsamte das Tempo kein bisschen und war schon bald hinter den Hügeln verschwunden. Genau wie Haraldsson es vorausgesagt hatte. Joakim war mehr und mehr von diesem Mann beeindruckt. Er schien wirklich alles zu wissen. Joakim lächelte die Mädchen an und referierte noch einmal Haraldssons letzte Worte:
«Wenn ihr etwas findet, dann schreit: ‹Fund!›.»
Emma nickte entnervt.
«Das hast du jetzt schon mindestens hundertmal gesagt.»
Doch Joakim ließ sich davon nicht entmutigen. Die Augen gegen die Sonne zusammengekniffen, stapfte er weiter und bemühte sich, Abstand und Richtung einzuhalten, obwohl es immer schwieriger wurde. Und Lasses Gruppe, die noch vor kurzem ein Stückchen links von ihnen gelaufen war, war nicht mehr zu sehen.
Nach einer halben Stunde wollte Emma eine Pause einlegen. Joakim versuchte ihr klarzumachen, dass sie das nicht einfach so tun konnten. Es bestand die Gefahr, die anderen vollkommen zu verlieren.
«Welche anderen?»
Alice lachte vielsagend, und Joakim musste sich eingestehen, dass sie die anderen nun schon seit geraumer Zeit nicht mehr gesehen hatten.
«Es klingt so, als wären sie hinter uns.»
Sie schwiegen und lauschten. In weiter Ferne waren schwache Geräusche zu hören. Jemand rief etwas.
«Wir gehen weiter», bestimmte Joakim, obwohl ihm insgeheim dämmerte, dass Alice vermutlich recht hatte. Sie waren wahrscheinlich zu schnell gelaufen. Oder in die falsche Richtung.
«Dann geh doch allein!», antwortete Emma und blickte ihn wütend an. Für einen Moment hatte Joakim das Gefühl, die Kontrolle über seine Gruppe zu verlieren, vor allem über Emma. Ausgerechnet über sie, die ihn während der vergangenen dreißig Minuten einige Male so sanft angeblickt hatte. Joakim brach der Schweiß aus, und das lag nicht nur an seiner viel zu warmen langen Unterwäsche. Eigentlich hatte er sie angetrieben, um sie zu beeindrucken, begriff sie das denn nicht? Und jetzt war plötzlich alles seine Schuld.
«Hast du Hunger?», unterbrach Alice Joakims Gedanken. Sie hatte einige belegte Brote aus ihrem Rucksack geholt.
«Nein», antwortete er etwas zu schnell, noch bevor er bemerkte, dass er doch hungrig war. Joakim ging ein Stück weiter und stellte sich auf einen Hügel, um den Anschein zu erwecken, er habe einen Plan. Emma nahm freudig ein Brot entgegen und würdigte Joakims Versuch, sich wichtig zu machen, mit keinem Blick. Er begriff, dass er seine Taktik ändern musste. Er holte tief Luft und ließ die frische Waldluft durch seine Lungen strömen. Der Himmel hatte sich zugezogen; die Sonne war verschwunden und mit ihr auch das Versprechen von einem perfekten Tag. Joakim ging zu den Mädchen zurück. Er beschloss, einen etwas sanfteren Ton anzuschlagen.
«Ich hätte doch gern ein Brot, falls du noch eins übrig hast», sagte er so freundlich wie möglich.
«Klar», antwortete Alice und kramte ein in Frischhaltefolie eingewickeltes Brot hervor. Sie lächelte ihn an, und Joachim merkte, dass seine neue Taktik besser ankam.
«Ich frage mich, wo wir eigentlich sind», sagte Emma und zog eine kleine Karte aus ihrer Tasche. Die drei beugten sich darüber und versuchten, ihre Position zu bestimmen. Das war ziemlich kompliziert, das Gebiet hatte keine eindeutigen Orientierungspunkte, es war ein einziges Durcheinander aus Hügeln, Wald und Sumpfland. Aber sie wussten ja, wo sie losgelaufen und in welche Richtung sie ungefähr gegangen waren.
«Wir sind fast die ganze Zeit nach Norden gegangen, also müssten wir ungefähr hier sein», schlug Emma vor. Joakim nickte beeindruckt. Emma war schlau.
«Sollen wir weitergehen oder auf die anderen warten?», fragte Alice.
«Ich finde, wir sollten weitergehen», antwortete Joakim prompt, fügte aber blitzschnell hinzu: «Es sei denn, ihr wollt lieber warten?»
Er sah die beiden Mädchen an, Emma mit ihren klaren, blauen Augen und Alice mit ihren etwas kantigeren Zügen. Sie waren einfach beide furchtbar hübsch, dachte er und wünschte sich plötzlich, die Mädchen würden vorschlagen, hier zu warten. Und dass die anderen sehr, sehr lange nicht kämen.
«Wahrscheinlich können wir genauso gut weitergehen. Wenn wir hier sind, dürften wir eigentlich nicht weit von dem Punkt entfernt sein, wo wir uns wieder treffen sollen», sagte Emma und zeigte auf die Karte.
«Ja, aber ihr habt natürlich recht, die anderen sind hinter uns, also können wir auch genauso gut auf sie warten», schlug Joakim versuchsweise vor.
«Ich dachte, du wolltest als Erster da sein. Du bist doch losgestürmt wie ein D-Zug», erwiderte Alice. Die Mädchen lachten, und Joakim genoss das angenehme Gefühl, mit so hübschen Mädchen zusammen zu lachen. Er knuffte Alice scherzhaft.
«Aber du hast doch ganz gut mitgehalten!»
Sie fingen an, sich gegenseitig zu jagen. Joakim und die Mädchen rannten zwischen den Wasserpfützen umher, zunächst ziellos, doch als Emma in einer Pfütze stolperte, begannen sie sich gegenseitig nass zu spritzen. Das machte wesentlich mehr Spaß als die langweilige Suchkette, fand Joakim. Er rannte Emma nach und bekam für eine Sekunde ihren Arm zu fassen. Sie riss sich los und versuchte, ihm wieder zu entkommen. Doch ihr linker Fuß verkeilte sich unter einer Wurzel, und Emma verlor das Gleichgewicht. Einen Moment lang sah es so aus, als käme sie wieder auf die Beine, aber der Boden rings um ein großes Wasserloch war vom Schlamm glitschig, und sie fiel bis zur Hüfte hinein. Joakim lachte, und Emma schrie. Als sich Joakim wieder beruhigt hatte, ging er zu ihr. Aber Emma schrie noch lauter. Merkwürdig, dachte Joakim. So gefährlich war das doch nun auch wieder nicht. Das bisschen Wasser. Dann sah er den weißen, bleichen Körper, der direkt vor Emma aus dem Wasser ragte. Als hätte er dort unter der Oberfläche gelegen und seinem Opfer aufgelauert. Die Ausgelassenheit ihres Spiels war wie weggeblasen, Panik und Übelkeit packte die drei. Emma übergab sich, und Alice schluchzte. Joakim stand wie versteinert da und starrte auf das Bild, das ihn für den Rest seines Lebens verfolgen würde.
Haraldsson lag im Bett und döste. Jenny lag neben ihm, die Fußsohlen in die Matratze gestemmt und mit einem Kissen unter dem Po. Sie hatte die Angelegenheit nicht in die Länge ziehen wollen.
«Es ist besser, wir erledigen es gleich, dann schaffen wir noch einen Durchgang, bevor ich wieder zurückmuss», hatte sie gesagt.
Erledigen. Gab es ein unromantischeres Wort? Haraldsson bezweifelte das. Aber jetzt war es eben erledigt, und er schlummerte. Irgendwo hörte jemand Abba: «Ring Ring».
«Das ist dein Handy.» Jenny stupste ihn in die Seite. Haraldsson schreckte hoch in dem Bewusstsein, dass er sich eigentlich nicht im Bett an der Seite seiner Frau befinden durfte. Er riss seine Hose vom Boden und kramte das Handy aus der Tasche. Tatsächlich. Hanser. Er holte tief Luft und nahm das Gespräch an. Auch diesmal waren es nur sechs Wörter.
«Wo zum Teufel steckst du wieder?!»
Hanser knallte irritiert den Hörer auf. «Den Fuß verstaucht.» Zum Teufel. Sie hatte nicht übel Lust, zum Krankenhaus zu fahren, oder wenigstens eine Streife dorthin zu schicken, um die Lügen dieses Idioten zu entlarven. Aber sie hatte keine Zeit für so etwas. Von einem Moment auf den anderen war sie für die Aufklärung eines Mordes zuständig. Und es machte die Sache nicht gerade leichter für sie, dass der Leiter der Einsatztruppe rund um Listakärr nicht vor Ort gewesen war und sich obendrein dazu hatte breitschlagen lassen, minderjährige Pfadfinder an der Suchaktion zu beteiligen. Kinder, für die sie nun psychologische Hilfe organisieren musste, weil eines von ihnen in einen Tümpel gefallen war und beim Aufstehen eine Leiche an die Oberfläche befördert hatte.
Hanser schüttelte den Kopf. Bei dieser Vermisstenmeldung war alles schiefgelaufen. Einfach alles. Jetzt mussten die Fehler ein Ende haben. Von nun an mussten sie alles richtig machen. Professionell sein. Sie starrte das Telefon an. Ihr war ein Gedanke gekommen. Es wäre ein großer Schritt. Zu früh, würden viele denken. Eventuell würde es ihre Autorität schwächen. Aber sie hatte sich selbst vor langer Zeit geschworen, nicht vor unbequemen Entscheidungen zurückzuschrecken. Dafür stand zu viel auf dem Spiel.
Ein Junge war tot.
Ermordet.
Es war an der Zeit, mit den Besten zusammenzuarbeiten.
«Ein Gespräch für dich», sagte Vanja, als sie ihren Kopf durch Torkel Höglunds Tür steckte. Sein Büro war wie fast alles an Torkel: nüchtern und schlicht. Kein Schnickschnack, nichts Wertvolles, kaum etwas Persönliches. Mit den Möbeln, die Torkel aus irgendeinem Zentrallager beschafft hatte, vermittelte der Raum eher den Eindruck, als würde hier ein Realschulrektor in einer von Haushaltskürzungen betroffenen Kleinstadt arbeiten, nicht einer der ranghöchsten Polizeichefs in Schweden. Manche Kollegen fanden es merkwürdig, dass der Mann, der die Mordkommission der schwedischen Reichskriminalpolizei leitete, der Welt nicht zeigen wollte, wie weit er es gebracht hatte. Andere zogen den Schluss, dass ihm sein Erfolg einfach nicht zu Kopf gestiegen war. Die Wahrheit war schlichter und weniger ehrenhaft. Torkel hatte einfach keine Zeit. Sein Beruf verlangte ihm viel ab, und er war ständig auf Reisen. Außerdem hatte er keine Lust, seine spärliche Freizeit ausgerechnet mit der Einrichtung eines Büros zu verschwenden, in dem er sich nur selten aufhielt.
«Aus Västerås», ergänzte Vanja und nahm ihm gegenüber Platz. «Ein sechzehnjähriger Junge wurde ermordet.»
Torkel sah, dass Vanja es sich auf dem Stuhl bequem machte. Offenbar sollte er dieses Telefonat nicht allein führen. Torkel nickte und griff zum Hörer. Seit seiner zweiten Scheidung hatte er das Gefühl, dass für ihn eingehende Anrufe nur von schrecklichen, plötzlichen Todesfällen handelten. Es war mehr als drei Jahre her, dass sich zuletzt jemand erkundigt hatte, ob er rechtzeitig zum Essen zu Hause sein würde, oder irgendetwas anderes, erfrischend Banales von ihm wissen wollte.
Er kannte den Namen, Kerstin Hanser, Leiterin der Kripo Västerås. Er hatte sie vor vielen Jahren auf einer Fortbildung kennengelernt. Ein sympathischer Mensch und mit Sicherheit eine kompetente Chefin, war sein damaliger Eindruck gewesen, und er erinnerte sich daran, dass er sich gefreut hatte, als er von ihrer Beförderung gelesen hatte. Jetzt klang ihre Stimme gepresst und angestrengt.
«Ich brauche Hilfe und habe beschlossen, die Reichsmordkommission anzufordern, und am liebsten wäre es mir, wenn du kommen könntest», hörte er sie sagen.
«Glaubst du, das wäre möglich?», fuhr sie beinahe flehend fort.
Einen kurzen Moment lang überlegte Torkel, ob er sich eine Ausrede einfallen lassen sollte. Er und sein Team waren gerade von einem äußerst unangenehmen Fall in Linköping zurückgekehrt. Aber er wusste, dass Kerstin Hanser nur dann anrief, wenn sie dringend Hilfe benötigte.
«Wir lagen von Anfang an falsch, und es besteht das Risiko, dass wir den Karren nun völlig gegen die Wand fahren. Ich brauche wirklich deine Unterstützung!», fügte sie hinzu, als hätte sie seine Zweifel hören können.
«Worum geht es?»
«Ein Sechzehnjähriger. Eine Woche lang vermisst. Tot aufgefunden. Ermordet. Brutal.»
«Schick mir alle Unterlagen per Mail zu, ich sehe mir den Fall an», antwortete Torkel und beobachtete Vanja, die inzwischen aufgestanden war und den Hörer des anderen Telefons abgehoben hatte.
«Billy, komm mal in Torkels Büro. Wir haben zu tun», sagte sie und legte wieder auf. Als hätte sie Torkels Antwort bereits gekannt. Das schien sie immer zu tun, und es machte Torkel einerseits stolz, andererseits ärgerte es ihn auch ein bisschen. Vanja Lithner war seine engste Verbündete im Team. Obwohl sie gerade erst dreißig geworden war, hatte Vanja sich in den vergangenen zwei Jahren, die sie mit ihm zusammengearbeitet hatte, in eine professionelle Polizistin verwandelt, und in Torkels Augen war es fast schon irritierend, wie gut sie war. Ein so guter Polizist wäre er selbst gern mit Anfang dreißig gewesen. Er lächelte sie an, nachdem er das Gespräch mit Kerstin Hanser beendet hatte.
«Noch bin ich hier der Chef», stellte er klar.
«Ich weiß, ich rufe doch nur das Team zusammen, damit du unsere Einschätzung des Falls hören kannst. Anschließend triffst wie immer du die Entscheidungen», entgegnete sie mit einem Augenzwinkern.
«Als ob ich eine Wahl hätte, wenn du dich erst mal in etwas verbissen hast», antwortete er und stand auf. «Dann müssen wir uns wohl ans Packen machen. Wir fahren nach Västerås.»
Billy Rosén fuhr routiniert die E18 entlang, wie immer zu schnell. Torkel hatte es schon lange aufgegeben, etwas zu sagen. Stattdessen konzentrierte er sich auf die Unterlagen zum Mordfall, die sie inzwischen erhalten hatten. Der Bericht war ziemlich dürftig, und der leitende Ermittler, Thomas Haraldsson, schien nicht gerade übereifrig zu sein. Wahrscheinlich würden sie ganz von vorn anfangen müssen. Torkel wusste, dass dies einer von jenen Fällen war, auf die sich die Boulevardpresse mit Vorliebe stürzte. Dass die vorläufig am Tatort festgestellte Todesursache auf eine extreme Gewalteskalation mit unzähligen Messerstichen in Herz und Lunge hindeutete, machte die Sache dabei nicht besser. Doch das war es nicht, was Torkel am meisten beunruhigte. Es war der kurze letzte Satz des Berichts, den der Arzt noch am Fundort der Leiche verfasst hatte:
«Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass das Herz des Toten zu großen Teilen fehlt.»
Torkel blickte durch das Fenster auf die Bäume, die draußen vorbeirauschten. Jemand hatte das Herz entnommen. Torkel hoffte, dass der Junge weder Heavy Metal gehört hatte, noch leidenschaftlicher World-of-Warcraft-Spieler gewesen war. Denn sonst würde die Presse mal wieder mit den aberwitzigsten Spekulationen aufwarten.
Vanja sah von ihren Unterlagen auf. Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte sie gerade denselben Satz gelesen.
«Vielleicht wäre es eine gute Idee, Ursula auch gleich hinzuzuziehen», sagte sie. Wie immer hatte sie seine Gedanken gelesen. Torkel nickte kurz. Billy warf einen kurzen Blick nach hinten.
«Haben wir eine Adresse?»
Torkel reichte sie ihm, und Billy tippte sie behände in das Navigationsgerät ein. Es gefiel Torkel nicht, dass Billy sich beim Fahren mit anderen Dingen beschäftigte, aber immerhin drosselte er dabei das Tempo ein wenig.
«Noch eine halbe Stunde.» Billy drückte das Gaspedal erneut durch, und der große Van reagierte sofort. «Vielleicht schaffen wir es auch in zwanzig Minuten, je nach Verkehrslage.»
«Eine halbe Stunde ist völlig in Ordnung. Ich finde es immer so unangenehm, wenn wir die Schallmauer durchbrechen.»
Billy wusste genau, was Torkel von seiner Fahrweise hielt, aber er lachte nur über seinen Chef, den er im Rückspiegel sah. Gute Straße, gutes Auto, guter Fahrer, warum sollte man das nicht maximal ausnutzen?
Billy gab noch mehr Gas.
Torkel holte sein Handy hervor und wählte Ursulas Nummer.
Der Zug verließ den Stockholmer Hauptbahnhof um 16:07 Uhr. Sebastian setzte sich in die erste Klasse. Er lehnte sich zurück und schloss die Augen, als sie aus der Stadt rollten.
Früher hatte er in Zügen nie wach bleiben können. Jetzt fand er keine Ruhe, obwohl er spürte, wie dringend sein Körper eine Stunde Schlaf brauchte.
Also holte er den Brief vom Bestattungsinstitut hervor, öffnete ihn und begann zu lesen. Er wusste bereits, was darin stand. Eine ehemalige Kollegin seiner Mutter hatte ihn angerufen und ihm mitgeteilt, dass sie gestorben sei. Still und würdevoll, sagte sie. Still und würdevoll – das Leben seiner Mutter auf den Punkt gebracht. Diese Beschreibung hatte nichts Positives, jedenfalls nicht, wenn man Sebastian Bergman hieß. Nein, für ihn war das Leben von der ersten bis zur letzten Stunde ein Kampf. Die Stillen und Würdevollen hatten bei ihm keinen Platz. Die Sterbenslangweiligen, so nannte er sie. Jene Menschen, die immer mit einem Bein im Grab standen. Doch ganz so überzeugt wie früher war er nicht mehr. Wie hätte sein Leben sich wohl entwickelt, wenn er still und würdevoll gelebt hätte?
Vermutlich besser. Weniger schmerzvoll.
Das versuchte zumindest Stefan Hammarström, Sebastians Therapeut, ihm einzureden. Bei einer der letzten Sitzungen hatten sie genau darüber diskutiert, nachdem Sebastian ihm vom Tod seiner Mutter erzählt hatte.
«Wie gefährlich ist es denn, so zu sein wie andere?», hatte Stefan gefragt, als Sebastian ihm klargemacht hatte, was er von «still und würdevoll» hielt.
«Lebensgefährlich!», hatte Sebastian geantwortet. «Anscheinend sogar tödlich.»
Anschließend hatten sie fast eine ganze Stunde damit zugebracht, die genetische Veranlagung des Menschen in seinem Verhältnis zur Gefahr zu diskutieren. Eines von Sebastians Lieblingsthemen.
Er hatte gelernt, wie wichtig die Gefahr als Triebkraft sein konnte, teils aus eigener Erfahrung, teils durch seine Forschungen über Serienmörder. Jetzt erklärte er seinem Therapeuten, dass ein Serienmörder nur von zwei Dingen wahrhaftig getrieben werde: der Phantasie und der Gefahr. Die Phantasie sei der schnurrende Motor, immer zugegen, wenn auch im Leerlauf.
Die meisten Menschen hatten Phantasien. Sexuelle, dunkle, brutale, in denen ständig das eigene Ego bestärkt wurde und mitunter Dinge oder Menschen vernichtet wurden, die im Weg standen. In der Phantasie war man übermächtig, doch nur die wenigsten lebten ihre Phantasien aus. Wer es tat, hatte den Schlüssel gefunden:
Die Gefahr.
Die Gefahr, entdeckt zu werden.
Die Gefahr dabei, das Unaussprechliche zu tun.
Das Adrenalin und Endorphin, das dabei freigesetzt wurde, war der Turboantrieb, der Brennstoff, das, was verpuffte und den Motor dazu brachte, auf Hochtouren zu laufen. Aus diesem Grund suchten manche Menschen immer neue Kicks, und Mörder wurden zu Serienmördern. Es war schwer, wieder in den Leerlauf zurückzufallen, wenn man den Motor einmal hochgejagt hatte. Die Kraft gespürt und entdeckt hatte, was einen zum Leben erweckte. Die Gefahr.
«Meinst du denn wirklich Gefahr, nicht eher den Nervenkitzel?» Stefan beugte sich vor, nachdem Sebastian verstummt war.
«Sind wir hier im Schwedischunterricht?»
«Du hast doch gerade einen Vortrag gehalten.» Stefan nahm die Karaffe vom Tisch neben sich, schenkte ein Glas Wasser ein und reichte es Sebastian. «Wirst du nicht eigentlich dafür bezahlt, Vorträge zu halten, anstatt nun selbst dafür zu bezahlen, welche halten zu dürfen?»
«Ich bezahle dich dafür, dass du mir zuhörst. Egal, was ich sage.»
Stefan lachte und schüttelte den Kopf.
«Nein, du weißt genau, wofür du mich bezahlst. Du brauchst Hilfe, und durch diese kleinen Exkurse haben wir weniger Zeit, über die Dinge zu sprechen, die wir wirklich behandeln sollten.»
Sebastian erwiderte nichts und verzog keine Miene. Er mochte Stefan, er gab keinen Mist von sich.
«Wenn wir also nochmal auf deine Mutter zurückkommen könnten: Wann findet die Beerdigung statt?»
«Hat schon stattgefunden.»
«Und, warst du da?»
«Nein.»
«Warum nicht?»
«Weil ich der Meinung war, dass die Zeremonie den Leuten vorbehalten sein sollte, die sie wirklich mochten.»
Stefan betrachtete ihn einen Moment lang schweigend.
«Wie du siehst, haben wir noch eine Menge zu bereden.»