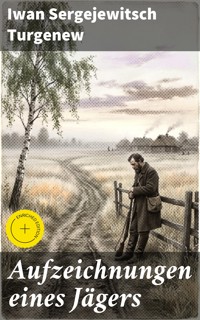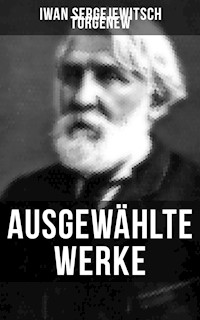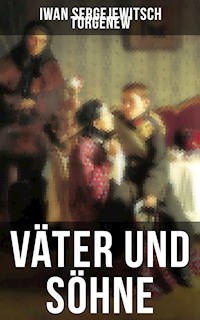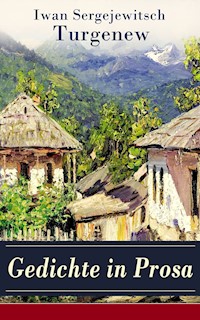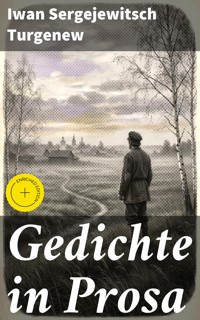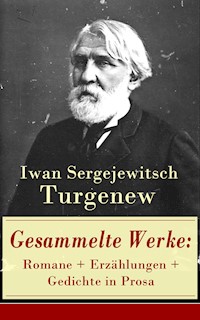Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Klassiker der Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Iwan Sergejewitsch Turgenew war einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller. Als einer der ersten griff er in der russischen Literatur die alltäglichen Nöte und Ängste der russischen Gesellschaft auf und thematisierte sie. Sein Werk "Der Mann mit der grauen Brille" zählt zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 45
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Mann mit der grauen Brille
Iwan Sergejewitsch Turgenew
Über den Autoren
Iwan Sergejewitsch Turgenew war einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller. Als einer der ersten griff er in der russischen Literatur die alltäglichen Nöte und Ängste der russischen Gesellschaft auf und thematisierte sie.
Inhalt
Den ganzen Winter von 1847 bis 1848 lebte ich in Paris. — Meine Wohnung lag in der Nähe des Palais-Royal, und ich ging fast jeden Tag dorthin, um Kaffee zu trinken und die Zeitung zu lesen. — Damals war der Palais-Royal noch nicht der verlassene Ort, der er heute ist, obwohl seine glorreichen Tage schon lange vorbei sind, den lauten und eigentümliche Ruhm, den unseren Veteranen von 1814 und 1815, wenn sie zum ersten Mal einen aus Paris zurückkehrenden Mann trafen, die unveränderliche Frage in den Mund legte: »Was macht Väterchen Palais-Royal?« — Eines Tages — es war Anfang Februar 1848 — saß ich an einem der Tische, die draußen unter unter einer Markise des Café de la Rotonde aufgestellt waren.
— Ein großer, grau-schwarzhaariger, drahtiger und hagerer Mann mit rostiger Eisenbrille und grauen Rauchgläsern auf der Adlernase kam aus der Kaffeestube, schaute sich um — und kam, wohl in der Überzeugung, dass alle Plätze unter der Markise besetzt waren, auf mich zu und bat, an meinem Tisch Platz nehmen zu dürfen. — Ich habe natürlich ja gesagt. — Der Mann mit der grauen Brille setzte sich nicht, sondern ließ sich auf einen Stuhl fallen, schob seinen alten Hut zurück, stützte sich mit den mageren Armen auf einen krummen Stock, verlangte eine Tasse Kaffee und lehnte die Zeitung, die ihm gereicht wurde, mit einem verächtlichen Schulterzucken ab. Wir wechselten ein paar unbedeutende Worte; — ich erinnere mich, dass er zweimal zu sich selbst sagte: »Was für eine verfluchte . . . verfluchte Zeit! — Er trank eilig seine Tasse aus und ging bald wieder, aber er hinterließ einen bleibenden Eindruck.
— Er war zweifellos ein Franzose aus Südfrankreich, ein Provenzale oder ein Gascogner; sein braungebranntes, faltiges Gesicht, seine eingefallenen Wangen, sein zahnloser Mund, seine gedämpfte Stimme und seine Kleidung, die abgenutzt und beschmutzt war, als wäre sie nicht für ihn gemacht, sprachen für ein rastloses, wanderndes Leben.
»Der alte, gebrochene, geschlagene Mann«, dachte ich bei mir, »er ist nicht nur jetzt in dem elenden Zustand; er hat wahrscheinlich sein ganzes Leben in einer verkrampften und untergeordneten Position verbracht; wo ist dieses unwillkürliche oder bewusste Gefühl der Überlegenheit in seinem Ausdruck, in jeder Bewegung, in seinem Gang, der schlurfend und nachlässig ist? — Die Armen — die Demütigen — gehen nicht so. — Mir fielen vor allem seine dunkelbraunen Augen mit dem gelblichen Weiß auf; öffnete er sie weit und richtete seinen starren und stumpfen Blick geradeaus, jetzt kräuselte er sie seltsam, hob die gekräuselten Augenbrauen und schaute seitwärts durch seine Brille . . . ein böser Spott entbrannte dann in allen Zügen seines Gesichts. An jenem Tag dachte ich jedoch kaum an ihn, denn die bevorstehenden Reformbankette beunruhigten ganz Paris, und ich begann, die Zeitungen zu lesen.
Am nächsten Tag ging ich wieder zum Kaffee ins Palais-Royal, und ich traf den Herrn vom Vortag wieder. Er begrüßte mich, als wäre ich ein Bekannter. Mit einem leichten Lächeln und ohne um Erlaubnis zu fragen — er wusste sicher, dass das Wiedersehen mir angenehm war, — setzte er sich an meinen Tisch, obwohl keiner der anderen Tische besetzt war — und kam mit mir sofort ins Gespräch, ohne die geringste Aufregung oder Verlegenheit.
Ein paar Augenblicke vergingen . . .
— Sind Sie ein Ausländer? Russe? — fragte er plötzlich und bewegte langsam den Löffel in seiner Kaffeetasse.
— Dass ich ein Ausländer bin, konnten Sie an meinem Akzent erkennen; aber warum haben Sie mich als Russen erkannt?
— Warum? Sie haben gerade gesagt: »pardon« — so, mit einer Dehnung: »pa-ardon«. Manche Russen dehnen die Worte so aus. Außerdem wusste ich bereits, dass Sie Russe sind.
Ich wollte um eine Erklärung bitten . . . Aber er begann aufs neue:
— Sie haben gut daran getan, jetzt hierher zu kommen. Es ist eine seltsame Zeit für einen Touristen. Sie werden sehen . . . de grandes choses.
— Was werde ich sehen?
— Dies. Es ist Anfang Februar, und in einem Monat wird Frankreich eine Republik sein.
— Eine Republik?
— Ja. Aber freue Sie sich nicht zu früh . . . wenn es Sie erfreut. Bis zum Ende des Jahres werden die Bonapartes (er drückte sich sehr viel deutlicher aus) über das selbige Frankreich verfügen.
Als er die Nähe der Republik erwähnte, glaubte ich ihm natürlich kein Wort und dachte nur: »Da will mich der Mann überraschen: gut, dass ich in seinen Augen ein unerfahrener Skythe bin . . . »Aber Bonaparte, warum Bonaparte? Damals, unter Louis-Philippe, dachte niemand an die Bonapartes, jedenfalls sprach niemand von ihnen. Bin ich einem Scherzbold begegnet? Oder einer dieser Gauner, die sich in Cafés und Gasthäusern herumtreiben, um Ausländer auszuhorchen, und am Ende meist Geld leihen? Aber nein, das ist nicht seine Art . . . Außerdem, diese unverschämte Leichtigkeit in der Behandlung, dieser gleichgültige Ton, mit dem er seine Paradoxien aussprach . . .
— Glauben Sie, dass der König einer Reform nicht zustimmen wird? — fragte ich nach einem kurzen Schweigen. — Die Forderungen der Opposition scheinen nicht groß zu sein . . .