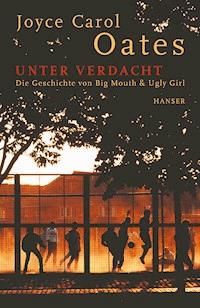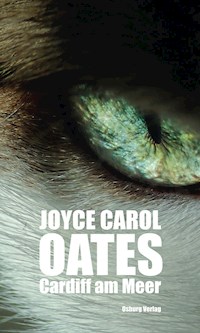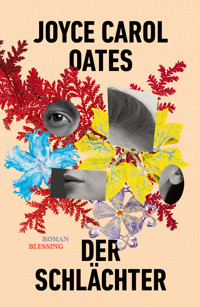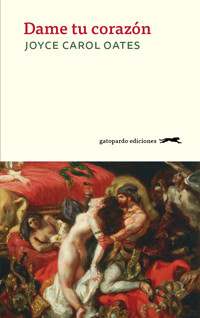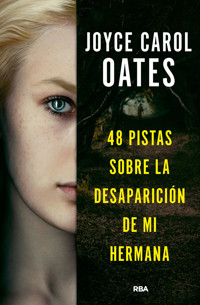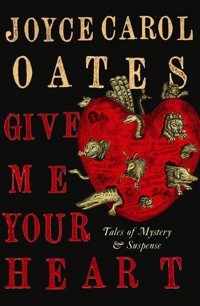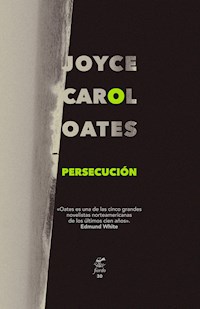19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Mann ohne Schatten - Ein eindringlicher Roman über Liebe, Erinnerung und die Frage, was uns ausmacht Die junge Neurowissenschaftlerin Margot lernt 1965 an der Universität von Darven Park den faszinierenden Patienten Eli kennen, der an einem schweren Gedächtnisverlust leidet. Er kann sich nur an Dinge erinnern, die nicht länger als siebzig Sekunden zurückliegen. Margot beginnt, Elis einzigartiges Erinnerungsvermögen mit einer Reihe von Tests zu untersuchen und kommt dem ungewöhnlichen Mann im Laufe der Zeit erstaunlich nahe - eine scheinbar unmögliche Beziehung, denn er vergisst immer wieder, wer sie ist. In Der Mann ohne Schatten ergründet die meisterhafte Erzählerin Joyce Carol Oates, was unsere Identität und unsere Verbindungen ausmacht. Ein zutiefst bewegender Roman über die Macht der Liebe angesichts von Vergessen und Einsamkeit, brillant und feinsinnig erzählt. Eine ergreifende Lektüre, die noch lange nachwirkt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Joyce Carol Oates
Der Mann ohne Schatten
Roman
Über dieses Buch
Für ihn ist immer alles Gegenwart: 1965 lernt die junge Neurowissenschaftlerin Margot an der Universität von Darven Park den charismatischen Patienten Eli kennen. Er leidet an Gedächtnisverlust und kann sich nur an Dinge erinnern, die nicht länger als 70 Sekunden zurückliegen. Margot beginnt, Elis Erinnerungsvermögen mit einer Reihe von Tests zu untersuchen, und kommt dem ungewöhnlichen Mann im Laufe der Zeit erstaunlich nahe. Eine unmögliche Beziehung, denn er vergisst immer wieder, wer sie ist. Joyce Carol Oates hat einen Roman über Liebe und Erinnerung, über Einsamkeit und imaginierte Nähe geschrieben – luzide, feinsinnig, funkelnd.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Joyce Carol Oates, geboren 1938 in Lockport (New York), ist eine der Titaninnen der amerikanischen Literatur. Sie lebt mit ihrem Mann, einem Neurowissenschaftler, in Princeton. Für ihren Roman »Der Mann ohne Schatten« hat sie Fallgeschichten von Patienten mit Gedächtnisverlust studiert, unter anderem die von Henry Gustav Molaison, dem berühmtesten Amnesiepatienten der Welt.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Danksagung
Für meinen Mann Charlie Gross,
meinen ersten Leser
Der Schrecken ist nicht die Auslöschung.
Der Schrecken ist der Weg dahin.
Elihu Hoopes
Kapitel eins
Anmerkungen zur Amnesie. Projekt »E.H.« (1965–1996)
Sie lernt ihn kennen, sie verliebt sich. Er vergisst sie.
Sie lernt ihn kennen, sie verliebt sich. Er vergisst sie.
Sie lernt ihn kennen, sie verliebt sich. Er vergisst sie.
Schließlich nimmt sie Abschied von ihm, einunddreißig Jahre nach ihrer ersten Begegnung. Auf seinem Sterbebett hat er sie vergessen.
Er steht auf einer Holzbrücke in einer Sumpfniederung, die Beine leicht gespreizt, und stemmt die Fersen in den Boden, wappnet sich gegen den plötzlichen Windstoß.
Er steht auf einer Holzbrücke an einem ihm unbekannten Ort, der wunderschön ist. Er weiß, dass er sich wappnen muss, klammert sich mit beiden Händen fest ans Geländer.
Hier an dem ihm unbekannten Ort, der wunderschön ist, und trotzdem die Angst, dass er, wenn er sich umdreht, in dem seichten Bach unter der Brücke hinter sich das ertrunkene Mädchen sieht.
… nackt, ungefähr elf Jahre alt, ein Kind. Die Augen offen und blicklos, im Wasser schimmernd. Leicht bewegtem Wasser, unter dem das Gesicht des Mädchens zu erschauern scheint. Ein dünner weißer Leib, zitternde lange weiße Beine und bloße Füße. Sonnenkleckse, Wasserläufer, ihre Schatten auf dem Gesicht des Mädchens vergrößert.
Sie wird sich niemandem anvertrauen: »Auf seinem Sterbebett hat er mich nicht erkannt.«
Sie wird sich niemandem anvertrauen: »Auf seinem Sterbebett hat er mich zwar nicht erkannt, aber so lebhaft mit mir gesprochen wie eh und je, als sei ich diejenige, die ihm Hoffnung gibt. – »Hal-lo?«
Mutig wird sie es vor der Öffentlichkeit bekennen – Er ist mein Leben. Ohne E.H. hätte mein Leben keinen Sinn.
Alles, was ich als Wissenschaftlerin erreicht habe, und der Grund, weswegen Sie mich heute Abend eingeladen haben und mich ehren, verdanke ich E.H.
Das ist die Wahrheit, frei heraus bekannt als Wissenschaftlerin und als Frau.
Sie spricht voller Leidenschaft und doch stockend. Sie muss immer wieder tief Luft holen, liest nicht mehr von ihrem vorbereiteten Redemanuskript ab, sondern blickt mit feuchten Augen ins Publikum. Von Lichtern geblendet, verwirrt und blinzelnd, kann sie keine einzelnen Gesichter mehr ausmachen und glaubt vielleicht, sein Gesicht befände sich darunter.
In seinem Namen nehme ich diese große Ehre an. Im Gedenken an Elihu Hoopes.
Zur großen Erleichterung der Zuhörer ist die Rede der diesjährigen Empfängerin des von der Amerikanischen Gesellschaft für Psychologie verliehenen Preises für ein Lebenswerk zu Ende. Gleich erhebt sich hier und da in dem großen Amphitheater Applaus wie kleine Fähnchen in einem schwachen launischen Wind. Und dann, die Preisträgerin kehrt sich unsicher und verwirrt schon vom Podium ab, brandet der Applaus in spätem Mitgefühl doch noch auf und wird zu einer Welle, laut, donnernd.
Sie ist erschrocken. Ist für einen Moment beinahe erschrocken.
Machen die sich über sie lustig? Wissen sie – Bescheid?
Sie tritt blicklos vom Podium zur Seite und stolpert. Sie hat die schwere und unhandliche vierzig Zentimeter große Trophäe, eine Pyramide aus Kristall, in die ihr Name eingraviert ist, stehen gelassen. Rasch eilt ein junger Mensch ihr mit der Trophäe nach und stützt sie.
»Professor Sharpe! Vorsicht, Stufe.«
»Hal-lo!«
Die erste Überraschung: Elihu Hoopes begrüßt Margot Sharpe so lebhaft und herzlich, als kenne er sie seit Jahren. Als bestünde eine tiefe emotionale Bindung zwischen ihnen.
Die zweite Überraschung: Elihu Hoopes selbst, der in keiner Weise dem entspricht, was Margot Sharpe erwartet hat.
Es ist 9.07, der 17. Oktober 1965: der alles entscheidende Moment in ihrem Leben, der sich als der alles entscheidende Moment in ihrer Karriere erweist.
Rein zufällig ist es der Tag vor Margot Sharpes vierundzwanzigstem Geburtstag – was hier in Darven Park, Pennsylvania, niemand weiß, denn sie hat die Wurzeln ihres Lebens aus dem mittleren Westen herausgerissen und hierher verpflanzt, unter Fremde –, als Professor Milton Ferris sie dem Amnesiekranken Elihu Hoopes als Studentin seinem neuropsychologischen Labor an der Universität vorstellt. Margot ist der jüngste und neueste Zuwachs in dem berühmten Gedächtnislabor; in ihrem ersten Jahr als Doktorandin hat Ferris aus zahlreichen Bewerbern sie ausgewählt, und ihr Mund ist trocken vor Vorfreude. Schon seit Wochen liest sie zum Projekt E.H. gehöriges Material.
Der Kranke ist jedoch so freundlich und höflich, dass Margot sofort beruhigt ist.
Der Mann ist unerwartet groß – einsfünfundachtzig mindestens. Er ist kräftig, hält sich gerade. Seine Haut hat einen warmen Schimmer, und seine Augen sehen normal aus, aber Margot weiß, dass er mit dem linken Auge nur schlecht sieht. Er wirkt längst nicht so beeinträchtigt, wie Margot erwartet hat, nicht wie ein Mensch, der eine Reihe elementarer körperlicher Fähigkeiten neu erlernen musste nach der schweren Erkrankung seines Gehirns, die er vor gerade mal fünfzehn Monaten, mit siebenunddreißig, durchgemacht hat.
Margot findet, E.H. strahle männliches Charisma aus – die geheimnisvolle Eigenschaft, auf die wir instinktiv reagieren, ohne es erklären zu können. Er ist gut gekleidet, im College-Stil, trägt eine saubere helle Baumwollhose, ein langärmeliges Leinenhemd, ochsenblutfarbene Mokassin und gemusterte Baumwollsocken – ein Kontrast zu anderen Patienten am Institut, die Margot flüchtig zu sehen bekam und die in Krankenhauskitteln oder zerknitterter Zivilkleidung herumlümmelten. Man hat ihr gesagt, E.H. stamme aus einer alteingesessenen, angesehenen Familie aus Philadelphia, den Hoopes, einstigen Quäkern, die in den Jahren vor dem amerikanischen Bürgerkrieg eine wichtige Rolle bei der Untergrund-Eisenbahn spielten. Er hat hier eine große, weitverzweigte Familie, selbst aber weder Frau noch Kinder oder Eltern.
Elihu Hoopes ist so was wie ein Künstler, hat Margot erfahren. Er besitzt Zeichenmappen und führt ein Tagebuch. In seinem früheren Leben war er Partner einer in Familienbesitz befindlichen Investmentfirma in Philadelphia, davor aber hat er am Union Theological Seminary studiert, war Bürgerrechtsaktivist und hat Bürgerrechtler unterstützt. Ist es ungewöhnlich, dass Elihu Hoopes mit fast vierzig noch ledig ist? Vielleicht, überlegt Margot, hatte dieser aristokratisch wirkende Mann mehrere Beziehungen zu Frauen, die er aber hinhielt und schließlich abwies – ohne zu ahnen, dass seine Zeit für Liebe, Ehe und die Gründung einer Familie jäh zu Ende gehen würde.
Während er allein auf einer Insel im Lake George, New York, zeltete, infizierte er sich mit einer besonders virulenten Form der Herpes-simplex-Enzephalitis, die sich in der Regel als Fieberbläschen auf einer Lippe manifestiert und innerhalb weniger Tage wieder vergeht; in seinem Fall wanderte die Virusinfektion durch den Sehnerv bis ins Gehirn, wo sie ein protahiertes hohes Fieber auslöste, das sein Erinnerungsvermögen schädigte.
Leider ließ E.H. zu viel Zeit verstreichen, bevor er Hilfe suchte. Wie ein krankhaft neugieriger Wissenschaftler hielt er sein Fieber mit Bleistift in einem Tagebuch fest – der höchste aufgezeichnete Wert war 39,5 °C –, bevor er zusammenbrach.
Das war paradox: eine machohafte Selbstzerstörung. Wie bei dem vorzeitigen Tod des Malers George Bellows, der gezögert hatte, das Atelier zu verlassen und Hilfe zu suchen, obwohl er eine Blinddarmentzündung hatte.
In dem weitläufigen Gebiet der Adirondacks gab es keine erstklassigen Krankenhäuser und keine angemessene medizinische Behandlung für eine so seltene und verheerende Infektion. Als der bereits phantasierende und krampfende Mann mit einem Krankenwagen ins Albany Medical Hospital gebracht worden war, wo man durch eine Notoperation die Schwellung seines Gehirns zu verringern versuchte, war es bereits zu spät. Irgendetwas Gravierendes in seinem Gehirn war zerstört worden, und die Schädigung ist offenbar irreversibel. Milton Ferris vermutet, dass es sich bei der zerstörten Region um die Struktur direkt oberhalb des Hirnstamms handelt, die wie ein Seepferdchen aussieht und an der die Hirnrinde anliegt, um den Hippocampus, über den man noch wenig weiß, der jedoch für die Verfestigung und Bewahrung von Gedächtnisinhalten entscheidend ist. E.H. kann daher keine neuen Erinnerungen ausbilden, und seine Erinnerungen an Vergangenes sind bruchstückhaft und unbestimmt; klinisch ausgedrückt leidet E.H. an einer partiellen retrograden und einer totalen anterograden Amnesie. Trotz der hohen Werte, die bei standardisierten Intelligenztests nach wie vor bei ihm gemessen werden, und trotz scheinbarer Normalität im Äußeren und im Verhalten, kann er neue Informationen maximal siebzig Sekunden im Gedächtnis behalten, und oftmals nicht einmal so lange.
Siebzig Sekunden! Ein Albtraum.
E.H. ist jedoch ein sehr angenehmer Mensch, der einzige Trost, denkt Margot, und blüht auf, wenn andere sich ihm zuwenden. Zumindest schließt die Art seiner Erkrankung seelische Schmerzen aus, glaubt Margot jedenfalls. Seine Erinnerungen an weit Zurückliegendes sind manchmal voller anschaulicher Details, wie es bei Träumen der Fall ist; die Erinnerungen an weniger weit zurückliegende Ereignisse (bis etwa anderthalb Jahre vor seiner Erkrankung) hingegen sind diffus und unscharf; beide sind als »schwach dissoziativ« beschrieben worden – so als gehörten sie zu einer anderen Person, nicht zu E.H. Der Proband ist anfällig für Stimmungen, allerdings in eng begrenzter Schwankungsbreite; seine Affekte sind abgeflacht, wie eine Karikatur ein abgeflachtes Porträt der Vielschichtigkeit einer Persönlichkeit ist.
Verblüffenderweise schildert E.H. Ereignisse aus seiner Vergangenheit immer auf gleiche Weise mit demselben Vokabular, ist sich aber nie ganz sicher, ob das, was er sagt, wirklich stimmt, auch wenn externe Prüfung ihn bestätigt.
Obwohl er sich nicht konstant an bestimmte Verwandte erinnert, deren Gesichter sich mit der Zeit ändern, kann er berühmte Personen auf Fotografien identifizieren, wenn sie vor seiner Erkrankung gewirkt haben. Zuweilen lässt er ein bemerkenswertes, an Inselbegabung gemahnendes Gedächtnis erkennen und trägt Statistiken vor, historische Daten, Songtexte, Comic-Charaktere und Filmdialoge (angeblich hat er den gesamten Stummfilm Potjomkin auswendig gelernt), rezitiert Passagen aus Gedichten, die er in der Schule gelernt hat, etwa Whitmans »Als jüngst der Flieder blühte vor dem Haus«, sein Lieblingsgedicht, aus berühmten amerikanischen Reden (Abraham Lincolns Gettysburg Address oder Franklin Delano Roosevelts Es gibt nur eines, was wir fürchten müssen – die Furcht selbst und seine Vier Freiheiten oder Martin Luther Kings Ich habe einen Traum). Er hat sich das Interesse am aktuellen Tagesgeschehen bewahrt, verfolgt im Fernsehen die Nachrichten, liest täglich mindestens zwei Tageszeitungen, darunter die New York Times und den Philadelphia Inquirer – ohne irgendetwas davon im Gedächtnis zu behalten. Er löst nun täglich das vollständige Kreuzworträtsel in der New York Times, wozu er sich (wie von seiner Familie bestätigt) vor seiner Erkrankung nur selten Zeit genommen hat. (»Eli hatte einfach nicht die Zeit dafür.«)
Ohne überlegen zu müssen, so scheint es, sagt er das Einmaleins auf, löst Probleme der Algebra, ohne einen Bleistift in die Hand zu nehmen, addiert lange Zahlenkolonnen. Es ist keine Überraschung, zu hören, dass Elihu Hoopes in einer stark umkämpften Branche sehr erfolgreich war.
Margot findet es schwierig, für den kerngesund wirkenden Mann dasselbe Mitgefühl aufzubringen, das man für erkennbar Behinderte empfindet, denn sein Verlust ist wesentlich heikler. Und obwohl ihm mehrmals gesagt wurde, dass er an einem schweren neurologischen Ausfall leidet, scheint E.H. in der Tat nicht recht zu begreifen, dass etwas Wichtiges bei ihm nicht in Ordnung ist – und verspürt deshalb den Drang, Tagebuch zu führen, womit er nach seiner Erkrankung begonnen hat.
Margot Sharpe macht sich inzwischen ebenfalls Aufzeichnungen. Das wird ein quasi privates Dokument, in erster Linie wissenschaftlich orientiert, teils aber auch Protokoll und Tagebuch, angeregt durch ihre Mitarbeit in Milton Ferris’ Gedächtnislabor; in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn wird sie für ihre wissenschaftlichen Artikel und Publikationen auf das Material in diesem Tagebuch oder vielmehr diesen Tagebüchern zurückgreifen. Die »Anmerkungen zur Amnesie. Projekt E.H.« werden viele Hefte füllen und schließlich in eine Computerdatei übertragen werden, die bis zu E.H.s Tod (am 26. November 1996) und darüber hinaus fortgeführt wird und verzeichnet, wie es mit dem posthumen Gehirn des Amnesiekranken weitergeht, nachdem man es – mit größter Sorgfalt – seinem Schädel entnommen hat.
Doch an diesem Morgen im Oktober 1965 im Neurologischen Institut der Universität in Darven Park, Pennsylvania, liegt Margot Sharpes ganzes Leben als Wissenschaftlerin noch vor ihr. E.H. vorgestellt, bekommt sie einen trockenen Mund und zittert wie jemand, der an den Rand eines Abgrunds geführt wurde und etwas vor sich sieht, das ihn blendet.
Fängt jetzt für mich endlich das Leben an? Das wahre Leben?
In der Wissenschaft gilt es als ausgemacht, dass es Bedeutsames gibt und Triviales.
Genauso verhält es sich beim Leben des Einzelnen.
Denn Tatsache ist, wenngleich nicht allgemein anerkannt: Wir haben als Individuen ein Leben, das ein wahres Leben ist, und wir haben ein anderes Leben, das ein zufälliges Leben ist.
Dass es auf das Alter nicht ankommt, wann jemand sein wahres Leben findet, mag in seltenen Fällen sein. Vielleicht verbringen die meisten Menschen ihr ganzes Leben so, wie es sich zufällig ergibt. Im Hinblick auf die Folgen für das, was Gesellschaft oder Nachwelt genannt wird, ist das zufällige Leben wohl kaum mehr als eine Addition von Nullen.
Damit soll nicht gesagt sein, dass ein zufälliges Leben gleichbedeutend ist mit einem trivialen. Ein solches Leben kann erfreulich und erfüllend sein: Wir alle wollen lieben und geliebt werden, und in unserer Familie und im kleinen Kreis von Freunden fühlen wir uns auch geschätzt und daher wichtig. Aber so ein Leben vergeht, ohne dass die weitere Welt davon berührt wird. Es löst nur selten eine Welle aus, es wirft keinen Schatten. Vom bloß Zufälligen bleibt nichts im Gedächtnis.
Margot Sharpe kommt aus einer Familie der zufälligen Leben. Einer Familie aus dem halbländlichen, im mittleren Norden gelegenen Oujibway County in Michigan, einer Region des zufälligen Lebens. Sie hatte sich jedoch schon als Kind von zwölf Jahren vorgenommen, nicht so planlos zu leben wie die Menschen um sie herum und ihr wahres Leben dadurch zu suchen, dass sie ihre Heimatstadt Orion Falls und ihre Familie verließ, sobald das möglich war.
In Orion Falls gehen junge Leute vielleicht weg und verpflichten sich bei den Streitkräften oder schreiben sich an einer Fakultät der staatlichen Universität oder einer Schwesternschule und so weiter ein, aber sie kehren alle zurück. Margot Sharpe weiß, dass sie nicht zurückkehren wird.
Margot ist seit jeher wissbegierig, hat viele Fragen gestellt. Ihr erstes Lieblingsbuch war das illustrierte Darwin für Anfänger, das sie mit elf im Regal einer Bücherei entdeckte. Das war ein Buch mit einer Geschichte, die sie in den Bann zog – Evolution. Ein anderes Lieblingsbuch aus ihrer Kindheit war Marie Curie. Eine Frau in der Physik. In der Highschool-Zeit stieß sie zufällig auf einen Artikel über B.F. Skinner und den Behaviorismus, der sie begeisterte. Sie hat seit jeher Fragen gestellt, bei denen die Antworten nicht bereits fix und fertig verfügbar waren. Wissenschaftler sein, denkt Margot, heißt zu wissen, welche Fragen man stellen muss.
Von dem großen Darwin lernte sie, dass die sichtbare Welt eine Ansammlung von Tatsachen und Bedingungen ist: von Wirkungen. Um die Welt zu begreifen, muss man den umgekehrten Weg gehen und die Vorgänge untersuchen, die diese Wirkungen erzeugen.
Durch die Umkehr des Verlaufs der Zeit (sozusagen) lernt man, dass man die Zeit (sozusagen) beherrschen kann. Man lernt, dass die Naturgesetze kein Zauberwerk sind, sondern dass man sie kennen kann wie die Ausfahrten auf der Interstate 75, die den Bundesstaat Michigan von Norden nach Süden durchschneidet.
Ist es ungerecht und paradox, dass eine Katastrophe in einem Leben (E.H.s Untergang) Hoffnung und freudige Erwartung bei anderen (in Milton Ferris’ Gedächtnislabor) auslöst? Karrierefortschritte ermöglicht, Erfolge?
So ist das in der Wissenschaft eben, denkt Margot. Ein Wissenschaftler sucht nach seinem Thema wie ein Räuber nach der Beute.
Schließlich hatte niemand das Enzephalitisvirus in Elihu Hoopes’ Gehirn eingebracht mit der Absicht, seine entsetzlichen Wirkungen zu untersuchen, wie es Naziärzte vielleicht getan hätten, oder hätte zu einem angeblich vorteilhaften Zweck eine radikale Psycho-Operation an ihm vorgenommen. Mit Schimpansen und Hunden, Katzen und Ratten wurden solche Experimente in großem Umfang gemacht, und in den vierziger und fünfziger Jahren war es eine Zeitlang en vogue, präfrontale Lobotomien an unglücklichen Geschöpfen durchzuführen, häufig mit verheerenden (und nicht gerade sorgfältig dokumentierten) Resultaten.
Manchmal wurden die durch Lobotomien herbeigeführten radikalen Persönlichkeitsveränderungen zumindest von den Familien der Patienten als vorteilhaft wahrgenommen: Ein rebellischer Jugendlicher wird plötzlich lenkbar; ein sexuell abenteuerlustiger junger Mensch, meist eine Frau, wird passiv, fügsam, asexuell; jemand, der zu Wutanfällen und Eigensinn neigt, wird kindlich, gefügig. Was vorteilhaft für die Familie oder die Gesellschaft ist, muss es nicht immer auch für den Einzelnen sein.
Bei Elihu Hoopes hat die Erkrankung wohl ebenfalls zu einer radikalen Persönlichkeitsveränderung geführt, denn kein männlicher Erwachsener mit seinem Können und seinem Format wäre so gutgläubig und kindlich, so anrührend und naiv hoffnungsvoll. In seiner Gegenwart hat man das bange Gefühl, der Mann möchte unbedingt gut ankommen, möchte gemocht werden. Er soll sich so stark verändert haben, dass seine Verlobte die Verbindung nur wenige Monate nach seiner Erkrankung gelöst hat, und Familie, Verwandte und Freunde besuchen ihn immer seltener. Er lebt in Gladwyne, einem Reichen-Vorort von Philadelphia, bei einer Tante, der jüngeren Schwester seines verstorbenen Vaters, selbst eine begüterte Witwe.
Aus persönlicher Erfahrung weiß Margot, dass es viel leichter ist, einen durch körperliche Gebrechen schwer gezeichneten Menschen zu akzeptieren als einen mit Gedächtnisverlust. Viel leichter, den einen weiterzulieben als den anderen.
Sogar Margot, die ihre Urgroßmutter als kleines Mädchen so sehr liebte, hat sich dagegen gesträubt, zu Besuchen der betagten Frau im Pflegeheim mitzufahren. Sonderlich stolz ist sie darauf nicht und vergisst es daher allmählich.
Doch E.H. ist ein ganz anderer Fall als ihre betagte Verwandte, die, wie nach ihrem Tod diagnostiziert wurde, an Alzheimer litt. Wüsste man nichts von E.H.s Erkrankung, würde man die Schwere seines Nervenleidens nicht sofort ahnen.
Margot stellt sich Fragen: Wurde die Enzephalitis bei ihm durch einen Mückenstich verursacht? War es eine besondere Mückenart? Oder war es eine gewöhnliche Mücke, die ihrerseits infiziert war? Sind bei Herpes-simplex-Enzephalitis noch andere Übertragungswege bekannt? Ist die Infektion in der Region um den Lake George im Staat New York sonst noch vorgekommen? In den Adirondacks? Sie nimmt an, dass Forscher in Albany den Fall untersuchen.
»Wie schrecklich! Der arme Mann …«
Das ist das Erste, was man sagt, wenn man E.H. sieht. Das heißt, sofern man sich außerhalb seiner Hörweite befindet.
Oder vielmehr ist es das Erste, was Margot Sharpe sagt. Ihre Kollegen im Labor sind besser auf ihn eingestellt, da sie bereits eine Weile mit ihm arbeiten.
Nervös lächelt Margot den geplagten Mann an, der sich nicht benimmt, als wisse er, dass er an einer Krankheit leidet. Sie lächelt ihn an, woraufhin er sie ebenfalls anlächelt, und dabei blitzt so etwas wie Vertrautheit auf. Sie denkt: Er ist sich nicht sicher, ob er mich kennt. Er wartet auf Signale von mir. Ich darf ihm keine irreführenden Signale übermitteln.
Für Margot ist so eine Situation neu. Sie hat noch keine lebende Versuchsperson vor sich gehabt. Unweigerlich empfindet sie Mitleid mit E.H. und ist entsetzt über sein Dilemma: Urplötzlich wurde aus dem attraktiven, kraftvollen, gesunden Elihu Hoopes, einem Mann in der Blüte seines Lebens, ein Mann, der dem Tode nah war, der über zwanzig Pfund abnahm, bei dem die Zahl der weißen Blutkörperchen rapide sank, der eine extreme Anämie erlitt und delirierte. Dass eine Herpes-simplex-Infektion eine Enzephalitis auslöst, kommt so selten vor, dass E.H. eher von einem Blitzschlag hätte getroffen werden können.
Dabei ist er alles andere als reserviert oder steif, er könnte ein Gastgeber sein, der bei sich zu Hause Besucher empfängt, deren Namen er allerdings nicht mehr richtig parat hat. In der Tat scheint er in der Umgebung des Instituts heimisch zu sein – zumindest wirkt er nicht desorientiert. Zu den Sitzungen wird er von einem Begleiter aus dem Haus seiner Tante mit einem Privatwagen gebracht; ursprünglich war er stationär behandelt worden, später nur ambulant; medizinisch wird er weiter von den Mitarbeitern des Instituts betreut. Auch wenn E.H. niemanden erkennt, schmeichelt es ihm, wie viele Menschen ihn erkennen.
Zum Grübeln neigt er anscheinend nicht, weil er die Fähigkeit zur Selbstreflexion verloren hat. Margot ist gerührt, wie E.H. ihren Namen ausspricht – »Mar-go« –, so als sei das ein wunderschöner und ganz einzigartiger Name und nicht der schroffe Spondäus, für den sie sich immer ein wenig geschämt hat.
Milton Ferris hatte seine jüngste Labormitarbeiterin zwar lediglich kurz und pro forma vorstellen wollen, es macht E.H. aber Freude, das Ritual in die Länge zu ziehen. Er schüttelt ihr die Hand auf eine Art, die höflich und zugleich zärtlich ist. Und beugt sich unverkennbar zu Margot herüber, so als atme er sie ein.
»Willkommen – Margot Sharpe. Sie sind ein – neuer Doktor?«
»Nein, Mr Hoopes. Ich bin Doktorandin in Professor Ferris’ Labor.«
E.H. korrigiert sich hastig: »Doktorandin – Professor Ferris’ Labor. Ja. Das wusste ich.«
Begeistert wiederholt er ihre Worte ganz genau, als seien sie ein Rätsel, das er lösen muss.
Menschen mit eingeschränktem Erinnerungsvermögen können bei ihrem Handicap gegensteuern, indem sie Fakten oder Wortfolgen wiederholen – sie einstudieren. Margot fragt sich aber, ob E.H.s Wiederholungen mit einem Begreifen einhergehen oder nur ein mechanisches Nachahmen sind.
Für den Mann mit dem Hirnschaden muss vieles im täglichen Leben ein ständiges Rätsel sein: Wo ist er? Was ist das für ein Gebäude? Wer sind die Menschen um ihn herum? Und zusätzlich zu all diesen verwirrenden Dingen das größere, bedeutendere Rätsel seiner Existenz, die Tatsache, dass er, der dem Tode nahe war, überhaupt lebt, ein Rätsel, dessen Unergründlichkeit, nimmt Margot an, ihn überfordert. Der Kranke mit dem sehr begrenzten Kurzzeitgedächtnis ist wie jemand, der so dicht vor einem Spiegel steht, dass sein Gesicht praktisch dagegen gepresst wird und er sich nicht sehen kann.
Was sieht E.H., wenn er in einen Spiegel schaut? Ist sein Gesicht jedes Mal eine Überraschung für ihn? Wer ist das?
Berührend ist auch – obwohl das der neurologischen Schädigung des Mannes zuzuschreiben sein könnte und nicht seiner feinen Art –, dass E.H. in seinem Benehmen Besuchern gegenüber keinen Unterschied zwischen der unwichtigsten Person im Raum (Margot Sharpe) und der wichtigsten (Milton Ferris) macht; er hat seine instinktive Fähigkeit zur Klassifizierung verloren. Es ist nicht klar, wie er Ferris’ andere Assistenten oder vielmehr Kollegen, wie Ferris sie nennt – de facto sind es Assistenten –, einschätzt, die er bereits kennt: die zweite, etwas ältere Doktorandin, mehrere bereits promovierte Mitarbeiter und eine angeblich brillante junge Assistenzprofessorin, die das Protegé des Institutschefs ist und mit ihm zusammen mehrere wichtige Artikel in neurowissenschaftlichen Zeitschriften publiziert hat.
E.H. lässt Margot Sharpes Hand nur langsam los. Bleibt weiter dicht neben ihr stehen, so als schnuppere er wiederholt an ihren Haaren, ihrem Körper. Ihr ist das unangenehm, denn sie möchte Milton Ferris nicht verärgern; sie weiß, ihr Betreuer wartet auf die Gelegenheit, mit den für diesen Vormittag geplanten Tests zu beginnen, die mehrere Stunden dauern werden, auch wenn E.H. in seiner Konzentration auf die schwarzhaarige hübsche junge Frau den Grund für den Besuch seiner Gäste wohl vergessen hat.
Margot Sharpe kommt plötzlich der Gedanke, ob ein hirngeschädigter Mensch einen Gedächtnisverlust womöglich mit gesteigertem Geruchssinn kompensiert. Eine plausible und aufregende Hypothese, der sie vielleicht eines Tages nachgeht.
Der amnestische Proband ist zweifelsfrei mehr an Margot interessiert als an den anderen – sie hofft, dass sein Interesse nicht bloß plump sexueller Natur ist. Hat die Amnesie des Probanden seine Sexualität überhaupt in Mitleidenschaft gezogen, und in welcher Weise?
Doch E.H. spricht in freundlichem Ton mit ihr, als ob sie ein junges Mädchen wäre.
»Mar-go, ich glaube, Sie waren in der Grundschule in der Gladwyne Day in meiner Klasse – Mar-go Madden, falls es nicht Margaret Madden war …«
»Leider nicht, Mr Hoopes.«
»Nicht? Wirklich? Sind Sie sich sicher? Das müsste Ende der dreißiger Jahre gewesen sein. Bei Mrs Scharlatt in der sechsten Klasse saßen Sie in der ersten Reihe, ganz links am Fenster. Sie hatten silberne Spangen im Haar, Margie Madden.«
Margots Gesicht wird heiß. Nicht allein das Kokettieren ist ihr so unangenehm, sondern auch ihre Mitschuld und die der Zuhörer, die E.H. nicht frank und frei über seine Krankheit aufklären.
Eigentlich müsste Dr. Ferris es ihm sagen oder vielmehr noch einmal sagen. Denn gesagt wurde es E.H. schon viele Male.
»Ich – ich fürchte, nein …«
»Na ja. Sagen Sie doch Eli zu mir. Bitte.«
»Eli.«
»Vielen Dank. Das ist sehr nett.«
E.H. schaut in ein kleines Notizbuch, das er in einer Tasche seiner Baumwollhose hat, und trägt hastig etwas ein. Er hält das Büchlein leicht schräg, damit niemand sieht, was er schreibt, allerdings auch nicht so betont schräg, dass die Geste beleidigend für Margot wäre.
Man hat Margot berichtet, dass der Proband Tagebuch führt, seit er sich von seiner Krankheit erholt hat und kräftig genug ist, einen Stift in der Hand zu halten. Er hat schon Dutzende dieser kleiner Kladden angesammelt, außerdem Zeichenmappen, die einen Meter mal siebzig groß sind; beide hat er immer dabei, wenn er im Institut eintrifft. Sie erfüllen offenbar verschiedene Funktionen. In den Notizbüchern hält E.H. einzelne Details fest, Namen, Termine und Daten; er fügt Kolumnen ein, die er aus Zeitschriften und Zeitungen im Aufenthaltsraum im dritten Stock herausgerissen hat. Männliche Institutskollegen, die die Toilette im dritten Stock aufsuchen, berichten, dass sie jeden Tag, an dem E.H. sich auf dem Gelände befindet, dort solche Abfälle finden – daher wissen sie, wie sie sagen, dass »euer schriller Proband« dagewesen ist. Die Mappen enthalten seine Zeichnungen.
Die fürs Lesen und Schreiben und für mathematische Berechnungen nötigen komplexen geistigen Fähigkeiten sind durch E.H.s Erkrankung nicht stark beeinträchtigt worden, da sie vor der Infektion erworben wurden. Und so liest E.H. strahlend aus seinem Notizbuch vor: »Elihu Hoopes besuchte das Amherst College und schloss in seinen beiden Hauptfächern Wirtschaftswissenschaften und Mathematik mit summa cum laude ab … Elihu Hoopes hat das Union Theological Seminary besucht und besitzt einen Abschluss der Wharton School of Business.« Er liest den Eintrag vor, als sei er aufgefordert worden, sich zu identifizieren. Als er die bemüht neutralen Gesichter seiner Besucher sieht, betrachtet er sie mit einem feinen Lächeln, als verstünde er genau in diesem Moment den Aberwitz und das Traurige seines Dilemmas und bäte sie um Nachsicht. Verzeiht mir! Der Kranke hat gelernt, die Stimmung seiner Besucher zu erahnen, und möchte sie fesseln und unterhalten: »Ich weiß schon. Ich weiß, wer ich bin. Aber es ist wohl nicht unvernünftig, die eigene Identität öfter zu überprüfen und sich zu vergewissern, dass sie noch da ist.« Lachend klappt er das Büchlein zu und schiebt es in die Hosentasche, und die anderen lachen auch.
Nur Margot kann nicht recht mitlachen. Irgendwie kommt ihr das Gelächter grausam vor.
Es gibt ein Lachen, und es gibt ein anderes Lachen. Nicht alles Gelächter ist gleich.
Lachen ist ebenfalls von der Erinnerung abhängig – der Erinnerung an früheres Lachen.
Dr. Ferris hat seinen jungen Mitarbeitern gesagt, ihr Proband »E.H.« werde dereinst vielleicht einer der berühmtesten Amnesiekranken in der Geschichte der Neurowissenschaften sein; unter Umständen ein zweiter Phineas Gage, jedoch in der Epoche moderner neuropsychologischer Experimente. Eigentlich ist E.H. interessanter als Gage, dessen Erinnerung durch seine denkwürdige Kopfverletzung – sein linker Frontallappen wurde bei einem Arbeitsunfall von einer Eisenstange durchbohrt – nicht schwer beeinträchtigt wurde.
Dr. Ferris hatte ihnen eingeschärft, außerhalb des Labors nicht zu offen über E.H. zu sprechen, zumindest anfangs nicht; sie sollten bedenken, dass sie »riesiges Glück« hätten, Teil seiner Forschungsgruppe zu sein.
Margot ist als Doktorandin zwar erst im ersten Studienjahr, ihr braucht man jedoch nicht zu sagen, dass sie sich glücklich schätzen darf. Auch braucht man sie nicht zu ermahnen, dass sie mit niemandem über den Fall dieses bemerkenswerten Amnesiekranken sprechen soll. Sie hat nicht die Absicht, Milton Ferris zu enttäuschen.
Ferris und seine Mitarbeiter entwickeln für E.H. Testreihen, wie sie noch nie zuvor durchgeführt worden sind. Der Proband soll pseudonym bleiben – »E.H.« wird seine Identität innerhalb und außerhalb des Instituts sein, und alle, die im Institut mit ihm arbeiten und ihn betreuen, werden zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Familie Hoopes, die der medizinischen Fakultät der Universität von Philadelphia Millionen von Dollar gespendet hat, hat nur dem Neurologischen Institut der Universität in Darven Park die Erlaubnis zur Durchführung solcher Tests erteilt, sofern E.H. zur Mitwirkung bereit ist – und das ist er wohl tatsächlich. Ein getretener Hund, der sich nach menschlicher Anerkennung und Liebe sehnt und unter allen Umständen den Anschluss an die »Normalen« wahren will, könnte nicht eifriger mitmachen als der würdevolle Elihu Hoopes, der Sohn einer wohlhabenden und angesehenen Familie von Philadelphiaern, eine Vorstellung, die Margot unbehaglich ist.
Er ist in ewiger Gegenwart gefangen, denkt Margot. Wie jemand, der im Halbdunkel der Wälder im Kreis herumläuft – ein Mann ohne Schatten.
Und darum ist er begeistert, dass man ihn aus dem Halbdunkel gerettet und zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gemacht hat, auch wenn er den Grund dafür nicht recht versteht. Woher weiß der Kranke sonst, dass er existiert? Allein, ohne die Ansprache aufmerksamer Fremder, die ihm Fragen stellen, würde sogar das Halbdunkel vergehen, und er wäre ganz und gar verloren.
»Margo Nicht-Madden? – so heißen Sie?«
Margot kann nicht gleich folgen, merkt dann aber, dass E.H. einen Scherz machen will. Er hat wieder sein kleines Notizbuch hervorgezogen und dort etwas eingetragen, was wie ein logisches Schema aussieht. Die eine Kategorie, durch einen Kreis dargestellt, ist M M, und eine zweite Kategorie, ebenfalls durch einen Kreis dargestellt, ist M Nicht-M. Zwischen den beiden Kreisen, die auch Ballons sein könnten, da unten Fäden herabhängen, befindet sich eine gestrichelte Linie.
»Die Tage, in denen ich einmal die symbolische Logik beherrscht habe, sind wohl vorbei«, sagt E.H. freundlich, »aber ich glaube, die Situation ist in etwa so.«
»Oh – ja …«
Wie bereitwillig man Behinderte bei Laune hält. Margot wird erfahren, dass im Umkreis des Amnesiekranken, nicht anders als in dem von Blinden oder Tauben, ein machtvoller Sog wirkt, dessen Stärke von der Willenskraft des Leidenden abhängt.
Trotzdem ist Margot sich nicht sicher, wie sie reagieren soll. Es ist ein kläglicher und irgendwie höflicher Versuch der Aufmunterung, sie möchte den Probanden aber nicht zur Verdrehung von Tatsachen animieren; sie weiß, das braucht man ihr nicht ausdrücklich zu sagen, dass ihre älteren Kollegen und Milton Ferris derlei missbilligen.
Außerdem ergibt sich eine zweite Misslichkeit in Bezug auf Rang und Stellung: die (untergeordnete) Margot Sharpe hat in E.H.s begrenzter Aufmerksamkeit den (tonangebenden) Milton Ferris abgelöst. Es kann sogar sein, dass der gehirngeschädigte Mann Dr. Ferris, der direkt neben ihm steht und in die Unterhaltung eingreifen will, willentlich und gekonnt ausblendet – (»ausblenden« ist ein neurologischer Begriff und bezeichnet eine durch die Hirnschädigung verursachte pathologische Blindheit). Margot muss deshalb ein Stück von E.H. abrücken, damit sich Ferris wieder als (offensichtlich) Verantwortlicher zur Geltung bringen kann. Sie hofft, dieses Manöver unauffällig zu vollführen, ohne dass der geschädigte Mann oder der angesehene Neuropsychologe davon etwas mitbekommen.
Sie möchte weder die Gefühle des Probanden verletzen, auch wenn die nur flüchtig sind, noch Milton Ferris kränken, den mit knapp sechzig Jahren angesehensten Neurowissenschaftler seiner Generation. Immerhin hängt ihr wissenschaftliches Fortkommen von diesem Menschen mit dem lodernden weißen Bart ab, über den sie widersprüchliche Dinge gehört hat. Milton Ferris ist der brillanteste unter den brillanten Forschern am Institut, aber er ist auch jemand, dem man »auf keinen Fall in die Quere kommen möchte, nicht einmal unabsichtlich. Vor allem nicht unabsichtlich.« Als Nachwuchswissenschaftlerin, eine von sehr wenigen am psychologischen Fachbereich der Universität, hält Margot sich in solchen Konstellationen instinktiv im Hintergrund; das hat sie während des Grundstudiums, als ihr Interesse an experimenteller kognitiver Psychologie geweckt wurde, bereits mit allen Fasern aufgenommen.
Außerdem war es deutlich genug: Am ganzen Fachbereich Psychologie gab es praktisch keine Professorinnen und in der Neurowissenschaft erst recht nicht.
Margot ist keine hübsche junge Frau, das ist ihr klar. Sie misstraut den Konventionen von Schönheit – in der Schule waren ihre reizvolleren Klassenkameradinnen durch die Aufmerksamkeit der Jungen abgelenkt, bei mehreren nahm das Leben eine andere Wendung (junge Liebe, frühe Schwangerschaften, überstürzte Heirat). Margot hält sich jedoch für besonnen und ist entschlossen, nicht aus Naivität Fehler zu machen. Wenn E.H. mit seinem Eifer und seiner Gefälligkeit ein braver Hund ist, ähnelt Margot einem Hund, den ein großmütiger Herr aus dem Tierheim gerettet hat – einer, dem man stets und ständig und so subtil wie möglich versichern muss, dass er wirklich der Herr ist.
Auf seine eisern gutgelaunte Art erläutert Milton Ferris E.H., Margot sei zu jung, um Ende der dreißiger Jahre seine Mitschülerin gewesen zu sein – »Diese junge Frau aus Michigan ist neu an der Universität und neu in unserem Team im Institut und wird uns hier bei unserem Gedächtnisprojekt helfen.«
E.H. macht ein nachdenkliches Gesicht, als nehme er die in den Satz gepackte Information auf. Leutselig stimmt er zu: »Michigan. Ja – dann ist es unwahrscheinlich, dass wir an der Gladwyne in einer Klasse waren.«
Er gibt sich außerdem den Anschein, als sei der Begriff Gedächtnisprojekt ihm vertraut. Margot überlegt, ob sich der Kranke diese überzeugende und sympathische Fassade unbewusst zugelegt hat. Und überlegt weiter, ob man andere Personen mit einer E.H. ähnlichen Schädigung bereits auf den Erwerb solcher Erinnerungen getestet hat.
Milton Ferris spricht weiter ausführlich über das Testen, und E.H. lässt lebhafte Begeisterung erkennen. Während der vergangenen anderthalb Jahre ist er zwar unzählige Male von Neurologen und Psychologen getestet worden, aber es ist kaum anzunehmen, dass er sich an einzelne Sitzungen oder Experimente erinnert. Aus der Zeit vor seiner Erkrankung weiß er grundsätzlich, was ein Test ist, weiß, was ein IQ-Test ist, weiß vielleicht auch noch, dass bei ihm, als er achtzehn war, einmal ein IQ von 153 gemessen wurde; er kann jedoch nicht wissen, dass diverse nach seiner Erkrankung durchgeführte IQ-Tests Werte zwischen 149 und 157 erbracht haben. Noch immer von überragender Intelligenz, zumindest theoretisch.
Margot findet es faszinierend: Das Vokabular, das Ausdrucksvermögen und die mathematischen Fähigkeiten, die E.H. vor seiner Erkrankung besaß, sind mehr oder weniger intakt noch vorhanden, er kann aber, heißt es, keine neuen Wörter, Begriffe oder Fakten behalten, nicht einmal, wenn sie in bekannte Informationen eingebettet sind. Er wurde beobachtet, als er sich Notizen auf den Finanzseiten seiner Lieblingszeitungen machte, wenige Minuten später gefragt, was er dort notiert habe, zuckt er verächtlich die Achseln: »Homo sapiens ist die Spezies, die Geld verdient und verliert. Was gibt’s sonst noch Neues?« Er hat vergessen, was ihn so in Anspruch genommen hat, kann aber ersatzweise sofort etwas präsentieren, womit er den Erinnerungsverlust kaschiert.
Manchmal weiß er offenbar, dass John F. Kennedy vor kurzem – vor zwei Jahren – ermordet wurde, andere Male spricht er von »Präsident Kennedy«, als ob der Mann noch lebte: »Kennedy wird seinen Standpunkt zu Kuba revidieren müssen. Er wird das Land aus dem Morast von Vietnam herausführen müssen.«
Und, großsprecherisch: »Einige von uns hoffen, nach Washington zu kommen und uns mit dem Präsidenten zu treffen. Die Lage wird immer ernster.«
Das würde wahnhaft klingen, wenn die Familie Hoopes aus Philadelphia, wie Ferris erwähnt hat, nicht seit langem Verbindungen zu Politikern auf höchster Ebene hätte.
Wie viele Menschen mit Hirnschädigungen trägt E.H. Wörterbücher und andere Sprachlehrbücher mit sich herum; er führt, alphabetisch geordnet, in seinem Notizbuch lange Wörterlisten; das heißt, es gibt Seiten unter A, B, C und so weiter. Dort schlägt er jetzt gern nach, wenn er das Kreuzworträtsel der Times löst, wohingegen er, wie seine Familie bestätigt hat, vor seiner Erkrankung für das Rätsel nie ein Wörterbuch gebraucht hat. Seine mathematischen Fähigkeiten sind bestechend, seine Kenntnis der Geographie der Welt ebenfalls. Er kann konkurrierende Wirtschaftstheorien – die Keynes’sche, die klassische, die marxistische – erörtern, doziert gern über von Neumanns Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten, ein Buch, aus dem er Kernsätze auswendig gelernt hat. Auf Befragen kann er aber mehr oder weniger nur wiederholen, was er bereits gesagt hat; seine Gedanken sind so starr wie sein Wortschatz. Neue Ideen oder Korrekturen von Vergangenem dringen nicht durch. Und meldet jemand Zweifel an, ist es um seine sonstige Umgänglichkeit gleich geschehen, und er wird reizbar und spöttisch. Er ist versiert in Brettspielen und Puzzeln von der Art, die er bereits als Kind gemeistert hat, lernt neue Spiele aber nur mühsam.
Könnte E.H. klar denken, hielte er die wiederholten Tests, denen er sich unterzieht, vermutlich für eine Behandlung oder Therapie, durch die sich sein Leiden bessert; doch er kann sein Leiden nicht begreifen, obwohl es ihm wiederholt dargelegt worden ist; er kann auch nicht wissen, dass die Tests genau genommen Wiederholungen sind und dass sie der experimentellen Forschung dienen – das heißt, der Neurowissenschaft und nicht der Versuchsperson.
Behutsam redet Ferris auf ihn ein: »Mr Hoopes – Eli –, lassen Sie mich Ihnen noch einmal erklären, dass ich Neuropsychologe bin und an der Universität von Pennsylvania lehre und dass dies Mitarbeiter meines Labors sind. Wir arbeiten seit fünfzehn Wochen hier im Institut in Darven Park mit Ihnen, und zwar jeden Mittwoch, und haben schon einige aufregende erste Entdeckungen gemacht. Sie haben mich schon kennengelernt, und wir sind prächtig miteinander ausgekommen. Ich bin Milton Ferris …«
E.H. nickt heftig, sogar ungeduldig, so, als wüsste er das alles. »Mil-ton Fer-ris, ja. Dr. Ferris.«
»Ich bin kein Doktor – ich bin Professor. Ich habe natürlich einen Doktortitel, aber das ist nicht wesentlich. Bitte sagen Sie doch einfach …«
»Professor Ferris. Ja.«
»Und ich habe erklärt – ich bin kein Kliniker.«
Auf diese Weise teilt er dem Probanden mit: Ich bin kein Doktor der Medizin. Sie sind nicht mein Patient.
Doch E.H. versteht ihn offenbar mit Absicht falsch und scherzt verlegen: »Tja, Herr Professor, da sind wir schon zu zweit. Ich bin auch kein Kliniker.«
Er hat ein bisschen zu laut gesprochen. Signalisiert er auf die Weise, dass er sich über Professor Ferris geärgert hat? Weil seine Aufmerksamkeit brachial von der schwarzhaarigen Margot Sharpe abgezogen wurde?
Margot überlegt auch, ob er so schnell spricht, um unbewusst zu signalisieren, dass ihm an der von Professor Ferris gegebenen Information nicht viel liegt, denn trotz schwerer Amnesie hat E.H. aus früheren Wortwechseln genug behalten, um zu wissen, dass er diese Information auch nicht behalten wird, und sie deshalb nicht hören will.
Während seine Besucher weiter schauen, blättert er in seinem kleinen Notizbuch, bis er zur entscheidenden Seite kommt. Er lächelt, zeigt die Seite aber eher Margot als Ferris – eine Zeichnung von zwei Tennisspielern, von denen einer hektisch mit dem Schläger herumfuchtelt und der Ball übers Netz fliegt. Soll dieser Spieler E.H. sein? Sein Haar und seine Züge deuten darauf hin. Und der andere Spieler mit dem unkenntlichen Gesicht und dem übertriebenen Grinsen wäre – der Tod?
»Das – Tennis – habe ich früher gespielt. Ich war verdammt gut in der Mannschaft in Amherst. Spielen wir jetzt auch Tennis?«
»Eli, Sie sind ein ausgezeichneter Tennisspieler. Sie können ein andermal spielen. Aber jetzt würde ich Sie bitten, sich zu setzen und …«
»Ein ausgezeichneter? Stimmt das? Ich hab aber schon lange nicht mehr Tennis gespielt, glaub ich.«
»Genau genommen, Eli, erst vorige Woche.«
Eli starrt Ferris an. Das hat er nicht erwartet und kann es offenbar nicht gleich verarbeiten, doch Ferris reagiert prompt und sagt aufmunternd: »Also, Eli, mich haben Sie immer haushoch geschlagen. Und mir wurde berichtet, dass Sie mit einem der besten Spieler unter den Angestellten gespielt – und jede Partie gewonnen haben.«
»Berichtet – tatsächlich!«
E.H. lacht, so ganz kann er das nicht glauben.
Margot wird klar: Der arme Mann empfindet das Unbehagen eines Menschen, dem begreiflich gemacht wird, dass das umfassendste Wissen über ihn von außen kommen kann – von Fremden.
Ein trauriger Gedanke, denkt Margot, wenn man begreift, dass man selbst sich nicht so zuverlässig kennt, wie Fremde einen kennen.
Geduldig setzt Milton Ferris E.H. auseinander, warum er an diesem Vormittag ins Institut gebracht worden ist und warum er und sein Labor ihn testen wollen – wie sie es schon in der Vergangenheit getan haben. Zuerst hört E.H. höflich zu, gerät dann aber in Verwirrung, denn nun fesselt ihn Margot, die er wiederentdeckt hat: Sie trägt einen schwarzen Wickelrock, eine schwarze Strumpfhose, einen schwarzen Jerseypullover, der sich eng um ihren schmalen Leib schmiegt, und flache schwarze Ballerinas, die Kleidung einer Tänzerin im Schülerinnenalter und nicht den frischen weißen Laborkittel der medizinischen Angestellten oder die mattgrünen Uniformen der Pflegekräfte. Sie hat auch kein Schildchen am Revers stecken, dem er ihren Namen entnehmen könnte.
Ferris sagt gereizt: »Wann immer Sie so weit sind, Mr Hoopes – Eli. Deswegen sind wir hier.«
»Deswegen sind Sie hier, Herr Doktor. Aber warum bin ich hier?«
»Sie haben bisher immer Spaß an Ihren Tests gehabt, Eli, und das werden Sie auch diesmal wieder.«
»Deswegen bin ich hier – um Spaß zu haben?«
»Wir hoffen, ein paar Tatsachen in Bezug auf das Gedächtnis nachzuweisen. Wir befassen uns mit der Frage, wo das Gedächtnis seinen Sitz im Gehirn hat – ob es gleichmäßig verteilt ist und nicht nur lokal begrenzt oder ob es doch lokal begrenzt ist. Und Sie helfen uns dabei, Eli.«
»Haben die mich aus dem Büro rausgeschmissen? – Hat jemand meinen Platz eingenommen? Mein Bruder Averill und mein Onkel« – E.H. verstummt, als sei ihm zu seinem Leidwesen für einen Moment der Name eines Verwandten entfallen, eines leitenden Angestellten bei Hoopes & Partner, Inc., um spöttelnd mit einer seiner rätselhaften Bemerkungen fortzufahren: »Wo würde ich denn sein, wenn ich woanders sein könnte?«
Milton Ferris versichert ihm, er sei »genau zur rechten Zeit am rechten Ort, um Geschichte zu machen«.
»Habe ich das schon gesagt? Ich habe Reverend King sprechen hören. Mehrmals. Das ist Geschichte.«
»Ja. Ein außergewöhnlicher Mann, Reverend King …«
»In Philadelphia sprach er auf der Treppe der Free Library, und in Birmingham, Alabama, sprach er in einer Negerkirche, die anschließend von weißen Rassisten niedergebrannt wurde. Er ist ein sehr tapferer Mann, ein Heiliger. Ein Heiliger an Couragiertheit. Ich habe vor, wieder mit ihm zu marschieren, sobald es mir bessergeht – wie ich es versprochen habe.«
»Natürlich, Eli. Vielleicht können wir mithelfen, das einzurichten.«
»Ich bin niedergeschlagen worden, daher kommt das – mit einem Gummiknüppel, in Alabama. Hab ich es Ihnen schon gezeigt? Die Narbe, wo keine Haare mehr wachsen …«
Er senkt den Kopf und drückt sein dichtes dunkles Haar platt, um ihnen die blasse Zickzacklinie auf seinem Schädel vorzuführen. Margot möchte gleich die Hand ausstrecken und die Stelle berühren – den Kopf des armen Mannes streicheln.
Sie begreift: Die Einsamkeit, die spürt er am stärksten.
»Ja, Sie haben uns Ihre Narbe gezeigt, Eli. Sie können sich glücklich schätzen, dass Sie mit dem Leben davongekommen sind.«
»Kann ich das! Mit dem Leben davongekommen, Sie meinen, das hab ich geschafft, Herr Doktor.« E.H. lacht traurig.
Milton Ferris unterhält sich weiter mit E.H., lässt ihn gewähren und beruhigt ihn so. Vor ihrem geistigen Auge sieht Margot Ferris ein erregtes Versuchstier beruhigen, einen Affen zum Beispiel, der gleich geopfert werden wird.
Das ist der in der experimentellen Wissenschaft verwendete Euphemismus. Die Labortiere werden nicht getötet und erst recht nicht ermordet: sie werden geopfert.
In E.H.s Nähe merkt man binnen kurzem, dass sein Lächeln gar nicht kindlich-eifrig ist, sondern vielmehr verzweifelt und kläglich. Man hat einen Ertrinkenden vor sich, der mit aller Kraft auf Rettung hofft, egal durch wen, ohne zu wissen, was ihn retten könnte und wovor er eigentlich gerettet werden will.
In mir sieht er – irgendetwas. Eine rettende Hoffnung.
Da es selbst bei schweren neurologischen Ausfällen isolierte Inseln der Erinnerung geben kann, die plötzlich auftauchen, überlegt Margot, ob sie mit ihrer Stimme, ihrem Gesicht oder ihrem bloßen Geruch schwache Erinnerungen in E.H.s lädiertem Hirn auslöst, so dass er für sie etwas empfindet, was ihm ebenso unerklärlich ist wie allen anderen. Denn auch wenn er Dr. Ferris’ forscher Rede zuhört, blickt er Margot sehnsüchtig an.
Margot hat Labortiere gesehen, die noch lebten und Empfindungen hatten, aber vollkommen hilflos waren, nachdem ihnen Teile des Gehirns entnommen worden waren. Und sie hat alles über Amnesie bei Menschen gelesen, was sie in die Hände bekam. Trotzdem macht es sie nervös, so einen Zustand direkt vor Augen zu haben bei einem Mann, der aus der Nähe völlig normal wirkt, ja charismatisch.
»Sehr gut, Eli! Möchten Sie sich vielleicht an den Tisch setzen?«
E.H. lächelt gequält. Er möchte sich unverkennbar nicht setzen; im Stehen fühlt er sich wohler, kann sich frei durch den Raum bewegen. Margot sieht den körperlich gesunden Mann auf dem Tennisplatz förmlich vor sich, ständig in Bewegung, er möchte nicht stillsitzen, da ist er im Nachteil.
»Hier. An den Tisch, bitte. Nehmen Sie irgendeinen Stuhl …«
»Irgendeinen Stuhl – und weiter?« E.H. zwinkert lächelnd, tut so, als wolle er einen Stuhl anheben und wegtragen; seine Finger zucken. Ferris lacht übertrieben.
»Ich meinte, Sie können sich auf einen Stuhl setzen. Den hier.«
E.H. seufzt. Er hatte ihn bei Laune halten wollen, den Fremden mit dem auffälligen kurzen weißen Bart und den blitzenden Brillengläsern, der so vertraulich mit ihm spricht.
»Jawoll – zu Befehl, ich meine, ja, Herr Doktor.«
Dazu lächelt er freundlich, es kann nicht beleidigend gemeint gewesen sein.
Sie treffen Vorbereitungen für den ersten Test dieses Vormittags, und E.H.s Aufmerksamkeit wird von Margot weggelenkt, die keine Aufgabe dabei hat und nur zuschaut. Sie hat sich inzwischen leise an eine Stelle begeben, an der der Proband sie höchstens noch schemenhaft am Rand seines Gesichtsfelds sehen kann. Vermutlich hat er die Namen der sonstigen Anwesenden – Kaplan, Meltzer, Rubin, Schultz – vergessen. Margot ist erleichtert, dass sie nicht mit Milton Ferris um die labile Aufmerksamkeit des Kranken konkurrieren muss.
Nach der Erkrankung zeigten E.H.s Testergebnisse gravierende Verluste beim Kurzzeitgedächtnis. Von den Versuchsleitern gebeten, sich Zahlenfolgen einzuprägen, geriet er zwischen fünf und sieben ins Stocken. Jetzt, Monate später, kann er auf Verlangen aus dem Gedächtnis neun Zahlen nacheinander aufsagen, manchmal zehn oder elf. Mit dem Resultat liegt er im Normalbereich, und man würde auch denken, dass E.H. normal ist – er agiert ruhig, methodisch, fast roboterhaft; wenn Erschwernisse eingebaut und die Listen länger werden und wenn es Unterbrechungen gibt, gerät E.H. rasch in Verwirrung.
Das Experiment wird zur Qual, als immer längere Intervalle des Schweigens die Zahlenreihen unterbrechen, die der Proband sich merken soll und die ihm nicht entgleiten sollen. Margot meint zu spüren, wie es den armen Mann anstrengt, nicht den Faden zu verlieren, wie mühsam das Einprägen für ihn ist. Am liebsten würde sie ihn an der Hand fassen, ihn trösten und ermutigen. Ich helfe Ihnen. Sie werden besser. Das bleibt nicht Ihr Leben lang so!
Körperliche Schädigung ist der große Gleichmacher, denkt sie. Vor anderthalb Jahren, vor seiner Erkrankung, hätte Elihu Hoopes bei ihr wohl kaum zweimal hingesehen. Fast möchte sie ihn beschützen, ihn bedauern, und spürt, dass er dankbar für ihre Berührung wäre.
Vierzig intensive Minuten, dann zehn Minuten Pause, dann die nächsten Tests in stetig wachsendem Tempo. E.H. ist willig und kooperativ, doch als es komplizierter wird und die Tests beschleunigt werden, gerät er zunehmend schnell in Verlegenheit, bemüht sich allerdings tapfer, freundlich und höflich zu bleiben. Und als die Intervalle länger werden, wirkt er wie ein hilflos um sich schlagender Ertrinkender. Sein Kurzzeitgedächtnis ist stark reduziert – auf bloße vierzig Sekunden.
Nach zwei Stunden sagt Ferris eine längere Pause an. Die Versuchsleiter sind genauso erschöpft wie der Kranke.
E.H. bekommt ein Glas Orangensaft gereicht, sein Lieblingsgetränk. Er hat bis zu diesem Moment noch nicht gemerkt, dass er Durst hat, und trinkt das Glas mit großen Schlucken aus.
Margot Sharpe bringt ihm den Saft. Die weibliche Rolle des Pflegens und Umsorgens erfüllt sie mit tiefer Befriedigung, denn E.H. lächelt sie besonders herzlich an.
Ihr wird ein wenig schwindlig. Kein Zweifel, der Amnesiekranke erkennt sie.
Unruhig und erschöpft, ohne zu wissen (sich daran zu erinnern), warum, steht E.H. am Fenster und starrt hinaus. Möchte er eruieren, wo er ist? Eruieren, wer diese Fremden sind, die ihn testen? Er ist ein stolzer Mann, er wird nicht fragen.
Wie ein Athlet, der zu lange in einem beengten Raum ausharren musste, oder wie ein rebellischer Teenager beginnt E.H. den Raum zu umkreisen. Fast ist es störend, dieses Benehmen – doch, es ist störend. Er schenkt den Fremden im Raum keine Beachtung. Biegt und streckt die Finger, schüttelt die Arme aus, dehnt die Waden. Reckt sich zur Decke – dehnt die Rückenwirbel, murmelt vor sich hin – flucht er? –, alles aber mit unverändert freundlicher Miene.
»Mr Hoopes? Möchten Sie Ihre Zeichenmappe haben?«, fragt jemand aus dem Institut und reicht sie ihm.
E.H. ist froh, seine Mappe zu sehen. Ist vielleicht überrascht, sie zu sehen. Er blättert mit gerunzelter Stirn darin und hält sie so, dass kein anderer einen Blick auf die Seiten werfen kann.
Dann findet er in der Tasche seines Hemds sein kleines Notizbuch. Er schlägt es gleich auf, blättert, trägt etwas ein und schiebt das Büchlein in die Tasche zurück. Schaut wieder in die Zeichenmappe, stößt darin auf etwas, was ihm missfällt, reißt die Seite heraus und zerknüllt sie. Margot ist vom Verhalten des Kranken fasziniert: Ist ihm klar, was er tut? Hat sein Tun einen Sinn? Margot fragt sich, ob er vor seiner Erkrankung auch schon Tagebuch geführt und eine so große Zeichenmappe mit sich herumgetragen hat; möglicherweise ja. Daher ist die Leistung, sich daran zu erinnern, nichts Ungewöhnliches.
Wenn er glaubt, allein zu sein und niemand in der Nähe ist, der ihn beobachtet, hört er auf zu lächeln. Dann zieht er ein finsteres Gesicht und schaut ernst drein wie jemand, der sich mit aller Kraft müht, aus alldem schlau zu werden.
Wie traurig und ermüdend, dass der Kranke nicht weiß, wie lange er sich mit dieser Frage bereits herumschlägt. Nicht weiß, ob er erst seit einigen Minuten in diesem Raum ist oder schon seit Stunden. Dass er hier nicht wohnt, scheint er zu begreifen, er hat aber keine klare Vorstellung davon, dass er bei einer Verwandten in Gladwyne wohnt und nicht bei sich zu Hause in Philadelphia wie vor seiner Erkrankung.
Ganz gleich, wie oft ein Test wiederholt wird, bei dem es um Auswendiggelerntes geht, E.H.s Ergebnis wird nicht besser. Ganz gleich, wie oft er vorher angeleitet wird, er muss beim nächsten Mal wieder angeleitet werden.
Das Gehirn des Amnesiekranken gleicht einem Sieb, durch das ständig Wasser fließt, sich aber nie sammelt; die Zeit vor der Erkrankung des Mannes, die den Großteil seines achtunddreißig Jahre währenden Lebens ausmacht, ähnelt einem stillen, durch dichtes Laub erspähten fernen Gewässer in einer halluzinatorischen Landschaft von Cézanne.
Ob am Grunde des durch die Erkrankung geschädigten Teils seines Gehirns noch Reste von Erinnerungsinhalten vorhanden sind? Ob an der Peripherie der Schädigung oder in angrenzendem Gewebe noch irgendeine Form von Neurogenese, neuem Nervenwachstum stattfindet? Und – könnte sich eine Neurogenese anregen lassen?
Wie wenig wir nach so vielen Jahrtausenden immer noch vom menschlichen Gehirn wissen! Das Gehirn ist das einzige Organ, auf dessen Funktionsweise nur aus beobachtetem Verhalten geschlossen werden kann und dessen elementare Physiologie bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt – das heißt 1965 – kaum verstanden worden ist. Nur die Gehirne von Tieren können am lebenden Objekt untersucht werden – hauptsächlich die Gehirne von Affen. Invasive Forschung am lebenden, normalen menschlichen Gehirn ist verboten. Die Frage beschäftigt Margot: Sind komplexe Erinnerungen über den gesamten cerebralen Cortex verteilt oder lokal begrenzt? – und wenn lokal begrenzt, wie? Über E.H.s Gehirn weiß man, dass der Hippocampus und angrenzendes Gewebe durch die Virusinfektion zerstört wurden – sind andere Teile des Gehirns aber unbeschädigt geblieben? Bevor E.H. nicht am Gehirn operiert wird oder ausgefeilte Apparate entwickelt werden, die das Gehirn durchleuchten können, wird man Genaueres über die Anatomie seines Gehirns erst nach seinem Tod wissen, wenn es obduziert werden kann.
Die Vorstellung entsetzt Margot, erregt sie aber auch. Vor ihrem geistigen Auge liegt E.H. auf einer Marmorplatte in einem Leichenschauhaus: tot, der Schädel aufgesägt. Der Pathologe entnimmt das Gehirn, das vom Neurowissenschaftler fixiert, seziert, eingefärbt, untersucht und analysiert wird.
Sie wird der Neurowissenschaftler sein.
E.H. wirft ihr einen bangen Blick zu, als ob er ihre Gedanken lesen könnte. Margot wird heiß im Gesicht wie jemand, der es gewagt hat, einen anderen intim zu berühren, und dabei ertappt wurde.
Aber ich werde Ihr Freund sein, Mr Hoopes! – Eli.
Ich werde derjenige sein, dem sie vertrauen können.
Das Geheimnis des Gedächtnisses lüften – Margot Sharpe wird zu den Ersten gehören.
Mit erhobenem Zeigefinger, um ihre Aufmerksamkeit wiederzuerlangen, blättert E.H. sein Notizbuch durch, sucht nach etwas Wichtigem. Liest mit seiner hellen, freundlichen Stimme vor:
»Es gibt keine Reise, und es gibt keinen Weg. Es gibt keine Weisheit, es gibt Leere.« Nach kurzer Pause fährt er fort: »Es gibt die Weisheit des Buddha. Aber es gibt keine Weisheit, und es gibt keinen Buddha.« Er lacht, unerklärlich gutgelaunt.
Seine Betreuer starren ihn an, können nicht mitlachen.
Das Testen geht weiter. E.H. macht abermals einen interessierten, hoffnungsvollen Eindruck.
Es ist schwer nachzuvollziehen: Für den Probanden beginnt das Abenteuer dieses Vormittags erst jetzt. Er hat vergessen, dass er müde ist.
Wie das Verlangen hängt auch die Müdigkeit vom Gedächtnis ab. Margot hätte nicht geglaubt, dass das so ist – es kommt ihr so unnatürlich vor!
Als Wissenschaftler begreift man schnell: Vieles in der Natur ist unnatürlich.
Die Hälfte ihres Programms ist abgearbeitet, als Milton Ferris geht. Er hat einen Termin, ein Mittagessen vielleicht. Der Projektleiter betraut seine Assistenten mit der Aufgabe, die von ihm entwickelten Tests ohne seine Aufsicht fortzusetzen.
Margot folgt den Anleitungen peinlich genau: Auch wenn sie weiß, was zu tun ist, wartet sie, bis Alvin Kaplan, Ferris’ Günstling, sie einweist. Den Probanden zu testen ist aufwendig und monoton, aber faszinierend; es sind verschiedene Gedächtnistests, akustische und visuelle, deren Schwierigkeitsgrad schrittweise steigt.
Mit einem Experiment verfolgt man offenbar den Zweck, den Probanden zu frustrieren und zu demotivieren. E.H. wird von Kaplan angewiesen, so weit zu zählen, »wie Sie ohne Unterbrechung können«. E.H. beginnt und zählt beeindruckend lange, über siebzig Sekunden; es geschieht methodisch, auswendig. Bei der Zahl neunundachtzig unterbricht Kaplan und lenkt E.H. damit ab, dass er ihm eine Karte mit einem kunstvollen geometrischen Muster zeigt und ihn bittet, es zu beschreiben. »Sieht aus wie drei umgekehrte Pyramiden oder vielleicht – Ananas?«
Und als Kaplan E.H. nun bittet, mit dem Zählen fortzufahren, ist der total verdutzt. Er hat keine Ahnung, wie es weitergeht.
»Zählen – was? Was habe ich denn gezählt?«
»Sie haben Zahlen gezählt, so weit Sie können – und haben angehalten, um die Karte zu beschreiben. Aber jetzt, Eli, können Sie weitermachen.«
»Weitermachen – womit?«
»Sie wissen nicht mehr, bis wohin Sie gekommen sind?«
»Bis wohin, ich …? Nein, weiß ich nicht.«
Er schaut auf die Karte mit der Abbildung, die ihn aus dem Konzept gebracht hat, und begreift jetzt, dass es ein Trick ist.
»Als ich klein war, hab ich Karten gespielt. Ich hab auch Dame und Schach gespielt.« Er blickt sich um, als suche er nach weiteren Karten oder nach Brettspielen.
Seine Finger zucken. Seine im Allgemeinen freundlich blickenden Augen funkeln vor Zorn. Er würde sie zu gern zerfetzen, diese dumme Karte mit der Abbildung von Pyramiden oder Ananas!
Als sie E.H.s Miene sieht, regt sich in Margot das schlechte Gewissen. Ist der Test letztlich nicht grausam – ein Fall von seelischer Grausamkeit? Auch wenn E.H. bis jetzt sichtlich gern im Zentrum der Aufmerksamkeit stand.
Margot denkt: Aber gleich weiß er es nicht mehr. Er vergisst es.
Sie denkt an die Versuchstiere vergangener Jahrzehnte, denen manchmal die Stimmbänder durchtrennt wurden, so dass ihre Schmerzens- und Schreckensschreie keinen Ausdruck fanden. Auf die Weise blieben ihre Qualen ungehört, und ihr Leiden brauchte nicht zur Kenntnis genommen zu werden: vor einer neuen und humaneren Ära der Tierversuche, Milton Ferris aber noch gut erinnerlich, da ist Margot sich sicher.
Ferris hat oft gewitzelt über diese neue, humanere Ära, über die Beschränkungen, die sie der Forschung auferlegt, über den Fanatismus terroristischer Tierschützer, die gegen Experimente der Art protestieren, wie er sie noch vor kurzem mit phantastischem Erfolg durchgeführt hat.
Margot sinniert nicht gern darüber, wie sie sich in den Laboren früherer Zeiten verhalten hätte. Hätte sie gegen das Leid der Tiere protestiert? Oder hätte sie in stummer Scham mitgemacht? – denn Einwände zu erheben hätte die Entlassung aus dem Labor des großen Mannes zur Folge gehabt und das Ende einer Karriere in der Neurowissenschaft überhaupt bedeutet.
Alle Wissenschaft ist so, sagt sie sich, eine Suche nach der Wahrheit, die schwer zu finden ist, tief verborgen.
Denn die Wahrheit liegt nicht an der Oberfläche wie verstreute Fossilien, die man zusammenlegen kann wie ein Puzzle. Die Wahrheit ist verdeckt, verborgen, ist labyrinthisch. Was andere sehen, ist nur die Oberfläche – oberflächlich. Ein Wissenschaftler gräbt tiefer.
E.H. sieht sich ratlos im Untersuchungszimmer um, einem Raum, den er nicht erkennt. Es ist, als sei eine Bühnendekoration abgebaut worden und als stünden nur noch karge Wände da. Das strahlende Lächeln ist von seinen Lippen verschwunden. Elihu Hoopes ist ein Gestrandeter und hat einen schmerzlichen Verlust erlitten; er strahlt kein Charisma aus, sondern Verzweiflung. »Sie waren bei neunundachtzig«, sagt Margot sanft, um den verlorenen Mann zu trösten. »Sie haben es sehr gut gemacht, bis Sie unterbrochen wurden.« Die zornigen Blicke Kaplans und der anderen, weil sie das Falsche gesagt hat, übersieht sie.
Als er Margots leise, aber bestimmte Stimme hinter sich hört, wendet E.H. sich überrascht zu ihr um. Seine Aufmerksamkeit galt Kaplan, er hatte Margot vollkommen vergessen und ist überrascht, dass noch andere im Raum sind und Margot hinter ihm in der Ecke sitzt wie ein Schulmädchen, beobachtet und Notizen macht.
»Hal-lo! – hal-lo!«
Es ist klar: Er hat sie noch nie zuvor gesehen. Sie ist eine zierliche junge Frau mit ungewöhnlich heller Haut, schwarzen Augenbrauen und Wimpern und einem glänzenden schwarzen Pony, der ihre Stirn fast völlig bedeckt; ihre mandelförmigen Augen wären schön, hätte sie sie nicht beim Grübeln zu Schlitzen zusammengezogen.
Sie ist in exzentrisches Schwarz gekleidet, trägt Lagen von Schwarz wie eine Tänzerin. Mit dem Notizbuch auf dem Schoß, dem Stift in der Hand, der krausen Stirn und dem Lächeln ist sie – wohl – eine junge Ärztin? Medizinstudentin? Keine Krankenschwester. Er weiß, dass sie keine Krankenschwester ist. Trotzdem hat sie keinen weißen Laborkittel an. Sie hat kein Namensschild am Revers, und das irritiert und fasziniert ihn.
Ohne auf Kaplan und die anderen zu achten, streckt E.H. die Hand aus, um der jungen Frau die Hand zu schütteln. »Hal-lo! Ich glaube, wir kennen uns – wir sind zusammen zur Schule gegangen, nicht wahr? In Gladwyne?«
Die schwarzhaarige junge Frau zögert. Dann erhebt sie sich anmutig von ihrem Platz und kommt zu ihm, schiebt die Hand in seine und lächelt dazu.
»Hallo, Mr Hoopes – Eli. Ich bin Margot Sharpe, und vor heute haben Sie mich noch nie gesehen.«
Auf dem weißen Gesicht des Mädchens unter dem leicht bewegten Wasser liegen die Schatten von Libellen und Wasserläufern. Ein merkwürdiger Anblick: die Schatten der Insekten sind größer als die Insekten selbst.
Er hat sie gefunden, hier im Bach. Kein Mensch weiß davon – er ist allein hier.
Aber er sieht nicht hin, er hat das ertrunkene Mädchen (noch) nicht gesehen. Er war nicht dort, also kann er es nicht sehen. Er kann sich nicht an etwas erinnern, was er nicht gesehen hat.
Auf der Holzbrücke an dieser seltsamen Stelle so viele Jahre später wendet er sich nicht um. Er schaut nur geradeaus. Klammert sich mit beiden Händen fest an das Geländer, stemmt sich tapfer gegen den erwarteten Wind.
Kapitel zwei
»Mr Hoopes? Eli?«
»Hal-lo!«
»Mein Name ist Margot Sharpe. Ich bin Professor Ferris’ Mitarbeiterin. Wir kennen uns bereits. Wir sind gekommen, weil wir heute Vormittag ein wenig von Ihrer Zeit beanspruchen wollen …«
»Ja. Guten Tag.«
Seine Augen leuchten auf. Das Aufblitzen der Hoffnung in seinen Augen!
»Guten Tag, Margot!«
Ihre Hand von seiner umschlossen, ein wiedererkennendes Halten.
Er erinnert sich an mich. Nicht bewusst – aber er erinnert sich.
Noch kann sie darüber nicht schreiben. Noch hat sie dafür keine wissenschaftlichen Belege.
Der Amnesiekranke wird Arten des Erinnerns finden. Es ist eine nichtdeklarative Erinnerung, sie kommt ganz ohne das Bewusstsein aus.
Denn es gibt ein emotionales Gedächtnis, genauso wie es ein deklaratives Gedächtnis gibt.
Es gibt ein tief im Körper wurzelndes Gedächtnis – ein Gedächtnis, das von Leidenschaft hervorgebracht wird.
Von Glück durchströmt, fühlt sich Margot Sharpe wie ein Ballon, dem das schnell einströmende Helium Auftrieb gibt.
»Mr Hoopes? Eli?«
»Hal-lo! Hal-lo.«
Er lächelt sie erwartungsvoll an, beugt sich vor und schüttelt ihr die Hand.
In seiner großen, kräftigen Hand Margot Sharpes kleine Hand.
»Vielleicht erinnern Sie sich nicht, wir kennen uns bereits – Margot Sharpe. Ich bin eine Kollegin aus der Forschungsgruppe von Professor Ferris. Wir arbeiten schon, nun ja, einige Zeit zusammen.«