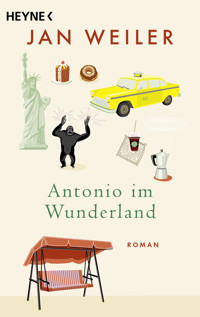10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was wissen wir schon über unsere Eltern? Meistens viel weniger, als wir denken. Und manchmal gar nichts. Die fünfzehnjährige Kim hat ihren Vater noch nie gesehen, als sie von ihrer Mutter über die Sommerferien zu ihm abgeschoben wird. Der fremde Mann erweist sich auf Anhieb nicht nur als ziemlich seltsam, sondern auch als der erfolgloseste Vertreter der Welt. Aber als sie ihm hilft, seine fürchterlichen Markisen im knallharten Haustürgeschäft zu verkaufen, verändert sich das Leben von Vater und Tochter für immer.
Ein Buch über das Erwachsenwerden und das Altern, über die Geheimnisse in unseren Familien, über Schuld und Verantwortung und das orange-gelbe Flimmern an Sommerabenden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Nachdem die fünfzehnjährige Kim einen katastrophalen Unfall verschuldet hat, wird sie zu ihrem Vater abgeschoben, den sie bisher nur von einem unscharfen Foto kannte. Anstatt also nach Florida zu fliegen, muss sie die großen Ferien am Rhein-Herne-Kanal bei einem Fremden absitzen. Dieser erweist sich nicht nur als ziemlich seltsam, sondern auch als der erfolgloseste Vertreter der Welt. Nach einem schwierigen Start versuchen Vater und Tochter, das Beste aus ihrer Zwangsgemeinschaft zu machen – und erleben den Sommer ihres Lebens.
Ein Buch über das Erwachsenwerden und das Altern, über die Geheimnisse in unseren Familien, über Schuld und Verantwortung und das orange-gelbe Flimmern an Sommerabenden.
Der Autor
Jan Weiler, ١٩٦٧ in Düsseldorf geboren, ist Journalist und Schriftsteller. Er war viele Jahre Chefredakteur des SZ Magazins. Sein erstes Buch Maria, ihm schmeckt’s nicht! gilt als eines der erfolgreichsten Debüts der letzten Jahrzehnte. Es folgten unter anderem Antonio im Wunderland, Mein Leben als Mensch, Das Pubertier, Die Ältern und die Kriminalromane um den überforderten Kommissar Martin Kühn. Neben seinen Romanen verfasst Jan Weiler zudem Kolumnen, Drehbücher, Hörspiele und Hörbücher, die er auch selbst spricht. Er lebt in München und Umbrien.
JAN WEILER
DER MARKISENMANN
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2021 by Jan WeilerCopyright © by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © t.mutzenbach design, München
unter Verwendung eines Fotos von svekloid / shutterstock.com
Motiv auf den Innenseiten: © shutterstock.com / ByMarietta
Herstellung: Mariam En Nazer
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28590-6V004
www.heyne.de
Für Milla
Prolog
Wenn ich an diesen Moment an diesem Sommertag im Juli 2005 zurückdenke – einem Donnerstag, und es war kurz nach 17 Uhr –, fällt mir kein Bild ein, sondern ein Gefühl: Enttäuschung. Ich war wirklich enttäuscht, als ich zum ersten Mal meinen Vater sah.
Ich hatte mir Ronald Papen anders vorgestellt. Bis meine Mutter mit mir fortging, als ich zweieinhalb Jahre alt gewesen war, habe ich ihn wahrscheinlich ständig gesehen. Aber zweieinhalb ist zu jung, um ein richtiges Bild vor Augen zu haben, eine Stimme im Ohr oder eine Erinnerung an seinen Geruch, seine Wärme oder seine Art, sich zu bewegen. In den folgenden dreizehn Jahren hatten wir keinen Kontakt. Mama hat das immer damit begründet, dass mein Vater kein Interesse an mir habe.
Heute weiß ich, dass das nicht stimmte und woran es lag, dass ich niemals etwas von meinem Vater hörte. Er schrieb jedenfalls keine Weihnachtskarten, er schickte keine Geschenke, er rief nicht an, und er ließ nichts ausrichten. Als einziger Beleg dafür, dass er überhaupt jemals existiert hatte, diente ein Foto, das es von ihm und Mama gab. Hintendrauf stand in ihrer Handschrift »Balaton 88«. Man konnte sein Gesicht darauf kaum erkennen, weil er eine merkwürdige breitkrempige Mütze und eine Sonnenbrille trug. Außerdem war das Foto verwackelt und rotstichig. Ein richtig schlechtes Bild, eines von jener Sorte, die man eigentlich aussortiert, um Fotoecken zu sparen. Dass Mutter sich die Mühe gemacht hatte, es einzukleben, wies darauf hin, dass sie ihr einmal wichtig gewesen war, diese eine missglückte Erinnerung an Ronald Papen. »Das ist dein Papa«, war alles, was sie dazu sagte.
Als kleines Kind habe ich das quadratische Foto mit dem weißen Rand oft betrachtet. Mama sah darauf sehr hübsch aus, soweit man das in der Unschärfe beurteilen konnte. Im Hintergrund waren Zelte zu erkennen. Wahrscheinlich wurde es auf einem Campingplatz aufgenommen.
Das Bild war das letzte im Album. Dahinter folgten ungefähr dreißig leere Seiten. Als sei ein Faden gerissen, als habe jemand mitten in einer Geschichte aufgehört, diese zu erzählen, um sich irgendeiner wichtigeren Tätigkeit zuzuwenden.
Als ich in die Schule kam und rechnen lernte, erhielt die Interpretation des Fotos eine neue Wendung. Falls das Bild tatsächlich aus dem Sommer 1988 stammte, war Mutter darauf noch nicht mit mir schwanger, denn ich wurde am 1. August 1989 geboren. In Österreich auf der Durchreise. Und zweieinhalb Jahre später trennten meine Eltern sich schon.
Natürlich fragte ich Mama nach meinem Vater, aber sie schwieg, wiegelte ab oder wurde ungeduldig, wenn ich von ihm anfing. Und irgendwann war das Foto nicht mehr im Album. Sie ließ Ronald Papen verschwinden, und das Bild von dem Paar auf dem Campingplatz verwischte mit der Zeit wie ein Traum, an den man sich nach dem Aufwachen erst genau, dann bruchstückhaft, dann unsicher und schließlich gar nicht mehr erinnern kann. Ich bekam ihn nicht mehr zusammen. Hatte er auf dem Bild gelächelt oder nicht? Steckte eine Zigarette in seinem Mund, oder war das ein Kratzer auf dem Fotopapier gewesen? Je mehr ich versuchte, mich zu erinnern, desto intensiver wurde das Ersatzbild, das ich mir aus meinen Informationen zurechtbastelte.
Wenn mein Stiefvater Heiko meinen Vater erwähnte, nannte er ihn den »feinen Herrn Papen«. Ich wusste noch nicht, was Sarkasmus war, aber diesen feinen Herrn stellte ich mir als einen Mann mit Sonnenbrille und dreiteiligem Anzug vor, sehr groß, wie alle Väter sind, sehr freundlich auch, aber beschäftigt mit ernsten Details eines unbegreiflichen Berufes. Manchmal tagträumte ich, wie ich ihn in seinem Büro überraschte und plötzlich vor seinem Schreibtisch stand, die Hände in die Hüften gestemmt. Er wedelte Zigarrenrauch beiseite, um mich besser sehen zu können, und ich rief: »Warum kommst du mich nie besuchen!« Mehr Klage als Frage. Aber ich erhielt keine Antwort und konnte sein Gesicht in den Schwaden nicht richtig erkennen. Sosehr ich mich in diesen Film hineinträumte und so viel ich auch darüber nachdachte: An dieser Stelle endete die Handlung, denn mir fiel kein plausibler Grund für sein Verhalten ein, und deshalb konnte ich ihn nicht antworten lassen.
»Ich habe keine Zeit.«
»Ich habe kein Interesse an dir.«
»Ich darf nicht.«
»Ich trau mich nicht.«
Keiner dieser Sätze passte, auch nicht der Gedanke, dass er mich nicht hätte finden können. Schließlich hatte ich ihn ja auch aufgespürt, zumindest in meinem Tagtraum.
In späteren Jahren verfestigte sich bei mir die dramatische Vorstellung, dass er nicht dazu in der Lage war, sich zu melden, weil er seine Stimme eingebüßt hatte oder noch grauenhafter: sein Gedächtnis. Lange Zeit stellte ich mir vor, dass er von einem Berg gefallen war und dabei sämtliche Erinnerungen verloren hatte. Ich fragte meine Mutter, was mit solchen Menschen geschehe, und sie sagte: »Die kommen in ein Heim, und man wartet ab, ob ihnen wieder einfällt, wer sie sind.« Und was sei, wenn es ihnen nicht einfalle, wollte ich wissen. Sie zuckte mit den Schultern. »Dann bleiben sie eben für den Rest ihres Lebens dort. Sie gehören ja nirgends hin.« Ich nahm also an, dass mein Vater irgendwo in einem Sessel saß und verzweifelt versuchte, sich an mich zu erinnern. Eine törichte Idee, denn wenn sich jemand nicht besinnen kann, dann weiß er meistens auch nicht, worauf. Er wird sich also kaum die Frage stellen, wo sein Kind ist und wie es noch mal heißt, sondern, ob er jemals eines hatte. Ich stellte mich darauf ein, dass der Prozess seiner Gesundung lange dauern könnte. Und darüber verlor ich allmählich mein Gefühl der Neugier und des Wohlwollens gegenüber Ronald Papen.
Mehr noch: Ich entwickelte einen regelrechten Unwillen gegen den unscharfen Mann, weil ich ihm unterstellte, sich nicht genug Mühe mit seiner Erinnerung zu geben. Oder: Womöglich hatte er längst aufgegeben und eine neue Familie gefunden. Vier Kinder gezeugt, sein altes Leben in eine Klarsichthülle geschoben, abgeheftet und den Ordner im Keller verstaut. Es machte mich mit der Zeit ungnädig, an ihn zu denken.
In meinen Gedanken entwickelte er sich schließlich zu einem grobschlächtigen Kerl mit dicker Nase und riesigen Füßen. Manchmal malte ich ihn mir in einem grotesk großen Anzug aus, denn auf meine Frage, was er beruflich mache, antwortete Mama, dass er »Geschäftemacher« sei, was Ungutes vermuten ließ. Bei mir bekam er also eine dröhnende Stimme und ein unstetes Wesen. Ich vermutete, dass er kriminell war und meine Mutter sich deswegen von ihm getrennt hatte. Vielleicht saß er bereits seit Jahren im Gefängnis, oder er hatte sich auf Nimmerwiedersehen ins Ausland abgesetzt.
Mit diesem Bild hakte ich ihn ab, und als ich fünfzehn war, dachte ich kaum mehr an Ronald Papen. Wenn Freundinnen bemerkten, dass ich nicht so hieß wie meine Mutter und ihr Mann und nach meinem richtigen Vater fragten, sagte ich, was man sagt. Was viele sagen, weil es wahr ist, und weil es die Bedeutung des Unscharfen so weit herunterspielte, wie nur irgend möglich: »Ich kenne ihn nicht. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich noch klein war.« Und wenn sie weiterfragten, ob ich nicht neugierig auf ihn sei, antwortete ich, dass er sich nicht für mich interessiere und ich mich daher nicht für ihn. Es sei okay so. Und damit war das Thema erledigt.
Und außerdem hatte ich ja besagten Heiko. Mama wollte, dass ich ihn »Papa« nenne, obwohl mir schon früh bewusst war, dass er das nicht war. Er sah mir so wenig ähnlich wie ein Klavier einer Geige, und er betonte sehr regelmäßig, wie teuer Kinder seien, und dass der feine Herr Papen nicht bereit sei, für meinen Unterhalt zu bezahlen. Was das bedeutete, verstand ich lange nicht. Das waren jedenfalls die einzigen Momente, in denen mein Familienname bei uns zu Hause erwähnt wurde. Als sei er mit einem Makel behaftet. »Papen« war so etwas wie »Schmarotzer« oder »Parasit« oder »Tochter aus erster Ehe«. Heiko Mikulla schien den Vater der Tochter seiner Frau nicht zu mögen, er schien auch mich nicht zu mögen, und ob er meine Mutter mochte, war manchmal ebenfalls unklar. Aber er hatte immerhin ein großes Haus in Hahnwald gekauft, in dem wir wohnten. Mama fand, wir sollten ihm dafür dankbar sein. Sie war es jedenfalls und ertrug Heiko mit einer Ausdauer, die mir damals fast wie hündische Ergebenheit vorkam.
Ich bekam nie so ganz genau heraus, wann oder wie sie sich kennengelernt hatten, aber es gab wohl einen nahtlosen Übergang von Ronald Papen zu Heiko Mikulla. Womöglich hatte er sie meinem Vater ausgespannt. Oder sie hatte sich in Heiko verliebt und eine Affäre mit ihm begonnen. Vielleicht Balaton 88. Das hätte aber bedeutet, dass ich womöglich gar nicht meines Vaters Kind gewesen wäre, was ich kategorisch ausschloss, weil ich keinesfalls Heikos Tochter hätte sein wollen. Lieber die des Unscharfen als die des Unerträglichen.
Heiko und Mutter bekamen noch einen Sohn und heirateten vor dessen Geburt. Sie nahm seinen Namen an, und damit war ich eine Papen zwischen drei Mikullas. Heiko, Susi und Geoffrey Mikulla. Sie nannten ihn Jeff oder Jeffy, als sei er ein Cockerspaniel.
Ich bin sechs Jahre älter als er, komme in die Schule, und kein Mensch interessiert sich dafür, weil Jeff Koliken hat und ständig herumgetragen werden muss. Ich bin acht und mache den Freischwimmer, was unbeachtet bleibt, weil Jeffy anfängt zu laufen. Ich bin gut in der Schule und ansonsten weitgehend unsichtbar, während Geoffrey alles unternimmt, um wahrgenommen zu werden. Er ist eine menschgewordene Heulboje, die bei der kleinsten seelischen Erschütterung in Betrieb geht.
Der Vorteil dieser familiären Konstruktion bestand darin, dass ich meistens meine Ruhe hatte. Das ist die euphemistische Beschreibung des Umstandes, dass sich kein Mensch um mich kümmerte. Ich nahm Mama das nicht einmal übel, ich kannte es ja nicht anders und fühlte mich in der Unsichtbarkeit sogar ganz wohl. Niemand sagte mir, wann ich ins Bett gehen sollte, und niemand schimpfte wegen der Poster an der Wand meines Zimmers oder der Unordnung darin, weil einfach keiner zu mir reinkam.
Aber manchmal wünschte ich es mir. Dann saß ich am Schreibtisch und zeichnete und stellte mir vor, dass Mutter hereinkam, an mich herantrat, meinen Nacken kraulte und mich lobte. Dafür würde ich ihr das Bild schenken, und sie würde es an den Kühlschrank kleben. Aber dort klebte nie etwas.
Das klingt melancholisch. Dabei ging es mir gut. Ich hatte ein ziemlich großes Zimmer für mich alleine und sogar ein halbes Bad. Die andere Hälfte benutzte Geoffrey, den ich insgeheim Shrimp nannte, für mich damals der Inbegriff für ein verschlagenes, wurmhaftes Wesen, dem jede Anmut oder wenigstens eine herzwärmende Menschenähnlichkeit fehlt, die selbst Amphibien aufbringen können. Ich hasste meinen kleinen Halbbruder regelrecht, dabei konnte er nichts dafür, der geliebte Wunschsohn neben einer unerwünschten Pflichttochter zu sein. Geoffrey hier, Geoffrey da.
Während Mama und Heiko damit beschäftigt waren, über die Anschaffung sinnloser Dinge zu diskutieren, mit denen sie das Haus nach und nach vollstopften, verbrachte ich meine Kindheit damit, so zu werden wie sie, nämlich weitgehend konsumorientiert und ichbezogen. Ich könnte an dieser Stelle schwindeln und behaupten, schon immer sozial engagiert gewesen zu sein, Mitglied bei den Pfadfindern oder wenigstens erfolgreich im Sportverein. Oder schon ganz früh politisch interessiert. Aber ich bin bis heute in keinem Verein und fand Politik schon immer langweilig. Die Wahrheit ist, dass ich eine emotional vernachlässigte, aber materiell verwöhnte Tochter war. Und dass Heiko und Susi Mikulla irgendwann lieber mit dem Teufel Golf gespielt hätten, als auch nur eine Minute länger als nötig mit mir zu verbringen. Kein Wunder, dass mein Stiefvater und meine Mutter mir vollkommen gestört erschienen.
Man sagt, dass Hunde kein Sättigungsgefühl verspüren. Solange man ihnen eine Praline vors Maul hält, schnappen sie danach. Selbst wenn sie bereits fünf Kilo davon im Bauch haben. Ungefähr so waren die Mikullas. Heiko hatte ein Vermögen mit Beteiligungen gemacht. Er kaufte und verkaufte Firmen. Investierte in die Ideen anderer. In seiner Sprache hieß das: »Ich handele mit Visionen.« Wenn er sich für eine Firma begeisterte, die zum Beispiel weiße Billardtische für reiche Araber herstellte, dann kaufte er Anteile oder gleich den ganzen Laden, knüpfte Kontakte zu vermögenden Kunden, organisierte das Geschäft neu, und wenn es funktionierte, verkaufte er das Unternehmen weiter. Natürlich hatten wir dann auch einen weißen Billardtisch.
Heiko und Mama waren ständig irgendwo eingeladen und fuhren durch halb Europa, um sich irgendwelche Investitionsmöglichkeiten anzusehen. Fitnessgeräte für Hotels. Das letzte Auto von John Lennon. Eine Farm, auf der Gänse gestopft wurden. Heiko interessierte sich niemals für die Menschen, deren Geschäfte oder Produkte er kaufte. Sein todsicherer Instinkt für die Monetarisierung von Ideen trieb ihn an.
Ob meine Mutter ihn liebte, bewunderte oder fürchtete oder alles zur selben Zeit empfand, wusste ich nicht. Ihre Beziehung war mir damals so sehr ein Rätsel wie ihre gemeinsame Geschichte. Sie stritten eigentlich die meiste Zeit, und wenn einmal Frieden zwischen ihnen ausbrach – anders kann man das nicht nennen –, war mir das viel unheimlicher, als wenn sie sich gegenseitig Gemeinheiten oder Crushed Ice an den Kopf warfen, weil er an ihrem Essen herummeckerte. Womit er übrigens meistens völlig recht hatte.
In den guten Phasen umgurrten sie sich und gingen derart aufgegeilt miteinander um, dass man ständig das Gefühl hatte, bei einem ersten Rendezvous zu stören. Ich machte mich also noch unsichtbarer, als ich es ohnehin bereits war, und verschwand buchstäblich in meinem Zimmer. Oder bei Delia.
Delia brachte mir mit elf Jahren das Rauchen bei. Sie wohnte in der Nachbarschaft, und ihr Vater saß im Vorstand eines Dax-Unternehmens. Deshalb genoss er Personenschutz und wurde jeden Tag wie exotische Feinkost in einem klimatisierten Fahrzeug morgens abgeholt und abends wieder nach Hause gebracht. Heiko war darauf neidisch. Aber er fand es auch von Vorteil, weil auf diese Weise die Straße sehr gut bewacht war und er sich den Betrieb der Alarmanlage sparen konnte. Unsere war seit Jahren ausgeschaltet, weil Mama einmal nachts um vier betrunken in den Pool gestolpert war und mit dem Alarm den halben Hahnwald aufgeweckt hatte.
Delia wies mich auch in die Kunst des Klauens ein, und bis ich vierzehn war, gelang es mir bei unseren Beutezügen in der Kölner Innenstadt, für ein paar Tausend Euro Kosmetik zu stehlen, die ich anschließend unter Handelspreis in der Schule verkaufte. Dabei hätte ich das Geld nicht gebraucht. Was mir viel mehr bedeutete, war die Bewunderung der kleinen Mädchen, die bei mir Lippenstifte oder Rouge bestellten. Ich zog ihnen das gefaltete Taschengeld aus den kleinen Portemonnaies und vergaß es. Irgendwann hatte ich in jeder Jeans klumpige Zehneuroscheine, die einfach mitgewaschen wurden, verschwanden oder wieder auftauchten.
Die Freundschaft mit Delia, die älter war als ich und bereits zwei Mal wiederholt hatte, hielt, bis ich selbst sitzenblieb. Danach wollte sie nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich ihr zu jung wurde. Ich war ja dann erst in der achten Klasse, und sie hätte eigentlich in die Elfte gehört.
Sie verließ mich, und ich brachte es nicht in den Zusammenhang, in den es gehörte: Der Unscharfe hatte mich verlassen, Mama hatte mich auf eine gewisse Weise verlassen, und nun hatte mich Delia verlassen. Das waren die drei Personen, die mir in dieser Zeit am meisten bedeuteten. Es war mir nicht bewusst, aber natürlich hatte es Folgen, denn ich kämpfte mich danach immer mehr mit meiner Unsichtbarkeit ab. Ich trat dagegen an, weil ich gesehen werden wollte. Und das gelang mir schließlich, wenn auch keineswegs auf die Weise, die ich mir insgeheim gewünscht hatte.
Als der Kaufhofdetektiv mich am Arm festhielt, hatte ich gerade ein Schminkpinsel-Set unter meinen Pullover geschoben. Es fiel heraus und auf den Boden. Das war Pech, weil es zerbrach und ich es anschließend auch noch bezahlen musste. Ich bekam eine Anzeige und Hausverbot, aber das Schlimmste war, dass Mama angerufen wurde. Sie schimpfte nicht einmal, sondern ignorierte mich völlig, als sie in das Büro des Detektivs kam. Man spielte ihr die Aufnahme der Überwachungskamera vor, erklärte ihr die nächsten Schritte, und sie fing sogar noch an, mit dem Typen zu flirten. Ob man da wirklich jeden Winkel ausspähen könne. Und dass er ja Adleraugen habe. Sie nannte ihn »Inspektor« und spielte die Doofe. Schließlich fragte sie ihn, ob man die Sache nicht einfach gegen einen angemessenen Betrag, eine Art Belohnung für seine Umsicht, als Übung betrachten könne. Das machte ihn verlegen, aber am Ende sagte er, dass er den Vorfall schon angezeigt habe, es sei zu spät. Mama vollzog in Sekundenbruchteilen einen beeindruckenden Stimmungswechsel und erkaltete wie eine verloschene Kerze in einer Gruft.
Dann drehte sie sich zu mir um, machte eine knappe Kopfbewegung, und ich folgte ihr ins Parkhaus. Auf der Rückfahrt sagte sie kein Wort. Abends erklärte Heiko Mikulla, dass er wenig Lust habe, mit einer Asozialen am Tisch zu sitzen. Ich wurde gebeten, in der Küche zu essen, wo ich das Risotto in den Mülleimer gleiten ließ. Ich war sicher, dass Heiko darauf neidisch war. In den Wochen darauf herrschte bei uns eine Stimmung wie im Führerbunker am 30. April 1945. Das gefiel mir beinahe, weil dadurch auch die quälende Eintracht der Mikullas in guten Phasen wegfiel.
Die Ehrenrunde sowie die neunte Klasse schaffte ich knapp, obwohl ich manchmal ganze Tage damit verbrachte, mit Freundinnen auf der Domplatte zu sitzen oder am Rhein, wo die Polizei seltener nach Schulschwänzern suchte. Heiko, Mama und ich hatten eine Art Nichtangriffspakt geschlossen: Ich machte ihnen keinen Ärger, und sie ignorierten mich.
Immerhin wurde ich nicht volltrunken nach Hause gebracht, und ich kiffte auch nicht wie die meisten aus meinem Freundeskreis. Ich bewahrte keine Bong zu Hause auf, und ich klaute nicht mehr, zumal ich irgendwann wirklich fast alles schon einmal hatte mitgehen lassen, mit Ausnahme eines U-Bootes und der britischen Kronjuwelen. Es besaß keinen Reiz mehr; wenn ich irgendwas haben wollte, kaufte ich es mit meiner Notfall-Kreditkarte, die das Haushaltskonto belastete. Geld war eben genug da, es interessierte mich nicht. Was ich lieber gestohlen hätte, was sich aber nicht stehlen ließ, waren gute Momente mit Mama. Manchmal gab es sie, dann waren wir gemeinsam albern, und sie berührte mich oder gab mir einen Kuss. Sie teilte mir ihre Liebe zu, und sie entzog sie wieder, als würde sie sich ihrer schämen. Es war dann, als fiele ihr wieder ein, wessen Kind ich war.
Als ich in die zehnte Klasse kam, verliebte ich mich in Max, den schönsten Jungen der Schule. Keine besonders originelle Wahl, wie man rückblickend sagen muss. Es war kein Kunststück, hingerissen von ihm zu sein. Umgekehrt verteilte er seine Gunst ziemlich strategisch, und als er auf einer Silvesterparty die Chance sah, mich zu entjungfern, ließ er sich dazu herab, was ich unfassbar romantisch fand. In der ersten Januarwoche wurde klar, dass damit keineswegs die von mir ersehnte lebenslange Liebesbeziehung begann, sondern genau genommen überhaupt gar nichts. Er reagierte nicht auf meine Anrufe, und er ging lächelnd an mir vorbei, als ich ihn zu Hause abpassen und zur Rede stellen wollte.
Das machte mich traurig und wütend. Ich empfand mich wieder einmal als verlassen, auch wenn Max ja nie mit mir zusammen gewesen war und mich daher auch nicht sitzen gelassen hatte. Aber in meinen Träumen war er mein erster fester Freund gewesen, und der Schmerz über seinen Verlust war größer als die tröstliche Gewissheit, in meinem ganzen zukünftigen Leben nie wieder so stümperhaften Sex zu haben.
In den Wochen und Monaten nach der Sache mit Max zog ich mich jedenfalls immer weiter zurück. Und da ich keine Lust hatte, ihm in der Schule andauernd über den Weg zu laufen, ging ich noch seltener hin. Meine Entschuldigungen fälschte ich, und wenn ein Attest gebraucht wurde, ging ich zur Frauenärztin und klagte über Bauchschmerzen, was ohne weitere Untersuchungen zu einer Bescheinigung führte. Die Schule gab mir nichts. Ich gab nichts zurück.
Natürlich verlor ich den Anschluss; um Ostern herum kam der Brief mit der Mitteilung, dass ich wahrscheinlich das Klassenziel nicht erreichen werde. Mama tat, wovon sie dachte, dass es angemessen sei, und rauchte wie wild, während sie mir einen Vortrag darüber hielt, wie wichtig Bildung sei, und dass ich mein Leben wegwerfe. Gerade für eine junge Frau sei es wichtig, einen ordentlichen Abschluss zu haben. Schon, um nicht in Abhängigkeit zu geraten. Da sprach sie von sich selbst, was ich so traurig fand, dass ich sofort anfing zu weinen. Mutter nahm mich in den Arm, und wir hielten uns über zehn Minuten lang. Das war bis dahin beinahe der beste Moment meiner Jugend. Sie fing sich und sagte, es sei ein Drama mit mir, diese Mischung aus Faulheit, Verstocktheit und Desinteresse. Dabei sei ich nicht dumm, jedenfalls habe sie das immer gedacht. Was man mit mir machen solle? Dann eben doch Internat, seufzte sie, und dass sie das Thema mit Papa, also mit Heiko, besprechen werde.
Ich machte mir keine Sorgen, dass sie mich abschieben würden, da konnte ich mich vollkommen auf Heiko verlassen, der abends erklärte, dass er sein schwer verdientes Geld nicht dafür verballern werde, aus mir ein brauchbares Mitglied der Gesellschaft zu machen. Wenn jemand ein Internat zahlen solle, dann ja wohl der feine Herr Papen. Und damit war die Sache vom Tisch. Mama besaß ja kein eigenes Geld.
Natürlich hatte ich wenig Lust, eine weitere Ehrenrunde auf dem Gymnasium Rodenkirchen zu drehen, und fing dann doch an, mich gegen das Schicksal zu stemmen. Wobei man da nicht von einem wirklich energischen Aufbäumen sprechen kann, eher von einem schwachen Aufrichten. Ich schaffte es einfach nicht, genug Energie für die vier Fächer aufzubringen, in denen ich gefährdet war. Es ging nichts hinein in diesen Kopf. Oder alles gleich wieder hinaus.
Nach Pfingsten hatte ich mich zwar in drei Fächern leicht verbessert, aber in einem noch weiter verschlechtert. In Mathematik. Glatte Sechs, völlig hoffnungslos. Es war, als würde man klare Brühe durch ein Sieb schütten. Und natürlich war es auch viel zu spät. Ich trieb unaufhaltsam in einem Strom von mathematischen und chemischen Formeln, nicht gelernten Vokabeln und nur überflogenen Schullektüren auf die Kante eines Wasserfalls zu, der mich magischerweise ein weiteres Mal in die zehnte Klasse und dann wieder in genau dieselben Stromschnellen befördern würde. Ich sah mich als Versagerin, zumal mir jede Idee fehlte, was ich mit meinem Leben hätte anfangen können.
Ich erzähle das alles, damit klar wird, wie es um mich bestellt war in jener Zeit, Monate vor dem einen Vorfall, der danach mein Leben bestimmte. Dinge geschehen nicht einfach so. Oft gibt es lange Ketten von Ereignissen. Um zu verstehen, was dazu führte, dass ich schließlich bei Ronald Papen abgeliefert wurde, muss ich von diesen Ereignissen erzählen. Und von diesem Tag, an dem sich mein Leben buchstäblich explosionsartig ändern sollte.
Heiko hatte ein neues Produkt entdeckt, das er groß machen wollte, richtig groß. Das war Ende Mai. Er hatte es aus den USA mitgebracht, wo er es bei einem Bekannten in Florida gesehen hatte. Bei dem Ding handelte es sich um einen sagenhaft scheußlichen Grill. Ein Monstrum, in dem man sowohl Kohle verfeuern als auch mit Gas heizen konnte. Je nachdem, was man zubereiten wollte. Heiko war kaum zu bremsen in seiner Begeisterung. Der Grill verfügte über einen schweren Deckel, um das Fleisch schonend garen zu können, über einen Dampfbereich für Gemüse und natürlich über herkömmliche Barbecue-Flächen. Bei Heiko klang das alles so großspurig, als handele es sich bei dem ganzen riesigen Aufbau nicht um einen Grill, sondern um eine Marsstation. Er wusste bloß noch nicht, wie er das Teil nennen sollte. »The Barbecue Beast« vielleicht. Oder »Grill-Gigant«. Oder »Würstchen-Panzer«. »Heikos heiße Hütte«. Er war wahnsinnig aufgeregt, was immer ein Zeichen dafür war, dass er ein riesiges Geschäft imaginierte.
Gegen Abend kamen drei Paare aus der Nachbarschaft, und Heiko begann mit einem ebenso langweiligen wie begeisterten Vortrag über die Vorzüge der AmericanPool-Kitchen. Immerhin waren die Gäste ganz aus dem Häuschen, und als alle bereits stark angeheitert waren, zündete er endlich die Kohle an, was ihm nicht auf Anhieb gelang. Er spritzte ungefähr einen halben Liter Brennspiritus in die Briketts, aber die wollten nicht durchglühen. Mir war das egal, aber Mama wurde langsam sauer, weil sie Hunger bekam, und der Ton wurde gereizter. Alle riefen durcheinander, besonders Geoffrey, der es kaum ertragen konnte, nicht im Mittelpunkt zu stehen.
Heiko fing an, über den Grill zu fluchen, was man als Eingeständnis werten konnte, einer Schnapsidee aufgesessen zu sein. Aber irgendwann glühte die Kohle dann doch, und er legte Würstchen, Schaschlik und Fleisch auf den Rost, was die Stimmung deutlich verbesserte. Es wurde schon dunkel, und der Salat war praktisch aufgegessen. Ich hatte die ganze Zeit brav am Tisch gesessen, weil Mama meine Unsichtbarkeit nicht akzeptierte, wenn Gäste da waren. Vor anderen mussten wir natürlich heile Familie spielen.
Als einer der Gäste, der bodenlos schmierige Glotzer Hüttenwald, mich fragte, wie es in der Schule laufe, antwortete ich nicht, weil mir nicht einfiel, was ich dazu sagen sollte, dafür sprach Heiko und erklärte der Grillgesellschaft, dass die kleine Papen mal wieder vor einer Ehrenrunde stünde. Und dass er leider seine Gene nur ein Mal verbreitet habe, sonst sähe die Sache ganz sicher anders aus.
Hüttenwald lachte und starrte auf meine Titten, seine Frau keuchte, dass man es sich mit den lieben Kleinen nicht aussuchen könne. Und Mama sagte zu meiner Verteidigung nur: »Sie ist ja nicht dumm, bloß so hoffnungslos verstrickt in ihre kleinen Seelennöte.« Als sei ich gar nicht dabei. Ich wäre am liebsten aufgestanden, aber das hätte ihnen ja recht gegeben: Da läuft es, das verstockte Ding. Also blieb ich sitzen, schaute auf den Tisch und suchte nach etwas, um mich abzulenken. Ich wollte etwas tun, nicht bloß auf dem Präsentierteller hocken wie ein kranker Bonobo im Affenhaus. Also griff ich nach einer Plastikflasche, die auf dem Tisch herumstand, und begann, darauf herumzudrücken.
Heiko schien den Krieg gegen das Grillgut zu gewinnen und rief: »Nur noch wenige Minuten, dann werdet ihr für eure Geduld mehr als belohnt!« Damit ebbte das Interesse an mir ab. Die Gäste stießen an, und ich saß weiter auf meinem Stuhl, als würde ich innerlich brennen, die Flasche in der Hand, den Blick auf den Boden gerichtet.
In diesem Moment kam Geoffrey angetanzt und zwar buchstäblich. Er hatte zwei Gartenfackeln in den Händen und turnte am Rand des Pools entlang. Er vollführte eine Art schamanischen Beschwörungstanz oder was er mit seinen neun Jahren dafür hielt. Mama rief »Jeffy, pass auf mit dem Feuer«, und Heiko brüllte, das sei der Hahnwalder Würstchentanz. Er und die Gäste klatschten rhythmisch, was Jeffy noch weiter aufheizte und seine Bewegungen noch gewagter und alberner aussehen ließ.
»Klatsch mit, Kim«, forderte mich Mama auf, aber Heiko winkte ab und sagte: »Lass sie doch, die beleidigte Leberwurst. Jeff! Jeff! Jeff!« Alle riefen seinen Namen. Jeff. Jeff. Jeff. Klatsch. Klatsch. Klatsch. Der Kleine drehte auf, und ich drückte fest auf die Flasche. Im nächsten Moment stand mein Bruder in Flammen.
Über diesen Moment ist in den Wochen danach so viel geredet worden. Warum ich das getan hatte? Was mir dabei durch den Kopf gegangen war? Ob mir klar war, was ich tat? Und ob ich Geoffrey umbringen wollte? Meine Antworten blieben immer dieselben.
Ich weiß es nicht.
Nichts.
Nein und noch einmal nein.
Ich habe es einfach getan. Ohne zu denken oder zu fühlen. Jedenfalls kann ich mich an nichts erinnern. Die Psychologin in der geschlossenen Abteilung der Kinder- und Jugendpsychiatrie baute mir eine Brücke und sagte mir vor, dass ich vielleicht gedacht habe, es sei Wasser in der Flasche. Ich hätte geglaubt, Geoffrey könnte sich mit den Gartenfackeln verletzen. Womöglich wollte ich Gutes tun und ihn löschen. Ich hätte mir diese Sichtweise aneignen können, aber das wäre lächerlich gewesen. Natürlich wusste ich, dass die Flasche, mit der ich da herumspielte, Brennspiritus enthielt. Und dass oben in der Kappe ein Loch war. Und dass man mit einem heftigen Druck auf die Flasche einen festen Strahl aus Spiritus abschießen konnte. Es war mir klar.
Ich sehe mich auf dem Stuhl neben dem Grill sitzen. Heiko hat die Flasche mit dem Brennspiritus neben meinem Platz abgestellt. Es wird dunkel. Ich fühle mich nutzlos, gedemütigt und angeglotzt. Geoffrey ist der Größte. Alle lachen und schreien. Dann dieses furchtbare Geklatsche. Vielleicht war es das Klatschen. Oder das Gesicht, mit dem mein Halbbruder auf mich zu tanzte. Dieser Gesichtsausdruck, der ausschließlich zu mir zu sprechen schien: »So macht man den Eltern eine Freude! Du Versagerin! Du Verschwendung! Du Papen!«
Ich bezweifle inzwischen, dass so etwas in dem Gesicht eines Neunjährigen steht. Aber ich weiß, dass Fünfzehnjährige so etwas darin lesen können. Geoffrey war nur fröhlich und hat geguckt, wie ein leicht überdrehter kleiner Junge eben guckt, wenn er unter der Anfeuerung von einem Rudel angetrunkener Erwachsener mit zwei Gartenfackeln herumtanzt.
Jeff bewegt sich auf den Tisch zu. Der Tisch steht an der Längsseite des Pools. Das Licht im Schwimmbad ist eben automatisch angegangen, weil die Sonne untergeht. Es beleuchtet ihn schwach, aber stimmungsvoll bei seinem Auftritt. Die Würstchen pfeifen, die Gläser klirren, Heiko brüllt »Jeff«, alle brüllen »Jeff«, alle sind besoffen. Nur ich bin nüchtern, und ich will, dass es endlich aufhört, das Gebrüll, das Gefuchtel, das Geräusch der Flammen, das Geklatsche, der Gestank von Fenchel-Würstchen, der ganze Scheiß in unserem Garten. Aber ich kann nicht weglaufen. Und in der nächsten Sekunde halte ich die Flasche in seine Richtung und spritze einen dicken Strahl Brennspiritus mitten auf sein T-Shirt. Ich sehe genau, wie die Tropfen durch die Flamme einer der Gartenfackeln schießen und sich dabei entzünden. Die brennenden Tropfen landen auf seinem von Brandbeschleuniger durchtränkten Hemd, und in der nächsten Tausendstelsekunde verpufft alles in einer riesigen Stichflamme.
Bis heute sehe ich diesen Moment in Zeitlupe ablaufen und auch, was danach passiert. Heiko lässt die Grillzange fallen, schießt an mir vorbei auf seinen Sohn zu, reißt ihn um und stürzt sich mit ihm in den Pool, wo auch die beiden Fackeln landen. Sofort sind sämtliche Flammen gelöscht. Alles in allem dauert der ganze Moment nicht länger als vielleicht drei oder vier ewige Sekunden, für deren Vergegenwärtigung ich heute noch zehn Minuten brauche. Und wenn es etwas gibt, wofür ich Heiko Mikulla bis an mein Lebensende dankbar bin, dann für seine Geistesgegenwart in diesem Augenblick.
Ich habe die Flasche immer noch in der Hand, als die anderen Gäste Heiko dabei helfen, seinen Sohn aus dem Wasser zu bekommen. Frau Rath steht vor mir und sagt, ich sei Satan. Sie sehe die Bosheit in meinen Augen. Hüttenwald ruft einen Notarzt, und weil er dabei erwähnt, dass soeben ein Mordanschlag verübt wurde, kommt auch gleich noch die Polizei mit drei Autos.
Zwei Stunden später sitze ich in der Aufnahme der Jugendpsychiatrie. Die Polizei hat meinen Stiefvater kaum beruhigen können, Mama ist bei Geoffrey im Kinderkrankenhaus, mich hat man gleich nebenan in der psychiatrischen Abteilung abgeliefert. Und die Würstchen kann man nicht mehr essen.
Ich blieb gute sechs Wochen in der Psychiatrie und musste nicht mehr in die Schule, es hätte auch nichts gebracht. Auf der Station gefiel es mir sogar, mir war nicht danach, zu Hause zu sein. Mama kam mich immerhin drei Mal besuchen.
Ich teilte mir das Zimmer mit einem Mädchen in meinem Alter aus Erftstadt, das sich seine langen Haare wie eine Gardine vor das Gesicht hängte und alles Mögliche unternahm, um an spitze Gegenstände zu kommen, mit denen es sich dann auf der Toilette ritzte. Ich nahm jeden Tag an einer Gruppentherapie teil, wir kochten gemeinsam und aßen an einem langen Tisch. Abends sahen wir Filme oder spielten. Jeden Nachmittag hatte ich eine Sitzung mit einer jungen Psychologin, die ich mochte, die mir aber nicht helfen konnte, weil ich mich gar nicht als krank empfand.
Ich war noch nie aggressiv oder gewalttätig aufgetreten, weder gegen andere noch gegen mich selbst. Ich wurde nicht missbraucht und auch nicht geschlagen. Ich nahm keine Drogen, wenn man von Zigaretten und meiner aufkommenden Leidenschaft für Prosecco einmal absah. Eine Weile hatte ich viel geklaut, ich war schlecht in der Schule und zu Jahresbeginn unglücklich verliebt gewesen. Für ein fünfzehnjähriges Mädchen war das nichts Besonderes. Dennoch hatte ich meinen kleinen wehrlosen Halbbruder beinahe umgebracht. Und das nicht aus Versehen. Die Psychologin sprach von einer Episode. Davon, dass unter einem großen emotionalen Stress so etwas passieren könne. Jeder noch so unauffällige Mensch könne auf eine Weise angetriggert werden, dass er etwas Ungeheuerliches tat. Dass es vielleicht schon lange in mir geschlummert habe. Dass es sicher auch mit meinem schwierigen Verhältnis zu meiner Mutter zu tun hätte. Und dass wir etwas gegen den Stress unternehmen müssten. Dem konnte ich zustimmen. Ich hatte bloß keine Ahnung, was. Als sie nach meinem leiblichen Vater fragte, antwortete ich, was ich in diesen Fällen immer antwortete. Die Therapeutin nickte verständnisvoll.
An einem Donnerstagmittag kam Mutter und holte mich ab. Die Einrichtung wurde über die Sommerferien geschlossen, und am letzten Schultag mussten alle Jugendlichen die Station verlassen. Das Mädchen aus meinem Zimmer wurde von seinem Vater abgeholt, der genauso aussah wie es, inklusive der Haare.
Mama kam, sprach mit der Psychologin in deren Büro, und ich packte meine Sachen. Dann saßen wir im Auto, und ich fragte sie, ob Geoffrey schon wieder aus dem Krankenhaus zuHause sei. »Jeff ist mit Heiko am Flughafen. Wir fliegen nach Miami.«
Ich war irritiert. Das war ein ziemlich seltsamer Ortswechsel. Eben noch Anstalt, dann Urlaub in Florida. »Echt? Jetzt? Nach Amerika?«, fragte ich.
»Wir fliegen. Du bleibst hier.«
Wir hielten an einer Ampel. Mutter sah mich durch ihre Sonnenbrille an, aber ich erkannte trotzdem, dass sie weinte. Dann erklärte sie mir, dass es ihr nicht gelungen sei, Heiko davon zu überzeugen, mich wieder aufzunehmen. Sie wisse nicht, wie es weitergehen solle. Sie würden nach Miami fliegen, um den Deal mit dem Grillhersteller auszuhandeln. Und um Urlaub zu machen. Es gäbe da auch einen Spezialisten, der Jeff weiter behandeln würde. Abstand sei jetzt wichtig. Vor allem für Heiko.
Eine Weile fuhren wir am Rhein entlang, dann Richtung Hahnwald. Nach fünf Minuten fragte ich: »Und wo soll ich hin in den Ferien?« Mama brauchte ein wenig, um zu antworten. Fast kam es mir so vor, als überlegte sie jetzt erst, was aus mir werden sollte. Aber das war nicht so. Es fiel ihr bloß schwer, die richtigen Worte zu finden. »Du kommst für die Ferien erst einmal zu deinem Vater.«
Die Vorstellung, zum Unscharfen zu müssen, überforderte mich sofort. Und natürlich betrachtete ich die Entscheidung der Mikullas als Vergeltungsschlag. Ronald Papen war also so etwas wie ein Straflager. So klang es jedenfalls. Niemals hätte ich gedacht, dass es dazu kommen würde. »Ich will da nicht hin. Ich kenne den gar nicht«, rief ich.
»Dann lernst du ihn kennen.«
»Er hat sich nie für mich interessiert. Und ausgerechnet jetzt, wo ich in der Psychiatrie war, soll sich das geändert haben?«, rief ich. Die Vorstellung, zu meinem Vater zu müssen, machte mir mehr Angst als jene, mit Geoffrey in den Urlaub zu fahren.
»Nein, ausgerechnet jetzt, wo du deinen Bruder angezündet hast«, schrie Mama. Wir fuhren für ein paar Minuten schweigend weiter. Nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, sagte sie: »Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Also mit deinem richtigen Vater. Und wir beide und auch Heiko halten es für das Beste, wenn du mal eine Auszeit von uns hast. Und wir von dir. Am Ende der Ferien sehen wir weiter.«
»Und wo wohnt mein Vater?«, fragte ich in der vagen Hoffnung, dass der Geschäftemacher Papen auf einer Jacht vor Nizza oder in einem toskanischen Schloss lebte.
»In Duisburg.«
»Wo ist Duisburg?«
»Nicht sehr weit von hier. Du wirst packen, dann bringe ich dich zum Bahnhof und fahre von dort gleich weiter zum Flughafen.«
Mutter dachte sogar daran, mir den Haustürschlüssel abzunehmen, für den Fall, dass ich beim Unscharfen ausreißen und nach Hause fahren würde. Sie brachte mich zum Hauptbahnhof, drückte mir den Fahrschein in die Hand und gab mir einen Kuss. Dann fuhr sie weg. Ich fand sie etwas zu eilig und daher sentimentaler Gefühle unverdächtig. Der Zug ging pünktlich, brauchte nicht einmal eine Stunde nach Duisburg, und als ich gegen 17 Uhr ausstieg, waren es deutlich über dreißig Grad. Die Sonne blendete mich, während ich das Gleis nach einem Geschäftsmann absuchte. Als der Zug weiterfuhr, leerte sich der Bahnsteig, und es blieb nur ein Mensch übrig, der als der feine Herr Papen infrage kam. Er kam auf mich zu, und ich war wirklich auf Anhieb vollkommen enttäuscht.
Teil 1
Der Sommer mit meinem Vater
Tag 1
Enttäuschung ist bloß das Ergebnis zu großer Erwartung. Sagt man so. Dabei waren meine Erwartungen nicht einmal groß, eher diffus. Sie zu unterlaufen war für Ronald Papen ein ziemliches Kunststück, wenn man bedenkt, dass ich gerade von meiner Familie abgeschoben worden war und einem völlig ungewissen Sommer entgegensah. Sehr viel schlimmer, als die vergangenen Wochen verlaufen waren, konnte mein restliches Leben gar nicht mehr werden. Von großen Erwartungen war also wirklich kaum die Rede. Und dann so was. Wobei: Vielleicht mischte sich in die Enttäuschung auch viel Überraschung. Als die Reisenden den Bahnsteig verlassen hatten und nur noch Herr Papen und ich dort standen, vielleicht zehn oder zwölf Meter voneinander entfernt, da sah ich nämlich gar nicht meinen Vater dort stehen. Sondern mich.
Ronald Papen, der Unscharfe, auf dem Foto kaum zu erkennen, verborgen hinter einer Mütze, viel Schatten und dem Unvermögen des Fotografen, ein gutes Bild zu machen, mein Vater also war die Inkarnation von mir als mittdreißigjährigem Mann. Er hatte denselben breiten Mund wie ich und hohe Wangenknochen, die irgendein Lehrer von meiner Schule einmal als »nordisch« bezeichnet hatte, was auch immer das bedeuten mochte. Ich hatte es zwar nicht verstanden, mir aber dennoch zu eigen gemacht, weil ich fand, dass es geheimnisvoll klang. Er besaß meine hohe Stirn und darüber dünnes blondes und dunkelblondes sowie mittelblondes Haar, das in keiner erkennbaren Frisur, halblang oder jedenfalls nicht sehr kurz, aus seinem Kopf herauswuchs. Das sah nicht vernachlässigt aus, sondern eher vergeblich, denn die lichten Stellen erkannte man trotzdem. Als er auf mich zukam, erkannte ich in seinem Gesicht hinter einer schiefen Brille meine hellblauen Augen. Er sah mich daraus mit derselben Mischung aus Verwunderung und Neugier an, die meinem eigenen Blick immer zugesprochen wurde. Er wirkte wie ein Kind und gleichzeitig wie ein alter Mann. Ronald Papen vermittelte einen zerstreuten Eindruck, wie man ihn von alten Herren kennt, die mit wachsendem Furor nach der Brille suchen, die sie sich kurz zuvor auf den Kopf geschoben haben. Gleichzeitig schien er aber auch aufgeregt, irrlichternd, wie ein kleiner Junge, der betäubt von Duft und Licht um den Weihnachtsbaum fliegt, überwältigt von den Möglichkeiten des Lebens und der Auswahl an Geschenken, die es einem bereitet. Dabei waren beide Gesichtsausdrücke ein und derselbe; Ronald Papen schien gleichzeitig sehr alt und deutlich jünger als ich zu sein. Und er war erkennbar überfordert.
Und dann war da seine Erscheinung und Statur. Der feine Herr Papen stellte sich nicht als der buchstäblich große Geschäftemacher heraus, sondern als ein zartes Männlein. Papen trug auch nicht den von mir imaginierten Anzug, sondern eine Jeans mit einem etwas ausgeleierten Gürtel, der die Hose im Bund zusammenzurrte wie ein Kälberstrick. Sein weißes Hemd war ihm zu groß, und die Schuhe waren auf beinahe fatale Art und Weise unmodisch und abgetragen, auch wenn man sah, dass er sie geputzt hatte. Dazu trug er ein dünnes Cordjackett, dessen Farbe man am zutreffendsten als »Erbrochenes« hätte bezeichnen können. Immerhin fehlte kein Knopf. Aus der vollgestopften Brusttasche des Sakkos ragten ein Stück Papier und ein Filzstift.
Er war nur wenig größer als ich und lächelte schief.
Nachdem wir uns mehr als dreizehn Jahre nicht gesehen oder gesprochen hatten, stand diese fremde Ausgabe meiner selbst vor mir und sagte: »Unerhört. Da bist du ja.«
Ich stellte meinen Koffer ab, und wir umarmten uns fast ohne Körperkontakt. Ich hatte mir zuvor so oft diese Begegnung vorgestellt. Wie ein riesiger Mann, der mein Vater ist, sich zu mir herunterbeugt, mich gleichsam verschattet und umhüllt. Doch der kleine Mann hatte nichts mit meinen Vorstellungen gemein. Der feine Herr Papen wirkte tatsächlich fein. Oder zart.
Und sofort kam die Wut. Dein eigener Vater sieht dich zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt, und alles, was er sagt, ist: »Unerhört«? Das klang wie ein Vorwurf, als habe er auf mich warten müssen. Ich ließ ihn los, und wir standen noch einen sprachlosen Moment lang auf dem Bahnsteig, bis er sich mein Gepäck griff und sagte: »Dann wollen wir mal.«
Er schleppte den Koffer die Treppe hinunter und mit zunehmender Atemlosigkeit Richtung Ausgang. Ich folgte ihm mit einigen Metern Abstand.
Papen stakste auf den Parkplatz zu, er trug dabei schwer an meinem Koffer. Der war randvoll mit Bademoden, Sportkleidung, Kosmetik, Sachen für abends, Sachen für morgens und Wechselkleidung für tagsüber, wenn man keine Lust mehr hatte, am Pool zu liegen. Ich ahnte noch nicht, dass ich kaum etwas davon brauchen würde. Für die sechs Wochen mit meinem Vater hätte eine kleine Sporttasche gereicht. Aber wenn mir das vorher klargemacht worden wäre, hätte meine Mutter mich bewusstlos nach Duisburg schleifen müssen.
Der Unscharfe blieb vor dem Heck eines alten Kombis stehen und fing an, im Schloss der Kofferraumklappe herumzu- nesteln.
»Was ist denn das?«, fragte ich, denn ich hatte noch nie so eine vergammelte Karre gesehen. Wenn meine Vorstellung von meinem Vater als Topmanager bei seinem ersten Anblick Risse bekommen hatte, fiel sie nun vollends in sich zusammen. Er fuhr eine totale Schrottkiste. Er drehte sich um und sagte mit ehrlicher Begeisterung: »Das ist mein Papen-Mobil.«
»Aha.«
»Na, dann mal rein mit den Klamotten«, keuchte er und wuchtete meinen Koffer auf die Ablagefläche des Kombis, die bereits gut gefüllt war mit allerhand Krempel. Aus dem Inneren des Autos wehte eine unheilvolle Brise. Als würde er darin wohnen. Papen knallte die Hecktür zu und sagte: »Alles einsteigen, Türen schließen.« Dieser Frohsinn machte mir Sorgen. Nichts von dem, was ich bisher gesehen hatte, gefiel mir auch nur ansatzweise. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich einfach nur den Bahnsteig gewechselt und wäre wieder zurückgefahren. Es ging aber nicht nach mir; ich hatte kein Geld für die Fahrkarte und keinen Schlüssel für unsere Haustür.
Also ging ich um Papens Auto herum, öffnete die Beifahrertür und setzte mich, nachdem mein Vater alles, was bis eben auf meiner Seite gelegen hatte, auf den Rücksitz geworfen hatte.
Ich spürte seine Nervosität, schließlich war er gerade erst seit vier Minuten mein Vater, und so rasch stellt sich keine Routine ein. Und ich war genauso nervös wie er. Trotzdem wollte ich wissen, was mir bevorstand. Es sah nicht so aus, als würden wir umgehend in die Ferien fahren. Und wer weiß: Womöglich gab es noch eine Frau zu diesem Auto. Und Kinder.
Ronald Papen schnallte sich an und fummelte einen Sonnenclip an seine verbogene Brille, was einiges an Geschick erforderte. Schließlich startete er den Wagen, und wir rollten auf die Straße.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte ich und suchte mit den Augen immer noch hoffnungsvoll das Innere des Wagens nach Antworten ab. Vielleicht lagen irgendwo Flugtickets. Oder Reiseproviant.
»Ach so. Ich dachte, wir fahren erst einmal nach Hause. Du bist ja sicher neugierig, wo du die nächsten eineinhalb Monate wohnen wirst.«
»Ich dachte, wir fahren in die Ferien?« Während ich das fragte, ackerte sich das Auto durch Duisburg, eine Stadt, deren Existenz mir bis vor wenigen Stunden unbekannt gewesen war. Wir fuhren über eine breite Straße, vorbei an Fassaden von Häusern, die aussahen wie Menschen, die sich nicht mehr schick machen, weil sie nichts mehr vorhaben im Leben. In der Sommerhitze schien der Ort zu vibrieren, als sei er das Organ eines großen, eines riesigen Körpers.
Auf einmal hatten wir die Stadt hinter uns, passierten Felder und überquerten dann einen tümpelhaft trägen Fluss, der aber immerhin ein sehr grünes Ufer hatte.
»Du hast Ferien. Ich leider nicht«, sagte Ronald Papen. Und als er nicht weitersprach, fragte ich: »Und was machst du?«
»Ich arbeite. Ich arbeite immer. Aber du machst Ferien.«
»Wo? Hier etwa?«
Wir fuhren nun durch eine Gegend, in der niemand wohnte. Fabrikgebäude aus braunen Ziegeln und schäbige, aber mit großzügigem Farbauftrag gestrichene, flache Zweckbauten mit vergitterten Fenstern. Es war der deprimierendste Ort, den ich je gesehen hatte, und ich verstand meine Frage als rhetorischen Kniff, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass es auf der ganzen Welt jemanden gab, der hier Urlaub machen würde. Oder wollte. Oder konnte.
Aber dann bogen wir nach links in eine schmale Straße ab, mehr einen Weg, der zu beiden Seiten von vergammelten Autos gesäumt war. Ronald Papen sagte: »Gleich sind wir da«, und klang dabei, als stünde mir der Eintritt zum Paradies bevor. Dann erreichten wir einen kleinen unbefestigten Platz, in dessen Mitte sich eine offenbar nie versiegende riesige Pfütze befand. Jedenfalls schien das so, denn der letzte Regen war damals schon zwei Wochen her.
Papen hielt vor einer Lagerhalle mit einem breiten Rolltor. Das alte Gebäude war cremeweiß gestrichen und hatte große, aber blinde Sprossenfenster in rostigen Fassungen. »Da wären wir«, sagte mein Vater und schnallte sich ab. Er legte den Sonnenbrillenclip auf die Ablage und stieg aus dem Wagen.
»Wo bitte sind wir?«, fragte ich nicht ohne eine gewisse Panik, während ich ihm zum Seiteneingang der Halle folgte. Er schloss die Tür auf, öffnete und sagte: »Zu Hause. Hereinspaziert.«
Ich betrat einen Raum, den Papen mit Bahnen von schwarzem Tuch vom Rest der Halle abgetrennt hatte. Ein lautes Klacken war zu hören, dann wurde es hell. Er hatte vier große Lampen eingeschaltet, die von einer dunklen und weit entfernten Decke herabhingen. In dem Raum befand sich unter anderem ein angestoßenes Sofa, eine Küchenzeile, eine Werkbank, ein Schreibtisch und allerhand Plunder. Der nackte Betonboden war zwar alt und rissig, aber sauber. Die Stirnseite des Raumes wurde von dem Rolltor beherrscht, welches anscheinend nie geöffnet wurde, denn Papen hatte es von innen mit Möbeln und Krempel zugestellt.
Der ganze Raum strahlte etwas Provisorisches aus. Hier drin zu leben war, als wartete man in einer Telefonzelle darauf, dass der Regen aufhörte. Der Anblick dieser Halle brachte mir drei Gewissheiten: Mein Vater war ein armer Schlucker, er lebte allein, und ich hatte die schwierigsten sechs Wochen meines Lebens vor mir. Wenn ich hierblieb. Was ich ganz sicher nicht vorhatte.
»Und jetzt zeige ich dir dein Reich«, sagte er freudig und winkte mich zu sich heran. Er durchquerte den Raum und ging auf zwei Türen an der entgegengesetzten Wand zu. »Hier geht es ins Bad«, sagte er und öffnete die linke Tür. Dahinter wurde ein kleines, nicht direkt ungepflegtes Badezimmer sichtbar, das so roch und aussah, als wäre es gerade frisch geputzt worden. Dann öffnete er die rechte Tür und sagte: »Hier. Bitteschön. Dein Zimmer.«