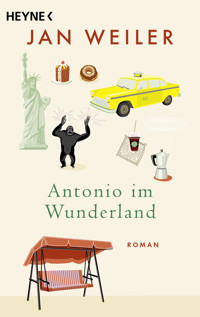9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Sonne geht auf, es regnet, oder es schneit. Aber im Grunde startet jeder neue Tag mit derselben Chance. So sieht Martin Kühn es jedenfalls, an guten Tagen. In letzter Zeit allerdings hatte er eher selten gute Tage, seine Frau Susanne benimmt sich seltsam, und er selbst ist dabei, einen amourösen Fehltritt zu begehen. Auch der heutige Tag beginnt wechselhaft, denn Kühn soll mit seinem Kollegen Steierer den Mörder eines jungen Mannes finden. Die Ermittlungen führen ihn, den einfachen Polizisten und Berufspendler, in die Welt der Reichen und Wohltätigen. Diese neue Erfahrung setzt ihm doch mehr zu, als Kühn es sich eingestehen will. Und während er auf der Terrasse der Verdächtigen selbstgemachte Limonade kostet, sucht Kühn die Antwort darauf, ob es überhaupt einen Ort gibt, an dem er in diesem Leben richtig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Cover & Impressum
Mittwochmorgen
1. Das Feuerzeug
2. Morgens auf der Weberhöhe
3. Die Ratte
4. Dienststellenleiter Kühn
5. Der Fernseher
6. Arzttermine
7. Apfel-Guave
8. Eine kleine Welt für sich
9. Führungskräfte
10. SonntagsmatinEe
11. Drei Verhöre
12. In der Ehe-Küche
13. Versuchsanordnung
14. Die Aussage
15. Am Ende
16. Sendlinger Straße
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de/literatur
ISBN 978-3-492-99105-6
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Emiliano Ponzi
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Mittwochmorgen
Der Polizist Martin Kühn stand vor dem Badezimmerspiegel und versuchte, sich objektiv zu betrachten. So, wie man jemanden auf einem Foto ansieht. Das Gesicht auf einem Foto schaut nicht zurück. Es lässt den Blick über sich ergehen, blinzelt nicht, schämt sich nicht, verbirgt nichts hinter einer schützenden Mimik. Es wehrt sich nicht. Je länger Kühn sich ansah, desto leichter fiel es ihm, sich zu ertragen.
Normalerweise nutzte er den Spiegel nur, um zu überprüfen, ob er noch Zahnpasta am Mund hatte oder ein überlanges Haar in der Nase. Nun stand er da und sah sich ausdruckslos und möglichst unverwandt ins Gesicht. Kühn versuchte, sich nicht durch Augenzwinkern oder eine Bewegung des Mundwinkels aus dem Gleichgewicht zu bringen, und fragte sich: Wer bist du? Wie geht es dir? Stimmt alles?
Er hatte erst vor Kurzem damit begonnen, sich selbst zu betrachten. Vor diesem Sommer hatte er eine eher funktionale Beziehung zu seinem bald 45 Jahre alten Körper gepflegt. Er hatte ihn – wenn überhaupt – als weitgehend wartungsfreie Lebensmaschine wahrgenommen. Er war nie ernsthaft krank gewesen, hatte jedoch auch nicht über die Maßen gesund gelebt. Er hatte sich nichts zugemutet, war aber auch niemals vor Anstrengungen zurückgewichen.
Dann war die Krise über ihn gekommen, samt Zweifeln, Schwachheiten und schließlich dem Zusammenbruch, der ihn in ein Reha-Zentrum für Beamte und dort an einen Vierertisch mit einem drogensüchtigen Grenzschützer, einem ausgebrannten Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Donauwörth und einem Nürnberger Steuerfahnder gebracht hatte. Der Steuerfahnder litt unter einer krankhaften Überidentifikation mit seiner Tätigkeit, die ihn an den Rand des Irrsinns getrieben hatte. Und Kühn?
Der hatte sich auch reingesteigert in die abwegigsten Grübeleien, in ein nicht mehr zu stoppendes Gedankengetöse, in dem aktuelle Fälle, seine dahinsiechende Karriere, seine erstarrte Ehe, die sich lösenden Bindungen zu seinen Kindern, dazu Kindheitserinnerungen und finanzielle Probleme vor sich hinsausten wie leere Körbe in einem Kettenkarussell. Am Ende fiel er härter als andere, denn er war groß und stark, und wenn solche Leute fallen, ist die Wucht des Aufschlags immer größer.
Aber Kühn war wieder aufgestanden, und nun betrachtete er sich im Spiegel wie einen Fremden. Man hatte ihn vor wenigen Minuten angerufen und zu einem Tatort bestellt. Er rechnete aus, dass er mit den Öffentlichen ungefähr eine Dreiviertelstunde brauchen würde. Dann würde er vor einem Leichnam stehen, den sein Kollege Steierer am Telefon als »furchtbar zugerichtet« bezeichnet hatte.
Sobald man wusste, wer die Leiche war, würde man damit beginnen, ihre letzten Tage und Stunden zu rekonstruieren. Kühn dachte oft, dass man viele Verbrechen verhindern könnte, wenn die Opfer schon vor der Tat identifiziert würden. Wenn man sich vorher schon mit ihnen beschäftigen würde und nicht erst hinterher. Er war überzeugt davon, dass es nicht nur bestimmte Dispositionen gab, die Täter zu Tätern machte, sondern dass auch Opfer in gewisser Weise zum Opfersein bestimmt waren. Er betrachtete sich im Spiegel und sann darüber nach, ob er in seinem Leben eher Opfer oder Täter war. Dann klingelte sein innerer Wecker, er putzte sich die Zähne, spuckte aus und ließ Spucke und Zahnpasta im Waschbecken, weil er keine Zeit mehr hatte, es sauber zu machen. Er musste ja los und zur Arbeit fahren.
1. Das Feuerzeug
Amir wusste nicht, was Liebe war, bis er Julia begegnete. Er hatte keine Ahnung davon gehabt, wie es sich anfühlte, wenn einem so ein Mädchen schon Sekunden nach dem Abschied fehlt. Er fühlte sich jedes Mal, als würde ihm ein Körperteil amputiert, wenn sie sich zum Abschied küssten. Dann stieg er ein, die Tür der Straßenbahn schloss sich mühsam und wie gegen ihren Willen. Julia winkte ihm sanft zu aus ihrer Welt, die Amir dann ruckelnd verließ, um in seine zurückzufahren.
Obwohl er bereits siebzehn Jahre alt war, kannte Amir derartige Gefühle nicht. Etwas zumindest ähnlich Betäubendes hatte er bis zu diesem Sommer höchstens erlebt, wenn er mit seinen Freunden Lösungsmittel einatmete oder kleine Beutezüge unternahm. Ladendiebstahl, manchmal nur so, zum Spaß. Kindern das Handy wegnehmen. Passanten um Zigaretten anschnorren und dann die ganze Packung von ihnen verlangen. Und das Feuerzeug dazu. Sich an deren Angst zu freuen und lachend weiterzuziehen verschaffte ihm Augenblicke des Hochgefühls, für die er sich nicht schämte, die ihm nicht einmal besonders vorkamen.
Mädchen hatten ihn bis zu diesem Sommer nie sonderlich beschäftigt. Wie seine Freunde war er der Meinung, dass Frauen im Allgemeinen, seine Mutter einmal ausgenommen, nur störten. Gleichzeitig hatte er jedoch die angeberischen Erzählungen seiner Freunde über die Eroberungen und reihenweisen Flachlegungen irgendwelcher willfährigen und meistens besoffenen Mädchen mit einem gewissen Unwohlsein verfolgt. Denn erstens war ihm so etwas bisher nicht gelungen, und zweitens hätte er gar nicht gewusst, wie man dieses Flachlegen hätte anstellen sollen, und drittens wusste er auch nicht, wofür es gut sein sollte. Er war nicht einmal auf Pornoseiten im Internet unterwegs, denn die offensive Körperlichkeit der Frauen in den Clips, die sich seine Kumpels gegenseitig aufs Handy schickten, verunsicherte ihn mehr, als dass sie ihn erregte. Bei aller Stärke und männlicher Wucht, die er in der Schule und in der Nachbarschaft zum Schrecken von Lehrern, Hausmeistern und wehrlosen Geschäftsinhabern ausstrahlte, war er sich dieser Schwäche bewusst.
Es war ihm zwar ohne jede Regung möglich, einem Jugendlichen in der U-Bahn die Jacke abzunehmen oder vor der Schule MDMA an Jüngere zu verkaufen. Aber ein Mädchen gernzuhaben oder noch irritierender: von ihm gemocht zu werden, sich gegen seine Brust zu lehnen, seinen Herzschlag zu spüren und sich dabei den Kopf streicheln zu lassen erschien ihm so unmöglich, dass er diese Vorstellung gar nicht erst zuließ.
Und so war Amir eine siebzehnjährige Jungfrau, aufgewachsen in Neuperlach, der Satellitenstadt im Südosten Münchens, die in ihrer Größe und Betonhaftigkeit einschüchternd und befremdlich auf Besucher wirkte, aber für Amir und seine Freunde ein Biotop darstellte, in welchem sie im Gegensatz zur Polizei jeden Winkel und jeden Meter der unendlich weiten Fuß- und Versorgungswege zwischen den riesigen Wohnblöcken kannten und sich ihrer sicher waren, solange sie einfach dort blieben. Tatsächlich verließ Amir sein Viertel ungern. Die Innenstadt sagte ihm nicht viel, er konnte sich dort nicht bewegen, fühlte sich wie ein Außerirdischer, beobachtet und bedroht von einem Leben, das ihm fremd war.
Wenn er in den großen Einkaufsstraßen der Stadt umherging, sah er Menschen, die einfach so dort einkauften, große Tüten aus Kaufhäusern heraustrugen oder in Cafés saßen, in denen ein Milchkaffee leicht fünf Euro kosten konnte.
Falls er überhaupt einmal Kaffee trank, dann in der Bäckerei des Perlacher Einkaufsparadieses. Für eins dreißig bekam man eine Rosinenschnecke dazu. Der Haarschnitt dort machte neun Euro, und wenn sein Freund Cem Lust hatte, rasierte er Amir noch einen Blitz von der Schläfe bis hinters Ohr. Für Amir bestand die Welt aus Neuperlach, und alles, was darüber hinausging, war Weltraum. Und dann landete, quasi aus dem All, Julia in seinem Leben.
Eigentlich landete dort zuerst ihre Mutter. Sie baute eines Tages im Jugendzentrum einen langen Tisch auf, auf den sie allerhand Broschüren schichtete. Außerdem spielte sie einen Film über einen Laptop ab. Der Sozialarbeiter Ulrich hatte vorher einen Aushang gemacht sowie auf Facebook und WhatsApp darüber informiert, dass der »Münchner Sternenhimmel« nach Neuperlach komme. Weil sich darunter niemand etwas vorstellen konnte, hängte er einige Links an seine Mitteilung, die aber von den wenigsten Jugendlichen geöffnet wurden. Sonst hätten sie sich darüber informieren können, was der »Münchner Sternenhimmel« war.
Es handelte sich dabei um einen Verein, der von Münchner Bürgern Anfang der Neunzigerjahre gegründet worden war, nachdem fremdenfeindliche Übergriffe in der Stadt zugenommen hatten. Die Sorge um gesellschaftliche Werte und die Empörung über fehlende Konsequenzen seitens der Politik hatten zunächst zu Bürgerprotesten und schließlich zu einer Versammlung geführt, in deren Verlauf der »Münchner Sternenhimmel« aufging.
Die Haupttätigkeit des Vereins bestand darin, Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Integration in die Gesellschaft zu erleichtern oder überhaupt erst zu ermöglichen. Der Gedanke dahinter war ehrenwert und sympathisch naiv: Wenn man die jungen Leute besser unterrichtete, ihnen Deutsch beibrachte und viele, auch kulturelle Angebote machte, konnten sie bessere Schulabschlüsse erzielen, schneller in Ausbildungen gelangen und würden insgesamt weniger stören, weil sie nicht mehr auf der Straße herumhingen. Auf diese Weise, so die Annahme der Vereinsgründer, würde jeder Ausländerfeindlichkeit auf Dauer der Nährboden entzogen.
Seit Jahren engagierten sich mehr oder weniger wohlhabende Münchner beim Sternenhimmel, und tatsächlich hatte man mit diversen Projekten viel Aufsehen erregt. Es hatte Breakdance- und Graffiti-Kurse gegeben, ein Hip-Hop-Projekt und zahlreiche Workshops, bei denen die ehrenamtlich tätigen Mitglieder den Jugendlichen zum Beispiel deutsche Lyrik des Biedermeiers oder die Feinheiten der bayerischen Küche nahegebracht hatten. Diese Kurse waren nicht direkt von Teilnehmern überrannt worden, besonders nicht jener mit dem Titel: »Schweinebraten leicht gemacht«, aber sie hatten trotzdem Gutes bewirkt – und zwar an den Vereinsmitgliedern. Das waren mehrheitlich wohlsituierte Münchner Bürger mit Sendungsbewusstsein, die gerne ihr Wissen über alle möglichen wichtigen Bereiche des Lebens teilten und vorzugsweise über Leinenbettwäsche, die authentische Zubereitung von Espresso und den perfekten Ort für eine neue Konzerthalle debattierten. Indem sie sich nun für das Wohl ausländischer oder zumindest ausländisch aussehender Jugendlicher einsetzten, gaben sie ihrem Leben einen neuen Sinn, gewissermaßen einen Bonus-Sinn, der sie zudem sozial weit über jene Bekannten und Freunde stellte, die lediglich spendeten. Was ja jeder konnte.
Die Mitgliedschaft im »Münchner Sternenhimmel« galt als erstrebenswert, und sie hatte einen hohen Preis. Schon der Jahresbeitrag sorgte dafür, dass der Kreis der »Botschafter«, wie sich die Mitglieder selber nannten, überschaubar blieb. Daran war den teilnehmenden Prominenten aus der Medienszene, Gastronomie und Wirtschaft sehr gelegen. Man wollte unter sich bleiben. Aufnahmeanträge wurden ausführlich diskutiert, jede Anwärterin und jeder Anwärter musste sich detailliert bewerben und seine aktive Hilfe garantieren. War man einmal drin im »Münchner Sternenhimmel«, konnte man sich der Bewunderung anderer sicher sein. Der Verein pflegte Kontakte in die Chefredaktionen und Vorstandsetagen, zu den Geschäftsführungen großer Kaufhäuser und zu den wichtigen Schauspielagenten. Wenn der »Sternenhimmel« eine Gala veranstaltete oder einen Theaterabend mit einheimischen Stars oder ein Dinner, kamen ganz sicher alle wichtigen Persönlichkeiten der Stadt und viel Geld zusammen.
Die einzigen, die regelmäßig bei Liederabenden oder Cocktail-Events fehlten, waren die Kinder, für die die Veranstaltungen organisiert wurden. Das machte aber nichts, denn im Verein herrschte die Auffassung, dass es dafür viel zu früh sei. Wenn nämlich ein persischstämmiger Jugendlicher aus Moosach etwas mit Robert Schumann anfangen könne, habe der Verein seine Ziele erreicht und könne sich auflösen. Insofern war man bei der Vereinsleitung beinahe dankbar dafür, wenn die vernachlässigten und in sozial prekären Verhältnissen lebenden Jungen und Mädchen nicht auftauchten.
Niemand konnte bestreiten, dass der »Münchner Sternenhimmel« sehr zum Segen benachteiligter Jugendlicher wirkte. Die Öffentlichkeit nahm nun viel häufiger Notiz von deren Problemen, zumal auch diverse Filmemacher und Fernsehredakteure auf den visuellen Reiz des gefährlichen und gefährdeten Lebens am Rande der Großstadt aufmerksam geworden waren. Und tatsächlich hatten mehr Lehrstellen vermittelt werden können. Das Engagement des »Münchner Sternenhimmels« trug dazu bei, dass die Kriminalität wenigstens in einigen Altersgruppen leicht zurückging und mehr Abiturzeugnisse überreicht werden konnten.
Das Problem mit der Ausländerfeindlichkeit hatte sich durch die Arbeit des Vereins dann jedoch nicht lösen lassen, weil die Grundidee zwar gut, aber womöglich zu eng gefasst gewesen war. Es half nicht viel, wenn lediglich die Ausländerkinder besser Deutsch konnten, bessere Schulabschlüsse machten und schneller in Ausbildungen kamen, solange latent ausländerfeindliche Jugendliche ohne Migrationshintergrund viel schlechter Deutsch sprachen, noch langsamer in der Schule waren und erst recht keine Jobs fanden.
Zu den engagiertesten der über vierhundert Botschafter des »Münchner Sternenhimmels« gehörten Damen der Gesellschaft aus den Stadtteilen Schwabing, Nymphenburg, Solln, Harlaching und Bogenhausen sowie aus Pullach und Grünwald, die dafür viel Zeit hatten und aufbrachten, weil sie nicht direkt im Erwerbsleben standen. Ihre eigenen Kinder waren nicht mehr ständig auf sie angewiesen, ihre Männer kamen spät nach Hause und befanden sich ohnehin oft auf Reisen, das Haus war wie der Garten in fabelhaftem Zustand, die Theater-Abos in jahrzehntelanger Fron abgesessen. Nachdem also sämtliche Aufgaben inklusive der Erlangung von Platzreife und Bridge-Meisterschaft erledigt waren, wuchs bei vielen dieser Frauen die Erkenntnis, dass es nun, rund um den fünfzigsten Geburtstag, an der Zeit war, endlich einmal etwas zurückzugeben. Der Gesellschaft.
Anstatt sich also an die völlige Umgestaltung des Heimes zu machen, bewarben sie sich beim »Sternenhimmel«, zumal die Umgestaltung des Heimes gerade erst drei oder vier Jahre her und ja auch im Grunde genommen niemals völlig abgeschlossen war.
Der »Sternenhimmel« eröffnete ihnen viele neue Perspektiven und bot ein soziales Upgrade wie sonst nur kostspielige Operationen oder der Erwerb eines Ferienhauses auf Mauritius. Zudem ermöglichte die Arbeit mit problematischen Jugendlichen aus Stadtteilen, die man sonst nur vom Hörensagen kannte, einen gruseligen, aber spannenden Abwärtsvergleich, in dem man immer gewann. Und schließlich ließen sich brachliegende Kompetenzen aus vorehelichen Studiengängen in Fremdsprachen oder Geisteswissenschaften hervorragend einsetzen. Die Mitarbeit im »Münchner Sternenhimmel« schuf also eine Win-win-Situation, wie Elfie van Hauten immer wieder betonte, wenn sie ihren Freundinnen davon erzählte, wie sie in den Problemvierteln aus verstockten und aggressiven Jünglingen smarte Deutschschüler formte.
Von ihrem Haus in Grünwald aus organisierte sie nicht nur Sprachkurse, sondern auch kulturelle Lehrgänge für Flüchtlingskinder und Sport-Workshops, an denen sich die größeren Fußballvereine der Stadt beteiligten, weil sie die Hoffnung hegten, mit einem minimalen Investment auf ein Talent aufmerksam zu werden. Über die Jahre war Elfie van Hauten für den Verein unverzichtbar geworden. Sie saß unabwählbar im Vorstand und galt als zähe Verhandlerin, wenn ein Autokonzern dem Verein keinen neuen Lieferwagen spenden wollte oder ein Getränkelieferant nicht den gewünschten Weißwein für das jährliche Sommerfest zu schenken beabsichtigte. An ihr kam niemand vorbei. Und das galt auch für die jugendliche Zielgruppe, die von ihr regelrecht gekobert wurde.
Dafür baute sie einmal in der Woche ihren Stand in einer Schule, einer kirchlichen Einrichtung, einem Wohnheim oder einem Jugendzentrum auf. Nachdem sie in früheren Zeiten noch auf Kundschaft gewartet hatte, war sie irgendwann dazu übergegangen, die Kinder direkt anzusprechen. Großmäuler quatschte sie kleinlaut, die Mädchen mit den dicken Lippen schnurrten bei ihr zu willfährigen Kätzchen zusammen. Ihr Erfolg bestand in ihrer Direktheit. Und in ihrer Ausstrahlung.
Normalerweise wäre Amir an jenem Mittwoch Ende Mai nicht im Jugendzentrum gewesen. Erstens hielt er den dort tätigen Sozialarbeiter Ulrich Bernstein für »einen Homo«, weil er den Jungen manchmal die Hand auf die Schulter legte und beim Tischfußball Geräusche machte wie beim Sex (oder so wie sich Amir Geräusche beim Sex vorstellte). Und zweitens mied er Orte, an denen er sich an Regeln halten musste. Im Jugendzentrum durfte man keine Kraftausdrücke verwenden, nicht einmal »Homo« durfte man sagen. Man durfte nicht rauchen oder andere Drogen nehmen, und man durfte die Musik in seinem Handy nicht über Lautsprecher laufen lassen. Wenn das alle machten, würde Ulrich wahnsinnig, hatte er mal gesagt. Na wennschon. Der war doch sowieso wahnsinnig. Der Homo. Fand Amir.
Amir war unterwegs nach Hause, wo er sich auf einen Nachmittag vor der Glotze freute und auf eine Tiefkühlpizza. Seine Mutter kochte selten und brachte nur dann und wann Sachen aus dem Supermarkt mit, meistens abgelaufene Joghurts oder beschädigte Ware. Gestern hatte sie ein paar Pizzen dabeigehabt, und darauf hatte Amir Appetit. Als es anfing zu regnen, bog er dann aber doch ins Jugendzentrum ab, um seine Frisur zu retten.
Im Foyer war eine Frau dabei, einen Tapeziertisch auszuklappen, und er sah sofort, dass sie sich absichtlich dumm dabei anstellte. Es wunderte ihn daher nicht, dass sie ihn um Hilfe bat. Er kannte diese Tricks, denn er war Dutzenden von Sozialtherapeuten, Lehrern, Trainern und Jugendpflegern begegnet. Immer dasselbe. Sie wollten unbedingt mit einem ins Gespräch kommen, machten stundenlang auf dufte, und am Ende fand man sich in einem Stuhlkreis mit Blödmännern wieder und sollte erzählen, was mit Papa war. Bei Amir ging das schnell: Papa war weg. Ende.
Die Frau bat ihn, Kartons mit Broschüren aus ihrem Auto zu holen und gab ihm den Schlüssel. Ganz schön mutig, dachte Amir. Ein BMW X5. Damit jetzt eine Runde zu fahren war verlockend. Oder wäre verlockend gewesen. Aber Amir konnte nicht Auto fahren. Und irgendwie hatte er keine Lust, in der Mittelkonsole oder im Handschuhfach nach interessanten Dingen zu suchen. Ihm war gar nicht klar, dass er der Frau längst auf den Leim ging. Er holte die Kartons aus dem Kofferraum und half ihr, den Inhalt auf dem Tisch zu drapieren. Sie stellte sich vor und sagte: »Ich heiße übrigens Elfie van Hauten. Wie die Schokolade, nur mit ›au‹.« Amir konnte mit dieser Information zwar nichts anfangen, war aber von sich selber verblüfft, weil er ihr die Hand gab. Sie roch gut. Er sagte: »Ich bin Amir.« Und sie sagte: »Hallo Amir.«
Damit war sein Pulver verschossen, und er stand vor dem Klapptisch wie ein angepisster Baum. Oder wie ein Siebzehnjähriger, der nicht weiß, wie er mit einer erwachsenen Frau umgehen soll. Ihm war so, als müsste er nun sagen, dass sie schöne Haare habe, was absolut zutraf. Erst am Vormittag war Elfie van Hauten bei ihrem Friseur gewesen, der nicht weniger als eine Dreiviertelstunde lang eine Art pneumatisches Meisterwerk an ihr aufgeföhnt hatte. Aber Amir fragte stattdessen, ob sie noch Hilfe brauche. Er fühlte sich verantwortlich für die Frau. Er musste sie beschützen, falls irgendeiner seiner Kumpel vorbeikam und die Broschüren vom Tisch fegen oder die Frau beleidigen würde.
Elfie van Hauten kannte diese Sorte Jungs. Oft massiv vorbestraft, aber im Grunde Kinder. Und in diesem Fall ein hübsches Kind dazu. Sie nahm eine Broschüre und sagte: »Ich glaube, in dir steckt viel mehr, als man dir ansehen kann. Und ich glaube, dass wir rausfinden sollten, was das ist.« Amir bekam auf der Stelle Angst, denn er war sein ganzes Leben hindurch der Meinung gewesen, für rein gar nichts gut zu sein. Er konnte lügen, klauen und ein paar schnelle Körpertäuschungen und Schläge, die er sich aus Martial-Arts-Filmen abgeschaut hatte. Des Weiteren konnte er Rahmspinat auftauen und seinen linken Mittelfinger auf geradezu absurde Weise nach hinten biegen. Und damit hatte es sich schon. Reflexhaft antwortete er: »Ich kann alles.«
»Das ist schön«, sagte Elfie van Hauten. »Und was willst du damit später mal machen? Gehst du zur Schule?«
»Klar«, log er. Er war das letzte Mal Anfang der vergangenen Woche da gewesen, aber es hatte ihm nicht gefallen. Zu hohe Anforderungen. Langweilig. Zu viele Regeln. Er hatte nicht vor, wieder hinzugehen. Und es vermisste ihn auch niemand.
»Ich mache KFZ-Mechatroniker, nach der Schule«, fügte er hinzu. Tatsächlich hatte ihm ein Berufsberater empfohlen, sich auf eine entsprechende Stelle zu bewerben, was aber nichts mit Amir zu tun hatte, sondern damit, dass da noch nicht alle Lehrstellen besetzt waren. Hatte er aber nicht getan.
»Na, das klingt doch gut«, sagte die Frau und schaute über ihn hinweg in den Raum. Sie suchte bereits nach weiteren Kunden. Dieser hier schien keinen Bedarf zu haben. In diesem Moment öffnete sich hinter der Frau die Tür, und ein Mädchen kam herein. Es passte so überhaupt nicht hierher, dass Amir sofort wusste, dass es die Tochter der Frau war. Sie trug zwei Flaschen Mineralwasser und lächelte Amir auf eine Art an, die ihn schlagartig wehrlos machte. Wenn er einen schmutzigen Gedanken gehabt hätte, wäre dieser auf der Stelle reingewaschen worden durch dieses Lächeln. Er hatte aber keinen Gedanken, denn er konnte gerade nicht denken.
»Das ist meine Tochter Julia. Julia, das ist Amir. Er will Autos reparieren, ist das nicht toll?«
Das Mädchen kam auf ihn zu und streckte ihre Hand aus. Er hatte noch nie so gerade und weiße Zähne gesehen. Alles an ihr beschämte ihn. Sie trug Sneakers und Jeans, ein T-Shirt und darüber ein fliederfarbenes Hemdchen, an ihren schmalen Handgelenken hingen dünne Lederbändchen. Ihre blonden Haare waren zu einem Zopf nach hinten gebunden, und sie hatte die hohe Stirn ihrer Mutter. Das Mädchen war so schön, dass Amir augenblicklich eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht hätte, wenn er ihr damit einen Gefallen hätte tun können. Für sie würde er sich nackt in die Berufsschule setzen. Oder sogar eine Lehre als Leichenwäscher oder Biogärtner anfangen.
»Hi«, sagte Julia, und Amir nahm ihre Hand, auf der keine Brandspuren, keine Kratzer und nicht einmal Muttermale waren. Er schaute lange auf diese Hand, und Julia fragte: »Alles gut?« Er sah verlegen in ihr Gesicht. Er wollte nicht, dass sie das Gefühl bekam, er würde sie anstarren. Dann sagte er: »Hallo, ich bin Amir.«
»Ich weiß«, sagte sie und nahm ihre Hand zurück.
»Leider ist Amir schon versorgt, wir werden uns um seine Freunde bemühen müssen«, sagte die Botschafterin Elfie van Hauten und schob die Unterlippe vor, als bedauere sie diesen Umstand tiefer als nötig.
»Also nicht unbedingt. Es ist noch nicht ganz sicher, dass ich die Stelle auch kriege. Bis dahin habe ich noch nichts, eigentlich.« Amir musste jetzt einfach alles tun, um noch wenigstens fünf Minuten mit diesem Geschöpf zu verbringen. »Eigentlich habe ich nichts, jetzt gerade. Und zur Schule gehe ich eher nicht so. Momentan.« Und da war mit einem Mal die ganze Wahrheit raus.
Wenige Minuten später war Amir von der Vorstellung, Trampolin zu springen, Theater zu spielen oder Tai-Chi zu versuchen, so angetan, dass er sich widerstandslos über das System der »Sternschnuppen« aufklären ließ. Für jede Stunde, die er in einem Kurs des »Sternenhimmels« verbrachte, wurde ihm eine Sternschnuppe gutgeschrieben. Wenn er ehrenamtlich mithalf und andere Jugendliche davon überzeugte, eine Aktivität des »Sternenhimmels« zu besuchen, erhielt er ebenfalls Sternschnuppen. Für zwanzig Sternschnuppen gab es Geschenke oder den Zugang zu weiterführenden Kursen. Im Grunde ganz ähnlich wie bei den Herzen, die seine Mutter an der Supermarktkasse abzählte und die sich ihre Kunden in kleine Heftchen klebten, um günstiger an Bratpfannen oder Kartoffelmesser zu kommen. Amir stellte sich vor, dass er für hundert Sternschnuppen kein Topfset, sondern dieses Mädchen bekam. Zum Heiraten.
Amir blieb den ganzen Nachmittag. Er stand einfach neben dem Mädchen und sah es an. Zwischendurch machte er Faxen, zeigte seinen Handstand und den Moonwalk. Er wollte Julia zum Lachen bringen. Und das gelang ihm. Sie strahlte ihn an, und einmal schubste sie ihn und rief: »Du bist ja blöd.« Alleine für diese winzige Berührung hatte sich der Tag schon gelohnt, fand Amir. In seiner Welt hätte er zurückgeschubst, aber er befand sich, obwohl sie in Neuperlach waren, in ihrer Welt. Überall, wo Julia war, war ihre Welt. So ist das mit den Mächtigen. Sie sind überall zu Hause. Die Schwachen müssen sich eine Zuflucht suchen.
Es war schon fast halb sieben, als Elfie van Hauten ihren Stand abbaute. Sie hatte einige Broschüren verteilt und eine kaugummischmatzende Gruppe von jungen Frauen für Cheerleading und Keramikarbeiten interessiert. Es war nicht unbedingt sicher, dass eines der Mädchen ein Angebot annehmen würde. Aber Elfie hatte es zumindest versucht. Und sie würde es wieder versuchen. Es war im Grunde auch nicht viel anders, als Soufflés zu backen. Außerdem hatte sie zumindest einen Erfolg erzielt. Der stand neben ihrer Tochter, die nur ausnahmsweise mitgekommen war.
Amir sah dem drohenden Abschied entgegen, und er wusste, dass er handeln musste, wenn er Julia wiedersehen wollte. Wobei ihm die Aussicht völlig unrealistisch und jedes Wünschen vergeblich schien. Aber wenn er jetzt nichts tat, würde diese Erscheinung, dieses Bonus-Level unter den Mädchen dieser Erde, einfach verschwinden. Und da schob er, der bis vor wenigen Stunden jede Vorstellung von Romantik als »schwule Scheiße« bezeichnet hätte, seinen ganzen Mut auf einen winzigen Haufen zusammen und machte etwas derart Ungeheuerliches, dass er sich hinterher nicht mehr daran erinnern konnte. Jedenfalls behauptete er später immer, sie habe ihn gefragt, aber das stimmte nicht: Amir fragte nach Julias Handynummer. »Wir können ja mal schreiben oder so«, schob er nach.
Zu seiner größten Überraschung lächelte Julia wieder und fragte ihn nach seiner Nummer. Er diktierte sie, Julia tippte sie in ihren Messenger und drückte auf »Senden«. In seinem Handy, das gar nicht ihm gehörte, erklang innerhalb einer Sekunde ein Ton, und damit hatte er ihre Nummer. Er sagte: »Cool.«
Zu Hause machte er sich eine Pizza und legte sich dann auf sein Bett. Er starrte auf das leere Display seines Smartphones. Was sollte er jetzt schreiben? Sollte er überhaupt etwas schreiben? Oder lieber gar nichts. Oder morgen. Dann hatte sie ihn aber sicher schon vergessen. Er rechnete damit, dass sie einen Freund hatte. Oder mehrere. Jungen, die besser zu ihr passten als er. Mit Müttern in riesigen SUVs. Was sollte er so einem Mädchen schreiben? »Hier ist Amir. Ich sitze hier in dem Zimmer, das ich mir mit meinem kleinen Bruder teile. Ich habe noch eine Ecstasy-Pille und vielleicht noch irgendwo Speed, aber ich weiß nicht, wo. Mehr Spaß hätte ich nicht zu bieten, aber wir können ja mal einen McRib essen gehen. Ich lade dich ein. Mit Cola.« Er schrieb lieber nichts als solchen Unsinn. Je länger er auf das leere Display starrte, desto alberner kam es ihm vor, diese Julia für sich gewinnen zu wollen. Was sollte das? Die Bitch. Kam in seine Gegend und lächelte wie die Winkekatze vom China-Imbiss. Amir legte sich das Handy auf den Bauch und schlief ein. Als er wieder aufwachte, kontrollierte er, ob Julia ihm geschrieben hatte. Er war enttäuscht, als keine Nachricht im Eingang war.
Er ging spazieren, traf aber niemand Bekannten. Er sortierte Wäsche, aß eine Orange, befahl seinem Bruder, die Zähne zu putzen, wartete auf seine Mutter, telefonierte mit Cem, erzählte ihm aber nichts von seiner Begegnung und legte sich wieder aufs Bett. Es war nach Mitternacht, als er beschloss, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und wie ein richtiger Mann seinen Standpunkt zu vertreten, eine Duftmarke zu setzen, sein Revier zu markieren. Nach einer weiteren Stunde hatte er sich für einen Text entschieden. Entschlossen und mit schnellen Fingern tippte er seine Nachricht ins Handy. Um 1:24 Uhr erhielt Julia die erste Nachricht von Amir. Sie lautete: »Hallo.« Julia hatte stundenlang darauf gewartet.
Von dort bis zu ihrem ersten Kuss dauerte es vier Tage, in denen Amir und Julia mehrere Hundert Textnachrichten austauschten, manche davon waren kurz und bestanden nur aus einem Smiley oder Kussmund, andere waren lang und besonders für Amir viel Arbeit, weil er sich seiner Rechtschreibung schämte und ewig an den kurzen Briefen feilte, sodass Julia aus Ungeduld eine schnarchende Säge schickte oder ein Männchen, das sich am Kopf kratzte. Sie erzählten sich Banales und Ernsthaftes, und Amir hatte das Gefühl, noch nie einem so gescheiten Menschen begegnet zu sein wie Julia, die ein Jahr jünger war als er, aber schon zwei feste Freunde gehabt hatte. Im Moment war sie solo, genau wie er, der vorgab, schon jede Menge Beziehungen hinter sich zu haben. Sie seien vor allem daran gescheitert, dass er zu anspruchsvoll gewesen sei. Und dass er nun aber den Eindruck habe, kürzlich der Richtigen begegnet zu sein. Wer das sei, wollte Julia wissen, und darauf schickte er ein großes pochendes Herz.
Wenn sie sich schrieben, gab es keine Unterschiede zwischen ihnen. Dann waren sie nur Buchstaben und Zeichen, dann begegneten sie sich in einer universellen Welt, in der es keine Schichten gab. Amir und Julia lebten in einem Zeichenhimmel, in dem alles gleich weit weg ist und Entfernungen keine Rolle spielen.
Am Samstag fragte Julia, ob sie ihn sehen könne, und er dachte sich eine Ausrede aus, weil er sich nicht traute, ihr zu begegnen. Dann eben am Sonntag, beharrte sie. Aber wo? In der Stadt? Das erschien ihm möglich. In Neuperlach wollte er sie nicht treffen, denn dort waren seine Freunde. Er schämte sich ihrer nicht direkt, aber wenn sie dabei waren, würde er sich anders geben müssen, dann konnte er nicht so weich sein, wie er es jetzt schon manchmal an sich bemerkte, wenn sie sich schrieben. Es tat ihm gut, so weich zu sein. Er spürte, wie sich seine Muskeln entspannten, wenn er ihre Briefe las. Das wollte er nicht aufs Spiel setzen.
Sie fragte, ob er nach Grünwald raus wollte. Er suchte dieses Grünwald in seinem Handy und stellte fest, dass zwischen ihm und ihr nur wenige Kilometer lagen. Man konnte theoretisch zu Fuß hingehen, durch den Perlacher Forst. Man wäre höchstens eineinhalb Stunden unterwegs. Dennoch hatte er von diesem Grünwald noch nie gehört. Hinter dem Karl-Marx-Ring war bei ihm die Welt zu Ende. Dann kam für ihn Österreich. Der Gedanke, einfach so mit der Straßenbahn in ihre Gegend zu fahren, gefiel ihm nicht. Wer wusste schon, was dort auf ihn wartete an Gefahren. Er schlug also vor, sich in der Innenstadt zu treffen, ein akzeptabler Kompromiss, wie er fand. Außerdem gab es am Stachus Palmen. Es war ansonsten ein Ort ohne Bedeutung für ihn und für beide leicht erreichbar.
Am Samstag lieh er sich einen Stapel Kleidung von Cem, den er bis zu diesem Tag für seinen ausgezeichneten Geschmack bewundert hatte. Nun aber kam er sich in dessen Hosen und engen Satinhemden vor wie verkleidet. Er legte breite Halsketten an und streifte sich Cems Siegelring über. Aber der Ring rutschte von seinem Ringfinger, und der Halsschmuck sah an ihm aus wie eine goldene Schneekette an einem Tretroller. Cems Trainingsjacken standen ihm gut, aber sie waren mit einem Code versehen, den Amir entschlüsseln konnte, Julia aber nicht. Sie würde sich abgestoßen fühlen, auch von den riesigen Sneakers, die Amir zu Cems Hosen kombinierte. Er versuchte, sich vorzustellen, in welchem Outfit er möglichst nahe an den Geschmack von Julia und ihren Leuten herankam, zog sich wieder und wieder um, bis er einen Schreianfall bekam und Cems Sachen durch die Wohnung schleuderte. Am Ende zog er seinen Jogginganzug an und lief ein paar Kilometer durch die Siedlung, um sich abzureagieren.
Am Sonntag duschte er eine halbe Stunde, cremte sich ein, wimmelte mehrere Freunde ab, die mit ihm an der U-Bahn-Haltestelle abhängen wollten, und entschied sich für schwarze Jeans, Sneakers und ein Sweatshirt mit Pfeilen in alle Richtungen. Er setzte sich seine Sonnenbrille auf, dann die Basecap. Er drehte den Schirm nach hinten, dann zur Seite. Schließlich warf er die Mütze aufs Bett. Er war sicher, dass Julia Basecaps nicht mochte.
Und dann musste er sehr lachen, als sie mit einer Kappe der New York Mets auf einem der Steine vor dem Brunnen am Stachus saß.
Erst waren sie einander ein wenig fremd, denn es besteht ein großer Unterschied zwischen dem Schreiben von Briefen und einem richtigen Gespräch. Obwohl sie sich schon einiges anvertraut und sich in den wenigen Tagen seit ihrer ersten Begegnung besser kennengelernt hatten, lag deshalb eine gewisse Befangenheit über den ersten zwanzig Minuten, die erst wich, nachdem Amir für Julia ein Eis gekauft und sich beim Probieren eine ganze Kugel aufs Sweatshirt gekleckert hatte. Er wurde sofort rot, und Julia erzählte, wie ihre Mutter früher ein Taschentuch angeleckt und sie sauber geputzt hatte, was sie immer eklig gefunden habe. Amir entgegnete, dass er sich so viel Nähe von seiner Mutter immer gewünscht habe, und beide wurden für einen Moment ganz still. Julia entschuldigte sich für ihre Plumpheit, und Amir sagte, sie habe doch nicht wissen können, dass es ihn so berührte. Sie umarmte ihn, und er roch ihr Shampoo und verlor sich in ihren Haaren und drückte sie etwas zu fest, er küsste ihre Schläfe und ihre Wange, sie lehnte sich an ihn, er spürte, wie eine beinahe schon unanständig fordernde Erektion in seiner Hose heranwuchs. Dann vergrub Julia sich tiefer in seinem vollgekleckerten Sweatshirt, er streichelte ihren Rücken, erst unbeholfen und etwas zu schnell, dann langsam, und er trat von einem Fuß auf den anderen, weil er nicht wusste, wie er sich hinstellen sollte, plötzlich hob sie den Kopf, und für einen Moment sahen sie sich in die Augen, bevor sich ihre Lippen zum ersten, mit geschlossenem Mund, aber sehr langen und innigen Kuss trafen.
Sie küssten sich noch einmal und noch einmal kurz, dann länger, dann küsste er nur ihre Unterlippe, dann sie seine, und dann öffnete sich ganz langsam und nur einen winzigen Spalt ihr Mund, und er küsste etwas Feuchtes, das darin war und sich bewegte, stellte mit großem Erschrecken und gleichzeitigem Verzücken fest, dass es ihre Zunge war, schob ihr vorsichtig seine eigene entgegen und erfuhr mit siebzehn Jahren und dreiundachtzig Tagen, dass es auf der Welt keinen größeren Genuss gab als so einen richtigen Kuss. Und plötzlich war er ganz sicher, dass sämtliche seiner Freunde Jungfrauen waren. Denn wenn sie sich wirklich ausgekannt hätten, dann hätten sie ihm nicht irgendwelchen Stuss übers Flachlegen erzählt, sondern davon. Vom Küssen. Von dem ersten Kuss, den man niemals vergisst.
Amir und Julia verliebten sich so krachend, so scheiße krass, wie Amir fand, dass er sein bisheriges Leben innerhalb weniger Tage hinter sich ließ. Es kam ihm dämlich vor, mit den Jungs im Viertel herumzuhängen. Die Nachmittage im Einkaufszentrum erschienen ihm als völlige Zeitverschwendung. Er hatte Julia erzählt, dass er mit Drogen dealte und auch welche nahm, wenn es sich anbot. Er hatte ihr von den Verhandlungen erzählt, von den nachsichtigen Richtern und den betroffenen Sozialarbeitern, die sich für ihn, den hoffnungslosen Fall, eingesetzt hatten. Er hatte ihr gestanden, dass er andere geschlagen und getreten hatte. Wie normal die Gewalt in seiner Umgebung war und wie sehr er sich dafür schämte, vor ihr als Kleinverbrecher zu stehen. Sie hörte sich alles an und nahm ihn in den Arm. Dafür streichelte er sie stundenlang, kraulte ihren Nacken und sang leise für sie. Er konnte nur drei Lieder, allesamt libanesische Schlaflieder, deren Texte er lautmalerisch wiedergab, so wie er sie in Erinnerung hatte aus der Zeit, in der seine Mutter noch für ihn gesungen hatte. Das war ewig her, und er wusste nicht, ob das Kauderwelsch, das er Julia ins Ohr sang, überhaupt einen Sinn ergab. Als sie ihn fragte, wovon er da singe, erfand er eine Geschichte mit einer Prinzessin und einem Löwen in einer kalten Nacht in der Wüste.
Sie schrieben sich weiter, außer am Vormittag, denn da waren beide in der Schule, auch Amir.
Nachdem er begriffen hatte, dass sie seine Nachrichten zwischen acht Uhr und vierzehn Uhr nicht beantwortete, weil sie da im Gymnasium saß, sah er keinen Sinn mehr darin, nicht in die Schule zu gehen. Er wusste schlicht mit seiner Zeit nichts Besseres mehr anzufangen. Außerdem lag ihm plötzlich daran, nicht als völliger Idiot von der Schule zu gehen. Bisher hatte er sich auf der Realschule gehalten. Neunte Klasse. Mit siebzehn. Der Zug war für ihn noch nicht abgefahren. Wenn es ihm in einem Jahr gelang, die Mittlere Reife zu bestehen, konnte er sogar aufs Gymnasium wechseln, eine Aussicht, die ihm noch vor wenigen Wochen als völlig sinnlos erschienen wäre, weil dort nur Schwuchteln und Bücherwürmer hingingen.
Doch nun tauchte er zur Überraschung seiner Lehrer jeden Tag pünktlich auf und blieb bis zum Unterrichtsschluss. Noch mehr erstaunte das Kollegium, dass Amir Bilal Interesse zeigte, nicht störte, Regeln ein- und sich aus Streitereien heraushielt. Plötzlich war er da, saß auf seinem Platz und hörte zu, anstatt wie sonst ostentativ zu gähnen, Lehrer zu provozieren oder Mitschüler zu drangsalieren. Er benahm sich derart unauffällig, dass sich sowohl seine Freunde als auch die Lehrer fast schon Sorgen machten.
Innerhalb von drei Wochen verwandelte sich Amir in eine Art Musterschüler. Zuerst war es nur wegen Julia. Doch mit der Zeit erkannte Amir einen Sinn in der Schule, er begann, sich für sich selber verantwortlich zu fühlen. Und das war, ganz abgesehen von der Freude, die er Julia damit bereitete, gut. Er fühlte sich stark, erwachsen, großartig. Und schlau. Es war eine andere Intelligenz als jene, die es ihm ermöglichte, auf dem Kinderspielplatz ein Tütchen Trips vor der Polizei zu verstecken. Als seine Deutschlehrerin ihn fragte, wieso er plötzlich korrekte Sätze formte, sagte er: »Ich bin ja nicht blöd.« Seine Zeichensetzung blieb katastrophal, aber damit konnte er leben.
Wenn sie sich nicht sehen konnten, weil Julia Hockey-Training hatte oder Pantomime oder Cellostunde, langweilte Amir sich oder nahm an Kursen des »Sternenhimmels« teil. Er brachte derart viel Sinn in sein Leben, dass es ihn manchmal überforderte. Dann bekam er es mit der Angst zu tun. Er fürchtete sich davor, dass Julia ihn verließ und er wieder zurück in sein altes Leben musste. Ohne sie war seine Seele jederzeit einsturzgefährdet, das wusste er ganz genau.
Julia und Amir trafen sich weiterhin nur in der Stadt. Manchmal legten sie sich auf die Wiese hinter dem Rathaus oder liefen bis zum Englischen Garten, wo sie den Surfern auf der Eisbachwelle zusahen oder über die nackten Menschen auf der Monopteroswiese lachten. Allmählich verlor Amir seine Scheu vor der Stadt. Dennoch verließ ihn nie das Gefühl, nicht zu den Studenten und Erwachsenen und, ja: Deutschen zu gehören. Dabei war er einer, geboren in München sogar. Aber es hatte sich nie so angefühlt. Man bleibe unter sich, hatte seine Mutter ihm einmal gesagt, als er vor Jahren in den Fußballverein wollte. Und sie sprachen nie wieder darüber.
Am Anfang hatte das Thema zwischen ihm und ihr noch eine Rolle gespielt. Es war viel von »euch« und »uns« die Rede. Doch irgendwann hatte das »Wir« gewonnen, und sie kamen auf andere Ideen. Dass sie noch nicht miteinander geschlafen hatten, war für beide kein Problem. Er war viel zu schüchtern, um sie darum zu bitten. Außerdem wusste er nicht, wo sie es hätten machen können, jedenfalls nicht in einem Gebüsch im Park. Und bei ihm zu Hause erst recht nicht. Amir vermied es, über sein Viertel zu reden, und er wäre im Traum nicht auf die Idee gekommen, sie mit in sein Zuhause zu nehmen. Sie bat ihn auch nicht darum.
Eines Tages, das war Ende Juni, lud sie ihn zu sich ein. Es war an einem Freitag. Sie sagte, dass ihr Bruder seinen achtzehnten Geburtstag feiere, es gebe ein Grillfest. Mit allen Freunden. Sie habe ihn gefragt, ob sie jemanden mitbringen dürfe, und ihr Bruder habe es ihr erlaubt. Mehr noch: Florin freue sich darauf, ihn endlich kennenzulernen. Sie habe ihm natürlich von Amir erzählt. Überhaupt sei Amir zu Hause immer wieder ein Thema, weil ihre Mutter so begeistert von ihm sei. Und nun sei es auch an der Zeit, Grenzen zu überwinden.
Sofort sagte Amir, dass er abends etwas vorhabe, eine dringende Sache, die er nicht aufschieben könne. Aber er log so ungeschickt und hastig, dass sie lachte und ihn zehnmal küsste. Da konnte er gar nicht anders und sagte, dass er gerne mitkomme. Dann suchten sie nach einem Geschenk, das er sich leisten konnte, und kauften ein Frühstücksbrettchen, auf dem stand: »Der frühe Vogel kann mich mal.« Julia war sicher, dass es für ihren Bruder passte, weil er so ein furchtbarer Morgenmuffel war. Sie ließen das Brettchen als Geschenk verpacken, fuhren mit der S-Bahn zum Rosenheimer Platz und stiegen dort in die 25er Tram um.
Amir war aufgeregter, als er zugeben wollte. Auf der Fahrt sprach er wenig, kontrollierte einmal heimlich an der Fensterscheibe, ob sein Atem unproblematisch war, und bekam feuchte Handflächen. Vor Julias Mutter hatte er keine Angst, die kannte er ja schon. Aber der Bruder konnte eine Gefahr darstellen, seine Freunde würden sich möglicherweise über ihn lustig machen. Seine Hauptsorge aber galt Julias Vater. Sie hatte von ihm erzählt. Dass er für sein Alter gut dastehe, was immer das bedeuten sollte. Und dass er eine der größten Kanzleien für Patentrecht habe. Mit über vierzig Anwälten. Und er sei deren Chef. Ein einziger angestellter Anwalt flößte Amir bereits Respekt ein. Und der Mann besaß gleich vierzig davon. Wie eine Armee stellte er sich die Kanzlei van Hauten, Storch und Ebert vor. Dieser Vater würde ihn auseinandernehmen, sie würden ihn für einen Asozialen halten, für einen Eindringling. Er gehörte nicht dorthin, in dieses Grünwald. Und je länger die Fahrt dorthin dauerte, desto größer wurden seine Zweifel.
Julia versuchte, ihn zu beruhigen. Sie legte ihren Kopf auf seine Schulter, nahm seine Hand und sagte, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Ihre Familie sei viel zu nett, um ihn nicht zu akzeptieren. Und unter Florins Freunden seien zwar einige Idioten, aber durchweg liebenswerte Idioten.
Von der Tramhaltestelle gingen sie wenige Hundert Meter in eine stille Straße direkt am Waldrand. Die Häuser hier hatten Hecken, manche auch Mauern. Hier musste niemand auf der Straße parken. Nur vor dem Haus der van Hautens standen einige Autos von Florins Freunden. Neue kleine Audis und BMWs, ein Jeep, ein älterer Porsche, ein Käfer-Cabrio.
Julia tippte eine sechsstellige Kombination in eine Tastatur und öffnete das Tor zum Grundstück. Dahinter befand sich ein langgezogener Bungalow aus Beton und Glas, darin integriert eine Garage für vier Autos und davor ein Mini mit einer großen roten Schleife. Das war Florins Geburtstagsgeschenk. Sie hörten Lachen aus dem Garten und gingen um das Gebäude herum, das im Erdgeschoss lediglich aus einem riesigen Raum bestand. Amir hatte noch nie so ein Haus gesehen, schon die Garage war um einiges größer als die Wohnung seiner Mutter. Er hatte hier nichts verloren, er musste hier weg. Dieser Nachmittag konnte kein gutes Ende nehmen. Und so sehr er Julia liebte, so wenig konnte er schon jetzt die Demütigungen ertragen, die ihm bevorstanden. Die Blicke, die Gesten. Sie würden hinter seinem Rücken tuscheln, ihre Autoschlüssel in der Hosentasche fest umgreifen und versuchen, ihn schnell wieder loszuwerden. Ihn abstoßen wie ein Organ, das ihrem Körper aufgedrängt wurde und das dieser einfach nicht haben wollte. Amir hatte das bei seinem Onkel erlebt. Eine Niere. Er hatte sie innerlich abgelehnt und war später eingegangen wie der Zitronenbaum im Wohnzimmer.
Doch Julia zog Amir mit, sie war so aufgeregt und glücklich, sie strahlte so hell, und ihre Hand fühlte sich so sicher an, dass er sich traute und dabei auch noch ein Lächeln hinbekam, ein hoffnungsvolles und offenes Lächeln, das ihm gar nicht bewusst war. Sie bogen um die Ecke des Hauses und standen plötzlich mitten auf der Terrasse, vor ihnen die Freunde des großen Bruders, mit Tellern und Gläsern in der Hand, manche rauchend. Erst nahmen sie keine Notiz von dem Paar, aber dann sah einer zu ihnen, löste sich aus der Gruppe und stellte sich vor Amir und Julia. Er war groß und dünn, trug mühsam gebändigtes krauses Haar auf dem Kopf und sehr seltene Nikes, wie Amir mit einem kurzen Blick erkannte. Der Junge klopfte mit einer Gabel an sein Glas und rief: »Achtung, Leute. Hier! Kleine Ansage! Soeben eingetroffen: die beste Schwester der Welt, mein einziger Augenstern und die mieseste Cellistin im ganzen Landesorchester.« Vereinzelte Lacher. »Und sie hat jemanden mitgebracht, auf den wir uns schon sehr lange gefreut haben. Und heute ist die Gelegenheit, ihn endlich kennenzulernen. Ihren Freund. Er heißt Amir, und wir sind froh, ihn hier begrüßen zu dürfen. Bitte seid nett zu ihm, denn er ist nett zu Julia. Und ich kann euch sagen, das ist verdammt schwer!« Wiederum Lacher. »Amir: Willkommen bei den van Hautens!« Darauf applaudierten alle, und Florin gab Amir die Hand, so weich, dass es Vertrauen schaffte, und so fest, dass Amir spürte, was für eine Kraft Florin hatte.
Dann begrüßten ihn sämtliche Gäste. Sie stellten sich ihm vor, immerhin achtzehn junge Leute. Sie sagten, dass sie sich freuten, ihn kennenzulernen. Einer bemerkte seine Sneakers und kannte sich mit Sweatshirts aus. Ein anderer fragte Amir, ob er Hip-Hopper sei, was dieser verneinte, nicht ohne sich geschmeichelt zu fühlen. Ein Mädchen kam mit einem Pulled Pork Burger auf einem Teller von der Grillstation, die von zwei tätowierten mobilen Gastronomen betrieben wurde, die sich den Platz vor dem Koi-Teich mit der Bar teilten, hinter der zwei hübsche Mädchen Drinks zubereiteten. Es war aber noch zu früh für Alkohol, und daher mixten sie alkoholfreie Sundowner. Josefine hielt Amir den Teller hin, aber noch bevor er zugreifen konnte, sagte sie: »Oh, sorry, Mensch. Das ist ja Schwein. Entschuldige bitte, das war so gedankenlos von mir. Wir ungebildeten Deutschen bekommen es einfach nicht hin mit euch Moslems. Bitte verzeih mir, es war nicht als Beleidigung gemeint.« Amir, bei dem sich kaum jemals irgendwann irgendwer für irgendwas entschuldigt hatte, sah Josefine prüfend an und wartete ab, ob jetzt brüllendes Gelächter über ihm ausbrechen würde, aber Josefine stand bloß mit dem Teller vor ihm und machte den Eindruck ehrlicher Betroffenheit. »Ich bin nicht gläubig«, sagte Amir.
»Ach so? Echt? Glück gehabt. Magst du es dann mal probieren? Ist echt große Klasse.«
Amir nahm den Teller. »Wenn du kein gläubiger Moslem bist, darfst du dann auch Alkohol trinken?«, fragte Florin, und Amir nickte. Wenn Florin gewusst hätte, was Amir seinem Körper ab dem zehnten Lebensjahr angetan hatte, wäre er womöglich vor Schreck in den Teich gefallen, also fügte Amir dem Nicken nichts hinzu.
Erst noch am ganzen Körper angespannt und nervös, löste sich Amirs Angst nach und nach. Er kam mit Florin und seinen Freunden ins Gespräch und fand bald, dass sie so anders als er auch nicht waren. Im Grunde interessierten sich doch alle für Sport, Musik und Klamotten. Zwischendurch kam Julia zu ihm und holte sich einen Kuss oder brachte ihm einen Virgin Caipi, ein Getränk, dessen nachhaltig unberauschende Wirkung Amir irritierte, weil er als Wirkungstrinker bei ähnlichem Geschmackserlebnis völlig andere Erwartungen an einen Drink hatte.
Als es langsam dunkel wurde, stiegen sie auf Gin Tonic um, von dem Tobi behauptete, es sei neben einem Tequila Sunrise der einzige Klassiker, den man auch in diesem Sommer noch trinken könne, ohne sich komplett lächerlich zu machen. Er erntete dafür viel Zustimmung, auch von Amir, der nicht so genau wusste, worauf Tobi hinauswollte. Er probierte daher auch einen Tequila Sunrise. Die Musik wurde nun lauter, erste Mädchen tanzten, während zwei Jungs kurz auf der Toilette verschwanden. Amir hatte einen Blick für solche Momente. Er wusste, dass sie dort koksen würden. Er musste sie hinterher nicht beobachten, denn die Veränderung war schon davor spürbar. Das überspannte Gelächter bei der Verabredung, die Nervosität, mit der sie die Terrasse verließen. Es machte ihn sicher zu wissen, dass die Jungen und Mädchen hier letztlich vom selben Stamm waren wie er.
Amir staunte über den japanischen Garten der van Hautens und genoss die Zuwendung der Gruppe, die ihn sofort akzeptierte, einbezog, über seine Witze lachte und ihn in eine warme Wolke von, ja: Liebe hüllte. Als die Jungen von der Toilette kamen, fiel ihm ein, dass er dort auch hinmusste, und fragte nach dem Weg. Dann ging er durch das Haus, staunend immer noch, vorbei an Kunst oder an dem, wovon er annahm, dass es Kunst sein musste. Er sah jedenfalls keinen Grund dafür, sich eine von langen Nägeln durchbohrte Holzkugel ins Wohnzimmer zu stellen, außer man sammelte solchen Scheiß. Und hängte sich Bilder auf, auf denen nichts weiter als drei bunte Farbstreifen zu sehen war. Oder ein riesiges Foto mit einer muskulösen nackten Frau in Schwarz-weiß.
Auf der Toilette brachte er mehrere Minuten damit zu, den Klodeckel immer wieder fallen zu lassen, der erst fiel, doch dann im letzten Moment abbremste und sanft und lautlos auf die Brille glitt. Amir befand sich in einem Film. Und auch wenn er in den letzten Stunden immer gelöster – und betrunkener – geworden war, so verließ ihn nicht die Unruhe darüber, dass dieser Film irgendwann zu Ende sein könnte.
Als er zurückkam, stand Elfie van Hauten auf der Terrasse und plauderte mit Josefine. Als sie Amir sah, schwebte sie auf ihn zu und umarmte ihn, hauchte einen Kuss auf seine Wange und sagte, dass sie glücklich sei, ihn zu sehen. Sie roch wieder gut, und ihre Haare bewegten sich keinen Millimeter, als sie von ihm abließ, ihren Kopf zur Seite drehte und rief: »Claus, du musst Amir Guten Tag sagen.«
Claus van Hauten rief zurück, dass er gleich da sei, er müsse nur die Schnitzeljagd ankündigen. Van Hauten stellte sich mitten auf die Terrasse und rief: »Leute, Kinder, Abenteurer. Wie bei jedem Kindergeburtstag muss es Spiele geben.« Vereinzelte Lacher. Einer rief: »Topfschlagen!«
»Nein, wir machen eine Schnitzeljagd. Ich habe unter gewaltigen Anstrengungen eine Magnumflasche Ruinart im Wald versteckt. Wer sie findet, darf sie aufmachen. Und: bekommt eine zweite als Siegerpreis geschenkt. Auf die Plätze, fertig, los!«
Darauf stoben Florin und seine Freunde durch den Garten bis zu einem Tor, von dem aus es direkt in den Wald ging. Sie ließen die Taschenlampen ihrer Handys aufblitzen und verschwanden johlend im Gehölz. Amir blieb als Einziger zurück, denn er konnte sich nichts Würdeloseres vorstellen, als im Dunkeln hinter einer Flasche Sekt herzulaufen. Ihm ging die ironische Begeisterung der anderen für diese kindische Aktion ab, sie machte ihn nur unsicher.
»Was ist mir dir? Willst du nicht mitmachen?«, fragte Claus van Hauten. Er ragte turmhoch vor Amir auf, ein Mann mit einem jungen Gesicht und grauen Haaren, die er dennoch modisch trug. Sein weißes Hemd hatte nicht eine Falte, genau wie sein Gesicht. Van Hauten trug Chinos und weiche Wildlederschuhe, an seinem Handgelenk eine große Uhr und im Gesicht einen aristokratischen Zug, der mit jedem Lächeln Selbstgewissheit und Sorglosigkeit ausstrahlte. Amir mochte ihn.
»Nein, ich schaue erst mal noch zu«, sagte Amir, dem jetzt erst klar wurde, dass er auf diese Weise womöglich längere Zeit ohne Julia würde auskommen müssen. Aber Claus van Hauten machte es ihm leicht. Er öffnete eine Flasche Champagner und goss drei Gläser ein. Eines gab er seiner Frau, eines Amir, und eines behielt er, erhob es und sagte:
»Auf Amir, den Herrscher. Ich habe deinen Namen nachgeschlagen. Er bedeutet ›Herrscher‹. Wusstest du das?«
»Nicht so genau«, sagte Amir, der erkannte, dass er im Familienleben der van Hautens offenbar schon eine gewisse Rolle spielte. Julias Vater stellte ihm kaum Fragen, was nur bedeuten konnte, dass Julia bereits alles über ihn erzählt hatte.
Sie unterhielten sich dann über den FC Bayern, und van Hauten lud Amir ein, einmal mit in seine Loge zu kommen. Beste Sicht und warmes Essen. Obwohl Amir eher an Basketball interessiert war, nahm er die Einladung an und freute sich.
Nach zwanzig Minuten war die Flasche gefunden und wurde wie eine Jagdtrophäe in den Garten getragen. Es folgte eine Champagnerdusche, noch lautere Musik, schließlich offener Kokskonsum, als Julias Eltern ins Bett gingen. Später fiel Gregor in den Teich. In dieser Nacht schliefen Julia und Amir zum ersten Mal miteinander. In ihrem Bett. Sie hatte ein Zimmer mit einem eigenen Bad. Und einem stillen Klodeckel.
Am nächsten Mittag traf sich ein gutes Dutzend der Gäste zum Frühstück im Wohnzimmer. Alle waren gut gelaunt und nur mäßig verkatert. Ihre sportliche Konstitution half ihnen dabei, den Alkohol gut zu verarbeiten. Julias Eltern saßen dabei, und es wurde gescherzt. Amir beeindruckte die Selbstverständlichkeit, mit der sich alle begegneten. Es gab hier keine Außenseiter. Nur Wohlgesinntheit, Lebensfreude und warme Croissants. Und er, Amir Bilal, gehörte zu ihnen. Er würde nichts, sicher gar nichts tun, um das zu gefährden. Niemals würde er zu Hause oder bei seinen Freunden von diesen Leuten erzählen, von der Holzkugel mit den Nägeln, dem Panamera in der Garage oder den Klodeckeln. Er würde Julia und ihre Familie und jeden von Florins Freunden bis aufs Blut verteidigen, so, wie sie auch ihn verteidigen würden. Er würde sich ihrer würdig zeigen. Und er würde Abitur machen.
In den letzten Wochen vor den Ferien bemühte sich Amir wie noch nie, um seine Versetzung zu schaffen. Und das gelang ihm, denn seine Lehrer honorierten die Anstrengungen, sprachen von einem Paradigmenwechsel, was auch immer das sein sollte. Der Groschen sei gefallen, stellten sie fest. Dafür entfremdete sich Amir zusehends von seinen Freunden. Er ging nicht mehr einmal pro Woche zu Cem, um sich Konturen nachrasieren zu lassen, sondern tauchte überhaupt nur noch einmal auf, mehr oder weniger um sich zu verabschieden. Seine neue Umgebung erwähnte er mit keinem Wort, deutete nur an, dass er jetzt viel in der Stadt sei und die Haare etwas wachsen lassen wolle. Auch lege er keinen Wert mehr auf scharf konturierte Bartschatten.
Er schlief nun meistens bei den van Hautens, an den Wochenenden machte er mit Claus Yoga auf der Terrasse oder drosch mit Florin gegen den Boxsack, der bei den van Hautens im Keller in einem kleinen Fitnessraum neben dem Pool hing. Mit Florin verstand er sich so gut, dass Julia manchmal witzelte, ihr Bruder habe endlich seinen verlorenen Zwilling gefunden.
Es kam nun vor, dass Amir nicht wegen Julia, sondern wegen Florin ins Haus kam. Sie spielten Backgammon, trainierten oder fuhren mit Florins neuem Auto in die Stadt. Florin, der nur ein Dreivierteljahr älter war, kam Amir vor wie ein lang vermisster großer Bruder. Und Florin freute sich darüber, dass Amir so offen und lustig war.
Einmal gingen sie zum Shoppen, und Florin zog ihn mit in Geschäfte, die Amir niemals betreten hätte. Weil er fürchtete, dort nicht bedient zu werden, und weil er wusste, dass er die Kleidung dort niemals würde bezahlen können. Und zuerst wollte er auch gar nicht in die Umkleidekabine, aber Florin drängte ihn dazu. Er wolle sehen, wie Amir in Ralph Lauren aussehe. Florin und der Verkäufer holten dann noch Jeans von Dolce & Gabbana herbei, kombinierten Sweater von Off-White und Supreme dazu, ergänzten das Ganze mit gepunkteten Sneakers von Comme des Garçons und bezeichneten Amir als weiße Leinwand, die man jetzt nach allen Regeln der Kunst gestalten müsse. Und wann immer Amir einwendete, es sei genug, lächelte Florin und sagte, es sei nie genug im Leben. Man müsse den Tag pflücken wie einen Apfel.