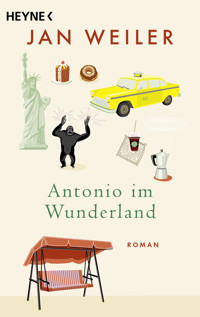9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben geht zwar immer weiter, aber es wird nicht unbedingt leichter. Jedenfalls nicht für jeden von uns: Kommissar Kühn zum Beispiel hat das Gefühl, schwerer zu sein, als es ihm gut tut. In der Seele und um die Hüfte rum. Während er sich damit abplagt, Gewicht zu verlieren, um interessanter für seine Frau Susanne zu werden, muss er sich gegen die Intrigen seines vermeintlich besten Freundes und Kollegen Thomas Steierer wehren: Seine Karriere bei der Mordkommission hängt an einem immer dünneren Faden – und er bekommt es mit einem Mörder zu tun, der ihm zeigt, wie tief man als Mensch sinken kann. Mit Empathie und einzigartigem Esprit erzählt Jan Weiler von Martin Kühn, dem sich die schwere Frage nach der Leichtigkeit des Lebens stellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: Emiliano Ponzi
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Vorwort von Ferdie Caparacq
1 – 115,2 Kilo
Für Frieda
Vorwort von Ferdie Caparacq
Wenn Du diese Zeilen liest, hast Du Dich entschlossen, in Deinem Leben mehr falsch als richtig zu machen. Dazu erst einmal meinen herzlichen Glückwunsch.
Es ist nämlich so: Die Fehler bringen Dich weiter. Sie machen Dich interessant. Sie sorgen dafür, dass es Fortschritt gibt. Oder warum gibt es Erfindungen? Weil es einen Mangel zu beheben gilt. Weil die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen. Also macht sich einer daran, die Probleme zu lösen. Falls Du immer gedacht hast, das könnten doch jetzt prima die anderen machen und Du bleibst schön auf der Couch liegen, muss ich Dir sagen: Damit ist jetzt Schluss. Mit diesem Buch wirst Du Deine Potenziale entdecken, Du wirst über Dich und Deine Umwelt nachdenken. Du wirst lernen, wie man seine Fehler und Unzulänglichkeiten in Energie umwandelt.
Und jetzt zu den schönen Nebeneffekten.
Erstens: Du wirst in zwei Wochen fünf Kilo abnehmen. Und dabei musst Du nicht einmal alles richtig machen. Du KANNST. Du musst aber nicht. Und weißt Du, warum? Weil Du ein Mann bist. Und Männer treffen ihre Entscheidungen für sich selber und für niemanden sonst.
Und damit zum schönen Nebeneffekt Numero zwei: Wenn Du dieses Buch gelesen hast, verwandelst Du Dich von dem Teppichtiger, der Du gerade bist, in eine reißende Bestie. Denn das liegt in Deiner Natur. Zu lange haben wir uns von den Frauen domestizieren lassen. Wir haben uns die Brust rasiert, bunte Cremes in unsere Gesichter geschmiert und aufgehört, beim Fernsehen zu furzen. Ich entschuldige mich nicht für meine klare Sprache, und wenn Du mit diesem Buch durch bist, wird es Dir genauso gehen.
Wir haben also alles Mögliche unternommen, um geliebt zu werden, und sind dabei der Beauty-Industrie, der Ernährungs-Industrie oder der Unterhaltungs-Industrie auf den Leim gegangen. Milliarden von Euros werden damit verdient, aus uns weibische Waschlappen zu machen. Die Unternehmen verdienen dabei gleich doppelt, nämlich zuerst mit der Enteierung der Männer und dann noch einmal mit der Verschwanzung der Frauen.
Warum sollten Frauen zum starken Geschlecht umgebaut werden? Es ist für gar nichts gut. Tausende von Jahren sind wir hervorragend damit gefahren, den Geschlechtern ihre natürlichen Rollen zu lassen. Und nun sollen die Jungs nicht mehr Cowboy spielen und die Mädchen nicht mehr Prinzessin. Das ist Stuss. Es ist gegen die Natur – und diese Natur wieder aus euch rauszuholen ist mein großes und edles Anliegen.
Ich wende mich dabei auch an euch, schöne Ladys. Auch ihr dürft dieses Buch gerne lesen. Da lernt ihr was! Und die Ernährungstipps tun euren Oberschenkeln gut, glaubt mir. Am Ende werdet ihr mir zustimmen: Frauen wollen keine winselnden Pfeifen, die sich ständig rechtfertigen und nach ihren Gefühlen suchen. Schluss mit der Heulerei. Schluss mit den Diskussionen, den Selbstzweifeln und den einteiligen Schlafanzügen. Ladys aller Länder seid froh, jubiliert und preiset meine Bemühungen: Ich gebe euch eure Männer zurück!
Ich weiß, was ihr wirklich wollt, und das solltet ihr euch auch mal fragen: Wollt ihr einen langweiligen Vogel im Norwegerpulli, der auch Sojasprösslinge dünstet und sich die Klagen über eure Menstruationsschmerzen anhört? Oder wollt ihr einen Kerl, der euch zur Begrüßung an den Arsch fasst und euch an die Schlafzimmerwand nagelt, dass euch Hören und Sehen vergeht?
Ich glaube keiner Frau, die sich für den Sojavogel entscheidet.
Aber zurück zu euch, Jungs. Ja, ihr werdet Fehler machen. Ihr werdet Rückschläge erleiden. Ihr werdet zweifeln. Scheiß drauf! Hat nicht auch Odysseus auf dem Meer gezweifelt? Oder Rommel in Afrika? Zidane im WM-Finale? Und haben nicht alle schon einmal Fehler gemacht? Die entscheidende Frage ist: Haben sich Odysseus, Rommel und Zidane danach auf eine Couch gelegt und geflennt? Oder haben sie einfach weitergemacht? – Ach! Letzteres? Na, dann solltest Du Dir an ihnen ein Beispiel nehmen und nicht an den Pussys, die heute zu Millionen die Schnuffeltücher ihrer Seelenklempner vollrotzen und dann im Kleinwagen nach Hause zockeln, wo die untervögelte Dame des Hauses vegane Klopse mit Kartoffelpüree brät. Ein Horror. Mit diesem Buch trete ich diesem Albtraum entschlossen entgegen.
Und so funktioniert die Methode Caparacq:
Da ist zunächst einmal die Ernährung. Zuckerbrot und Peitsche. Die schlägt gleich mal vier Tage zu. Du hast gesündigt, Du Sau! Also wirst Du auf Entzug gesetzt. Vier Tage keine feste Nahrung. Das macht Dich wütend, Du wirst stinken, Du wirst schwitzen, aber Du wirst Dich auch endlich mal wieder wie ein Mann fühlen. Danach Rezepte. Wir bauen Dich wieder auf. Das Fundament sind Fleisch, Eier und Nudeln.
Wenn Du hier Gutmenschenkacke wie vegane Kochrezepte suchst, habe ich nur einen Tipp für dich: Iss dieses Buch. Es ist vegan. Ansonsten halt die Klappe.
Neben den Rezepten bietet der Ratgeber Ertüchtigung für den Geist, Notwehrtexte gegen die Verweiblichung des Mannes. Lies jeden Tag ein Kapitel und nach vier Wochen und Kapitel 30 bist Du wieder da angekommen, wo die Natur Dich haben wollte: im Garten Eden der Männlichkeit.
Noch ein Hinweis, bevor es gleich endlich losgeht mit Deinem neuen Leben in Kapitel eins. Du wirst an jedem Tag dieses Programms morgens vor dem Spiegel stehen und Dich anbrüllen. »Ho, ho, hu, Du geiler Typ.« Das ist unser Schlagwort. »Ho, ho, hu, Du geiler Typ.« Kann man sich merken, oder?
Am Ende wirst Du es dreißigmal gebrüllt haben, und weißt Du was? Am Anfang kommt es nur leise raus, das ist kein Problem. Aber am Ende wackeln die Wände, wenn Du es rauslässt, denn am Ende wirst Du endlich meinen, was Du brüllst: »Ho, ho, hu, Du geiler Typ.«
Alles, was Du dafür brauchst, ist Leidensdruck am Anfang, dann Disziplin und schließlich die Gewissheit, das geilste Männchen auf dem Affenfelsen zu sein. Und am Ende des Buches sprechen wir uns wieder. Du wirst mir aufrecht stehend begegnen. Du wirst endlich ein Kinn haben. Du wirst aussehen wie ein Mann und nicht wie eine Muschi. Und Du wirst es lieben, genau wie die Frauen Dich lieben werden. Und sie werden Dich nicht nur lieben. Sie werden Dich fürchten.
Hau rein
Ferdie Caparacq
1 – 115,2 Kilo
Martin Kühn blätterte die vierte Seite von »Weck die Bestie, Du Sau!« um, seufzte tief und sah nach links, wo seine Frau Susanne noch schlief. Sie hatte die Decke über die Schultern gezogen, und in dem Moment, wo Kühn seine Frau ansah, drehte sie sich auf die linke Seite und ihm den Rücken zu.
Er war schon eine Weile wach. Seit einiger Zeit brauchte er keinen Wecker mehr. Wenn der klingelte, hatte Kühn schon die To-do-Liste für den Tag in seinem Kopf erstellt. Er visualisierte seinen Weg durch die Weberhöhe. Er stellte sich vor, welche Nachbarn er vermutlich treffen würde und dass er Elisabeth Rohrschmidt auf keinen Fall begegnen wollte. Ihr Mann Rolf, Chemielehrer und Idiot, hatte hoch verschuldet einen Becher Joghurt vergiftet und dann den Supermarkt auf der Weberhöhe damit erpresst. Ein Mädchen war an dem Zeug gestorben, Rolf hatte versucht sich umzubringen und saß nun im Gefängnis. Kühn war nicht scharf darauf, Rolfs Frau über den Weg zu laufen, denn er hatte in dem Fall ermittelt.
Die Stimmung in der Nachbarschaft des Michael-Ende-Weges war deswegen ihm gegenüber zwar nicht feindselig, aber distanziert. Und in dieser Lage dachte Kühn darüber nach, dass er Elisabeth und einigen anderen Mitbürgerinnen und Mitbürgern lieber aus dem Weg gehen wollte.
Jedenfalls wusste er jetzt im Bett schon, was er anziehen, welche S-Bahn er nehmen und wann er im Präsidium auf seinem Stuhl sitzen würde.
Er war im Geiste schon Akten durchgegangen, hatte damit begonnen, sich dem Leben zu stellen, und er hatte die morgendliche Erektion durch beharrliches Ignorieren so weit niedergekämpft, dass er auf die Toilette gehen konnte.
Früher war er mal ein Langschläfer gewesen, aber inzwischen befand er sich nachts nicht mehr im Schlaf, sondern eher in einer Art Ohnmacht, aus der er frühmorgens hochschreckte. Wenigstens hatte er etwas zu lesen. Das Buch über die Caparacq-Methode war ein Bestseller, und das schon seit Monaten.
Die Caparacq-Methode, von der im Buch die Rede war, erfreute sich im Moment größter Beliebtheit bei allen Menschen, die schnell und effizient ihr Gewicht reduzieren wollten. Die Kur war ausdrücklich nicht auf Nachhaltigkeit angelegt, was ihr Erfinder, der belgische Arzt Ferdie Caparacq, oft genug betonte. Der sogenannte Jo-Jo-Effekt war sogar Bestandteil des Programms. Er wolle den üblichen Diäten den verlogenen Schleier des vermeintlich Gesunden vom Gesicht reißen und Männern dabei helfen, endlich wieder richtig männlich zu sein, schrieb Caparacq in seinem Buch.
Nach Ansicht von Kritikern war es kein Wunder, dass die Caparacq-Methode in puncto Gewichtsabnahme funktionierte, weil man dabei zunächst einmal tagelang nichts aß.
Im Großen und Ganzen basierte Caparacqs Programm auf einer vom Erfinder persönlich ausprobierten Vermischung anderer Abnehmanleitungen, die er so dreist wie wahllos miteinander kombinierte. Zum Beispiel durfte man an einigen Tagen für 16 Stunden gar nichts zu sich nehmen, außer Ingwerwasser und Melonensaft mit einem Spritzer Wodka. In den restlichen acht Stunden gab es durchaus etwas zu essen, an den ersten vier Tagen jedoch überhaupt nichts. Da durfte man ausschließlich Ingwerwasser oder Gemüsebrühe trinken. Nach vier Tagen konnte man wieder etwas Festes zu sich nehmen, nämlich eine Avocado, sehr viel kaubarer wurde es dann für weitere drei Tage nicht. Nach insgesamt acht Tagen folgte ein Ausnahmetag, an dem man plötzlich essen und trinken durfte, was man wollte, was sich jedoch die wenigsten Teilnehmer trauten, um den Erfolg der Diät nicht zu gefährden. Und so blieb es auch am Ausnahmetag bei einer halben Grapefruit, einem gekochten Ei und schwarzem Kaffee. Bis zum nächsten Ausnahmetag, an dem sich die meisten Caparacq-Jünger belohnten, was zunächst folgenlos blieb, aber in einen Rückfall in alte Gewohnheiten mündete. Das war durchaus gewollt.
Caparacq schrieb von der natürlichen Gewichts-Amplitude des Lebens, die mal in die eine und mal in die andere Richtung ausschlage. Daher enthielt sein Buch auch Anleitungen für Mayonnaise und karamellisierte Schweinswürstchen à la Depardieu. Für jede Phase der Amplitude bot Caparacq die richtigen Rezepte, kombiniert mit philosophischen Aperçus für die geschundene Männerseele.
Der Autor geizte nicht mit Lebenshilfe für die Zielgruppe des mittelalten Herrn, der gerne ein reißender Wolf wäre, sich jedoch mit der Zeit in einen zahnlosen Waschbär verwandelt hatte. »Wenn Du es Ihr richtig zeigen willst, solltest Du vorzeigbar sein« hieß es auf Seite elf. Und auf Seite 36 folgte der bemerkenswert simple, aber eingängige Satz: »Nimm Dir, was Du magst, dann hast Du, was Du brauchst.«
Frauen spielten in dem Werk eher eine untergeordnete Rolle und fungierten in meist tierischen Analogien wahlweise als zu erbeutende Hasen, trottelige Sex-Mäuse oder als meckernde Ziegen (»Frauen wollen eigentlich keine Männer, sondern Untergebene«).
Dennoch gab es auch Frauen, die das Buch lasen und die Anleitungen des Männerverstehers Caparacq befolgten, weil sie nun einmal so einen durchschlagenden Abnehm-Erfolg versprachen. Zehn Kilo in vier Wochen waren garantiert. Wenn man länger durchhielt, schmolz man regelrecht von einer Kleidergröße in die nächste. Und wem es reichte, der konnte sich übergangslos einen Gin Tonic mixen und den Kartoffeln in der Fritteuse beim Blasenwerfen zusehen. Das Undogmatische an der Caparacq-Methode war ihr eigentliches Erfolgsgeheimnis. Wer sich streng an ihr orientierte, konnte nach einem halben Jahr wieder von vorne mit der Diät beginnen. Nichts anderes versprach ihr Schöpfer Ferdie Capraracq, und das machte ihn in den Augen seiner vielen Leserinnen und Leser besonders glaubwürdig.
Bevor sich Martin Kühn für Caparacq entschied, hatte er sich ausführlich im Internet über alle möglichen Diäten informiert. Entweder in der Dienststelle oder abends zu Hause, wenn Susanne bereits schlief. Kühn hatte vor Kurzem seinen 45. Geburtstag gefeiert und dabei eine kummervolle Sentimentalität verspürt, eine Art Abschiednehmen von der Jugendlichkeit, die er bis dahin für sich in Anspruch genommen hatte. Seine langen blonden Haare waren schon vor einigen Jahren einer nicht näher beschreibbaren Frisur gewichen; etwa zur selben Zeit erhielt er eine Lesebrille, die ihm vom Optiker mit den Worten »Willkommen in der Altersweitsicht« überreicht worden war. Und nun gewann er den Eindruck, dass ihm sein Körper wegschwamm. Er geriet in einen Strom des Alterns, dem er mental wenig entgegenzusetzen hatte. Am ehesten konnte er ihn durch physischen Einsatz bremsen und hatte damit begonnen, mehr oder weniger regelmäßig durch die Nachbarschaft zu joggen, was ihm allerdings überhaupt keine Freude machte.
Das lag zum einen an ihm und seinem sportlichen Desinteresse und zum anderen an der Weberhöhe. Man hatte den vielen kleinbürgerlichen Bauherren und -frauen Grundstücke auf dem kontaminierten Gelände einer früheren Munitionsfabrik angedreht. Nachdem das Gift durch die Keller in die Häuser gedrungen war, hatten alle Nachbarn versucht, den Bauträger zu verklagen, doch die Reformbau, ein Tochterunternehmen der kreditgebenden Reformbank, zögerte den Prozess immer weiter hinaus, um Entschädigungen zu vermeiden.
Während die Eigentümer von Giftograd, wie die Weberhöhe im Münchener Volksmund spöttisch genannt wurde, alles dafür taten, ihre Keller abzudichten und sich gegen den übermächtigen Gegner zu formieren, saß die Reformbau den Skandal ganz einfach aus und widmete sich neuen Projekten.
Vor Kurzem war jedoch Bewegung in den Vorgang gekommen, denn Kühn hatte jemanden kennengelernt, der ihm einen Weg zu einer Sammelklage verriet. Und dann hatten sie tatsächlich unter den Nachbarn einen amerikanischen Bauherrn entdeckt: Shaun Anderson aus Baltimore, der mit seiner Familie für zehn Jahre im deutschen Büro eines US-Unternehmens angeheuert hatte. Anderson hatte Haus und Grundstück noch in den USA lebend erworben, die Anwälte seiner Firma hatten den Deal eingefädelt, und Gerichtsstand für den Kaufvertrag war Baltimore in Maryland, USA.
Für die Anwohner-Initiative »Saubere Weberhöhe«, der auch Kühn angehörte, eröffnete es die Möglichkeit einer Sammelklage, falls Anderson eine Klage gegen die Reformbau in den USA anstrengen würde. Wochenlang bearbeitete man den Amerikaner und seine Frau, und schließlich erklärte dieser sich bereit, gegen die Reformbau zu Felde zu ziehen. Kurz darauf hatten sich fast alle Hausbesitzer dieser Klage angeschlossen, was ein hohes finanzielles Risiko für den Fall einer Niederlage in sich barg – und die Aussicht auf einen sagenhaften Geldregen, wenn man obsiegte. Die Stimmung in der Weberhöhe schwankte andauernd zwischen Euphorie und Depression, denn natürlich teilte die Reformbau per Einschreiben umgehend mit, dass man die Siegchancen der Bewohner für gering halte. Dennoch habe man sich entschlossen, die vorher schon einmal angebotene Kompensation aufzustocken und das Angebot für eine Abfindung bei gleichzeitigem Ausstieg aus der Klage auf 100 000 Euro erhöht.
Sofort waren drei der 51 Kläger eingeknickt und hatten sich aus der Sammelklage verabschiedet. Die restlichen 48 beschworen in regelmäßigen Treffen ihre Einigkeit und zitterten sich in den Schlaf. Shaun Anderson und seine Familie wurden zu Siedlungsikonen und bei jeder Gelegenheit von ihren dankbaren Nachbarn mit Bratwürsten oder Kuchen vollgestopft. Die völlige Abhängigkeit von dem Amerikaner, der sich als Republikaner bezeichnete und regelmäßig über Schwarze, Schwule und die Weicheiigkeit seiner deutschen Kollegen herzog, ging Martin Kühn auf die Nerven.
Womöglich trug es dazu bei, dass Kühn die Rennerei durchs Viertel bald wieder einstellte. Außerdem hatte es viel geschneit in diesem Winter, und da ließ es sich nicht gut laufen. Nach dem Jahreswechsel stellte er dann fest, dass seine Hosen nicht mehr richtig passten, oder vielmehr: Sie passten schon noch, allerdings erforderte der Inhalt der Hosen die Ausweitung des Gürtels um ein Loch, bequemer waren zwei. Das war Martin Kühn noch nie passiert.
Sein Oberkörper war immer ein rechteckiger Kasten gewesen, mit definierten Oberarmen und einem unbehaarten, freundlichen Bauch. Über die Jahre waren allerdings Haare an Stellen gewachsen, die Kühn dafür nicht vorgesehen hatte. Und es entwickelten sich da und dort Flecken und Male, die er nicht sorgenvoll, aber mit mildem Interesse beobachtete. Auch hatte seine Haut an Spannkraft verloren und dafür an Fahlheit gewonnen. Alles in allem fand er sich nicht unwiderstehlich, aber immer noch vergleichsweise passabel.
Kühn hatte dennoch gewärtigen müssen, dass seine Frau ihn nicht mehr so begehrte wie früher. Das sei normal, dachte er sich. Nach achtzehn Jahren Ehe. Und 23 Jahren Beziehung. Da wird man nicht angesprungen, wenn man mit Lesebrille auf der Nase den Schnapper von der Haustür repariert. Man stürzt sich allerdings auch nicht mehr auf seine bügelnde Frau. Man schrumpft und runzelt gemeinsam in Würde.
Dennoch verletzte ihn das mangelnde Interesse seiner Frau, denn es bestätigte seine Selbstwahrnehmung als alternder Ex-Gutaussehender. Nach seinem Zusammenbruch, der ein Jahr her war, hatte sich ihr Verhältnis nicht mehr richtig eingerenkt. Kühn hatte Susanne vor Monaten – und das war vorher noch nie geschehen – eine Affäre unterstellt und selber eine gehabt. Das hatte sein Selbstwertgefühl zwar mittelfristig aufpoliert, aber auch ein bemerkenswert ambivalentes Schuldgefühl ausgelöst: Natürlich tat es ihm leid, dass er seine Frau betrogen hatte. Aber gleichzeitig fand er, dass es nur dazu gekommen war, weil sie sich nicht für ihn interessiert hatte. Er war sozusagen zu gleichen Teilen schuld wie sie.
Dennoch stand die gegenseitige Scham und ihr Gefühl der Unzulänglichkeit zwischen ihnen. Kühn nahm in den kommenden Wochen sukzessive an Gewicht zu. Im unteren Drittel seines Oberkörpers verschob sich Landmasse. Der haarlose Bauch drängte seitlich über den Bund seiner Hose. Und vorne beulte sich das Hemd. Wenn Kühn an sich heruntersah, konnte er die Gürtelschnalle nur sehen, wenn er sich vorbeugte. Außerdem nahm er mit außerordentlichem Gram zur Kenntnis, dass er offenbar zur sogenannten Biertitte neigte.
Das machte ihn weiblicher, als es ihm gefallen hätte, und es brachte ihn ein wenig in die Defensive, wie er fand. Überhaupt geriet seine Männlichkeit in letzter Zeit in Gefahr, das spürte er sehr deutlich, und es irritierte ihn zunehmend. Er selbst hatte sich über die Stellungen des Mannes und der Frau in der Gesellschaft nie Gedanken gemacht. Er hätte nicht einmal gewusst, wozu das hätte gut sein können. Natürlich fand er es ungerecht, dass Frauen im Allgemeinen weniger Geld verdienten als Männer. Und er war durchaus der Meinung, dass Beamtinnen dieselben Aufstiegschancen zustanden wie ihren männlichen Kollegen. Mit Frauenrechten hielt er es wie mit der Mülltrennung: Beides fand er sehr sinnvoll. Weiter dachte er nicht, trennte Papier-, Rest- und Plastikmüll und ging respektvoll mit Kolleginnen und Nachbarinnen um. Sein Seitensprung war nicht als rücksichtslose Unterwerfung vonstattengegangen, sondern er war verführt worden. Von einer selbstbewussten Frau. Darauf legte er Wert, obwohl er fand, dass es ihm nicht schmeichelte.
Ebenfalls wenig triumphal geriet ihm die Auseinandersetzung mit Susannes immer deutlicher zutage tretendem weiblichen Selbstbewusstsein. Anfangs hatte er sich eingebildet, dass sich diese Zeichen weiblicher Selbstbehauptung erst durch die Verfehlung mit Ulrike Leininger als eine Form der Widerständigkeit bei Susanne herausgebildet hatten. Aber dann schwante ihm allmählich, dass seine Frau sich ganz einfach veränderte. Sie nahm chauvinistische Sprüche an ihrem Arbeitsplatz nicht mehr gelassen hin, sondern konterte scharf. Sie beschwerte sich bei der Schulleitung, weil Alinas Klassenlehrerin vor den zehnjährigen Kindern erklärt hatte, dass nur alleinstehende Frauen zur Arbeit gehen sollten. Sie reagierte zunehmend spöttisch auf ihren Mann, wenn er in ihren Augen Ansichten vertrat, die nicht zeitgemäß waren. Dann sagte sie: »Junge, wir haben 2019 und nicht 1920.«
Kühn spürte, dass sie ihn manchmal regelrecht mied, und er konnte sie nicht mehr damit zum Lachen bringen, dass er o-beinig durchs Wohnzimmer ging, grunzte und sich dabei in den Schritt griff. Das hatte sie früher witzig gefunden, jetzt verdrehte sie die Augen.
Und dann waren sie aus dem Kino gekommen. Es hatte einen politischen Film gegeben, nicht gerade die größte Leidenschaft des Martin Kühn, dem im Kino sehr an einfachen Konfliktlösungen gelegen war, gerne im Weltraum oder in mittelalterlich anmutenden Fantasiewelten. Aber Susanne hatte sich gewünscht, etwas Relevantes zu sehen. Also hatten sie sich einen amerikanischen Film angeschaut, in welchem Politiker vom alten Schlag die Welt unter sich aufteilen. Lauter alte Männer in schlecht sitzenden Anzügen. Über zwei Stunden lang. Kühn konnte der Handlung nur schwer folgen und drohte einzuschlafen, was er sich aber nicht traute, weil er dann geschnarcht hätte.
Also hielt er durch, und als sie das Kino verließen, heuchelte er Begeisterung, um größeren Debatten aus dem Weg zu gehen. Aber Susanne war verärgert, und alles, was sie über den Film sagte, war: »Keine einzige starke Frauenrolle.« Diese Kritik irritierte Kühn, denn darüber hatte er sich wirklich keine Gedanken gemacht. Und genau das war es dann auch, was seine Frau ihm vorwarf. Nach diesem Kinobesuch mehrten sich die Anlässe, bei denen sie ihn anklagte, sich nicht deutlich genug pro Frau zu positionieren. Wenn er es versuchte, glaubte sie ihm nicht. Und wenn er argumentierte, dass die Welt doch ganz gut mit männlichen Schiedsrichtern auf dem Fußballplatz zurecht gekommen sei, ohne etwas gegen weibliche Schiedsrichter gesagt haben zu wollen, unterstellte sie ihm ein geradezu mitleiderregendes Festhalten am Patriarchat. Das verunsicherte Kühn. Und er, der seine Männlichkeit immer für ein großes Plus hielt und nicht weiter erwähnenswert fand, stand unter einem Druck, den er sich kaum erklären konnte und dem er weder emotional noch vom Verstand her gewachsen war.
Nachdem nun auch noch sein Gürtel verrücktspielte, beschloss er, dem Ungemach diszipliniert entgegenzutreten. Teils, um sich wohlerzufühlen, teils um Susanne zu beweisen, dass er durchaus bereit war, sich für sie zu schinden, und außerdem, weil er sich einbildete, mit einer zumindest periodischen Konzentration aufs Körperliche seine Prostata zu befrieden.
Vor fünf Monaten hatte ihm der Arzt eröffnet, dass es dort zu einer ungestümen Zellteilung kam und der PSA-Wert besorgniserregend erhöht sei. Daraufhin hatte Kühn Panik bekommen und auch deshalb diese Nacht mit seiner Kollegin Leininger verbracht. Er wollte einfach sehen, ob noch alles funktionierte. Danach hatte er sämtliche Gedanken an eine mögliche Erkrankung ganz weit nach hinten in seinen Kopf verbannt. Und natürlich war er nicht zu dem Onkologen gegangen, der ihm von seinem Arzt empfohlen worden war.
Kühn hatte sich die Auswahl der richtigen Diät nicht leicht gemacht und sorgfältig recherchiert. Es gab solche, bei denen man keine Kohlenhydrate, aber Fett zu sich nehmen durfte. Oder kein Fett, keinen Zucker, keinen Alkohol, aber Huhn und Fisch. Problematisch an den meisten Programmen fand er, dass dort dauernd gekocht werden musste. Das ging ja nicht in der Dienststelle. Und er wollte auch nichts Eingetuppertes von zu Hause mitbringen. Das war unter seiner Würde. Die Caparacq-Methode überzeugte ihn dadurch, dass er einfach gar nichts essen würde. Und was es später gab, konnte man unauffällig ins Büro schleusen. Er wollte als Chef nicht, dass seine Ernährung in der Abteilung zum Thema wurde. Es war ihm peinlich.
In München wird, gerade in Relation zur doch eindrucksvollen Einwohnerzahl von fast eineinhalb Millionen Menschen, nicht allzu oft unter Fremdeinwirkung gestorben. Und so dachte Kühn, dass jetzt ein guter Zeitpunkt war, weil kein Ermittlungsdruck auf ihm lastete. Also kaufte er das Buch in der Shoppingmall der Weberhöhe und legte es unter den missbilligenden Blicken seiner Frau auf seinen Nachttisch.
Susanne hielt Caparacq für einen chauvinistischen Idioten und sein Buch für einen Angriff auf die Frauen und den Feminismus. Mit dieser Meinung stand sie nicht alleine. In den Medien tobte ein vehementer Streit darüber, ob Caparacq die Männer in die Steinzeit oder in die Zukunft führte. Es meldeten sich auch ein paar Kritiker, die behaupteten, dass das Buch einfach ein genialer Marketingcoup und das pseudo-männliche Gefasel des Autors nur verkaufsförderndes Gewäsch seien. Das konnte durchaus sein, denn Ferdie Caparacq trat in mehreren Talkshows auf, um dort seine Sprüche zu klopfen, was sich tatsächlich enorm verkaufsfördernd auswirkte.
Kühn fand den Text nach der Lektüre des Vorwortes auch etwas dämlich, aber er las sich unterhaltsam. Und Susanne würde vermutlich nichts mehr einwenden, wenn ihr Mann in drei oder vier Wochen um zehn Kilo erleichtert vor ihr stand. Zehn Kilo waren keine unrealistische Zielsetzung. Kühn wog bei 198 Zentimetern Körpergröße 115,2 Kilo. Das entsprach einem Body-Mass-Index von 29,3, was wiederum ein kleines Übergewicht dokumentierte. Normal war bei seiner Länge und in seinem Alter ein BMI von 22 bis 28 Punkten. Nach dem Verlust von zehn Kilo würde er auf einen BMI von 24,5 kommen, also genauso schön dünn sein wie vor 25 Jahren. Kühn war nicht eitel, aber diese Vorstellung gefiel ihm sehr.
Er begann also seine Diät, indem er nichts zu sich nahm außer einem Glas warmen Leitungswassers und dem Caparacq’schen Tagesmotto, welches heute lautete: »Ganz tief verborgen steckt ein Mensch. Hol ihn raus!« Dann sah er in den Spiegel und sagte leise »Ho, ho, hu, du geiler Typ«. Er schaute in seinen Zahnzwischenräumen nach, ob dort noch etwas zu essen war, denn bei dem Gedanken, dass er jetzt den ganzen Tag nichts mehr kommen sollte, bekam er augenblicklich schlechte Laune.
Kühn stellte sich darauf ein, den ersten Tag seines neuen Lebens als Hungerkünstler damit zu verbringen, seinen Schreibtisch aufzuräumen und einige der Memos und Mails zu lesen, die er in den vergangenen drei Wochen ignoriert hatte.
Er rechnete damit, dass ein geruhsamer Fastentag vor ihm lag. Nun kann man jedoch den Menschen kaum vorschreiben, wann sie ihre Straftaten begehen sollen. Und so kam es, dass genau am ersten Tag von Kühns Diät nach der Caparacq-Methode gegen zwanzig nach elf das Telefon im Kommissariat klingelte und der Fund einer leblosen Person gemeldet wurde, was Kühns Plan, geruhsam ins Idealgewicht zu trödeln, augenblicklich vereitelte.
Der Kollege Steierer trat in Kühns Büro und sagte: »Frauenleiche auf einer Baustelle in Obermenzing. Sieht nach Tötungsdelikt aus.« Kühn erhob sich, nahm seine Jacke, und sie fuhren los.
Die Arbeit der Ermittlung begann bereits mit der Anfahrt zum Fundort der Leiche. Oft erzählte die Umgebung etwas von der Tat, und Kühn versuchte, alles in sich aufzunehmen, was auch Täter und Opfer vor ihm gesehen hatten. Er konzentrierte sich, um Zusammenhänge herzustellen. Eine Autobahnauffahrt in der Nähe konnte zum Beispiel darauf hinweisen, dass man den Ablageort seines Opfers nach günstigen Fluchtmöglichkeiten ausgesucht hatte. Doch der Ort, den sie nach zwanzigminütiger Fahrt erreichten, bot sich dafür nicht an. Er war nur über eine schmale Straße zu erreichen. In der Nachbarschaft gab es bloß das Gelände einer Großbrauerei und ein Gartencenter sowie den Lärm von der Autobahn, die am Gelände vorbeiführte. Kühn hatte gesehen, dass auf der anderen Seite des Grundstücks ein Campingplatz lag. Das fand er interessant.
Der Fundort der Leiche war noch keine richtige Baustelle, wie Steierer gesagt hatte, eher so etwas wie eine offene Wunde in der Landschaft, die man geöffnet hatte, um einen Baumarkt hineinzupflanzen. Die Erdarbeiten waren abgeschlossen, das Material für die Fundamente lag schon bereit, aber nach dem Aushub war der Winter mit Massen von Schnee über München gekommen, und man hatte die Arbeiten unterbrochen. Nun waren sie wieder aufgenommen worden. Man hatte gleich am ersten Tag die Funktionsfähigkeit der bereits fertiggestellten Wasserversickerung überprüfen wollen und darin den toten Frauenkörper entdeckt.
Manchmal konnte Kühn einem Tatort ansehen, was geschehen war. Wenn er zum Beispiel in ein Einfamilienhaus kam, in dem der Vater die Mutter erschlagen hatte, erzählten die Erbsensuppe, die Fernbedienung des Flatscreens, die geöffnete Mahnung und der Schürhaken des unbenutzten und unbezahlten Kamins ihm ganze Romane. Wenn er den erschöpften Vater in der fürs Wohnzimmer zu groß geratenen Couchgarnitur hocken sah, Blut an den Händen und am Kopf, den er in diesen Händen zu verbergen versucht hatte, dann musste er kaum Fragen stellen. Der Ort verriet ihm schon alles.
Hier schwieg er jedoch. Was dem Frauenkörper widerfahren war, den man aus einer Sickergrube geborgen hatte, das hatte nichts mit diesem leeren Ort zu tun. Sie fühlte sich gespenstisch an, diese völlige Abwesenheit von Inhalt, von Zusammenhang, dieses totale Fehlen einer Geschichte, fand Kühn. Aber vielleicht lag das auch nur an seinem Hunger.
Er versuchte trotzdem, sich auf seine Aufgabe zu konzentrieren. Und die Aufgabe bestand darin, diese fehlende Geschichte zu entdecken und sie von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende zu erzählen. Naturgemäß war es immer am schwersten, den Anfang der Geschichte zu finden. Den Moment, an dem alles begonnen hatte, was auf dieser Baustelle sein Ende gefunden hatte.
2 – 45 Kilo
Am liebsten ist Sebastian der Geruch im Rosalita’s. Dort versprüht man einen Duft, der ihn an etwas in seiner Kindheit erinnert. Es fällt ihm zwar nicht ein, was es ist, aber er saugt diesen blumigen Geruch ein und freut sich über die Aufmerksamkeit der Betreiber, die ihren Laden offenbar gut pflegen.
Anderswo stinkt ihm und den Kollegen eine Mischung aus Parfüm und Desinfektionsmitteln entgegen, die Sebastians Augen tränen lassen. Dann sieht er die Mädchen und die Gäste sekundenlang nur durch einen Schleier, muss zwinkern und sich mit dem Handrücken über die Augen fahren, bis er sich einen Überblick verschaffen kann.
Aber das kommt nur selten vor, denn sie gehen nicht oft in die Tabledance-Bars oder Nightclubs hinein. Keiner der Barmänner oder der Mädchen ruft gerne nach der Polizei, es ist nicht gut fürs Geschäft. Die Gäste werden davon nervös.
Aber manchmal muss die Polizei kommen. Ein amerikanischer Tourist weigert sich, die zweite Flasche Sekt zu bezahlen, weil er sie angeblich nicht bestellt habe. Oder ein Student randaliert, bereits vom Leben enttäuscht und nun wütend, weil er gerne mehr bekommen hätte als einen Tanz an seinem Platz. Gibt aber nicht mehr, das ist der Hauptbahnhof und nicht das Gewerbegebiet. Gewerbe gibt es dort, hier wird nur getanzt. Man kann wen kennenlernen, das geht die Wirte ja nichts an. Aber in der Bar wird nur getrunken und geglotzt. Maximal wird gefragt, und wenn es einer übertreibt, begleitet man ihn nach draußen.
Mancher landet dann direkt im Hauptbahnhof und taumelt betrunken, betrogen und empört durch die Halle. Wenn Sebastian im Dienst ist, lernt er Leute wie den Pharmavertreter aus Frankfurt kennen, der seine Uhr angeblich im Columbo gelassen hat. Die Uhr, die er als Bonus vor vier Jahren bekommen hat. Da war der Umsatz fantastisch und die Stimmung auch. Inzwischen ist beides im Keller. Sebastian mag den Mann nicht. Der zetert, dass sie ihm die Uhr geklaut haben. Kann stimmen oder nicht. Ob er eine Anzeige erstatten wolle, fragt Sebastian den Mann. Und der ruft, dass er sich die Uhr zurückhole. Sebastian bittet ihn, sich auszuweisen, aber der Mann will nicht, also muss er mit auf die Wache.
Dort geht das Theater weiter, und Kollege Klaus setzt den Mann grob auf einen Stuhl. Dabei schlägt der mit dem Hinterkopf gegen die Wand und will erst einmal Anzeige wegen Körperverletzung erstatten. Bei wem er das könne? Und er wolle seine Uhr zurück. Man mache vermutlich gemeinsame Sache mit den Kriminellen aus diesem Columbo-Puff, und er werde damit zur Zeitung gehen. Zuerst geht er aber in ein Einzelzimmer zur Ausnüchterung. Obwohl er gar nicht so betrunken ist, dass es sein müsste. Da hat Sebastian schon ganz andere Gestalten erlebt. Aber Klaus und Erik haben das so beschlossen, damit der Mann die Klappe hält. Und das macht er auch irgendwann, und zweieinhalb Stunden später darf er wieder raus. Die Beamten legen ihm nahe, die Anzeige wegen des Diebstahls seiner Uhr am folgenden Tag zu erstatten, wenn er wieder klar im Kopf sei. Er solle erst einmal im Hotel nachsehen, ob die Uhr nicht vielleicht dort auf dem Waschbecken liege.
Und genau dieser Mann begegnet Sebastian nur eine Viertelstunde später wieder. Allerdings hat er nun eine blutige Nase und sitzt beim Seiteneingang des Bahnhofs auf dem Gehweg. Sebastian und seine Kollegin Maxine helfen ihm auf die Beine, und er will gleich wieder über die Straße und rein ins Columbo, weil er nicht genug hat. Er habe nämlich soeben festgestellt, dass der Mann an der Bar seine Uhr am Arm trage, seine Uhr, seine Bonus-Uhr. Sebastian weiß jetzt auch nicht weiter. Seine Zuständigkeit endet ja an diesem Bürgersteig. Die Wache am Hauptbahnhof ist für die Clubs in der Nachbarschaft eigentlich nicht zuständig. Aber der Mann eiert schon wieder los, und er sieht aus, als würde er hinter dem Eingang des Columbo gleich die Treppe runterfallen; die ist steil und düster. Also laufen Maxine und Sebastian hinterher, und es verschlägt ihm den Atem, weil es hinter der Tür nach Ammoniak und Alkohol stinkt, unheilvoll und aggressiv. Es riecht, als sei man selber schuld, wenn man diese Treppe hinuntersteigt, als akzeptiere man mit dem Einatmen die Geschäftsbedingungen des Ladens. Stufe um Stufe geht es hinab in diese Hölle der Erwachsenenunterhaltung, und dann steht Sebastian in seiner warmen Schutzweste mitten im Elend des Columbo.
Der Uhren-Mann ist erst einmal nirgends zu sehen, bloß zwei Damen sitzen in einer Ecke und ein Alter an der Theke. Und dahinter steht der Barmann mit Samurai-Zopf und Kinnbärtchen. Der Barmann fragt Sebastian, was er für ihn tun könne. Im selben Moment stürzt der Pharmavertreter aus Frankfurt von der Garderobe aus heran und versucht bäuchlings über den Tresen zum Samurai zu rutschen, um ihm die Uhr zu entreißen. Aber der tritt einen Schritt zur Seite, und der Vertreter rutscht an ihm vorbei und fliegt hinter die Theke mit dem Gesicht zuerst aufs Linoleum mit der rutschfesten, dreckigen Plastikmatte.
Sebastian versucht nun, den Sachverhalt zu klären, aber der Barmann hebt die Hände und dreht die Handgelenke, und da ist keine Uhr. Der Alte am Tresen lacht blöde, der Vertreter kommt wieder zum Vorschein und will eine Lokalrunde ausgeben. Sebastian beschließt, dass der Einsatz vorbei ist, und rückt mitsamt seiner Kollegin ab. Den Geruch in seiner Nase bekommt er den ganzen Tag nicht mehr los.
Und deshalb mag er das Rosalita’s so gerne. Es ist so frisch und hell und freundlich, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dort könnten eventuell Prostitution oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder sonst was vorliegen.
Aber es ist ja selten, dass sie in die Läden rund um den Hauptbahnhof kommen. Der ist ihr Revier, und das ist bloß ungefähr 15 Hektar groß. Diese befinden sich in der Bahnhofshalle inklusive der Bahnsteige und den Nebengebäuden sowie den Untergeschossen und dem Vorplatz. Man braucht nicht lange, um den ganzen Bereich der Inspektion zu kennen mitsamt den vielen Menschen, die hier arbeiten und Würstchen verkaufen oder Schließfächer warten oder Passanten anschnorren.
Sebastian ist einer der Jüngsten in der Polizeiinspektion 16, wie die Wache im Hauptbahnhof offiziell heißt. Einundzwanzig ist er und seit elf Monaten dabei. Er hätte sich auch den Flughafen vorstellen können, aber da haben sie ihn nicht genommen. Und in anderen Einheiten auch nicht. Also hat er einfach akzeptiert, als sie ihm den Hauptbahnhof zugeschoben haben. So richtig dringend will da keiner hin, wegen der Kotze und den Aussätzigen und dem Lärm. Aber als Sebastian mal da ist, findet er es gar nicht mal so übel. Man hat ja Handschuhe an, wenn man die Schmutzigen rausschmeißt. Und man muss nicht jeden gleich anfassen, dem man einen Platzverweis erteilt.
Klaus hat ihm vor der ersten Streife gleich mal erklärt, wie man durch den Bahnhof geht. Da dürfe man nicht wie ein ängstlicher Schwächling herumschleichen, man müsse sich schon auch aufmandeln. Schließlich repräsentiere man die Staatsgewalt. Und es reiche nicht, dass man seine Weste anhat und die festen Schuhe, die Mütze, die Handschuhe und die Dienstwaffe, das Spray, Handschellen, Funkgerät, dieses ganze Bullen-Charivari. Es gehöre auch der richtige Gang dazu. Klaus macht Sebastian das vor, auf dem Flur der Inspektion, nicht erst draußen. Das geht so: Beim Gehen die Daumen nach außen drehen. Ganz unauffällig, einfach die Daumen rechts und links vom Körper weg. Und schon hebt sich der Oberkörper, und die Schulter wird breit. Da brauchst du kein Fitnesstraining. Du kannst es üben, und irgendwann gehst du automatisch so, auch wenn die Daumen gar nicht draußen sind.
Sebastian lernt schnell, und er mag lieber durch den Hauptbahnhof streifen, als in der Inspektion Anzeigen aufnehmen und Papierzeug erledigen oder an der Kaffeemaschine herumdoktern. Als seine Mutter ihn fragt, was er da alles macht, kann er gar nicht aufhören mit dem Aufzählen, so vielfältig sind die Aufgaben.
Er hat schon Kerle eingesammelt, die sich am Bahnsteig entblößt haben. Dann die Besoffenen, das ist klar. Und Desorientierte und Omas, die nicht zum Taxistand finden. Dann die Personenüberprüfungen. Es gibt Millionen Schwarzfahrer, und viele stehen bei der Bahn in der Kreide, fahren aber trotzdem weiter mit dem Zug. Also überprüft man stichprobenartig die Personalien der Fahrgäste. Da sind Leistungserschleicher dabei, die der Bahn schon 600 oder 800 Euro schulden. Die siebt man raus. Und was einem da noch alles ins Netz geht: Idioten mit Anscheinswaffen. Seine Mutter weiß nicht, was eine Anscheinswaffe ist. Das sind Softair-Pistolen oder Schreckschussdinger, die aber genauso aussehen wie richtige Waffen. Die Leute denken vielleicht, man könnte damit durch den Bahnhof spazieren, aber so einfach ist das nicht.
Dann die Gymnasiasten, die am Bahnhof Gras kaufen wollen, und die Obdachlosen, die Pfandflaschensammler und die armen Schweine, die nicht wissen, wo sie sonst hinsollen. Die eiligen Reisenden, die weinende Austauschschülerin aus Norwegen, die ihre Gastfamilie nicht findet. Die Abenteuersucher. Die Gestrandeten und die, die nicht nach Hause wollen. Oder können. Landet alles bei ihnen in der Inspektion, schichtweise. Immer wieder dieselben Kunden, wie Sebastian sie nennt. Figuren, denen man einen Platzverweis erteilt und die anschließend einmal um den halben Bahnhof laufen und am südlichen Ausgang wiederauftauchen. Klauende Kinder, gackernde Mädchen, die eben im Begriff sind, die falschen Jungs kennenzulernen. Aktentaschenträger, die den Mann vom Saft- und Früchtestand anzeigen, weil sie eine verschimmelte Erdbeere im Salat gefunden haben. Eltern, die ihren betrunkenen Sohn abholen. Ausländer, Asylanten, Migranten, irgendwelche Afrikaner oder wer weiß was für Vögel. Sie sind nicht rassistisch in der Wache am Hauptbahnhof, aber Realisten sind sie. Sie schauen genau hin. Und natürlich haben sie ein Auge auf die Rumänen. Ganze Klau-Clans haben sie schon hochgenommen. Und wieder freigelassen. Man kann ja meistens gar nichts beweisen. Es gibt Menschen, denen steht die Straftat ins Gesicht geschrieben. Wenn man da Zeit hätte, man würde immer was finden. Aber so auf die Schnelle, wenn es keine Beweise gibt, muss man sie gehen lassen. Du kannst so einen Rumänen die Reisetasche öffnen lassen, und die ist randvoll mit Einbruchswerkzeug. Die Sache ist völlig eindeutig. Aber du musst ihm trotzdem eine gute Reise wünschen. Sebastians Mutter staunt.
Und dann die Penner, die noch stehen können. Altpunks mit Bier in der Hand, meistens am Ausgang Arnulfstraße. Sie kleben dort wie die Kacke am Schuh. Vor dem Kollegen Klaus haben sie richtig panische Angst, das ist lustig anzusehen. Wenn sie ihn erblicken, setzen sie ihre zitternden Trinkerkörper in Bewegung und wackeln ein paar Meter in Richtung Taxistand. Sobald die Polizisten weg sind, kommen sie zurück. Sebastian tun sie leid, jedenfalls solange er keinen von ihnen anfassen muss.
Lieber sind ihm die Schüler, die ihm auf die Waffe starren und vielleicht überlegen, ob sie auch mal so was machen wollen. Und die Pendler, die an ihm vorbeihuschen und schuldig aussehen. Man spürt, wie es ihnen widerstrebt, dieses Gefühl von Schuld, das sich jedoch beim Anblick einer Amtsperson immer bei ihnen einstellt. Polizist zu sein, das ist für Sebastian wie mit einem Ferrari durch die Tempo-30-Zone zu schleichen. Man weiß immer, dass man der Stärkste ist, da muss man nicht aufs Gas gehen. So sieht er das, auch wenn er noch nie in einem Ferrari gesessen hat. Er hat mal einen abschleppen lassen, das schon.
Und dann sind da noch die Mädchen aus den Clubs ringsum. Sebastian kennt sie alle, bei manchen weiß er sogar, in welche S-Bahn sie steigen, um nach dem Tanzen nach Hause zu fahren. Er weiß das, weil er ihnen manchmal hinterhergeht, wenn er alleine unterwegs ist. Vom Eingang der Halle, mit der Rolltreppe runter bis auf den Bahnsteig der S-Bahn. Dass er mit den schönen Mädchen geht, ist sein Geheimnis, niemand ahnt etwas davon. Manchmal steigt er sogar mit einem ein, bloß so, um ein bisschen bei ihm zu sein. Er stellt sich nahe an es heran und versucht, etwas von ihm mitzunehmen: ein bisschen Duft, einen Zug Schweiß oder wenigstens Kaugummigeruch oder Zigarettenrauch. Er weiß, wie er das bekommt, und atmet tief ein, aber ohne dass es jemand bemerken kann. Manchmal schließt er dabei kurz die Augen. In seinem Kopf verwandeln sich die Gerüche in Bilder, und von denen hat er lange etwas. Er atmet und fährt bloß eine Station bis zum Stachus mit oder bis zur Hackerbrücke, je nachdem. Dann nimmt er einen letzten Zug von ihrem Duft, vielleicht berührt er noch wie zufällig den Ärmel der jungen Frau, dann steigt er aus und fährt wieder zurück. Kein Mensch merkt etwas. Niemand. Daumen raus.
Sebastian verehrt die Mädchen. Er verehrt überhaupt alle Frauen. Genau genommen ist er verrückt nach Frauen. Wenn es irgend geht auf dem Weg nach Hause, setzt er sich im Regionalzug zwischen Schülerinnen und hört genau zu, was sie sagen. Er trägt zwar Kopfhörer im Ohr, doch die sind nur Tarnung, damit sie denken, er höre Musik und bekäme nichts von ihnen mit. Dann sind sie unbefangener. Aber in Wahrheit ist er bei ihnen, merkt sich jede Wendung von Erzählungen und achtet auf den Ton, den sie haben, wenn sie mit ihrem Freund telefonieren. Es entgeht ihm nichts. Er sieht heimlich auf ihre klackernden Fingernägel, wenn sie an ihren Mobiltelefonen herumspielen, und ihre Finger erinnern ihn an Spinnen, die Beute in klebrige Fäden wickeln. Er schaut auf ihre Wangen, besonders wenn sie Kaugummi kauen. Er liebt es, wenn sich die Lippen, die Kiefer und die Knochen bewegen, und er bekommt eine Ahnung, was in den Mündern alles los sein könnte, wozu sie fähig sind, diese Lippen und die Zungenspitzen, die manchmal dazwischen herausblitzen, wenn die Mädchen sich Geschichten erzählen. Er sieht, wenn ein wenig Speichel auf der Zunge glänzt. Er freut sich, wenn sie sich die Lippen lecken oder wenn sie sich die langen Haare aus der Jacke ziehen. Er registriert, wenn sie die Beine übereinanderschlagen. Am liebsten ist ihm, wenn sich eine schminkt oder Lippenstift nachzieht. Da sammelt er Bilder, die er wochenlang in seinem Kopfkino abspielt. Im Zug tut er so, als schaue er aus dem Fenster, aber in Wahrheit sieht er in die Spiegelung der Scheibe und nimmt alles mit, was er von den Mündern ablesen kann. Und von den Fingernägeln und dem Blick auf ihre Hälse und Schultern. Da ist ein BH-Träger verrutscht, dort blitzt eine Tätowierung hervor. Wie weit wird die gehen? Die Tätowierung. Und die junge Frau. Würde sie mit ihm gehen?
Der Polizist Sebastian Pflug wünschte, er hätte etwas zu bieten. Hat er aber nicht. Nicht einmal ein Auto hat er.
Er fährt jeden Tag eine Dreiviertelstunde mit dem Zug aus Landshut zum Hauptbahnhof. Dort steigt er gleich an seinem Arbeitsplatz aus, das ist ein Vorteil. Und nach dem Dienst fährt er wieder zurück. Landshut–München–Landshut, jeden Tag, an dem er Dienst hat. In München könnte er gar nicht wohnen, finanziell nicht und überhaupt: Er möchte es auch gar nicht. Bei seinen Eltern hat er ein schönes Reich unterm Dach. Zwei Zimmer, ein Bad. Küche ist unten bei den Eltern. Was will man mehr? Sebastian hat es nicht weit vom Bahnhof nach Hause, und wenn er dort die Tür aufmacht: hat die Mutter schon gekocht. Sie ist stolz auf ihn, gerade weil der berufliche Erfolg dem Sebastian nicht in die Wiege gelegt wurde.
Erst haben die Pflugs sogar gedacht, es wird gar nichts mit ihm. Einziger Sohn und natürlich Ein und Alles. Aber auch kein Tausendsassa. Es gibt ja die großen Sippen, aus denen über Jahrhunderte hinweg Denker und Ingenieure, Künstler oder Regenten hervorgehen. Und es gibt welche, aus denen gar nichts hervorgeht. Die Pflugs sind solche Leute, das ist ja auch nicht weiter schlimm. Was sollte man in einer Welt anfangen, die nur aus Genies besteht, und keiner macht die Betten, und keiner repariert die Heizung? Also sind die Pflugs ganz normale Landshuter, und das sind sie schon seit so vielen Generationen, dass sich nicht mehr zurückverfolgen lässt, von wo sie dorthin gekommen sind. Die Pflugs haben immer bei der »Landshuter Hochzeit« mitgespielt. Meistens sind sie bloß mitgelaufen, aber Sebastians Urgroßvater, der auch schon Sebastian hieß, der hat mal den Salzburger Erzbischof gespielt, das ist fast so etwas wie eine Hauptrolle. Es wird so ungefähr 75 Jahre her sein, leider gibt es kein Foto.
Dass der Sohn nun so einen herausgehobenen Posten hat, nämlich in Uniform bei der Polizei, das ist den Eltern beinahe schon unangenehm. Aber er sieht gut aus darin, und es ist ein großes Glück, dass er es so weit gebracht hat, nachdem es in der Schule nur so knapp zufriedenstellend lief und danach diese Sache auf dem Maifest passiert ist.
Kein Mensch weiß, was da in den Sebastian gefahren ist und ob überhaupt. Hinterher hat es geheißen, er habe versucht, die Veronika zu vergewaltigen, aber dafür gab es gar keine Beweise. Er selber hat nichts gesagt, und die Veronika konnte nichts sagen, weil sie mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Koma gelegen hat. Und als sie viel später wieder sprechen konnte, war die Erinnerung weg. Das Einzige, was von der ganzen Geschichte übrig blieb, war, dass der Sebastian die Veronika begleitet hat, als das Maifest vorüber war. Sie sind aber nicht in den Ort gegangen, sondern eigentlich falsch rum in Richtung Felder. Das haben später mindestens sechs oder sieben Besucher bezeugen können.
Am nächsten Morgen hat ein Spaziergänger die Veronika gefunden, in dem Waldstück beim Salzdorfer Graben. Ihr Dirndl war zerrissen und ihr Gesicht blutig geschlagen, aber wenigstens war sie nicht vergewaltigt worden. Gottlob. Natürlich kam Sebastian Pflug in Verdacht, weil man ihn mit Veronika gesehen hatte. Er wurde auch vernommen, und irgendwann drohte der Polizist, Sebastian werde gleich hinter dem Wald, wo sie die Veronika gefunden hatten, in die JVA umziehen. Dort in Berggrub ist nämlich das Gefängnis. Und das mag dem Sebastian Angst gemacht haben, aber er schüttelte trotzdem den Kopf und sagte nur immer wieder, dass er die Veronika in Salzdorf an der Straßenbiegung verabschiedet habe und seines Weges gegangen sei. Er habe diesen Umweg zur Ausnüchterung gemacht, und schließlich habe er niemandem etwas zuleide getan, erst recht nicht der Veronika.
Jedenfalls kann es sein, dass Sebastian bei dem Verhör sein Berufswunsch gekommen ist. Einen anderen hat er nie geäußert. Er ist ja kein großer Redner und sitzt am liebsten an seinem Rechner oder vor der Playstation. Da ist er ziemlich gut und schnell und geschickt. Aber das sieht leider keiner. Auf andere wirkt Sebastian hingegen ein bisschen verlangsamt. Er weiß auch nie so ganz genau, ob jemand gerade einen Spaß mit ihm macht oder nicht. Bei Mädchen ist das ganz schlimm. Aber eigentlich auch bei Männern. Bei jedem. Bei Kindern geht es noch. Und ältere Menschen mögen ihn komischerweise. Doch davon kann er sich auch nichts kaufen.
Er hätte nämlich schon gerne eine Frau, oder wenigstens eine Freundin, denn eine Frau in dem Sinne, wie man eine Frau braucht, hat er ja schon. Seine Mutter. Die regelt alles, was er nicht selber regeln kann oder will. Sie haben beschlossen, dass sie mittwochs bei ihm oben rein darf zum Putzen, und alle drei Wochen bezieht sie das Bett neu. Und er kann beschwören, dass sein Bett niemals befleckt ist, weil er seiner Mutter das nicht zumuten will und weil er seine Angelegenheiten grundsätzlich am Schreibtisch erledigt.
So eine Freundin würde ihm jedenfalls gefallen. Eine, die man streicheln kann und die auch mal was Hübsches für einen anzieht. Man kann vielleicht gemeinsam in eine Wirtschaft gehen oder sogar ins Kino und dort im Dunkeln die Hand wo hinlegen. Und natürlich die versauten Sachen machen, das ist klar. Aber dafür bräuchte es im Prinzip keine Freundin. So eine richtig feste Gefährtin braucht man eher dafür, dass sie bleibt. Bisher hat das aber nicht geklappt. Eigentlich nichts von dem, was dazugehört. Sebastian weiß nicht, wie man das anstellt mit den Mädchen. Er kapiert’s einfach nicht, diese Chemie zwischen Männern und Frauen ist ihm ein Rätsel.
Nach der Sache beim Maifest sagt er jedenfalls zum ersten Mal, dass er zur Polizei möchte, und die Eltern sind überrascht, aber sie freuen sich, dass von ihm etwas kommt. Sonst hätte er eben Koch gelernt oder Zugbegleiter wegen der Uniform oder am besten Gärtner, da muss man vor allen Dingen nicht so viel reden. Und man wird nicht rot, wenn man mit einer Zimmerpflanze spricht.
Und deshalb sind sie so erstaunt, dass er Polizist werden will, denn das ist ein hochgradig kommunikativer Beruf, da muss man ständig mit fremden Menschen sprechen. Was seine Eltern daran nicht verstehen, das ist es, was Sebastian daran gefällt, nämlich die abschüssige Richtung der Kommunikation, von oben nach unten. So hat er das ja selber erlebt. Er saß unten, und der andere redete von oben auf ihn ein. Und sagte: »Sie reden, wenn ich Sie etwas frage.« Und nicht einfach so. Man bestimmt, wie es läuft, und die anderen halten ihr Maul. Ich rede! Daumen raus.
Die Ausbildung gefällt ihm, und er findet, dass dort einige wie er sind. Das gibt ihm Sicherheit, und das mit dem Reden gelingt ihm mit der Zeit immer besser, denn die Polizeiwache ist ein eigenes kleines Land mit einer eigenen Sprache, die nur den Beamten gehört. Es ist eine Mischung aus Verwaltungsdialekt und Juristendeutsch. Es gefällt ihm, dass die normalen Menschen nicht alles sofort verstehen. Er mag es, wenn er verschraubte Formulierungen benutzt, möglichst viele Substantive aneinanderhängt und von einer anlassunabhängigen Personenüberprüfungsmaßnahme spricht, wenn er einen Ausweis kontrolliert. Er schaut sich bei den Kollegen ab, was sie so reden, wenn sie mit Kunden zu tun haben, und ihre Standardformulierungen gehen ihm bald leicht von den Lippen. Und dann sagt er eben zu dem Afghanen, den sie sechs Stunden haben sitzen lassen: »Es ist ihnen unbenommen, bei der Dienststellenleitung eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen.«
Unterlassungsgewahrsam. Eingriffsermächtigung. Es macht ihm Spaß, dass selbst solche vor ihm kuschen, die ihn früher in der Schule gehänselt haben. Im Radio ist die Rede davon, dass die Polizei es ganz allgemein immer häufiger mit respektlosen Bürgern zu tun habe. Dass die Beamten angegangen, bespuckt, provoziert oder beleidigt würden. Zumindest für Sebastian trifft das nicht zu. Das liegt am Daumengang, an den schwarzen Handschuhen und an Klaus’ Ausbildung.
Sebastian kommt meistens in Uniform zur Arbeit. Er mag es, wenn sie ihn im Zug als Polizisten erkennen. Dann stellt er die Ordnung her, auch wenn er gar nicht im Dienst ist. Und außerdem sieht er gut aus in der Lederjacke.
Sebastian hat festgestellt, dass es bei den Nachtclubs, den Sexbars und den Tabledance-Läden auch Dienstschichten gibt, genau wie auf der Inspektion. Das verbindet, findet er. Mit der Zeit hat er sich gemerkt, welcher Laden wann das Personal wechselt, und er hat die Mädchen quasi abgeholt. Ist hinter ihnen hergegangen und hat ihnen dabei zugesehen, wie sie noch eine Zigarette geraucht haben. Ganz normale schöne Mädchen vor dem Bahnhof. Und natürlich hat er auch die Frauen gesehen, die beim Schichtwechsel hineingingen in die Bars und Lokale. Bald kennt er sie alle. Zu Hause am Rechner durchforstet er die Webseiten der Läden nach Bildern von ihnen.
Manchmal stellt er sich vor, dass er sie beschützt. Die kleine Dunkelhaarige mit der rosa Winterjacke, die aus dem Château kommt. Die freche Dünne, die im Bahnhof jeden Tag eine Nussecke kauft und mit den falschen Wimpern klimpert wie ein nervöser Vogel. Und die Blonde, die nach so etwas wie Vanille riecht, wenn er neben ihr in der Tram steht und unauffällig ihren Duft mitnimmt.
Dann beginnt er, auch nach der Arbeit auf die Jagd zu gehen. In Zivil. Er bringt seine private Kleidung mit ins Revier und erklärt den Kollegen, er habe nach dem Dienst noch etwas vor. In der Stadt.
Ohne die Uniform erkennt ihn nie jemand. Selbst Leute, die er täglich trifft, sehen in dem mittelgroßen, mittelschlanken Mann von Anfang zwanzig nicht den Beamten, der vor einer halben Stunde noch dabei geholfen hat, das Rollgitter vor dem Zeitschriftenladen einzuhaken. Ohne Dienstmütze ist er bloß irgendein Typ. Dabei hilft, dass er sich auch anders bewegt. Daumen rein, sozusagen. Schultern hängen, Kopf fällt leicht nach vorne. Er fühlt sich, als habe er sich getarnt, dabei ist das hier seine völlig normale Erscheinung und die Uniform eigentlich die Verkleidung.
Er steht stundenlang vor den Läden herum, aber er traut sich nicht hinein, denn dann müsste er die Mädchen mit anderen Männern teilen. Er würde eifersüchtig, wenn einer seine Mädchen so ansähe, wie er sie heimlich ansieht. Außerdem sind ihm die Getränke zu teuer. Und er hat eine beinahe ulkige Angst davor, dass dort etwas Strafbares passiert, das er vereiteln oder ahnden müsste. Dann wäre seine Deckung futsch. Er will keinesfalls auffallen, das ist für ihn das Beste. Deshalb spricht er die Mädchen niemals an. Er wüsste auch überhaupt nicht, was er mit ihnen reden sollte. Er kann sie nicht einladen, so vom Finanziellen her. Und ins Hotel würde er erst recht nicht mit ihnen. Er weiß gar nicht, wie das genau vonstattengeht. Auch wenn er es oft in Pornos studiert hat, bleibt ihm doch eines ein Rätsel, nämlich diese Übereinkunft zwischen Kunden und Dienstleisterinnen in diesem Segment. Sebastian Pflug kann sich das nicht vorstellen, wie das geht, dass er so eine Frau bezahlt und die ist dann zu ihm wie eine richtige Freundin, wie ein Mensch, der ihn wahrhaft liebt. Er glaubt nämlich an die wahre Liebe und daran, dass man einander treu ist. Gleichzeitig fühlt er sich diesen offenbar auf eine geschäftliche Art untreuen jungen Frauen verbunden. Das macht ihn innerlich ganz unruhig. Er begehrt sie, und er mag sie auch wirklich. Wann immer jemand aus dem Milieu in der Inspektion landet, gibt er sich Mühe, ein richtiger Gentleman zu sein.
Und hier draußen, auf der Straße, begegnet er ihnen mit derselben scheuen Hingabe, läuft mal der einen, mal der anderen hinterher. Er rückt ihnen niemals so dicht auf den Leib, dass sie ihn bemerken, bleibt aber auch nicht weiter weg als achtzig Zentimeter. Wird der Abstand größer, reißt die Duftfahne ab.
Wenn er freihat, sitzt Sebastian am Rechner. Er hat einen schnellen Computer und drei Monitore, das ist sein persönlicher Luxus. Er braucht nicht viel mehr. Eine ausreichende Menge Spezi, Kräckersortiment für Genießer oder eine große Tüte Pom-Bär. Dann geht so ein Abend oder eine halbe Nacht schnell vorbei.
Sebastian kennt die Pornoseiten und ihre Stars. Er legt lange Listen mit Favoriten an, die er nach Themen sortiert. Frauen mit langen Beinen. Frauen ohne Haare. Frauen, die es mit Frauen machen. Frauen im Freien. Frauen, die man heimlich in Umkleidekabinen gefilmt hat. Frauen mit großen Brüsten, mit kleinen oder ohne. Frauen, die sich für Geld mit einem Elektroschocker streicheln lassen oder Männern gebutterte Maiskolben einführen. Frauen mit Handschuhen. Frauen, die beim Sex rauchen. Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben, Frauen, die sich als Nonnen verkleiden. Frauen mit Locken, mit Perücken, mit Hüten. Alte Videos mit jungen Frauen. Neue Videos mit alten Frauen. Frauen in Latexanzügen. Frauen in Herrenanzügen. Frauen in Aufzügen.
Er hat scheinbar keine Vorlieben, in Wahrheit wechseln sie bloß häufig. Dann fahndet er tagelang nach Frauen in hohen Stiefeln oder Frauen, die gar nichts machen, außer frech daherzureden. Er versucht, alle Filme mit Babysittern zu sehen, die von Vätern verführt werden. Oder sämtliche Videos von Japanerinnen, auf deren Hinterteilen zu Abend gegessen wird. Oder italienische Pornos mit ausgedehnter Handlung. Oder amerikanische ganz ohne.
Das Einzige, was ihm nicht so liegt, sind die Männer in den Filmen. Sie gehen oft nicht gut um mit den Frauen, das mag er nicht, und er hält es auch für lebensfern, denn wer eine schöne Frau zu etwas überreden will, der muss doch freundlich sein und nicht grob. So stellt er sich das vor für den Fall, dass er mal bei einer zum Zuge kommt. Sebastian Pflug nennt sich PonyMaster123, und seine Listen werden von anderen Usern geteilt und bewertet. Er bekommt viel Lob für seine Kennerschaft.
Für eine Freundin bleibt bei seinen vielen Freizeitinteressen keine Zeit, so erklärt er das der Mutter, wenn er nach dem Abendessen unters Dach geht. Sie denkt, er beschäftige sich mit Autos und Brauchtum, so hat er das mal erzählt, und sie hat keinen Grund, daran zu zweifeln. Aber schade findet sie es schon, dass Sebastian so gar kein Mädchen mitbringt.
In Wahrheit hat er Hunderte von Frauen. Er kontrolliert sie ständig; er notiert, wenn Jedda Jenkins eine neue Tätowierung trägt oder Dolly McPolly wieder etwas hat machen lassen, es entgeht ihm kein Feintuning. Er studiert auch, wen die Nachtclubs und die Bordelle in München und Umgebung im Angebot haben. Ohne jemals eine einzige der Frauen gesprochen, geschweige denn berührt zu haben, meint er, sie zu kennen, mehr noch: ihr Vertrauter zu sein. Manchmal findet er seine Geheimwissenschaft selber verrückt. Und er hat als Polizist durchaus ein Gespür dafür, dass seine Verehrung für die Schönheit der Frau im Allgemeinen und sein Interesse an allem, was irgendwie rot schimmert und merkwürdig riecht im Speziellen, schon Existenzen vernichtet und Männer in den Abgrund geführt hat. Deswegen versteckt er seine Listen und auch die heruntergeladenen Bilder und Filme in vielfach verschachtelten Ablagen auf seinem Rechner und auf externen Festplatten, die er gegen fremden Zugriff mit Passwörtern und Geheimverstecken hinter der Fußleiste schützt. Er ist sich ziemlich sicher, dass er nichts Verbotenes hortet, aber süchtig ist er trotzdem, und das weiß er auch, wenn er den Gedanken mal zulässt. Das geschieht meistens, wenn er den Rechner herunterfährt. Bevor er ins Bett geht, bringt er die leeren Spezi-Flaschen nach unten in den Kasten und die Pom-Bär-Tüte in die Mülltrennung. Aber die Finger leckt er sich nicht ab.
Er hasst es, wenn er mehrere Tage hintereinander freihat, denn dann kann er nicht auf Streife gehen. Er muss sich dann mit dem Club 69 begnügen. Der befindet sich in einem Gewerbegebiet von Landshut direkt hinter dem großen Möbelhaus und manchmal fährt er mit seinem Fahrrad hin und guckt. Aber es kommen kaum Mädchen heraus und wenn überhaupt, dann kann er sich ihnen nicht nähern, ohne aufzufallen. Aber die Beleuchtung des Hauses reicht ihm schon für eine kleine Aufregung. Oft hat er überlegt, ob er einmal reingeht, nur auf ein Bier. Aber es spricht mehr dagegen als dafür. Erstens mag er lieber Spezi, und er fürchtet, dass ihn die Frauen im Club 69 auslachen, wenn er das bestellt. Dann kostet zweitens ein Bier schon 7,90 Euro, das hat er am Aushang vor der Tür gelesen. Und außerdem könnte ihn drittens jemand erkennen, Landshut ist ja klein. Und das wäre ihm peinlich.
Jedes Mal, wenn Sebastian zum Dienst fährt, freut er sich auf seinen Hauptbahnhof. Mütze auf, Daumen raus und Gutes tun, das ist seine Devise. Er kontrolliert häufig die Richtigen. Und so hat er an einem kalten Vormittag Ende November schon seit einigen Minuten einen Mann, Anfang, Mitte dreißig, Windjacke, Basecap im Visier, der sich so unauffällig verhält, dass Sebastian innerlich grinsen muss. Der Mann läuft immer wieder durch die Fressmeile in der Halle und nach einer Weile hat Sebastian verstanden, was der Kerl da macht: Er sieht sich die Verkäuferinnen in den beiden Bäckereien an. Es geht ihm um ein bestimmtes Detail, um eine einzige Bewegung, die der Mann immer wieder sehen möchte: Etwas aus dem obersten Fach nehmen. Der Arm streckt sich, der Körper gerät in Spannung, der Kopf beugt sich nach hinten. Es ist bloß eine kurze Haltung des Oberkörpers und der Beine, es kommt bloß auf einen winzigen Moment an. Wobei das Alter oder das Aussehen der Frau gar keine Rolle spielen. Es ist diese eine Bewegung. Und auch, wenn Sebastian sich nichts aus diesem Fetisch macht, so ist er doch voller Verständnis für den Mann, der sich bei seinem heimlichen Tun nicht ungeschickt anstellt.
Der bleibt nie länger als nötig stehen, er nimmt die Bewegung scheinbar beiläufig mit, um dann weiterzulaufen, zur anderen Bäckerei. Und zu einer dritten, etwas abgelegenen, doch da gibt es kein richtig hohes Regal. Aber im Untergeschoss befindet sich eine weitere Bäckerei, Sebastian könnte wetten, dass der Mann nun dort hingeht. Macht er auch. Und dann kauft er etwas, einen Dinkellaib, der liegt ganz oben. Sebastian kann sich vorstellen, was in dem Mann vorgeht, als die kleine Frau sich auf die Zehenspitzen stellt, um das Brot aus dem Fach zu angeln.
Ende der Leseprobe