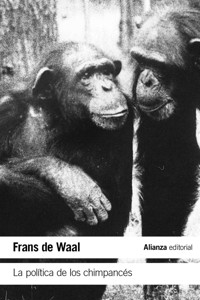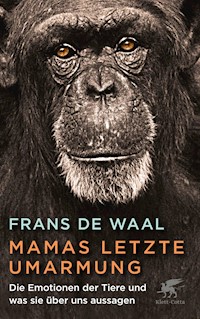19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Woher kommt die Moral? Wie hilft sie uns dabei, richtig zu handeln? De Waal beantwortet Fragen rund um Moral und Humanismus mit Blick auf Primaten und andere Tiere, die uns erstaunlich nahestehen: Im gottlosen Universum beobachtet er, wie Menschenaffen gerecht, kooperativ und empathisch handeln. Der weltbekannte Primatenforscher Frans de Waal nimmt uns mit auf eine erfrischende, philosophische Reise, bei der die lange Tradition des Humanismus ebenso zu Wort kommt wie das Sozialverhalten im Tierreich. Er untersucht, welche Konsequenzen seine Forschungen für unser Verständnis von moderner Religion haben. Ganz gleich, welchen Einfluss die Religion auf den Moralkodex des Menschen genommen hat, sie ist nicht die Urheberin unserer Moralität. Der Autor fordert die Leser auf, sich konstruktiv mit Fragen wie diesen auseinanderzusetzen: Welche Rolle spielt die Religion heutzutage in einer gut funktionierenden Gesellschaft? Wo können Gläubige und Nichtgläubige Inspiration für eine gute Lebensführung finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
FRANS DE WAAL
DER MENSCH,DER BONOBO UNDDIE ZEHN GEBOTE
MORAL IST ÄLTER ALS RELIGION
Aus dem Amerikanischen von Cathrine Hornung
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Bonobo and the Atheist. In Search of Humanism Among the Primates« im Verlag W. W. Norton & Company, New York/London
© 2013 by Frans de Waal
Für die deutsche Ausgabe
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
Unter Verwendung eines Ausschnitts aus »Im Garten der Lüste« von Hieronymus Bosch © Bridgeman Images
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98504-7
E-Book: ISBN 978-3-608-10822-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Catherine, meine Lieblingsprimatin
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1:Irdische Freuden
Kapitel 2:Woher kommt das Gute?
Kapitel 3:Bonobos im Familienstammbaum
Kapitel 4:Ist Gott tot oder nur im Koma?
Kapitel 5:Das Gleichnis vom guten Affen
Kapitel 6:Zehn Gebote zu viel
Kapitel 7:Die Gotteslücke
Kapitel 8:Bottom-up-Moralität
Danksagungen
Bildteil
Anmerkungen
Literatur
Abbildungsnachweise
Kapitel 1Irdische Freuden
Wie? ist der Mensch nur ein Fehlgriff Gottes?Oder Gott nur ein Fehlgriff des Menschen?
– Friedrich Nietzsche1
Ich bin im niederländischen Den Bosch zur Welt gekommen, der Heimatstadt von Hieronymus Bosch, nach der sich der Maler genannt hat.2 Das macht mich noch nicht zu einem Bosch-Experten, aber da ich mit der Statue des Künstlers auf dem Marktplatz aufgewachsen bin, habe ich seine surrealistischen Bildwelten, seinen Symbolismus und die Art und Weise, wie er die Menschheit unter dem schwindenden Einfluss Gottes im Universum verortet, immer gemocht.
Boschs berühmtes Triptychon Der Garten der Lüste, in dem sich unzählige nackte Figuren tummeln, ist eine Hommage an die paradiesische Unschuld. Die Szenerie der Mitteltafel, die dem dreiteiligen Altarbild seinen Namen gibt, ist viel zu fröhlich und entspannt, um der puritanischen Deutung von Kunsthistorikern gerecht zu werden, die darin ein Sinnbild für Verderbtheit und Sündhaftigkeit vermuten. Vielmehr wird die Menschheit hier frei von Schuld und Scham dargestellt – entweder vor dem Sündenfall, oder der Sündenfall ist überhaupt nicht vorgesehen. Für einen Primatologen wie mich sind die Nacktheit, die Anspielungen auf Sex und Fruchtbarkeit, die Fülle an Vögeln und Früchten und das Umherziehen in Gruppen etwas sehr Vertrautes, das eigentlich gar nicht nach einer religiösen oder moralischen Interpretation verlangt. Bosch scheint uns in unserem Naturzustand gemalt zu haben, während er seine moralische Anschauung für den rechten Innenflügel des Triptychons (»Die Hölle«) aufgespart hat, wo aber meines Erachtens nicht die ausgelassenen Gestalten aus dem Mittelbild bestraft werden, sondern Mönche, Nonnen, Gefräßige, Glücksspieler, Trunkenbolde und andere Verdammte, die sich einer Todsünde schuldig gemacht haben. Bosch war kein Freund des Klerus und verurteilte dessen Habgier, was aus einem kleinen Detail im Höllenbild hervorgeht: Ein Mann wird von einem Schwein bedrängt, das den Schleier einer Dominikanernonne trägt. Offenbar versucht das Schwein, dem Mann eine Schenkung abzuluchsen. Wie es heißt, handelt es sich bei dieser armen Figur um ein Selbstbildnis des Künstlers.
Abb. 1: Rechts unten im Höllenbild des Triptychons hat Hieronymus Bosch sich selbst abgebildet, wie er ein als Nonne gekleidetes Schwein abwehrt, das ihn mit Küssen zu verführen sucht. Offenbar will es ihn zu einem Ablasshandel bewegen (daher das Tintenfass, die Feder und ein Schriftstück, das wie eine Urkunde aussieht), indem es ihm als Gegenleistung für sein Vermögen ewiges Seelenheil in Aussicht stellt. Der Garten der Lüste entstand um 1504, also gut ein Jahrzehnt bevor Martin Luther solche Praktiken der Kirche öffentlich anprangerte.
Mehr als fünf Jahrhunderte später liefern wir uns noch immer erbitterte Gefechte darüber, welche Stellung die Religion in der Gesellschaft einnimmt. Wie zu Boschs Zeiten ist das zentrale Thema die Moral. Können wir uns eine Welt ohne Gott vorstellen? Und wäre das eine gute Welt? Glauben Sie bloß nicht, die aktuellen Fronten zwischen dem fundamentalistischen Christentum und der Wissenschaft würden durch unumstößliche Tatsachen abgesteckt. Um an der Evolution zu zweifeln, muss man gegen die vorliegenden Daten schlichtweg immun sein. Daher sind Bücher oder Dokumentarfilme, die Skeptiker überzeugen wollen, reine Zeitverschwendung. Wer sich darauf einlässt, profitiert von solchen Beiträgen, aber ihr Zielpublikum erreichen sie nicht. Wer glaubt, Moralität käme geradewegs von Gott, dem Schöpfer, kann sich mit der Evolution nicht abfinden, weil sich sonst ein moralischer Abgrund auftun würde. Reverend Al Shapton hat es in einem Streitgespräch mit dem inzwischen verstorbenen Polemiker und Atheisten Christopher Hitchens so formuliert: »Wenn dem Universum keine Ordnung innewohnt und es kein Wesen, keine höhere Macht gibt, die diese Ordnung hergestellt hat, wer bestimmt dann, was richtig und was falsch ist? Wenn nichts und niemand dafür zuständig ist, gibt es auch nichts Unmoralisches.«3 Ähnliches habe ich von Leuten gehört, die in Anlehnung an Dostojewskis Iwan Karamasow folgerten: »Wenn es keinen Gott gibt, kann ich getrost hingehen und meine Nachbarin vergewaltigen!«
Vielleicht geht es ja nur mir so, aber mir sind Menschen suspekt, die nur durch ihr Glaubenssystem davon abgehalten werden, eine abscheuliche Tat zu begehen. Warum gehen wir nicht von der Annahme aus, dass unsere Humanität, einschließlich der Selbstkontrolle, die für eine lebenswerte Gesellschaft unerlässlich ist, in uns angelegt ist? Glaubt irgendwer im Ernst, unsere Vorfahren hätten keine sozialen Normen gehabt, bevor sie die Religion entdeckten? Haben sie nie einem Artgenossen geholfen, der in Not war? Haben sie sich nie über eine ungerechte Behandlung beschwert? Die Menschen müssen ein Interesse daran gehabt haben, in funktionierenden Gemeinschaften zu leben, und zwar lange bevor die heutigen Religionen aufgekommen sind, was erst vor ein paar Tausend Jahren der Fall war. Diese Zeitspanne ist für Biologen ein Klacks.
Moral ohne Gott?
Mit dieser Frage begann im Oktober 2010 mein Blogeintrag auf der Webseite der New York Times, wo ich behaupte, Moralität sei schon vor der Religion da gewesen, und dass wir viel über ihre Ursprünge lernen können, wenn wir uns mit anderen Primaten befassen.4 Entgegen der üblichen blutrünstigen Vorstellungen von der Natur verfügen Tiere sehr wohl über Dispositionen, die wir als moralisch bezeichnen. Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass Moralität keineswegs mit dem Menschen beginnt und, anders als wir vielleicht denken, keine ausschließlich menschliche Errungenschaft ist.
Da dies der Gegenstand des vorliegenden Buches ist, möchte ich auf die einzelnen Themen eingehen, die damit zusammenhängen, indem ich die Woche nach der Veröffentlichung meines Blogeintrags schildere. Kurz bevor ich zu einer Europareise aufbrach, nahm ich an einer Veranstaltung über Wissenschaft und Religion an der Emory University in Atlanta teil, wo ich arbeite. Anlass war ein Forum mit dem Dalai Lama über sein Lieblingsthema: Mitgefühl. Mit anderen mitzufühlen scheint mir eine hervorragende Empfehlung fürs Leben zu sein; daher begrüßte ich die Botschaft unseres ehrenvolles Gastes. In meiner Eigenschaft als erster Korreferent saß ich direkt neben dem Dalai Lama, umgeben von einem Meer aus roten und gelben Chrysanthemen. Man hatte mich instruiert, ihn mit »Eure Heiligkeit« anzureden und »Seine Heiligkeit« zu sagen, wenn ich von ihm in der dritten Person sprach. Das fand ich verwirrend und ich bemühte mich daher, sämtliche Formen der Anrede zu vermeiden. Der Dalai Lama, einer der am meisten bewunderten Menschen auf diesem Planeten, zog als erstes seine Schuhe aus, ließ sich im Schneidersitz auf dem Stuhl nieder und setzte sich eine riesige Baseballkappe auf, die farblich genau auf sein orangerotes Gewand abgestimmt war. Mehr als dreitausend Menschen hingen an seinen Lippen. Was meinen Redebeitrag betraf, so hatten die Organisatoren mir im Vorfeld eingeschärft, dass niemand kommen würde, um mich zu hören, sondern dass alle nur wegen seinen Weisheiten dort sein würden.
Ich begann mit einem kurzen Überblick über die neuesten Erkenntnisse zu Altruismus in der Tierwelt. Zum Beispiel halten Affen einem Artgenossen von sich aus eine Klappe auf, um ihm Zugang zu Futter zu gewähren, selbst dann, wenn ihr eigener Futteranteil dadurch schrumpft. Kapuzineräffchen sind darauf aus, andere zu belohnen. Das wissen wir aus Versuchen, bei denen wir zwei Affen nebeneinandersetzen und einen von ihnen zwischen zwei verschiedenfarbigen Plastikchips (Token) wählen lassen. Für den einen Token bekommt nur der Affe eine Belohnung, der ihn ausgewählt hat, während der andere Token eine Belohnung für beide Affen nach sich zieht. Schon bald entscheiden sich die Affen für den »prosozialen« Token. Das geschieht nicht etwa aus Furcht, denn wie sich herausgestellt hat, sind die dominanten Affen, die am wenigsten zu fürchten haben, die großzügigsten.
Gute Taten kommen auch ganz spontan vor. Eine alte Schimpansendame, Peony, verbringt ihre Zeit zusammen mit anderen Schimpansen im Außengehege der Forschungsstation des Yerkes Primate Center. An schlechten Tagen, wenn ihr die Arthritis zu schaffen macht, fällt ihr das Laufen und Klettern schwer, aber die anderen Schimpansinnen helfen ihr. Peony versucht schnaufend und keuchend auf das Klettergerüst zu gelangen, wo sich mehrere Schimpansen zur Fellpflege (engl. grooming) versammelt haben. Eine andere Schimpansin, die nicht mit Peony verwandt ist, klettert hinter ihr her und schiebt sie unter gehöriger Kraftanstrengung mit beiden Händen an ihrem üppigen Hinterteil nach oben, bis Peony bei der restlichen Gruppe angelangt ist.
Wir haben auch beobachtet, wie Peony sich erhob und langsam auf die Wasserzapfstelle zusteuerte, die in einiger Entfernung liegt. Manchmal wurde sie von jüngeren Schimpansinnen überholt, die etwas Wasser aufnahmen und es dann Peony brachten. Zuerst hatten wir keine Ahnung, was sie da taten. Wir sahen nur, wie eine Schimpansin ihren Mund auf den von Peony presste, aber nach einer Weile wurde uns klar, warum: Peony öffnete weit ihren Mund, und die jüngere Schimpansin spie das Wasser hinein.
Solche Beobachtungen fallen in ein neues Fachgebiet, das sich mit Empathie bei Tieren befasst, und zwar nicht nur bei Primaten, sondern auch bei Hunden, Elefanten und sogar bei Nagetieren. Ein typisches Beispiel ist, wie Schimpansen aufgebrachte Artgenossen beschwichtigen, indem sie sie umarmen und küssen. Dieses Verhalten ist so vorhersehbar, dass wir Tausende von Fällen dokumentiert haben. Säugetiere nehmen die Emotionen des anderen wahr und reagieren auf seine Bedürfnisse. Dass Menschen ihr Zuhause lieber mit fleischfressenden Pelzträgern teilen als mit Leguanen und Schildkröten, liegt einzig und allein daran, dass Säugetiere etwas geben, das kein Reptil je bieten kann: Sie geben Zuneigung, sie wollen Zuneigung, und sie reagieren auf unsere Emotionen, ebenso wie wir auf ihre.
Bis zu diesem Punkt hatte der Dalai Lama aufmerksam zugehört, aber jetzt hielt er seine Kappe hoch, um mich zu unterbrechen. Er wollte mehr über Schildkröten erfahren. Diese Tiere mag er besonders, weil es heißt, sie trügen die Welt auf ihrem Rücken. Das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten wollte wissen, ob es auch unter Schildkröten so etwas wie Empathie gibt. Er schilderte, wie das Meeresschildkrötenweibchen an Land kriecht und die beste Stelle für die Eiablage wählt – bringt sie damit nicht ihre Sorge um das Wohl der künftigen Jungen zum Ausdruck? Der Dalai Lama fragte sich außerdem, wie die Mutter wohl reagieren würde, wenn sie später einmal ihrem Nachwuchs begegnete. Für mich stellt sich dieser Vorgang folgendermaßen dar: Schildkröten sind darauf programmiert, einen Ort mit günstigen Brutbedingungen für ihr Gelege zu suchen. Zur Eiablage kehrt die Meeresschildkröte an den Strand ihrer Geburt zurück. Dort gräbt sie oberhalb der Hochwasserlinie eine Grube in den Sand, in die sie die Eier legt. Dann buddelt sie die Grube mit ihren Hinterflossen wieder sorgfältig zu und kehrt ins Meer zurück. Nach ein paar Monaten schlüpfen die Jungtiere und wuseln im Mondlicht zum Wasser. Ihre Mutter lernen sie nie kennen.
Empathie setzt voraus, dass man den anderen und seine Bedürfnisse wahrnimmt. Begonnen hat das vermutlich mit der elterlichen Fürsorge und Brutpflege, wie sie bei Säugetieren üblich ist, aber es gibt auch Belege für Empathie unter Vögeln. Einmal habe ich die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im niederösterreichischen Grünau besucht, wo in großen Volieren Raben gehalten werden. Das sind beeindruckende Vögel, vor allem, wenn sie auf deiner Schulter sitzen und du ihren mächtigen Schnabel aus nächster Nähe bewundern kannst! Das weckte bei mir Erinnerungen an die zahmen Dohlen, die ich als Student hielt: Diese Vögel gehören ebenfalls zur Familie der Rabenvögel, sind aber viel kleiner. In Grünau werden die Forscher mitunter Zeugen von spontanen Kämpfen unter den Raben. Dabei haben sie beobachtet, wie unbeteiligte Vögel auf ihre gestressten Artgenossen reagieren. Die Verlierer dieser Kämpfe können mit einer wohltuenden Gefiederpflege oder kleinen Schnabelstupsern von ihren Freunden rechnen. In derselben Forschungsstation wurden freilaufende Graugänse – Nachkommen der berühmten Schar, an der Lorenz seine Verhaltensforschung betrieb – mit Minisendern ausgestattet. Mithilfe von Telemetrie, also über Funk, wurde die Herzfrequenz der Gänse gemessen. Da jede erwachsene Gans einen Partner hat, kann man anhand dieser Messwerte Rückschlüsse auf ihre Empathie ziehen: Sobald eine Gans in einen Kampf verwickelt ist, beginnt das Herz ihres Partners zu rasen, auch wenn dieser gar nicht involviert ist. Seine Herzfrequenz lässt jedoch erkennen, dass er aufgebracht ist. Auch Vögel können das Leid des anderen nachempfinden.5
Da sowohl Vögel als auch Säugetiere ein gewisses Maß an Empathie aufweisen, geht diese Fähigkeit vermutlich auf ihre gemeinsamen Vorfahren, die Reptilien, zurück. Allerdings trifft das nicht auf alle Reptilien zu, denn die meisten betreiben keine Brutpflege. Nach Paul McLean, dem amerikanischen Neurowissenschaftler, der das limbische System als den Sitz der Emotionen identifiziert hat, ist eines der sichersten Zeichen für eine fürsorgliche Haltung der Not- beziehungsweise »Suchruf« junger Tiere. Junge Affen machen das ständig: Wenn ihre Mutter sie zurücklässt, rufen sie so lange nach ihr, bis sie zurückkommt. Ihr Anblick ist herzzerreißend, wie sie da auf einem Ast hocken und mit ihrem Schmollmund ununterbrochen Klagerufe (»K-u-u«) ausstoßen. MacLean hat darauf hingewiesen, dass dieser Suchruf bei den meisten Reptilien, etwa bei Schlangen, Eidechsen oder Schildkröten, fehlt.
Bei ein paar wenigen Reptilien ruft das Jungtier allerdings sehr wohl nach der Mutter, wenn es sich bedroht fühlt. Haben Sie schon mal einen Babyalligator festgehalten? Seien Sie vorsichtig, denn die Kleinen verfügen nicht nur über scharfe Zähne, sondern geben auch ein heiseres Bellen von sich, welches die Mutter dazu veranlassen könnte, wie ein Pfeil aus dem Wasser zu schießen. Sollten Sie je der Auffassung gewesen sein, Reptilien hätten keine Gefühle, werden Sie spätestens dann eines Besseren belehrt!
Ich erzählte das dem Dalai Lama und fügte hinzu, dass wir Empathie nur bei Tieren mit Bindungen erwarten können, und dass das nur bei wenigen Reptilien der Fall ist. Ich weiß nicht, ob er damit zufrieden war, denn eigentlich interessierten ihn ja die Schildkröten. Die sehen auch viel netter aus als die grimmigen Monster aus der Familie der Krokodile, mit ihren spitzen Zähnen. Allerdings kann die äußere Erscheinung auch täuschen. Manche Mitglieder dieser Familie nehmen ihre Jungen vorsichtig ins Maul oder auf den Rücken, um sie an einen anderen Ort zu transportieren, und sie verteidigen sie gegen Angreifer. Manchmal lassen sie sich von den Sprösslingen sogar Fleischfetzen von Beutetieren aus dem Maul schnappen. Auch die Dinosaurier kümmerten sich um ihren Nachwuchs. Der Plesiosaurus, ein gigantisches Meeresreptil, war möglicherweise sogar lebendgebärend und brachte nur ein einzelnes Jungtier im Wasser zur Welt, ähnlich wie heute die Wale. Nach allem, was wir wissen, wirkt sich die Zahl der Jungtiere auf die Qualität der Brutpflege aus: Je weniger Junge ein Tier hat, umso besser kümmert es sich um sie, weswegen man davon ausgeht, dass Plesiosaurier fürsorgliche Eltern waren. Übrigens gilt das auch für Vögel, die aus wissenschaftlicher Sicht nichts anderes sind als gefiederte Dinosaurier.
Abb. 2: Nur wenige Reptilien betreiben Brutpflege, aber die Familie der Krokodile kümmert sich um den Nachwuchs. Ein Alligatorweibchen transportiert eines seiner Jungen wohlbehalten im Maul.
Der Dalai Lama hakte nach: Wie es denn um die Empathie bei Schmetterlingen bestellt sei? Da konnte ich mir eine scherzhafte Bemerkung nicht verkneifen: »Die haben keine Zeit für so etwas – sie leben ja nur einen Tag!« Das kurze Leben der Schmetterlinge ist in Wirklichkeit ein Mythos, aber was auch immer diese Insekten füreinander empfinden, ich bezweifle, dass es viel mit Empathie zu tun hat. Natürlich wollte der Dalai Lama mit seinen Fragen auf etwas ganz Bestimmtes hinaus: Alle Tiere tun das, was am besten für sie und ihren Nachwuchs ist. So gesehen ist alles Leben fürsorglich – vielleicht nicht bewusst fürsorglich, aber dennoch fürsorglich. Von hier aus leitete der Dalai Lama elegant zu seiner These über, nämlich, dass Mitgefühl zu den grundlegenden Dingen gehört, um die es im Leben eigentlich geht.
Besuch bei Mama
Anschließend wandte sich das Forum anderen Fragen zu, etwa wie sich Mitgefühl im Gehirn buddhistischer Mönche mit jahrzehntelanger Meditationserfahrung messen lässt. Richard Davidson von der Universität Wisconsin erzählte, dass seine Probanden – tibetanische Mönche und Laienbuddhisten – zunächst keinen Sinn darin sahen, an einer neurowissenschaftlichen Studie teilzunehmen, weil Mitgefühl ihrer Meinung nach nicht im Gehirn stattfand, sondern im Herzen! Alle fanden das lustig, und die Mönche im Publikum bogen sich vor Lachen. Aber die Probanden lagen gar nicht so falsch, denn bei seinen Forschungen entdeckte Davidson tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Kopf und Herz: Die »Mitgefühlsmeditation« hatte zur Folge, dass sich die Herzfrequenz der meditationserfahrenen Probanden beschleunigte, wenn man ihnen die Stimmen leidender Menschen vorspielte.6
Ich musste an die Gänse denken. Gleichzeitig saß ich da und staunte über dieses verheißungsvolle Zusammentreffen kluger Köpfe. Im November 2005 hatte der Dalai Lama selbst dazu aufgerufen, den Dialog zwischen Wissenschaft und Religion zu vertiefen. Auf der Jahrestagung der Society of Neuroscience in Washington hatte er vor Zehntausenden Wissenschaftlern darauf hingewiesen, wie schwierig es für die Gesellschaft sei, mit ihren bahnbrechenden Forschungsergebnissen mitzukommen: »Offensichtlich kann unser moralisches Denken nicht mit dem rasanten Tempo Schritt halten, mit dem wir neues Wissen erwerben und Macht gewinnen.«7 Wie wohltuend, dass hier zur Abwechslung mal nicht der Versuch unternommen wurde, einen Keil zwischen Religion und Wissenschaft zu treiben!
Dieses Thema ging mir durch den Kopf, als ich in jener Woche nach Europa aufbrach. Kaum hatte ich den Segen des Dalai Lama erhalten, eine Khata (einen langen Schal aus weißer Seide) um den Hals gelegt bekommen und das Oberhaupt der Tibeter – umringt von schwer bewaffneten Sicherheitsleuten – in seiner Limousine davonfahren sehen, da war ich auch schon unterwegs nach Gent, einer schönen alten Stadt im flämischen Teil Belgiens. Diese Region ist kulturell enger mit dem südlichen Teil der Niederlande – wo ich herkomme – verbunden, als beide mit dem nördlichen Teil, den wir Holland nennen. Zwar sprechen wir alle dieselbe Sprache, aber Holland ist calvinistisch geprägt, während die südlichen Provinzen überwiegend katholisch geblieben sind. Das haben wir den Spaniern zu verdanken, die uns im 16.Jahrhundert den Herzog von Alba und die Inquisition bescherten – und zwar nicht die alberne Inquisition à la Monty Python (»Niemand rechnet mit der Spanischen Inquisition!«), sondern eine von der Sorte, die einem sofort echte Daumenschrauben anlegte, wenn man es wagte, die Jungfräulichkeit Marias infrage zu stellen. Da die Inquisitoren den vermeintlichen Ketzern offiziell keine blutenden Wunden zufügen durften, wandten sie besonders gern das Strappado an, bei dem das Opfer an den hinter dem Rücken gefesselten Handgelenken aufgehängt wurde, oftmals mit Gewichten an den Füßen. Diese Prozedur ist so schmerzhaft, dass man bereitwillig von der Vorstellung ablässt, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Sex und Empfängnis. In den letzten Jahren hat der Vatikan einige Anstrengungen unternommen, um das schlechte Image der Inquisition aufzubessern – schließlich habe sie nicht jeden Ketzer getötet, und außerdem habe sie sich streng an die Verfahrensvorschriften gehalten–, aber die Jesuiten, die mit dieser Kampagne beauftragt waren, hätten ein paar Trainingseinheiten in Sachen Mitgefühl vertragen können.
Übrigens erklärt dieser Teil der niederländischen Geschichte auch, warum man hierzulande vergeblich nach Gemälden von Hieronymus Bosch sucht. Die hängen fast alle im Museo Nacional del Prado in Madrid. Vermutlich hat der »Eiserne Herzog« in seiner Eigenschaft als Statthalter der Spanischen Niederlande den Garten der Lüste erbeutet, als er den Prinz von Oranien 1568 zum Gesetzlosen erklärte und seinen gesamten Besitz konfiszierte. Der Herzog hinterließ das Meisterwerk seinem Sohn, von dem es in Besitz des spanischen Staates überging. Die Spanier verehren den Maler, den sie »El Bosco« nennen und dessen rätselhafte Bilderwelten Künstler wie Joan Mirò und Salvador Dalì inspiriert haben. Bei meinem ersten Besuch im Prado konnte ich Boschs Werke nicht richtig genießen, weil ich in ihnen hauptsächlich »koloniale Beutekunst« sah. Man muss dem Museum zugutehalten, dass es den Garten der Lüste unlängst in hochauflösender Qualität digitalisiert hat; über Google Earth kann ihn jetzt jeder »besitzen«.
Im Anschluss an meinen Vortrag in Gent luden mich ein paar Kollegen spontan zu einem Besuch des Tierparks Planckendael ein, einer Außenstation des Zoos von Antwerpen, der auf die weltweit älteste Geschichte der Bonobo-Zucht zurückblickt. Da Bonobos in den ehemaligen belgischen Kolonien beheimatet sind, ist ihre Gegenwart in Planckendael nicht weiter verwunderlich. Einige Exemplare dieser Spezies wurden, tot oder lebendig, aus Afrika nach Belgien verfrachtet – noch eine Form von kolonialem Beutezug. Aber vielleicht hätten wir diese seltene Menschenaffenart sonst nie kennengelernt. Entdeckt wurde sie 1929 in einem belgischen Kolonialmuseum ganz in der Nähe von Planckendael, wo ein deutscher Anatom den Staub von einem kleinen runden Schädel blies, welchen man zunächst einem jungen Schimpansen zugeordnet hatte. Doch der Wissenschaftler erkannte, dass der Schädel von einem erwachsenen Individuum mit einem ungewöhnlich kleinen Schädel stammte. Schnurstracks verkündete der deutsche Anatom, er sei auf eine neue Unterart des Schimpansen gestoßen. Seine Entdeckung wurde jedoch schon bald von der noch bedeutsameren eines amerikanischen Kollegen in den Schatten gestellt, der behauptete, bei dem Fund handle es sich nicht um eine Schimpansen-Unterart, sondern um eine völlig neue Art, die erstaunliche Ähnlichkeiten mit der menschlichen Anatomie aufwies. Bonobos sind zierlicher gebaut als andere Menschenaffen und haben längere Beine. Die neue Art wurde derselben Gattung – »Pan« – zugeordnet wie die Schimpansen. Den Rest ihres langen Lebens verbrachten die beiden Wissenschaftler in einer erbitterten Rivalität darüber, wer von ihnen die sensationelle Entdeckung als Erster gemacht hatte. Ich habe selbst erlebt, wie der Amerikaner bei einem Symposium über Bonobos aufstand und mit einer vor Entrüstung bebenden Stimme verkündete, er sei vor einem halben Jahrhundert um seinen »Platz in der taxonomischen Literatur betrogen« worden.8
Der deutsche Wissenschaftler hatte seine Ergebnisse auf Deutsch veröffentlicht, der Amerikaner auf Englisch – dreimal dürfen Sie raten, wer von beiden öfter zitiert wird. Viele Sprachen geraten gegenüber dem allgegenwärtigen Englisch ins Hintertreffen, aber im Tierpark Plankendael plauderte ich fröhlich auf Niederländisch, das mir trotz der vielen Jahrzehnte, die ich im Ausland verbracht habe, immer noch den Bruchteil einer Sekunde früher über die Lippen kommt als jede andere Sprache. Während ein junger Bonobo an einem Seil hin und her schwang und unsere Aufmerksamkeit erregte, indem er jedes Mal gegen die Glasscheibe schlug, wenn er in unser Sichtfeld geriet, unterhielten wir uns darüber, wie sehr sein Gesichtsausdruck dem eines lachenden Menschen glich. Er hatte sichtlich Spaß, vor allem, wenn wir zurückhüpften und so taten, als hätte er uns erschreckt. Heute können wir uns kaum vorstellen, dass die beiden Pan-Arten einst in einen Topf geworfen wurden. Es gibt eine berühmte Fotografie, die den amerikanischen Primatologen Robert Yerkes mit zwei jungen Menschenaffen auf dem Schoß zeigt, von denen er dachte, sie seien beide Schimpansen. Das war, bevor die Bonobos entdeckt wurden. Yerkes war jedoch aufgefallen, dass einer der beiden Affen viel empfindsamer und empathischer, vielleicht sogar intelligenter war als alle anderen, die ihm bislang begegnet waren. In seinem 1925 veröffentlichtem Buch Almost Human (»Beinahe menschlich«) nannte er diesen vermeintlichen Schimpansen ein »menschenähnliches Genie«, ohne zu wissen, dass er einen der ersten lebenden Bonobos in der westlichen Welt vor sich hatte.
Abb. 3: Im Laufe der menschlichen Evolution machte der aufrechte Gang längere Beine erforderlich. Von allen Menschenaffen ähnelt das Arm-Bein-Längenverhältnis des Bonobos am meisten dem unseres Vorfahren Ardipithecus. (Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu: Der moderne Mensch ist größer als die übrigen Primaten.)
Die Bonobo-Kolonie in Planckendael unterscheidet sich schon allein dadurch von den Schimpansen, dass sie von einer Frau* angeführt wird. Der Biologe Jeroen Stevens erzählte mir, wie sich die Atmosphäre in der Gruppe entspannt hatte, seitdem die langjährige Alphafrau, eine wahre »eiserne Lady«, in einen anderen Zoo umgesiedelt worden war. Sie hatte die meisten anderen Bonobos tyrannisiert, vor allem die Männer. Die neue Alphafrau hatte einen freundlicheren Charakter. Der Austausch von weiblichen Tieren zwischen den Zoos ist eine neue und empfehlenswerte Praxis, die dem natürlichen Gruppenmuster der Bonobos entgegenkommt. In der freien Wildbahn bleiben die Söhne bis ins Erwachsenenalter bei ihrer Mutter, während die Töchter die Gruppe verlassen.
Lange Zeit schoben die Zoos die männlichen Tiere hin und her und richteten so ungeheuren Schaden an, weil die Bonobomänner ohne ihre Mütter aufgeschmissen sind. Am Ende mussten diese armen, wehrlosen Bonobos meist getrennt von der Gruppe außerhalb des Ausstellungsbereichs der Zoos gehalten werden, damit ihnen nichts zustieß. Seit man sie bei ihren Müttern lässt und ihre Bindung akzeptiert, werden viele Probleme vermieden.
Bonobos sind also keineswegs friedliche Engel. Die Bonobomänner sind richtige »Mamasöhnchen«, was ihren männlichen Verwandten unter den Menschen gar nicht passt: Manche Männer empfinden die matriarchalische Sozialstruktur der Bonobos und die »verweichlichten« männlichen Tiere geradezu als Beleidigung. Nach einem Vortrag in Deutschland meldete sich einer meiner Zuhörer, ein älterer Professor, zu Wort und blaffte: »Was stimmt denn nicht mit diesen Männchen?« Das Schicksal der Bonobos will es, dass sie zu einem Zeitpunkt auf der wissenschaftlichen Bildfläche erschienen, als Anthropologen und Biologen eifrig mit Gewalt und Kriegführung beschäftigt waren und wenig Interesse an den friedlichen Eigenschaften unserer nächsten Verwandten zeigten. Da niemand sie so recht einordnen konnte, wurden die Bonobos rasch zum schwarzen Schaf der Literatur über die menschliche Evolution. Ein amerikanischer Anthropologe hat sogar empfohlen, sie einfach zu ignorieren, da sie ja ohnehin fast ausgestorben seien.9
Einer Spezies ihren unmittelbar bevorstehenden Untergang anzukreiden, ist ungewöhnlich. Stimmt etwas nicht mit den Bonobos? Sind sie schlecht angepasst? Auf der anderen Seite sagt das Aussterben einer Art nichts über ihre ursprüngliche Anpassungsfähigkeit aus. Der Dodo kam wunderbar zurecht, bis Seeleute auf Mauritius landeten und in diesem flugunfähigen Vogel eine leicht zu erbeutende (wenngleich nicht besonders wohlschmeckende) Mahlzeit sahen. Ebenso müssen unsere frühen Vorfahren in ihren jeweiligen Zeitaltern gut angepasst gewesen sein – und doch hat keiner von ihnen die Jahrmillionen überdauert. Sollten wir uns deshalb nicht mit ihnen befassen? Wohl kaum. Jedes Mal, wenn eine noch so winzige Spur unserer Vergangenheit entdeckt wird, löst das einen Medienrummel aus, was vielleicht auch daran liegt, dass diese Fossilien Namen wie Lucy oder Ardi bekommen und somit personalisiert werden.
Ich schätze die Bonobos, gerade weil sie sich von den Schimpansen unterscheiden und unser Verständnis der menschlichen Evolution dadurch bereichern. Sie zeigen, dass unsere Entwicklungsgeschichte nicht nur durch männliche Dominanz und Xenophobie geprägt ist, sondern auch durch ein ausgeprägtes Harmoniebedürfnis und Einfühlungsvermögen. Da die Evolution sowohl über die männliche als auch die weibliche Abstammungslinie stattfindet, gibt es keinen Grund, den Fortschritt des Menschen allein daran zu messen, wie viele Schlachten unsere männlichen Vorfahren gegen andere Hominine gewonnen haben.10 Es würde nicht schaden, die weibliche Linie, aber auch den Sex, stärker ins Blickfeld zu rücken. Denn soweit wir wissen, hat der Mensch andere Gruppen nicht durch Kriege ausradiert, sondern durch Fortpflanzung weggezüchtet. Der moderne Mensch hat Neandertaler-DNA in seinem Erbgut, und es würde mich nicht wundern, wenn wir noch weitere hominine Gene in uns trügen. So gesehen erscheint das Wesen der Bonobos gar nicht so fremd.
Ich verabschiedete mich von diesen einfühlsamen Menschenaffen und fuhr weiter nach Arnheim in den Niederlanden. Im dortigen Zoo hat meine Laufbahn als Primatologe vor mehr als vier Jahrzehnten mit der Erforschung der anderen Pan-Spezies begonnen. Der deutsche Professor würde Schimpansen lieben, denn bei ihnen sind die Männer die uneingeschränkten Herrscher. Außerdem wetteifern sie ständig untereinander, und ihre Rangkämpfe sind so ausgeklügelt, dass ich ein Buch nur über »Schimpansenpolitik« geschrieben habe (Chimpanzee Politics; dt. Unsere haarigen Vettern, 1983), in dem ich beschreibe, wie sie anderen Honig ums Maul schmieren und intrigieren. Als Student las ich Machiavelli, um Einblicke zu gewinnen, die Biologie-Lehrbücher nicht bieten konnten. In jener turbulenten Zeit, als ich noch im Zoo von Arnheim arbeitete, wurde einer der männlichen Schimpansen von seinen Artgenossen getötet, und dieses Erlebnis verfolgt mich bis heute, nicht zuletzt, weil die Angreifer ihm auf grausame Weise die Hoden abrissen. Im Laufe der Jahre sind auch die anderen Männer alle gestorben, aber ihre Söhne, die jetzt erwachsen sind, gehören noch zu der Kolonie. Sie sehen ihren Vätern nicht nur verblüffend ähnlich, sondern hören sich auch an wie sie, wenn sie johlen oder schreien. Schimpansen haben unverwechselbare Stimmen: Ich konnte damals alle fünfundzwanzig Individuen allein anhand ihrer Rufe auseinanderhalten. Diese Menschenaffen sind mir sehr vertraut, und ich finde sie absolut faszinierend, aber ich mache mir keine Illusionen über ihre »Nettigkeit«, auch wenn sie auf die meisten Menschen einen freundlichen Eindruck machen. Schimpansen nehmen ihre Machtkämpfe sehr ernst und schrecken nicht davor zurück, ihre Rivalen zu töten. Es ist auch vorgekommen, dass sie Menschen angegriffen, getötet oder ihnen das Gesicht weggebissen haben. In den USA hat es solche Fälle zum Beispiel bei Schimpansen gegeben, die als Haustiere gehalten wurden. Aber wenn man ein wildes Tier in einer Umgebung hält, in der die Gefahr besteht, dass sexuelle Eifersucht und Dominanzstreben durch unsere eigene vergleichsweise schwache Spezies ausgelöst werden, sind solche Tragödien vorprogrammiert. Ein einzelner männlicher Schimpanse hat eine solche Muskelkraft (ganz zu schweigen von seinen dolchartigen Fangzähnen und seinen »vier Händen«), dass selbst ein Team von fünf starken Männern nicht in der Lage ist, ihn festzuhalten. Schimpansen, die unter Menschen aufgewachsen sind, wissen das genau.
Die Schimpansinnen aus meiner Zeit in Arnheim sind dagegen fast alle noch am Leben, darunter auch die beeindruckende Matriarchin der Kolonie, die »Mama« heißt. Anders als bei den Bonobos herrschen die Schimpansinnen nicht über die Gruppe, aber Mama ist seit eh und je das Alphatier unter den weiblichen Mitgliedern der Kolonie. In ihrer Glanzzeit mischte Mama aktiv in den Machtkämpfen der Männer mit. Sie warb um die Unterstützung der Frauen für einen bestimmten Schimpansen, und wenn dieser dann tatsächlich an die Spitze der Rangordnung gelangte, war er der Schimpansendame etwas schuldig. Der neue Chef hütete sich davor, sich mit Mama anzulegen, denn das konnte das Ende seiner Laufbahn bedeuten. Mama ging so weit, andere Schimpansinnen zu bestrafen, wenn sie es wagten, für einen Schimpansen Partei zu ergreifen, der ihr nicht zusagte. Sie verhielt sich wie eine echte Fraktionsführerin. Körperlich dominieren die Schimpansenmänner die Frauen, aber das heißt noch lange nicht, dass die Schimpansenfrauen nichts von Politik verstehen und sich aus diesen Dingen raushalten. In der freien Wildbahn ist das zwar oft der Fall, nicht aber im vergleichsweise engen Lebensraum im Zoo von Arnheim. Dort hält sich das Machtgefälle zwischen den Geschlechtern in Grenzen. Da alle Schimpansinnen ständig anwesend sind, unterstützen sie sich gegenseitig, und kein Mann kommt an diesem weiblichen Machtblock vorbei.
Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Mama. Jedes Mal, wenn sie mich sieht, begrüßt sie mich mit einer Mischung aus Respekt und Zuneigung. Das hat sie in all den Jahren immer getan und tut es auch jetzt noch, sobald sie mein Gesicht unter den Besuchern erkennt. Ich komme alle paar Jahre nach Arnheim und nehme mir jedes Mal Zeit für ein bisschen gegenseitige Fellpflege mit Mama, aber dieses Mal hatte ich fast hundert Personen im Schlepptau, die alle an einem Symposium im Tagungszentrum des Zoos teilnahmen. Als wir zu der Affeninsel hinaufliefen, kamen Mama und eine andere alte Schimpansendame namens Jimmy sofort nach vorne, um mich zu begrüßen. Sie gaben leise Grunzlaute von sich, und Mama streckte mir aus der Entfernung ihre Hand entgegen. Diese »Komm-her«-Geste verwenden die Schimpansinnen in der Regel, wenn sie aufbrechen und ihre Kinder dazu auffordern, auf ihren Rücken zu springen. Ich machte dieselbe Geste zurück, und später half ich dem Pfleger bei der Fütterung der Schimpansen. Ich warf Obst über den Wassergraben und achtete darauf, dass Mama, die nicht mehr die Schnellste ist und die Orangen nicht so geschickt aus der Luft fängt wie die anderen, genügend abbekam.
Das blieb den anderen Schimpansen natürlich nicht verborgen, und Mamas erwachsene Tochter Moniek wurde eifersüchtig. Sie schlich sich heran, hob einen schweren Stein auf und warf ihn aus einer Entfernung von circa zwölf Metern in meine Richtung. Monieks parabolischer Wurf hätte schlimme Folgen haben können: Der Stein hätte mich am Kopf getroffen, wenn ich sie nicht im Auge behalten hätte. Ich fing den Stein aus der Luft auf. Moniek kam zur Welt, als ich noch im Zoo arbeitete, und ich habe oft beobachtet, wie sehr es sie in Rage bringt, wenn ihre Mutter mir Aufmerksamkeit schenkt. Wahrscheinlich kann sie sich nicht an mich erinnern und hat keine Ahnung, warum Mama diesen Fremden wie einen alten Freund begrüßt. Besser ihn mit etwas bewerfen! Manche Leute sind der Auffassung, das gezielte Werfen sei eine rein menschliche Spezialisierung, die mit der Sprachevolution zusammenhängt. Ich habe Verfechter dieser Theorie dazu eingeladen, am eigenen Leib auszuprobieren, wozu Schimpansen in der Lage sind, aber ich konnte keine Freiwilligen finden. Wahrscheinlich wissen sie, dass Menschenaffen nicht nur mit Steinen werfen, sondern manchmal auch mit übelriechenden Körpererzeugnissen.
Die Symposium-Teilnehmer waren von meiner Begegnung mit Mama gerührt und fragten sich, wie gut Schimpansen uns erkennen, und wir sie. Für mich sind die Gesichter von Menschenaffen ebenso unterscheidbar wie die von Menschen. Allerdings sind beide Spezies auf ihre Artgenossen spezialisiert. Noch vor wenigen Jahren wurde dieses Bias – wie solche durch bestimmte Neigungen oder Voreingenommenheit hervorgerufenen Verzerrungen von Forschungsergebnissen genannt werden – einfach ignoriert. Man ging davon aus, nur Menschen seien gut darin, Gesichter zu erkennen. Menschenaffen hatten bei den gleichen Tests, die mit Menschen durchgeführt worden waren, schlechter abgeschnitten. Sowohl bei den Tests mit Menschen als auch bei denen mit Menschenaffen waren jedoch dieselben Reize verwendet worden, das heißt, die Affen waren mit Gesichtern von Menschen getestet worden. Das nenne ich das »anthropozentrische Bias« in der Primatenforschung, auf das viele Fehlschlüsse zurückzuführen sind. Als eine meiner Mitarbeiterinnen in Atlanta, Lisa Parr, Hunderte von Fotografien verwendete, die ich in meiner Zeit in Arnheim gemacht hatte, und Schimpansen mit Bildern ihrer eigenen Spezies testete, erzielten sie hervorragende Ergebnisse. Die Fotos wurden ihnen auf einem Computerbildschirm gezeigt, und sie wussten sogar, welche Kinder zu welchen Müttern gehörten, ohne dass sie den abgebildeten Schimpansen je persönlich begegnet waren. Wenn wir Menschen ein Familienalbum durchblättern, können wir in der Regel allein an den Gesichtern erkennen, welche Personen miteinander blutsverwandt sind.
Wir leben in einer Zeit, in der unsere Verwandtschaft mit den Menschenaffen immer seltener infrage gestellt wird. Natürlich wird der Mensch nicht müde, Anspruch auf Einzigartigkeit zu erheben und nach Merkmalen zu suchen, die ihn angeblich von anderen Primaten unterscheiden, aber kaum eine dieser Behauptungen lässt sich länger als zehn Jahre aufrechterhalten. Wenn wir unsere Spezies einmal betrachten, ohne uns von den technischen Errungenschaften der letzten Jahrtausende blenden zu lassen, sehen wir ein Geschöpf aus Fleisch und Blut, mit einem Gehirn, das zwar dreimal so groß ist wie das eines Schimpansen, aber keine neuen Regionen aufweist. Selbst unser viel gepriesener präfrontaler Cortex ist im Vergleich zu dem anderer Primaten eher von durchschnittlicher Größe. Niemand zweifelt an der Überlegenheit unseres Intellekts, aber wir haben keine Grundbedürfnisse, die nicht auch bei unseren nahen Verwandten vorhanden wären. Genau wie wir streben Affen und Menschenaffen nach Macht, haben Freude am Sex, wollen Sicherheit und Zuneigung, verteidigen ihr Revier – wenn es sein muss, bis aufs Blut – und wissen Vertrauen und Kooperation zu schätzen. Ja, wir haben Computer und Flugzeuge, aber unsere psychologische Verfassung bleibt die eines sozialen Primaten.
Das Symposium fand also aus gutem Grund im Zoo statt, denn es ging um die Frage, was Gesundheitsexperten und Sozialwissenschaftler von der Primatenforschung lernen können. Ich vertrat die Primatologie, habe aber selbst etwas gelernt, und zwar bei einer Diskussion am Rande der Veranstaltung. Wir sprachen darüber, woher Moralität ihre Berechtigung nimmt. Wenn die Bedeutung, die moralischem Handeln beigemessen wird, nicht von oben kommt, wer oder was bestimmt dann darüber? Ein Kollege meinte, die zunehmende Säkularisierung der Niederländer im Lauf der letzten Jahrzehnte ginge mit einem Verlust von moralischer Autorität einher. Da niemand mehr öffentlich zurechtgewiesen werde, seien die Menschen weniger zivilisiert. Ich sah, wie rund um den Tisch mit dem Kopf genickt wurde. War das nur eine frustrierte Tirade der älteren Generation, die keine Gelegenheit auslässt, sich über die jüngere zu beschweren? Oder gab es ein Muster? Überall in Europa schreitet die Säkularisierung voran, aber niemand weiß so recht, welche moralischen Implikationen diese Entwicklung mit sich bringt. Sogar der deutsche Philosoph Jürgen Habermas – ein atheistischer Marxist wie er im Buche steht – ist zu der Auffassung gelangt, dass der Verlust von Religion am Ende vielleicht gar nicht so vorteilhaft ist: »Als sich Sünde in Schuld (…) verwandelte, ging etwas verloren.«11
Das atheistische Dilemma
Ich bezweifle jedoch, dass Moralität von oben verordnet werden muss. Kann sie nicht von innen heraus kommen? Das würde unser Mitgefühl erklären, vielleicht auch unseren Gerechtigkeitssinn. Vor ein paar Jahren haben wir gezeigt, wie Primaten für ein Stück Gurke bereitwillig eine Aufgabe ausführten, aber nur so lange, bis sie beobachteten, dass andere für die gleiche Leistung mit Weintrauben belohnt wurden, die sie noch viel lieber mögen. Die Gurkenesser wurden unwillig, warfen das schnöde Gemüse in die Ecke und streikten. Der sonst so begehrte Leckerbissen wurde plötzlich verschmäht, nur weil andere etwas Besseres bekamen.12 Wir nennen diese Abneigung gegen Benachteiligung Ungleichheitsaversion (inequity aversion). Das Phänomen ist inzwischen auch bei anderen Tieren untersucht worden, unter anderem bei Hunden: Ein Hund macht mehrmals ein Kunststück, ohne dafür belohnt zu werden, aber sobald er sieht, dass ein anderer Hund für dasselbe Kunststück ein Würstchen bekommt, macht er es auch nicht mehr ohne.
Solche Studienergebnisse werfen Fragen über die menschliche Moralität auf. Die meisten Philosophen glauben, dass wir moralische Grundsätze durch logisches Schlussfolgern entwickeln. Auch wenn sie keinen Gott ins Spiel bringen, gehen sie doch von einem Top-down-Prozess aus, bei dem zunächst die moralischen Prinzipien formuliert und dann dem menschlichen Verhalten auferlegt werden. Aber laufen moralische Überlegungen tatsächlich auf einer so hohen Ebene ab? Hängen sie nicht eher davon ab, wer und was wir sind? Würde es beispielsweise Sinn machen, die Menschen zu gegenseitiger Rücksichtnahme zu verdonnern, wenn sie nicht ohnehin eine natürliche Neigung dazu hätten? Stellen Sie sich die kognitive Belastung vor, wenn wir jede unserer Entscheidungen erst auf eine tradierte Logik hin überprüfen müssten. Ich bin ein überzeugter Anhänger von David Humes These, dass Vernunft die Sklavin der Leidenschaften ist. Moralische Empfindungen und Intuitionen gehören zu unserer Grundausstattung, und genau an diesem Punkt ist die Kontinuität mit anderen Primaten am größten. Wir haben unsere Moralität keineswegs aus dem Nichts heraus, durch rationales Denken, entwickelt; vielmehr hat unser Hintergrund als soziale Tiere den Anstoß dazu gegeben.
Zugleich widerstrebt es mir, Schimpansen als »moralische Wesen« zu bezeichnen. Denn Gefühle allein reichen nicht aus. Wir streben nach einem logischen, kohärenten System und streiten darüber, wie die Todesstrafe mit der Heiligkeit des Lebens vereinbar ist, oder ob eine sexuelle Orientierung, die man sich nicht selbst ausgesucht hat, moralisch verwerflich sein kann. Solche Fragen stellen sich nur Menschen. Wir haben so gut wie keine Belege dafür, dass andere Tiere die Angemessenheit von Handlungen beurteilen, die sie selbst nicht direkt betreffen. Der große Pionier der Moralforschung, der finnische Anthropologe Edward Westermarck, hat darauf hingewiesen, dass moralische Emotionen von der eigenen, konkreten Situation losgelöst sind. Sie setzen sich auf einer abstrakteren, neutraleren Ebene mit Gut und Böse auseinander. Hierin unterscheidet sich die Moralität des Menschen von der anderer Tiere. Sie beruht auf universellen Normen in Verbindung mit einem ausgeklügelten System von Rechtfertigung, Überwachung und Bestrafung.
An diesem Punkt kommt die Religion ins Spiel. Man denke nur an die vielen Erzählungen, in denen Mitgefühl propagiert wird, etwa das Gleichnis vom barmherzigen Samariter; oder das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, das unseren Gerechtigkeitssinn strapaziert und mit dem berühmten Spruch endet: »Die Ersten werden die Letzten sein, und die Letzten die Ersten.« Hinzu kommt eine geradezu Skinner’sche Vorliebe für Belohnung und Bestrafung – von den Jungfrauen, die im Paradies den Märtyrer erwarten, bis zu dem Höllenfeuer, das dem Sünder droht – und die Instrumentalisierung unseres Bestrebens, »lobenswert« zu sein, wie Adam Smith es formuliert hat. Tatsächlich ist der Mensch gegenüber der öffentlichen Meinung so empfindlich, dass ihm ein Bild von zwei Augen an der Wand genügt, um sich »lobenswert« zu verhalten. Die Religion hat das schon früh erkannt und den allgegenwärtigen Gott als ein Auge dargestellt, das alles sieht.
Aber selbst wenn man der Religion nur diese bescheidene Rolle zuweist, ist das manch einem ein Dorn im Auge. In den letzten Jahren haben wir uns an einen schrillen Atheismus gewöhnt, dessen Verfechter mit Büchern wie Der Herr ist kein Hirte (Christopher Hitchens) oder Der Gotteswahn (Richard Dawkins) provozieren. Die Neoatheisten bezeichnen sich selbst als Brights, womit sie zu verstehen geben, dass sie Gläubige für weniger »helle Köpfe« halten. Sie haben das Diktum des heiligen Paulus, wonach Sünder im Dunkeln leben, kurzerhand ins Gegenteil verkehrt: Die Nichtgläubigen sind die einzigen, die das Licht gesehen haben. Sie pochen darauf, allein der Wissenschaft zu vertrauen, und wollen die Ethik im naturalistischen Weltbild verankern. Ich teile ihre Skepsis, was religiöse Institutionen und deren »Primaten« – Päpste, Bischöfe, Megaprediger, Ayatollahs und Rabbiner – betrifft, aber warum muss man die vielen Menschen beleidigen, die der Religion einen Wert beimessen? Anders gefragt: Welche Alternative hat die Wissenschaft denn zu bieten? Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, den Sinn des Lebens zu erklären, und es steht ihr schon gar nicht zu, den Menschen vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Der britische Philosoph John Gray hat es folgendermaßen formuliert: »Wissenschaft ist nicht Hexerei. Der Zuwachs an Wissen vergrößert die Palette dessen, was Menschen tun können. Er kann sie aber nicht davor bewahren, das zu sein, was sie sind.«13 Wir Wissenschaftler sind gut darin, herauszufinden, warum die Dinge so sind, wie sie sind, oder wie sie funktionieren, und ich bin davon überzeugt, dass die Biologie viel zu unserem Verständnis von Moralität beitragen kann. Aber das berechtigt uns noch lange nicht dazu, moralische Ratschläge zu erteilen.
Man kann ein noch so überzeugter Atheist sein, aber wer in der westlichen Welt aufwächst, kommt nicht umhin, die grundlegenden Lehren des Christentums in sich aufzunehmen. Sogar die zunehmend säkularen Nordeuropäer, deren Kultur mir vertraut ist, können die weitgehend christliche Prägung ihrer Anschauungen nicht verleugnen. Ganz gleich, in welchem Teil der Welt: Alles, was der Mensch je geschaffen hat – von der Architektur bis zur Musik, von der Kunst bis zur Wissenschaft – hat sich Hand in Hand mit der Religion entwickelt, nie getrennt von ihr. Wir können daher unmöglich wissen, wie Moralität ohne Religion aussehen würde. Dazu müssten wir eine menschliche Kultur ausfindig machen, die nicht religiös ist und es auch nie war. Dass eine solche Kultur nicht existiert, sollte uns zu denken geben.
Hieronymus Bosch beschäftigte sich mit denselben Fragen. Er war kein Atheist, weil das zu seiner Zeit keine Option war, aber er fragte sich, welchen Platz die Wissenschaft in der Gesellschaft einnimmt. Die kleinen Figuren in seinen Gemälden tragen umgekehrte Trichter auf dem Kopf, und die Gebäude im Hintergrund erinnern an Gerätschaften für die Destillation, wie sie Chemiker verwenden. Egal, welches Bild wir heute von der Wissenschaft haben, wir sollten nicht vergessen, dass sie in ihren Anfängen keinesfalls ein rationales Unterfangen war. Zu Boschs Zeiten erfreute sich die Alchemie großer Beliebtheit; allerdings war sie stark okkultistisch geprägt und brachte zahlreiche Scharlatane und Quacksalber hervor, die der Maler sehr humorvoll vor ihrem leichtgläubigen Publikum dargestellt hat. Erst als sie sich von diesen Einflüssen befreite und selbstkorrigierende Verfahren entwickelte, wurde aus der Alchemie eine empirische Wissenschaft. Unklar blieb, wie die Wissenschaft zu einer moralischen Gesellschaft beitragen kann.
Abb. 4: Boschs Gemälde wimmeln nur so von Symbolen und Anspielungen auf die Alchemie, die mystische Vorgängerin der Chemie. Die zentrale Figur im Höllenbild des Garten der Lüste ist der sogenannte Baummensch, dessen eiförmiger Torso auf zwei verwitterten Baumstümpfen ruht. Der Kopf trägt eine Scheibe, auf der dämonische Wesen mit ihren Opfern um eine rauchende Sackpfeife kreisen. Dieses Gebilde erinnert an Vorrichtungen, wie sie in der Alchemie Verwendung fanden.
Die anderen Primaten haben solche Probleme natürlich nicht, aber auch sie streben eine bestimmte Gesellschaftsordnung an. In ihrem Verhalten erkennen wir dieselben Werte, die wir selbst verfolgen. So wurde zum Beispiel beobachtet, wie Schimpansinnen gegnerische männliche Schimpansen trotz aller Sturheit dazu brachten, sich nach einem Kampf wieder zu versöhnen, indem sie sie aufeinander zuschubsten und ihnen ihre Waffen abnahmen. Außerdem schlüpfen hochrangige Schimpansen regelmäßig in die Rolle des parteilosen Schiedsrichters, um Streit in der Gruppe zu schlichten. Für mich ist dieser Gemeinschaftsgeist ein Zeichen dafür, dass die Bausteine von Moralität älter sind als die Menschheit, und dass wir keinen Gott brauchen, um zu erklären, wie wir dort hingelangt sind, wo wir heute stehen. Auf der anderen Seite, was würde passieren, wenn wir die Religion aus unserer Gesellschaft verbannen würden? Es fällt mir schwer zu glauben, dass die Wissenschaft und die naturalistische Weltanschauung diese Lücke füllen und zu einer Inspiration des Guten werden könnten.
Am Ende meines einwöchigen Transatlantik-Trips, auf dem Rückflug in die Staaten, fand ich schließlich Zeit, die annähernd siebenhundert Kommentare zu lesen, die inzwischen unter meinem Blogeintrag Moral ohne Gott? eingegangen waren. Die meisten Beiträge waren konstruktiv und plädierten dafür, bei den Ursprüngen von Moralität keine Schwarz-Weiß-Schablone anzulegen, sondern Grauabstufungen zuzulassen. Es gab aber auch zahlreiche Kommentare von Atheisten, die der Versuchung nicht widerstehen konnten, gegen Religion zu sticheln, was ich mit meinem Blog gar nicht beabsichtigt hatte. Für mich ist es viel wichtiger, das Bedürfnis nach Religion zu verstehen, als es zu entwerten. Ich finde die zentrale Frage des Atheismus, die (Nicht-)Existenz Gottes, völlig uninteressant. Was haben wir davon, über etwas zu streiten, dessen Existenz niemand beweisen oder widerlegen kann? Wozu die ganze Aufregung? Im Jahr 2012 erntete der britisch-schweizerische Schriftsteller Alain deBotton einen Sturm der Entrüstung, weil er sein Buch Religion für Atheisten mit dem Satz beginnen ließ: »Die langweiligste und unproduktivste Frage, die man sich zu einer Religion stellen kann, ist die, ob sie wahr ist oder nicht – sprich: ob sie wirklich beim Schalle von Trompeten und unter Mitwirkung von Propheten und himmlischen Wesen auf übernatürliche Weise vom Himmel heruntergereicht wurde.«14 Und doch reden manche über nichts anderes. Warum diese Engstirnigkeit? Es ist, als säßen wir in einem Debattierclub, wo man nur gewinnen oder verlieren kann.
Die Wissenschaft ist nicht die Antwort auf alles. Als Student habe ich mich mit dem »naturalistischen Fehlschluss« befasst und gelernt, dass es der Gipfel der Arroganz ist, wenn Wissenschaftler glauben, ihre Arbeit könne den Unterschied zwischen Richtig und Falsch beleuchten. Wohlgemerkt war das nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg: Damals hatten Wissenschaftler unter dem Deckmäntelchen einer wissenschaftlichen Theorie der selbstgesteuerten Evolution enormes Unheil angerichtet. Sie waren zuhauf an der Maschinerie des Genozids beteiligt gewesen und hatten unvorstellbar grausame Experimente durchgeführt. Kinder wurden zusammengenäht, um siamesische Zwillinge zu schaffen, Menschen wurden ohne Anästhesie operiert, Gliedmaßen und Augen wurden entfernt und an andere Körperstellen versetzt. In der dunklen Zeit nach dem Krieg war jeder Wissenschaftler, der auch nur mit deutschem Akzent sprach, irgendwie verdächtig. Amerikanische und britische Wissenschaftler hatten aber auch keine weiße Weste – schließlich waren sie diejenigen, die Ende des 19.Jahrhunderts die moderne Eugenik begründeten. Sie sprachen sich für rassistische Zuwanderungsgesetze aus und nahmen an Tauben, Blinden, psychisch Kranken und Körperbehinderten, Kriminellen und Mitgliedern ethnischer Minderheiten Zwangssterilisationen vor. Diese Eingriffe wurden ohne Aufklärung und Einwilligung der Betroffenen durchgeführt, wenn diese aus anderen Gründen in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Wer diese schmutzige Geschichte nicht der Wissenschaft anlasten möchte, sondern in diesem Zusammenhang lieber von »Pseudowissenschaft« spricht, sei daran erinnert, dass die Eugenik eine seriöse akademische Disziplin an zahlreichen Universitäten war. Um 1930 gab es nicht nur in England und den USA entsprechende Lehrstühle, sondern auch in Schweden, Norwegen, Russland, der Schweiz und in Deutschland. Eugenische Ideen wurden von prominenten Persönlichkeiten, darunter auch amerikanische Präsidenten, unterstützt. Der Begründer der Eugenik, der britische Anthropologe und Universalgelehrte Sir Francis Galton, wurde in die Royal Society gewählt und zum Ritter geschlagen, nachdem er Vorschläge zur Verbesserung der menschlichen Rasse unterbreitet hatte. Galton war der Auffassung, der Durchschnittsbürger sei »zu nieder, um den Anforderungen der modernen Zivilisation gerecht zu werden.«15
Offenbar mussten erst Hitler und seine Schergen auf den Plan treten, bevor die moralische Verwerflichkeit dieser Ideen entlarvt wurde. Das zwangsläufige Ergebnis war ein jäher Verlust des Vertrauens in die Wissenschaft, insbesondere in die Biologie. Noch in den 1970er Jahren wurden Biologen gemeinhin mit Faschisten gleichgesetzt, was sich auch in den erbitterten Protesten gegen die sogenannte »Soziobiologie« niederschlug. Als Biologe bin ich froh darüber, dass diese schlimmen Zeiten vorbei sind, aber gleichzeitig frage ich mich, wie man diese Vergangenheit einfach vergessen und die Wissenschaft erneut zum moralischen Retter der Menschheit erklären kann. Wie konnten wir jenes tiefe Misstrauen einfach durch einen naiven Optimismus ersetzen? Ich befürworte zwar die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Moralität – schließlich ist sie Teil meiner eigenen Arbeit–, aber ich habe kein Verständnis für den Ruf nach der Wissenschaft als moralische Instanz, die menschliche Werte bestimmen soll, wie es Sam Harris mit dem Untertitel seines Buchs The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values nahelegt.16 Ist Pseudowissenschaft etwas, das der Vergangenheit angehört? Sind moderne Wissenschaftler vor moralischen Verfehlungen gefeit? Man denke nur an die Tuskegee-Syphilis-Studie, die erst wenige Jahrzehnte zurückliegt, oder an die derzeitige Beteiligung von Ärzten an der Folter von Gefangenen im Lager von Guantánamo.17 Ich bin zutiefst skeptisch, was die moralische Reinheit der Wissenschaft betrifft; meiner Meinung nach sollte sie niemals mehr sein als eine Handlangerin der Moral.
Das Verwirrspiel um die Rolle der Wissenschaft scheint der Illusion geschuldet, dass alles, was wir für eine gute Gesellschaft brauchen, mehr Wissen ist. Wenn wir den entscheidenden Algorithmus der Moralität erst einmal bestimmt haben, so die Annahme, können wir den Rest getrost der Wissenschaft überlassen – sie wird dann schon das Richtige tun. Das ist in etwa so, als würde man annehmen, ein berühmter Kunstkritiker müsse auch ein großer Maler sein, oder ein Restaurantkritiker ein Spitzenkoch. Schließlich bieten Kritiker tiefe Einblicke in Dinge, die andere hervorgebracht haben. Da sie über das nötige Wissen verfügen, können sie den Job (des Künstlers, Musikers, Schauspielers, Kochs etc.) doch gleich selbst machen, oder? Die Aufgabe des Kritikers besteht jedoch darin, etwas zu beurteilen, nicht, es zu erschaffen. Der Schaffungsprozess erfordert Intuition, Fertigkeiten und Vorstellungskraft. Selbst wenn die Wissenschaft uns verständlich macht, wie Moralität funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass sie moralische Vorgaben machen soll. Wenn ein Koch weiß, wie man Eier zubereitet, erwarten wir ja auch nicht, dass er selbst welche legt.
Die Vorstellung von Moralität als eine Reihe von unumstößlichen Prinzipien oder Gesetzen, die wir selbst entdecken müssen, geht im Endeffekt auf die Religion zurück. Ob es nun Gott ist, der diese Gesetze formuliert, oder die menschliche Vernunft oder die Wissenschaft, ist letztlich egal. Allen diesen Ansätzen ist eine Top-down-Ausrichtung (von oben nach unten) gemein, das heißt, sie gehen grundsätzlich davon aus, dass der Mensch nicht weiß, wie er sich verhalten soll, und dass er jemanden braucht, der es ihm sagt. Was aber, wenn Moralität nicht auf einer abstrakten geistigen Ebene entsteht, sondern durch soziale Interaktionen? Was, wenn sie in den Emotionen wurzelt, die sich bekanntlich nur selten in die von der Wissenschaft so sehr geschätzten klaren Kategorien einteilen lassen? Da ich in diesem Buch einen entschiedenen Bottom-up-Ansatz (von unten nach oben) verfolge, werde ich auf diesen Punkt noch mehrfach zurückkommen. Meine Ansichten decken sich mit unseren Erkenntnissen darüber, wie der menschliche Geist funktioniert (emotionale Beweggründe kommen grundsätzlich vor rationalen Erwägungen) und wie die Evolution Verhaltensweisen hervorbringt. Zunächst einmal sollten wir unseren Hintergrund als soziale Tiere zur Kenntnis nehmen und überlegen, wie dieser Hintergrund uns zum Umgang mit unseren Artgenossen befähigt. Dieser Ansatz verdient Aufmerksamkeit, gerade in einer Zeit, in der eingeschworene Atheisten einer semireligiösen Moralität verhaftet bleiben und glauben, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn nur die Priesterschaft die Soutane gegen den weißen Kittel eintauschen würde.
Kapitel 2Woher kommt das Gute?
Denn erstens führen die socialen Instincte ein Thier dazu, Vergnügen an der Gesellschaft seiner Genossen zu haben, einen gewissen Grad von Sympathie mit ihnen zu fühlen und verschiedene Dienste für sie zu verrichten.
– Charles Darwin1
Amos war einer der hübschesten Kerle, die mir je begegnet sind – außer vielleicht an dem Tag, als er sich zwei ganze Äpfel ins Maul stopfte, was mir wieder einmal vor Augen führte, dass Schimpansen Dinge tun können, zu denen wir Menschen nicht fähig sind. Er hatte ein freundliches, symmetrisches Gesicht mit großen Augen, ein dichtes, glänzendes schwarzes Fell und wohldefinierte Muskeln an Armen und Beinen. Anders als viele männliche Schimpansen war er nie übermäßig aggressiv; dafür legte er in seiner Glanzzeit ein hohes Maß an Selbstbewusstsein an den Tag. Alle liebten Amos. Als er starb, weinten einige von uns, und seine Genossen blieben tagelang gespenstisch stumm. Ihr Appetit ließ stark nach.
Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, woran Amos gestorben war, aber die Obduktion ergab, dass er nicht nur eine stark vergrößerte Leber gehabt hatte, die fast seinen kompletten Bauchraum ausfüllte, sondern auch mehrere Krebsgeschwulste. Im Vergleich zum Vorjahr hatte er fünfzehn Prozent seines Körpergewichts verloren, doch obwohl sich sein Zustand über Jahre hinweg entwickelt haben musste, hatte er sich nicht anders verhalten als sonst, bis sein Körper nicht mehr mitmachte. Er muss monatelang gelitten haben, aber jedes Zeichen von Schwäche hätte seinen Status in der Gruppe gefährdet. Schimpansen scheinen das genau zu wissen. Ein hinkender Schimpansenmann in der freien Wildbahn wurde beobachtet, wie er sich wochenlang von den anderen Schimpansen isolierte, um seine Verletzungen zu kurieren. Hin und wieder tauchte er aber in der Gruppe auf, um eine kraftstrotzende Demonstration seiner Vitalität und Stärke hinzulegen. Anschließend zog er sich wieder zurück. Auf diese Weise sollte niemand auf dumme Gedanken kommen.
Amos ließ erst einen Tag vor seinem Tod erkennen, wie schlecht es ihm ging. Während sich seine Artgenossen draußen in der Sonne tummelten, saß er keuchend auf einem Jutesack in einem der Nachtkäfige. Er hatte eine Atemfrequenz von 60 pro Minute, und der Schweiß rann ihm über das Gesicht. Da er sich weigerte, nach draußen zu gehen, versuchten wir, ihn von der Gruppe zu trennen, bis der Tierarzt kam, um ihn zu untersuchen. Die anderen Schimpansen ließen aber nicht locker und kamen immer wieder herein, um nach Amos zu sehen. Schließlich öffneten wir die Klappe, hinter der Amos saß, um den Kontakt mit ihm zu ermöglichen. Amos setzte sich gleich neben die Öffnung, und eine der Schimpansinnen, Daisy, nahm sanft seinen Kopf, um ihn an der weichen Stelle hinter den Ohren zu kraulen. Dann begann sie, große Mengen Holzwolle durch die Klappe zu schieben: Aus diesem Material bauen sich Schimpansen gerne Schlafnester. Kurz darauf beobachteten wir, wie ein anderer Schimpanse es ihr gleichtat. Da Amos mit dem Rücken an die nackte Wand gelehnt dasaß, und keine Anstalten machte, sich ein Nest zu bauen, nahm Daisy die Holzwolle und stopfte sie ihm kurzerhand hinter den Rücken.
Das war bemerkenswert. Deutete Daisys Verhalten nicht darauf hin, dass sie erkannt hatte, wie unbequem Amos’ Sitzposition sein musste, und dass es besser für ihn war, wenn er sich an ein weiches Polster lehnen konnte, genau wie wir Menschen einem Patienten im Krankenbett Kissen in den Rücken stecken? Wahrscheinlich schloss Daisy von sich selbst auf ihren Genossen, denn sie wusste, wie gut es sich anfühlt, ein Polster aus Holzwolle im Rücken zu haben. Daisy ist für ihre Holzwolle-Leidenschaft bekannt, und in der Regel hortet sie das Zeug, anstatt es mit anderen zu teilen. Ich bin davon überzeugt, dass Menschenaffen sich in andere hineinversetzen können, vor allem, wenn es sich um Freunde handelt, die in Schwierigkeiten stecken. Es stimmt, dass diese Fähigkeiten bei Labortests nicht immer bestätigt werden, aber normalerweise wird bei solchen Studien von den Affen verlangt, dass sie sich in Menschen hineinversetzen, noch dazu in einem künstlichen Setting. Das anthropozentrische Bias in unserer Forschung habe ich bereits erwähnt. Wenn Menschenaffen dagegen unter ihresgleichen getestet werden, schneiden sie bedeutend besser ab, und in der freien Wildbahn achten sie darauf, was ihre Artgenossen wissen beziehungsweise nicht wissen.2 Kein Wunder also, dass Daisy die Lage erfasste, in der Amos sich befand.
Am nächsten Tag wurde Amos eingeschläfert. Es bestand keine Aussicht auf Heilung und er hätte nur noch mehr Schmerzen erleiden müssen. Der Vorfall veranschaulicht zwei gegensätzliche Seiten des sozialen Lebens von Primaten. Zum einen leben Primaten in einer unbarmherzigen Welt, in der die Männchen ihre körperlichen Beeinträchtigungen so lange wie möglich verbergen und den harten Kerl mimen müssen. Zum anderen sind sie Teil einer engen Gemeinschaft, in der sie auf Zuneigung und Hilfe von anderen zählen können, auch wenn sie nicht mit ihnen verwandt sind. Solche Widersprüche sind schwer zu verstehen. Viele populärwissenschaftliche Autoren neigen dazu, die Dinge zu vereinfachen, indem sie das Leben der Schimpansen entweder unter Hobbes’schen Gesichtspunkten beschreiben, also im Sinne eines brutalen und grausamen Naturzustandes, oder indem sie die freundliche Seite überbetonen. In Wirklichkeit gibt es kein Entweder-oder: Es ist immer eine Mischung aus beidem. Wenn ich gefragt werde, wie um alles in der Welt ich Schimpansen als »empathisch« bezeichnen kann, wo doch bekannt ist, dass sie in der Lage sind, einander zu töten, antworte ich immer mit einer Gegenfrage: Wenn wir dieselbe Messlatte beim Menschen anlegen würden, müssten wir das Konzept von der menschlichen Empathie dann nicht ebenfalls verwerfen?
Diese Zweischneidigkeit ist der Knackpunkt: Moralität wäre überflüssig, wenn wir alle ausnahmslos nett wären. Worüber sollten wir uns Sorgen machen, wenn wir einander immerzu Sympathie entgegenbrächten und niemals stehlen, niemals anderen in den Rücken fallen und niemals unseres Nächsten Weib begehren würden? So sind wir nun mal nicht, und genau aus diesem Grund brauchen wir moralische Regeln. Auf der anderen Seite könnten wir zigtausend Regeln für den respektvollen Umgang mit unseren Mitmenschen aufstellen, aber sie wären vergebens, wenn wir nicht bereits eine entsprechende Veranlagung hätten. Sie wären wie Saatgut, das auf einer Glasplatte statt auf fruchtbarem Boden ausgesät wird – ohne die geringste Chance, dass es Wurzeln schlägt. Wir sind in der Lage, Richtig und Falsch zu unterscheiden, weil wir sowohl gut als auch schlecht sein können.
Die Unterstützung, die Daisy ihrem sterbenden Artgenossen zukommen ließ, fällt in die Kategorie »Altruismus«: Ein Verhalten, das einen selbst etwas kostet (zum Beispiel ein Risiko eingehen oder Energie aufwenden) und anderen zugutekommt. Die meisten biologischen Diskussionen von Altruismus beschäftigen sich jedoch weniger mit den Beweggründen für altruistische Verhaltensweisen als mit ihren Auswirkungen auf andere, und mit der Frage, warum die Evolution ein solches Verhalten überhaupt hervorgebracht hat. Obgleich diese Diskussion bereits seit mehr als 150Jahren geführt wird, ist sie in den letzten Jahrzehnten in den Mittelpunkt gerückt.
Die genetische Sichtweise
»Ziehen Sie eine der Sauerstoffmasken zu sich heran, streifen Sie sie über Mund und Nase und atmen Sie normal weiter. Erst dann helfen Sie Mitreisenden.« Diesen Sicherheitshinweis hören wir zu Beginn eines jeden Fluges. Altruismus setzt voraus, dass wir uns zuerst um uns selbst kümmern. Genau das hat einer der führenden Theoretiker auf diesem Gebiet tragischerweise versäumt, wie der israelische Historiker Oren Harman in seinem packenden Buch The Price of Altruism beschreibt.3
George Price war ein exzentrischer amerikanischer Chemiker. 1967 zog er nach London, wo er sich der Populationsgenetik zuwandte und versuchte, das Rätsel des Altruismus mithilfe von brillanten mathematischen Formeln zu lösen. Was die Lösung seiner privaten Probleme anging, war er allerdings nicht so erfolgreich. Bis dato hatte er seinen Mitmenschen wenig Respekt entgegengebracht – er verließ seine Frau und seine Töchter und kümmerte sich nicht um seine alte Mutter–, aber nun schwang das Pendel ins andere Extrem. Aus dem eingefleischten Skeptiker und Atheisten wurde ein hingebungsvoller Christ, der sich ganz den städtischen Obdachlosen widmete. Er gab seinen gesamten Besitz auf und vernachlässigte sich selbst. Mit fünfzig war er sehnig und ausgemergelt wie ein alter Mann, mit fauligen Zähnen und einer Reibeisenstimme. 1975 setzte Price seinem Leben mit einer Schere ein Ende.
Einer langen Tradition folgend setzte Price den Altruismus in Beziehung zur Selbstsucht: Je schärfer der Gegensatz, umso mysteriöser erschienen die Ursprünge von Selbstlosigkeit. An rätselhaften Beispielen mangelt es in der Natur freilich nicht. Wenn Honigbienen ihren Stock verteidigen, sterben sie kurz nachdem sie die Eindringlinge gestochen haben. Schimpansen retten einander aus den Klauen von Leoparden. Eichhörnchen stoßen Alarmrufe aus, um ihre Artgenossen vor Gefahren zu warnen. Elefanten versuchen, ihre Kameraden wieder aufzurichten, wenn diese zu schwach sind, um weiterzuwandern. Aber warum sollten Tiere im Interesse der anderen handeln? Widerspricht das nicht den Naturgesetzen?