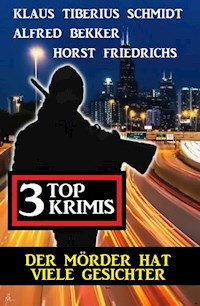
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Krimis: Ein Gesicht, das man nie vergisst (Horst Friedrichs) Die nackte Mörderin (Alfred Bekker) Der Tod liebt blond (Klaus Tiberius Schmidt) Wieder wurde eine junge blonde Frau getötet. Sie ist nun schon das vierte Opfer des Würgers von Manhattan – und die Freundin von Phyllis Snyder. Phyllis wendet sich an den Privatdetektiv Bount Reiniger, denn sie will ihre Freundin gerächt sehen. Was sie noch nicht ahnt, dass der Würger sie ebenfalls im Visier hat. Doch sein erster Versuch schlägt fehl ... Auch die hübsche, blonde June March, die Bount Reiniger bei seinen Ermittlungen unterstützt, gerät in höchste Gefahr, als sie dem Würger gegenübersteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Horst Friedrichs, Alfred Bekker, Klaus Tiberius Schmidt
Inhaltsverzeichnis
Der Mörder hat viele Gesichter: 3 Top Krimis
Copyright
Ein Gesicht, dass man nie vergisst
Die nackte Mörderin
Der Tod liebt blond: N. Y. D. - New York Detectives
Der Mörder hat viele Gesichter: 3 Top Krimis
Alfred Bekker, Horst Friedrichs, Klaus Tiberius Schmidt
Dieser Band enthält folgende Krimis:
Ein Gesicht, das man nie vergisst (Horst Friedrichs)
Die nackte Mörderin (Alfred Bekker)
Der Tod liebt blond (Klaus Tiberius Schmidt)
Wieder wurde eine junge blonde Frau getötet. Sie ist nun schon das vierte Opfer des Würgers von Manhattan – und die Freundin von Phyllis Snyder. Phyllis wendet sich an den Privatdetektiv Bount Reiniger, denn sie will ihre Freundin gerächt sehen. Was sie noch nicht ahnt, dass der Würger sie ebenfalls im Visier hat. Doch sein erster Versuch schlägt fehl ...
Auch die hübsche, blonde June March, die Bount Reiniger bei seinen Ermittlungen unterstützt, gerät in höchste Gefahr, als sie dem Würger gegenübersteht.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER STEVE MAYER
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Trevellian 1241
Ein Gesicht, dass man nie vergisst
Horst Friedrichs
Wie ein zuckender Blitz flammte der Scheinwerfer auf. Grell und unbarmherzig riß der Lichtkegel sie aus der schützenden Dunkelheit.
Josh Whitmore fuhr im Kommandostand der Jacht herum. Geblendet schloß er die Augen, und seine Hände packten das Steuerruder fester. »Milt!« brüllte er gegen die dumpf dröhnenden Maschinen an. »Milt, verdammt nochmal, wo steckst du?« Whitmore wandte sich nach vorn und beugte sich tief über das Ruder, als könnte er der Jacht dadurch zu noch schnellerer Fahrt verhelfen.
Der Lichtkegel blieb. Gnadenlos.
»Milt!« schrie Whitmore erneut: An seinem Hals schwollen die Adern zu Strängen an.
Milton Eidred schob sich grinsend in den Kommandostand. In jeder Hand hielt er eine Maschinenpistole. Eine der beiden Waffen legte er neben Whitmores Füßen auf den Teppichboden.
»Mach dir nicht in die Hosen und bleib auf Kurs, Junge! Denen blasen wir ihr verdammtes Licht mit links aus!« Eidred knallte das Mahagoniholzschott zu und war verschwunden.
»Die Einzelheiten passen«, sagte Captain John Leisenring und reichte mir das Fernglas. »Überzeugen Sie sich selbst, Sir!«
Ich justierte die doppeläugige Optik, bis die Schärfe stimmte. Breitbeinig verschaffte ich mir Standfestigkeit. Es erforderte einiges Geschick, die Bewegungen des Schnellboots auszugleichen, das bei Windstärke 5 durch den Seegang pflügte.
Der Scheinwerfer erleichterte es, unser Zielobjekt zu orten.
Eine hochseetüchtige Motorjacht von stolzen 42 Fuß Länge. Heimathafen New Orleans, Louisiana. Und den Namenszug am Bug entzifferte ich mühelos als Bayou Belle.
Ich gab das Fernglas an meinen Freund und Kollegen weiter, der neben mir auf der Brücke des Coast-Guard-Schnellboots Potomac stand. Worte waren überflüssig. Wir kannten die Hinweise auswendig, die uns über Fernschreiber aus New Orleans erreicht hatten. Die V-Leute unserer Kollegen im heißen Süden hatten gute Arbeit geleistet.
Lieutenant Dennis Hope, zweiter Mann an Bord des Schnellboots, ließ Gischt und Fahrtwind hereinwehen, als er auf die Brücke stürmte. Das Schott flog von selbst zu. Hope lockerte den Kinnriemen seiner Dienstmütze.
»Nichts«, sagte er. »Der Bursche reagiert auf keinen Funkruf.«
Milo Tucker ließ das Fernglas sinken.
»Sieht nach schlechtem Gewissen aus.«
»Nicht nur das!« rief Captain Leisenring, der vor fünf Minuten das Ruder übernommen hatte. »Jetzt zeigt er es auch noch.«
Wir spähten nach vorn. Der elegant geschwungene Bug der Potomac hob und senkte sich im Wellengang. Die Bugsee ließ Schwaden weißer Gischt emporsteigen, die wie Nebel durch das Scheinwerferlicht waberten. Der Lichtkegel, den ein Sergeant von der Brücke aus steuerte, folgte der Luxusjacht hartnäckig. In der Tat drehte die Bayou Belle jetzt nach Steuerbord ab und ging auf neuen Kurs. Unser Scheinwerferlicht klebte an ihren schnittigen Aufbauten. Die Chromstreben der Reling funkelten.
»Ein Traumtänzer«, sagte Captain Leisenring, und der Anflug eines Lächelns kerbte sich in seine Mundwinkel. »Entweder ist er blind, oder er will nicht wahrhaben, wer ihm im Nacken sitzt.«
Ich wußte, daß Leisenring darauf brannte, uns seine Fähigkeiten am Steuerruder vorzuführen. Coast-Guard-Beamte sind einsame Leute, wenn sie ihren Patrouillendienst vor der Küste schieben. Selten genug passiert es ihnen, daß sie Besuch an Bord haben. Und Milo und ich waren als FBI-Beamte besonders willkommen, hautnah mitzuerleben, wie gut ein Coast Guard Captain seinen Job beherrschte.
Der Mann im Kommandostand der Jacht mußte von Illusionen beflügelt sein. Mit zwei 300-PS-Maschinen war sein Schiff zwar Spitze in seiner Klasse.
Verschwindend wenig jedoch gegen das, was wir unter den Füßen hatten.
Captain Leisenring ließ das Ruder mit Fingerspitzengefühl wirbeln. Dann schob er die beiden Regler langsam nach vorn. Der Bug des Schnellboots schwenkte nach Backbord, und im Maschinenraum erwachten zweimal 1000 PS mit Rumoren.
Wir mußten uns festhalten. Ein Gefühl, das an die Beschleunigungskraft meines Jaguars erinnerte. Nur fehlten die Sitzlehnen, die einem Halt boten. Der schlanke Rumpf der Potomac hob sich und nahm uns für eine Weile die Sicht auf die Jacht. Die entfesselte Maschinengewalt ließ den Boden unter unseren Füßen vibrieren.
Der Captain legte das Boot in einen weitgeschwungenen Bogen, und unsere Sicht war endgültig dahin. An Steuerbord der schwarze Samt des Nachthimmels mit seinen Sternen, die wie Diamanten funkelten. An Backbord die aufgewühlten Wogen des Atlantik, schätzungsweise vier Seemeilen westlich von New Dorp Beach, Staten Island. Erst als Leisenring wieder auf Geradeauskurs ging, sahen wir die Bayou Belle wieder.
Die Entfernung war in Sekundenschnelle zusammengeschmolzen. Wir befanden uns unmittelbar achteraus. Die Motorjacht kroch mit einem Abstand von etwa 100 Yard steuerbords wie eine schwerfällige Seekuh dahin. Augenblicke später waren wir auf gleicher Höhe.
Lieutenant Hope hatte bereits seine Befehle gegeben. Ein Mann in gelber Wetterjacke erschien in unserem Blickfeld auf dem Vordeck und machte den Signalscheinwerfer einsatzbereit. Captain Leisenring zog die Regler zurück. Die Potomac blieb jetzt wie ein zu groß geratener Bruder gleichauf mit der Bayou Belle. Auf dem Vordeck glühten die Signale, die den Mann am Steuerruder der Jacht zum Stoppen auf forderten. Und immer noch haftete das grelle Licht des Suchscheinwerfers auf den beigefarben lackierten Aufbauten der Bayou Belle.
Wieder nichts.
Die Jacht stampfte durch den Wellengang, als seien wir Luft.
Leisenring und Hope sahen mich fragend an.
Ich nickte.
Lieutenant Hope griff nach dem Bordfunkmikro und gab einen knappen Befehl. Der Signalgast, der die Kopfhörer unter der Kapuze seiner Wetterjacke trug, gab seine Tätigkeit auf und hob den rechten Arm zum Zeichen, daß er verstanden hatte. Mit wenigen Schritten war er bei dem Geschütz, das weiter vorn auf einer erhöhten Drehlafette montiert war. Eine Schnellfeuerkanone, Kaliber 20 Millimeter.
Wir beobachteten den Beamten und ließen auch die Jacht nicht aus den Augen. Drüben rührte sich noch immer nichts. Nur die Gestalt des Mannes im Kommandostand war als Schatten zu erkennen.
Captain Leisenring erhöhte die Maschinendrehzahl geringfügig. Mit spielerischer Leichtigkeit glitt die Potomac weiter voraus, bis wir mittschiffs etwa auf gleicher Höhe mit der Jacht waren.
Der Coast-Guard-Beamte hatte das Buggeschütz klariert.
»Schuß vor den Bug«, sagte Lieutenant Hope in das Bordfunkmikro. »Feuer frei!«
Der Beamte duckte sich hinter das Geschütz, schwenkte es auf der Lafette und visierte an.
Eine bläulichweiße Flamme stach meterlang aus der Mündung der Kanone. Erst im nächsten Sekundenbruchteil hörten wir das dumpfe Wummern.
Vor dem Bug der Bayou Belle riß das Sprenggeschoß eine Fontäne aus dem Wasser.
Dann beging der Beamte einen verhängnisvollen Fehler.
Der Nachhall des Schusses war noch nicht verklungen, als wir auf dem Vorschiff der Jacht eine plötzliche Bewegung erkannten.
»Deckung!« brüllte Lieutenant Hope in das Bordfunkmikro.
Im selben Moment ließ Captain Leisenring das Steuerruder rotieren. Die Potomac schwenkte nach Backbord weg.
Nicht schnell genug.
Der Beamte am Buggeschütz ließ sich fallen.
Bevor er das Deck erreichte, zuckten Mündungsblitze auf dem Vorschiff der Jacht auf. Mindestens eine der Kugeln traf den Beamten, und ich sah, wie sein Körper unter der Wucht des Einschusses herumgerissen wurde.
»Den Scheinwerfer weg!« befahl Lieutenant Hope mit vibrierender Stimme. Der Sergeant reagierte sofort, und der Lichtkegel schwenkte von der Bayou Belle in die entgegengesetzte Richtung.
Keine Sekunde zu spät! Denn abermals sahen wir drüben Mündungsblitze. Die Geschosse, die mit hellem Klang von den stählernen Decksaufbauten der Potomac abprallten, jagten uns einen Schauer über den Rücken. Aber der Scheinwerfer wurde nicht getroffen. Leisenring konzentrierte sich darauf, das Schnellboot weiter auf Distanz zu bringen.
Ich packte meine Thompson Submachine Gun und war mit einem Satz beim Schott. Milo schnappte sich ebenfalls seine Thompson und folgte mir. Durch Handzeichen verständigten wir uns mit dem Captain und dem Lieutenant. Worte brauchten wir nicht zu verlieren. Jeder von uns wußte, was jetzt zu tun war.
Draußen empfingen mich Wind und Feuchtigkeit. Die Kunststoff haut der Regenjacke wurde gegen meinen Oberkörper gepreßt. Gischt schlug mir mit einem Prickeln von tausend feinen Nadeln ins Gesicht. Auf meinem Weg zum Vordeck hielt ich mich an der hüfthohen Reling fest. Captain Leisenring hatte die Fahrt erhöht. Mit einem Blick überzeugte ich mich, daß wir uns in spitzem Winkel nach Backbord Von der Bayou Belle entfernten. Vereinzelt spülte Wasser schäumend über das Vordeck, wenn sich der Bug unseres Bootes senkte und in eine höhere Welle tauchte.
Der Verletzte mußte geborgen werden. Schnellstens.
Milo folgte mir dichtauf. Dann verließ auch Lieutenant Hope die Kommandobrücke. Er trug eine Taurolle, die er langsam abwickelte. Das Ende war irgendwo bei der Brücke festgezurrt.
Als ich den regungslosen Körper des Beamten erreichte, drohte von der Jacht keine Gefahr mehr. Wir waren längst außer Schußweite, und der Captain würde jetzt die überlegene Stärke dieses Schnellboots voll ausspielen.
Ich hatte richtig vermutet. Der Coast-Guard-Beamte war nicht lebensgefährlich verletzt. Die Kugel hatte ihn in den rechten Oberschenkel getroffen. Beim Fallen war er mit dem Kopf auf das stählerne Deck geschlagen und hatte das Bewußtsein verloren.
Ich hängte mir die Thompson auf den Rücken und schloß den Karabinerhaken des Lederriemens Milo tat es mir nach.
Dann hoben wir den Bewußtlosen vorsichtig an und trugen ihn Lieutenant Hope entgegen. Es waren nur wenige Schritte. Weitere Mitglieder der Crew hatten die Kajüte verlassen und packten mit an. Hope schlang dem Verletzten das Tau um den Oberkörper und sicherte es mit einem Spezialknoten, den er trotz des Seegangs geschickt zustandebrachte. Für die letzten Meter bis zur Kajüte drohte dem Verletzten keine Gefahr mehr.
Milo und ich kehrten zum Buggeschütz zurück. Mit der Funktion des Schnellfeuergeschützes war ich vertraut. Wenige Handgriffe genügten mir, um es wieder klar für den Einsatz zu machen. Milo ging hinter der Verschanzung an der Steuerbordreling in Deckung. Ich gab ein Handzeichen in die Richtung, in der ich den Captain hinter dem Sicherheitsglas der Kommandobrücke wußte.
Leisenring hatte das Schnellboot abfallen lassen, war vorübergehend auf Gegenkurs gegangen und änderte jetzt erneut den Kurs in einem weitgeschwungenen Bogen. Mit dröhnenden Maschinen schob sich die Potomac von Backbord achteraus auf die Bayou Belle zu. Die Entfernung betrug noch eine gute Dreiviertelmeile, und unserem Suchscheinwerfer drohte keine Gefahr. Denn auf diese Entfernung hatte der Bursche mit seiner Maschinenpistole drüben keine Aussicht auf Erfolg.
Unaufhaltsam schmolz die Entfernung zusammen.
Ich wechselte einen Blick mit Milo. Meinen Freund und Kollegen bewegten die gleichen Gedanken. Die Männer auf der Jacht hatten panikartig reagiert, weil ihre Organisation bislang ungeschoren geblieben war. Zum ersten Mal war es uns gelungen, eins ihrer Schiffe ausfindig zu machen und aufzubringen. Das aber auch nur, weil die Kollegen in New Orleans erstklassige Kleinarbeit geleistet hatten. Wir verfügten über alle erforderlichen Informationen, was die Bayou Belle betraf, einschließlich der voraussichtlichen Positionsangaben, die uns schließlich auf die richtige Spur geführt hatten.
Während sich unser Schnellboot immer näher heranschob, erspähte ich eine Bewegung auf dem Achterdeck der Jacht. Nur für einen Moment! Dann rührte sich nichts mehr. Man bereitete sich auf unseren Empfang vor. Ich verständigte Milo mit einem Ruf. Er nickte, löste den Karabinerhaken und zog die Thompson von der Schulter.
Wir mußten diese Jacht haben, die niemals zuvor den Namen Bayou Belle getragen hatte und jetzt mit gefälschten Registerpapieren und einer neuen Lackierung durch den Atlantik pflügte. Hinweise auf die Organisation, die dahintersteckte, besaßen wir seit langem. Ein Geschäft mit Millionenumsätzen!
Im Süden der Vereinigten Staaten und in Mittelamerika häuften sich die Fälle von Schiffsdiebstählen. Ausnahmslos hochseetüchtige Motorjachten, die zur Luxusklasse gehörten. In versteckten Bootsschuppen wurden diese Schiffe umfrisiert, in den Norden der Staaten oder sogar nach Kanada überführt und dann an außeramerikanische Abnehmer weiterverkauft.
In allen bisherigen Fällen, so vermuteten wir, waren die Jachten im Huckepack-Verkehr auf Überseefrachtern über den Atlantik oder den Pazifik gereist, um ihre Bestimmungshäfen in den entlegensten Winkeln der Weltmeere zu erreichen. Innerhalb der Drei-Meilen-Zone hatten wir diesem Treiben mittlerweile einen Riegel vorgeschoben. Alle Verschiffungen wurden von den Hafenbehörden und Zollämtern sorgfältig unter die Lupe genommen. Nur die Möglichkeit, daß sich die Hochseejachten'mit eigener Kraft aus der Drei-Meilen-Zone entfernten, hatten wir bislang noch nicht ausschließen können.
Die Entfernung war auf knapp 500 Meter zusammengeschmolzen.
Ich klemmte mich hinter das Geschütz und gab dem Captain ein Handzeichen. Sofort verringerte er die Fahrt.
Ich visierte an.
Nur kurz betätigte ich die Abzugsvorrichtung. Die Schnellfeuerkanone wummerte zweimal hintereinander. Beide Schüsse lagen knapp hinter dem Heck der Motorjacht. Die hellen Fontänen, von den Sprenggeschossen emporgerissen, zeigten es mir deutlich. Ich hob den Geschützlauf geringfügig und wartete, um die Auf- und Ab-Bewegungen des Schnellboots auszugleichen.
Drüben tat sich nichts. Der Mann mit der Maschinenpistole kauerte offenbar noch auf dem Achterdeck, in Deckung hinter den Sitzbänken. Die Verschanzung zwischen den Chromstreben der Reling bestand aus lackierten Spanplatten. Kein wirkungsvoller Schutz, wenn es darauf ankam.
Der rundumverglaste Kommandostand war im oberen Teil mit einer Persenning abgedeckt. Eine Schiffskonstruktion für die Schönwetterzonen des Erdballs.
Wir hatten uns auf etwa 450 Meter herangeschoben. Ich korrigierte die Visierung ein letztes Mal. Dann feuerte ich erneut.
Der erste Einschuß lag im Achtersteven. Im Scheinwerferlicht sah ich das faustgroße Loch, das das Sprenggeschoß ins Stahlblech riß. Der Moment war günstig. Die Potomac stabilisierte sich für Sekunden in einem ausgedehnten Wellental. Ich blieb in der Visierlinie, ließ die Schnellfeuerkanone hämmern und rucken. In rascher Folge stießen die Mündungsflammen aus dem Lauf. Dann hielt ich inne.
Vier oder fünf Einschußlöcher verunzierten den ehedem glatten Achtersteven der Bayou Belle. Alle lagen knapp über der Wasserlinie. Dort, wo ich sie haben wollte. Und der Erfolg blieb nicht aus.
Die Hecksee der Jacht verlor ihre Ebenmäßigkeit. Der Strom der weißschäumenden Gischt versiegte, erhob sich nur kurz wieder und endete dann vollends. Deutlich hörten wir das Spucken und Stottern, mit dem die beiden 300-PS-Maschinen ihren Geist aufgaben. Ich hatte die lebenswichtigen Teile getroffen. Ein geringer Schaden, verglichen mit den Unsummen, die die Versicherungsgesellschaften für die gestohlenen Jachten zu zahlen hatten.
Ich sicherte das Buggeschütz und gab Captain Leisenring ein erneutes Zeichen. Alles Weitere war ebenfalls abgesprochen. Offenbar bestand die Crew der Bayou Belle nur aus zwei, höchstens drei Mann. Soviel wußten wir jetzt, und damit war der letzte Unsicherheitsfaktor vergessen.
Die Potomac nahm höhere Fahrt auf. Sie näherte sich der manövrierunfähigen Jacht jetzt unaufhaltsam, wie von einem unsichtbaren Faden gezogen.
Ich ging hinter der Verschanzung in Deckung, nur zwei Schritte von Milo entfernt. Mit wenigen Handgriffen hatte ich die Thompson schußbereit und entsichert. Aus den Augenwinkeln heraus sah ich Lieutenant Hope, der die Kajüte verlassen hatte und geduckt in unsere Richtung zum Vordeck hastete. Er war mit einer Maschinenpistole oder einem Schnellfeuergewehr bewaffnet.
Nur noch 200 Meter! Und mit jeder Sekunde verringerte sich die Entfernung.
»Achtung!« brüllte Milo ung zog den Kopf ein. Er hatte das Achterdeck der Bayou Belle keinen Atemzug lang aus den Augen gelassen.
Lieutenant Hope warf sich lang hin, noch bevor er bei uns war.
Auch der Sergeant auf der Brücke hatte genug beobachtet. Der Lich'tkegel des Scheinwerfers schwenkte ruckartig von der Jacht weg.
Das trockene Hämmern einer Maschinenpistole übertönte den Maschinenlärm unseres Schnellboots. Die Schüsse lagen hoch. Keine Querschläger, die von der Bordwand abgeprallt waren!
Ich zählte die Sekunden, kam blitzschnell hoch und stieß die Thompson über die Verschanzung hinweg. Rechtzeitig, um den letzten Mündungsblitz versiegen zu sehen. Anvisieren und durchziehen waren eine fließende Bewegung. Die Thompson rüttelte an meiner Schulter.
Lieutenant Hope nutzte die Gelegenheit, um endgültig hinter der Verschanzung in Stellung zu gehen, links von Milo.
Ich ließ die Thompson sinken.
Sofort reagierte Milo, federte hoch und jagte einen Feuerstoß zum Achterdeck hinüber, um den Mann in Deckung zu halten.
Der Lichtfinger unseres Scheinwerfers ragte wie ein geisterhafter Strahl auf die nachtdunkle See hinaus. Wir waren das bessere Ziel.
Und wir bekamen es zu spüren, noch bevor ich den Gedanken zu Ende gebracht hatte.
Mündungsblitze zuckten jäh aus dem Kommandostand der Jacht auf. Wir zogen die Köpfe ein. Keinen Atemzug zu spät.
Bedrohlich nahe sirrte der Geschoßhagel über uns hinweg. Eine der Kugeln knallte mit hartem, durchdringendem Schlag gegen die Verschanzung.
Nur noch 100 Meter waren wir jetzt von der Jacht entfernt. Captain Leisenring drosselte die Maschine. Der Sergeant auf der Brücke reagierte prächtig. In dem Moment, als der Feuerstoß von der Bayou Belle verstummte, schwenkte er den Scheinwerfer herum.
Wir hatten sie wie auf dem Präsentierteller.
Gleichzeitig schnellten wir hoch und hielten die Thompsons aus der Bewegung heraus im Anschlag.
Drüben reagierten sie panikartig. Beide feuerten gleichzeitig. Der eine vom Achterdeck, der andere aus dem Kommandostand. Unsere MPi spuckten Blei. Die Kugeln von der anderen Seite flogen uns um die Ohren. Lieutenant Hope wurde plötzlich herumgerissen, verlor die Waffe aus den Händen und griff sich an die Schulter. Der Länge nach schlug er hin.
Mit Todesverachtung jagte ich zwei weitere Feuerstöße hinüber, als Milo in Deckung ging. Bemühte mich, genau genug zu zielen. Unsere Absicht war es nicht, ein Gemetzel zu veranstalten.
Noch immer funktionierte der Scheinwerfer. Die Schüsse von der Jacht waren zu ungenau.
Ein Schrei gellte.
Das MPi-Feuer von drüben geriet ins Stocken. Dann endete es.
Ich ließ mich hinter die Verschanzung fallen. Wieder schwenkte der Lichtkegel von der Jacht weg. Noch hatten'wir keine Zeit, uns um den Lieutnant zu kümmern.
Ein lautes Knacken ertönte. Dann die dröhnende Lautsprecherstimme von Captain Leisenring. Die Potomac machte inzwischen kaum noch Fahrt, und die »Bayou Belle« lag wie ein plumper Klotz im Wellengang.
»Hier spricht die Coast Guard! Stellen Sie das Feuer ein, und geben Sie auf! Dies ist unsere letzte Warnung! Wir richten jetzt unseren Scheinwerfer wieder auf Sie! Verlassen Sie Ihre Deckung, und heben Sie die Hände, daß wir es sehen können!«
Sekundenlange Stille, bis auf das dumpfe Brummen der Maschinen. Dann glitt der Lichtkegel von der See herüber und erfaßte die hellen Aufbauten der Jacht.
Vorsichtig richteten Milo und ich uns auf. Ich sah den reglosen Körper eines Mannes, der halb aus dem offenen Schott des Kommandostands hing.
Der andere dachte nicht daran, sich an die Lautsprecher-Anweisung zu halten.
Jäh tauchte er hinter der Sitzbank auf dem Achterdeck auf. Die Maschinenpistole flog an seine Schulter.
Milo und ich waren schneller. Unsere Thompsons hämmerten nur kurz.
Der Mann wurde zurückgeschleudert. Seine MPi begann noch zu rattern. Doch die Geschosse fauchten in den Nachthimmel empor. Dann war Ruhe. Beklemmend.
Während wir unsere Waffen schußbereit hielten, erhöhte der Captain die Drehzahl der Maschinen kaum merklich. Das Schnellboot schob sich näher an die Jacht heran. Aus der Kajüte tauchten zwei Mitglieder der Potomac-Crew auf und liefen geduckt zu Lieutenant Hope. Noch war Vorsicht geboten. Mit einer Überraschung mußten wir nach wie vor rechnen. Ich wandte den Kopf nur kurz zur Seite und sah, daß Hope sich bewegte. Es konnte ihn nicht allzu schlimm erwischt haben. Einer der beiden Männer nahm seine Waffe auf. Dann stützten sie ihn auf dem Weg zurück zur Kajüte.
Unterdessen bewies Captain Leisenring abermals, mit welchem Fingerspitzengefühl es sein Schnellboot beherrschte. Behutsam bugsierte er es an die havarierte Jacht heran. Er schaffte es, bis auf einen Meter Abstand längsseits zu gehen. Kalkig weiß erhellte das Scheinwerferlicht jetzt die Aufbauten der Bayou Belle.
Ich öffnete die Pforte in der Steuerbordverschanzung und klemmte sie fest. Näher konnten wir nicht heran. Die beiden Schiffe tanzten nebeneinander im Gegentakt auf und ab. Das Achterdeck der Jacht war etwa vier Fuß tiefer. Normalerweise! Durch die Gegenbewegung erhöhte sich dieser Unterschied jedoch bis auf das Doppelte.
Die Maschinenpistole brauchte ich nicht mehr. Während Milo seine Waffe weiter auf das Achterdeck der Bayou Belle gerichtet hielt, sicherte ich meine Thompson upd band sie mit dem Lederriemen an der Reling fest. Statt dessen zog ich den 357er Smith & Wesson.
Die beiden Männer auf der Jacht rührten sich auch jetzt nicht. Daß sie Komplizen hatten, die unter Deck lauerten, war unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Ich wartete einen günstigen Moment ab, spannte die Muskeln und schnellte mit einem Satz hinüber. Federnd landete ich auf der angerauhten Fiberglasfläche des Achterdecks. Ich konnte nicht verhindern, daß ich zu Boden ging. Doch ich war sofort wieder auf den Beinen und hielt den Revolver im Anschlag.
Keine Gefahr…
Dem Mann, der vor der Sitzbank lag, stieß ich die Maschinenpistole mit dem Fuß weg. Er bewegte sich nicht. Er hatte das Bewußtsein verloren. Die zweite MPi lag bereits auf dem Deck, unerreichbar für den, der kopfüber aus dem Schott des Kommandostands heraushing.
Ich gab Milo ein Zeichen. Mein Freund ließ seine Thompson ebenfalls zurück, folgte meinem Beispiel und stand Sekunden später neben mir auf dem Achterdeck der Bayou Belle. Das Schnellboot der Coast Guard ging sofort auf sicheren Abstand. Captain Leisenring wollte einen unnötigen Zusammenstoß der beiden Schiffe vermeiden.
Ich verlor keine Zeit, sondern sah mich in der geräumigen Kajüte der Motorjacht um. Alles roch nach Luxus. Teppichboden, Postermöbel, Mahagonitische, Küche, Dusche und sanitäre Einrichtungen. Wahrscheinlich hatten sie es gründlich renoviert, denn die gesamte Inneneinrichtung sah nagelneu aus.
Aber es gab keine Menschenseele mehr, die uns gefährlich werden konnte. Ich kehrte auf das Achterdeck zurück.
Milo hatte seinen Smith & Wesson gehalftert. Die beiden Magazine aus den Maschinenpistolen staken in der Außentasche seiner Regenjacke.
»Für ihn gibt es keine Rettung mehr.« Mein Freund zog die Schultern hoch und deutete mit einer matten Kopfbewegung auf den Mann im Kommandostand. »Der andere hat einen Schulterdurchschuß. Ohne Bewußtsein.«
Wahrscheinlich hatte Captain Leisenring bereits einen Hubschrauber angefordert. Auch die beiden Beamten von der Potomac mußten schnellstens ins Hospital.
Milo reichte mir einen Stapel Papiere. »Sie hatten ihre Pässe und die Schiffsdokumente bei sich. Sieht so aus,als ob die Pässe echt sind.«
»Natürlich«, nickte ich. »Für die Abwicklung bei den Hafenbehörden wollten sie kein Risiko eingehen. Außerdem gehören sie nur zum Fußvolk. Notfalls hätten sie die Ahnungslosen gemimt.«
Ich blätterte die Papiere durch. Der Tote hieß Josh Whitmore, sein verwundeter Komplize Milton Eidred. Beide stammten aus New York. Nach den Schiffspapieren gehörte die Jacht einem gewissen Henry Jeffries aus New Orleans. Die Überprüfung würde ergeben, daß es diesen Jeffries überhaupt nicht gab. Soviel stand jetzt schon fest.
Ich stieg in den Kommandostand hinauf und schaltete die elektrische Anlage der Jacht aus. Gemeinsam mit Milo holte ich die vorhandenen Taue aus dem Bugraum. Dann gaben wir Captain Leisenring das Zeichen, und er bugsierte die Potomac mit ihrem flachen Heck heran. Wir warfen die Enden der beiden Schlepptaue hinüber. Männer der Crew fingen sie auf.
Für die Dauer der weiteren Fahrt mit Kurs auf New York City blieben Milo und ich an Bord der Bayou Belle. In Höhe von Graham Beach, Staten Island, erreichte uns der Hubschrauber der Coast Guard. Mit Hilfe einer Seilwinde wurden die Verwundeten und der Tote in die Maschine gehievt. Milo und ich wechselten uns am Steuerruder der Jacht ab.
Als das Häusermeer von Brooklyn und die Verrazano Narrows Bridge in Sicht kamen, lag über dem Horizont bereits der helle Streifen des beginnenden Morgengrauens.
***
David Pearl blickte vom Schreibtisch auf, als seine Sekretärin eintrat. Ein Lächeln entspannte seine jungenhaften Gesichtszüge. Diana Dyer gehörte zu den erfreulichen Seiten, die seine Stellung bei der Chase Manhatten Bank, Filiale Canal Street, Manhattan, zu bieten hatte.
Sie trug ein kleines Tablett mit Kaffeetasse, Zucker und Milch herein und schob es auf die blankpolierte Schreibtischplatte, wo zwischen Papierbergen noch ein freier Platz war.
»Guten Morgen, David. Sie müssen wohl aus dem Bett gefallen sein. Seit wann sind Sie schon im Büro?«
Er lehnte sich zurück, lachte leise und drückte die Fingerspitzen gegeneinander.
»Guten Morgen, Diana. Tut mir leid, aber ich hätte Ihnen gestern abend noch Bescheid sagen sollen. Ich hocke seit zwei Stunden hier. Wegen dieser Besprechung heute nachmittag hatte ich einfach keine Ruhe.«
Er sah sie an. Diana war schlank und dunkelhaarig, eine Schönheit. Ihr eleganter Hosenanzug hatte nichts Herausforderndes, ließ aber andererseits erkennen, daß sie ihr Äußeres nicht zu verstecken brauchte. Ihrem Teint nach gab es südländische Einflüsse in ihrer Vorfahrenreihe, vielleicht Portorikaner, Mexikaner oder Hawaiianer. Er hatte sie noch nicht danach gefragt. Sie kannten sich nur wenige Tage.
»So war es nicht gemeint, David.« Sie schüttelte den Kopf, und das Sonnenlicht, das durch die halboffenen Jalousien hereinfiel, verursachte einen seidigen Schimmer auf ihrem Haar. »Wenn wir im selben Haus wohnen, bedeutet das ja noch lange nicht, daß Sie sich irgendwie verpflichtet fühlen müssen. So etwas kann auch zu einer Belastung werden. Halten Sie mich nur nicht für aufdringlich!«
»Unsinn, Diana.« Er lachte erneut, und in seinen blauen Augen entstand ein amüsiertes Blitzen. »Ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Wenn man sich den ganzen Tag aus beruflichen Gründen sieht, möchte man vor und nach der Arbeitszeit gern andere Gesichter um sich haben.«
»Das ist ganz normal, David. Außerdem sind Sie mein Vorgesetzter. Ich erwarte nicht, daß Sie jeden Morgen mit mir gemeinsam ins Büro gehen.«
Er strich sich mit der Hand über das blonde Haar. Trotz seiner Jahre im Bankfach erinnerte er noch immer ein wenig an den Collegeboy, der seine Freizeit als Champion der Baseballmannschaft verbringt.
»Denken Sie nichts Falsches, Diana. Ich bin froh, daß ich an meinen ersten Tagen in New York nicht mutterseelenallein sein muß. Etwas anderes… gehen Sie heute abend mit mir essen?«
»Sie stehen doch nicht in meiner Schuld.«
»Himmel noch mal!« lachte er. »Sie machen Dinge verzwickt, die ganz einfach sind. Nehmen Sie die Einladung an? Sagen Sie ja oder nein!«
Diana zögerte nicht lange.
»Ja, David.«
Er blickte ihr nach. Dann wandte er sich wieder den Computerausdrucken zu, die er auszuwerten hatte. Die Nachmittagsbesprechung betraf sein Ressort, die Privatdarlehen. Die Bankzentrale hatte neue Richtlinien herausgegeben. Zinsanpassung, geänderte Laufzeiten für künftige Kredite und so weiter. Den Kunden durfte man solche Dinge nicht wie mit einem Hammerschlag präsentieren.
David nippte an seiner Kaffeetasse, als der Hausapparat summte. Er stellte die Tasse zurück und nahm den Hörer ab. »Pearl.«
»Magrath hier. David, wenn Sie Zeit haben, auf einen Sprung herüberzukommen…«
»Selbstverständlich, Sir.«
»In Ordnung. Dann bis gleich.«
David leerte seine Tasse, ordnete die Unterlagen und durchquerte das Büro nebenan, in dem Diana Dyer und der jüngere Kollege Frank Reynolds ihren gemeinsamen Arbeitsplatz hatten. Frank, hochaufgeschossen und sommersprossig, packte Thermosflasche, Sandwichpaket und Morgenzeitung in eine der unteren Schreibtischschubladen und nickte David höflich zu. »Guten Morgen, Sir.«
David erwiderte seinen Gruß mit einem betont mißbilligenden Blick. Er schätzte es nicht, den Vorgesetzten herauszukehren. Dazu, so fand er, fehlten ihm die grauen Schläfen. Reynolds war zwei Jahre jünger als er, und Zusammenarbeiten ließ es sich nach Davids Empfinden besser, wenn man auf Kollegialität baute.
»Sorry… David«, sagte Reynolds.
»Ich bin beim Chef« erklärte David Pearl, und sein Blick traf sich sekundenlang mit den dunklen Augen Dianas.
John B. Magrath hatte ein Büro, dessen Fenster mit dreifachen Lärmschutzscheiben ausgestattet und überdies dunkel getönt waren. Der Ausblick auf den Verkehrstrubel der Canal Street hatte deshalb etwas Unwirkliches. Autos glitten nahezu geräuschlos vorüber, und die Passanten, die sich unterhielten, sahen aus wie Mitwirkende eines Stummfilms.
»Setzen Sie sich, David!« sagte Magrath väterlich, deutete auf die schwarzen Besuchersessel und stand hinter seinem Schreibtisch auf. Er nahm seinem jungen Mitarbeiter gegenüber Platz. Magrath war mittelgroß, leicht untersetzt, hatte spärliches silbergraues Haar und ein gutmütiges rundes Gesicht.
»Ich bin in den Vorbereitungen für die Besprechung, Sir. Handelt es sich darum?«
»Nur zum Teil, mein Junge.« Magrath öffnete die silberne Schachtel au dem Tisch und schob sie hinüber.
»Nein danke, Sir, ich rauche nicht.«
»Ach, richtig. Unten in Montgomery waren Sie aktiver Sportler. Gordon Burns hat es mir erzählt. Ein guter Ausgleich übrigens, wenn man einen Schreibtisch-Job hat. Schon igendwelche sportlichen Pläne für New York?« John B. Magrath nahm ein Zigarillo aus der Schachtel, klappte sie zu, und David Pearl ließ das Tischfeuerzeug für ihn aufflammen.
»Nein, Sir. Ich will mich erst ein bißchen umsehen.«
»Danke, David.« Magrath blies eine Serie von Rauchwolken zur Decke. »Sie haben recht. Sicher ist es nicht gut, gleich dem erstbesten Club beizutreten. Aber kommen wir zur Sache: Sie werden heute nachmittag ein paar von den wichtigeren Leuten aus der Zentrale treffen. Das ist natürlich eine reine Routineangelegenheit. Vielleicht haben Sie aber trotzdem das Gefühl, daß man ein besonderes Auge auf Sie wirft, weil Sie zum ersten Mal dabei sind. Ich will Ihnen nur eines sagen, David: Lassen Sie sich von so einem Gefühl nicht aus der Fassung bringen!«
»Ich verstehe nicht ganz, Sir. Sicher bin ich ein bißchen nervös. Aber den Kopf wird mir wohl niemand abreißen.«
John B. Magrath nickte lächelnd. »So habe ich Sie eingeschätzt, David. Bewahren Sie Ihre Selbstsicherheit, und Sie werden Ihren Weg machen.«
David Pearl beugte sich stirnrunzelnd vor.
»Das hört sich an, als ob es Probleme gibt, Sir.«
»Keine Probleme, Junge.« Magrath schüttelte energisch den Kopf. »Nur ein paar Hinweise, an die Sie denken sollen. Sie sind jetzt fünf Tage in New York, und Sie sind einer der jüngsten Abteilungsleiter der Chase Manhattan Bank. Grund genug, eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen.«
»Ich weiß all das zu würdigen, Sir.«
»Sicher. Aber darum geht es nicht, David. Mit Ihren 25 Jahren haben Sie längst noch nicht alles gelernt. Sie werden die Erfahrung machen, daß es Neider gibt. Immer und überall. Man wird versuchen, Ihnen Steine in den Weg zu werfen und Ihnen Schwierigkeiten zu bereiten. Sie sollen eines wissen. Junge: Ich bin für Sie da, wenn es keinen gibt, an den Sie sich sonst wenden können. Und ich würde mich freuen, wenn Sie hin und wieder auch zu mir kommen, bevor Sie mit einem anderen gesprochen haben.«
David spürte, wie ein glühendes Gefühl der Dankbarkeit in ihm aufstieg. Und er spürte, daß er rot wurde.
»Danke, Sir«, sagte er heiser.
John B. Magrath winkte ab. »Ich habe Sie nach New York geholt, David, und ich fühle mich ein bißchen für Sie verantwortlich. Sie wissen, daß Gordon Burns ein alter Freund von mir ist. Ich kenne ihn gut, und ich weiß, daß er ein erstklassiger Lehrmeister für Sie war. Außerdem hat die Commercial Bank in Montgomery einen guten Namen in der Branche. Als ihr Direktor ist Gordon nicht irgend jemand. Ich konnte also mit ruhigem Gewissen zustimmen, als er Sie mir empfohlen hat.«
David senkte verlegen den Kopf.
»Ich werde versuchen, Sie nicht zu enttäuschen, Sir.«
»Das weiß ich, mein Junge. Darum geht es im Moment nicht. Erstens sollen Sie wissen, daß Sie Ihren Posten nicht irgendwelchen guten Beziehungen, sondern Ihren Leistungen zu verdanken haben. Sie brauchen sich also vor niemandem zu ducken. Zweitens gehört die Canal-Street-Filiale nicht zu den bedeutenden der Chase Manhattan Bank. Es ist nur ein Sprungbrett für Sie, David. Wenn es Ihnen in New York und in unserem Unternehmen gefällt, dann nutzen Sie die Chance, Ihren Weg nach oben zu machen! Solange ich kann, werde ich für Sie da sein.«
Wie ein Vater, dachte David Pearl gerührt, und er wußte gleichzeitig, daß John B. Magrath dieses Wort niemals aussprechen würde.
Als David das Büro seines Chefs verließ, hatte er das sichere Gefühl, daß Magrath jede Einzelheit aus seinem Leben kannte.
***
Jemand hatte sich einen großen Bahnhof für unseren Empfang ausgedacht.
Das sahen wir schon, als wir noch auf der Mitte des Hudson River stromaufwärts rauschten. Ein Blick durchs Fernglas genügte. Ich schüttelte fassungslos den Kopf und nahm das Glas herunter.
»Was ist es?« fragte Milo, der das Steuerruder übernommen hatte.
»Sie haben Pier 80 in eine Freilichtbühne verwandelt«, entgegnete ich. Milo grinste. »Wenn wir die Stars sind…«
Ich klemmte mir eine Zigarette zwischen die Zähne und setzte den Tabak in Brand.
»Wenn ich nicht diesen Blechadler in der Tasche hätte«, knurrte ich, »könnte ich mich vielleicht über den Rummel freuen. Aber so, wie die Dinge stehen, kann uns der Zirkus nur schaden.«
»Himmel, Jesse, du kannst eine ausgewachsene Jacht wie diese nicht unsichtbar machen! Dann hätten wir uns eben eine andere Stelle aussuchen müssen, um an Land zu gehen.«
Ich nahm die Zigarette aus den Zähnen und deutete über den Bug hinweg.
»Da stehen ein paar hundert- Leute, Milo. So viele Fußgänger gibt es an der Jay Street nicht. Nie.«
Mein Freund runzelte die Stirn.
»Also keine zufälligen Sensationsgeier. Du meinst, jemand hat sie herbestellt?«
»Genau das. Wenn es ein Zufall wäre, woher sollen die Leute dann wissen, daß wir an Pier 80 anlegen?«
Milo preßte die Lippen aufeinander und schwieg. Ich hob erneut das Fernglas. Die Menschen standen dichtgedrängt auf dem Pier, dessen Abfertigungsgebäude schon vor Jahren abgebrochen worden war. Vor der flachen Plattform des Piers, an der Jay Street, parkten lange Reihen von Autos, darunter auch zwei Kastenwagen. Derjenige, der für den Trubel verantwortlich war, hatte wahrscheinlich auch einen der lokalen Fernsehsender verständigt.
Wir hatten Pier 80 gewählt, weil er der Stadt New York gehörte. Dort konnten wir die Jacht für die nächsten Tage festmachen und von unseren Spurensicherern auf den Kopf stellen lassen. An jedem anderen Pier hätten wir Liegegebühren zahlen müssen. Auch auf solche Dinge muß das FBI achten. Steuergelder dürfen wir nie verschwenden.
Die Jay Street verläuft unterhalb des West Side Express Highway, parallel zu der Schnellstraße auf ihren altmodischen Gitterstahlstelzen. Jenseits der Jay Street befanden sich die ausgedehnten Betriebsanlagen der Yale Transport Corporation und der Greyhound-Buslinien.
»Es ist zum Auswachsen«, sagte ich ärgerlich. »Weshalb schicken wir den Gangstern nicht gleich eine schriftliche Mitteilung, daß wir einen ihrer Kähne aufgebracht haben?«
»Du glaubst doch wohl nicht, daß Mr. McKee diesen Rummel inszeniert hat?«
»Nicht im Traum. Aber ich kann mir denken, wer dahintersteckt.« Ich nahm das Mikro des Funkgeräts. Wir hatten uns inzwischen mit der Anlage vertraut gemacht.
Die Potomac verlangsamte jetzt ihre Fahrt und drehte nach Steuerbord ab. Wir befanden uns auf gleicher Höhe mit Pier 80. Captain Leisenring mußte die Strömung des Hudson einkalkulieren.
Ich rief ihn über Funk. Er meldete sich sofort.
»Ich nehme an, Sie haben unser Publikum schon entdeckt«, sagte ich und gab mir keine Mühe, meinen Arger zu verbergen.
»Für mich ist es selbst eine Überraschung, Mr. Trevellian«, tönte Leisenrings Stimme blechern aus dem Funklautsprecher. »Sie müssen mir glauben, daß ich nichts davon gewußt habe.«
»In Ordnung. Sie haben auch keine Ahnung, wer uns diesen Zauber beschert hat?«
»Darüber möchte ich mich im Moment nicht auslassen.«
»Das kann ich mir denken. Over und…«
»Moment! Bleiben Sie gleich dran! Ich muß Ihnen sowieso ein paar Anweisungen für das Anlegemanöver geben.«
»Okay«, sagte ich, »wir hören.«
Milo erwies sich als Rudergänger von Format. Er hielt sich an die knappen Kommandos von Captain Leisenring und schaffte es mühelos, die Bayou Belle an den Pier zu bugsieren, ohne daß wir den Achtersteven des Schnellboots rammten.
Ein kleines Patrouillenboot der Flußpolizei lag weiter vorn am Pier. Uniformierte Beamte, die zu seiner Besatzung gehörten, waren zur Stelle, um unsere Jacht aus New Orleans, Louisiana, zu vertäuen.
Wir hatten einen Moment lang Zeit, die Neugierigen aus sicherer Entfernung zu betrachten. Nicht alle waren Presseleute. Wer mit Kameras, Recordern und Notizblocks ausgestattet waren, hatte sich in den Vordergrund gedrängt. Die Beamten von der Flußpolizei hatten alle Mühe, nicht in den Bach gestoßen zu werden. Jeder Journalist versuchte, den besseren Platz zu ergattern und die lästigen Konkurrenten mit dem Ellenbogen aus dem Weg zu räumen. Die Fluß-Cops mußten ebenfalls die Ellenbogen benutzen, um in dem Gedränge und Geschiebe nicht unterzugehen.
Im Hintergrund sahen wir einige Leute, die nicht von Rundfunk, Fernsehen oder Zeitungsverlagen stammten. Das waren in der Tat Neugierige, die mehr oder weniger per Zufall aufgekreuzt waren. An der Jay Street gibt es eine Menge Verladestellen für Trucks und Lieferwagen. Außerdem die Kneipen, in denen sich Seeleute, Lastwagenfahrer und Spediteure treffen. Mit denen, die überall zu den Randerscheinungen in solchen Lokalen gehören.
Diejenigen, die den Journalisten einen wohlmeinenden Tip gegeben hatten, konnten wir noch nicht erblicken. Wenn sie überhaupt anwesend waren, zogen die Gentlemen es vermutlich vor, sich abseits vom Trubel zu halten.
Vor uns wurde jetzt die Potomac am Pier festgemacht. Captain Leisenring hatte offenbar Order, nicht sofort wieder zu verschwinden.
Ich schaltete das Funkgerät auf die New Yorker FBI-Frequenz und hatte im Handumdrehen Verbindung mit der Zentrale im Distriktgebäude an der Federal Plaza.
»Steve Tardelli und Blackfeather sind zu euch unterwegs«, antwortete der diensthabende Kollege in der Funkzentrale, nachdem ich ihm den Stand der Dinge erklärt hatte. »Wahrscheinlich hängen sie irgendwo in einem Stau fest;. Ihr habt euch einen ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht.«
»Das scheint mir auch so«, entgegnete ich grimmig. »Niemand hat daran gedacht, hier eine Absperrung aufzubauen. Tu mir einen Gefallen und schick uns ein paar Streifenwagenbesatzungen vom nächsten Revier!«
»Okay, geht in Ordnung. Habt ihr Angst, daß die Presseburschen euch in der Luft zerreißen?«
»Wir schlottern. Noch eins: Melde uns beim Chef an! In etwa einer Stunde.«
Ich schaltete wieder um und nahm noch einmal Verbindung mit Leisenring auf.
»Bevor Sie und Ihre Leute von Bord gehen, Captain, möchte ich eins klarstellen: Dies ist ein FBI-Fall! Die Coast Guard hat uns Amtshilfe geleistet, ist aber nicht berechtigt, irgendwelche Verlautbarungen abzugeben. Ich werde es nicht zulassen, daß unsere laufenden Ermittlungen gefährdet werden. Es ist mir egal, wie Ihre Dienstoberen darüber denken.«
»Trevellian, hören Sie! Ich denke, wir haben uns ein bißchen kennengelernt. Sie sollten wissen, daß ich nicht hungrig auf Publicity bin. Wenn meine Vorgesetzten darüber anders denken…« Er ließ den Rest unausgesprochen.
»Ich weiß«, entgegnete ich. »Also überlassen Sie uns die Abfertigung unserer Zeitungsfreunde. Okay?«
»Okay.«
Draußen wurden sie ungeduldiger. Das Stimmengewirr schwoll an, und die Cops von der Flußpolizei hatten keine Chance, zu ihrem Boot zurückzukehren.
»Ich nehme an, wir haben es nicht eilig«, meinte Milo lächelnd. Er schaltete die elektrische Anlage der Jacht aus.
»Wenn wir zu lange warten, werden Sie den Kahn entern.« Ich deutete nach draußen.
Die versessensten Fotografen hatten begonnen, die Einschußlöcher im Heck der Bayou Belle abzulichten. Motorgetriebene Kameraverschlüsse surrten und klickten.
»Also auf sie mit Gebrüll!« grinste mein Freund und stieß das Schott des Kommandostands auf.
Sofort verstummte das Stimmengewirr, als wir auf das Achterdeck traten. Sämtliche Augenpaare richteten sich auf Milo und mich. Denn sie hatten inzwischen begriffen, daß Captain Leisenring und seine Coast-Guard-Beamten nicht daran dachten, von Bord zu gehen. Leisenring war beruhigt. Seinen Vorgesetzten gegenüber konnte er die Hände in Unschuld waschen, wenn es eine offizielle Dienstbeschwerde vom FBI-Hauptquartier gab.
Ich öffnete die Pforte in der Reling. Von der Jay Street näherte sich Sirenengeheul. Mit einem federnden Satz sprang ich auf den Pier. Die Regenjacken aus Coast-Guard-Beständen hatten Milo und ich zurückgelassen. Wir trugen unsere gewohnten Anzüge.
Sofort brandete die Woge auf uns zu. Das Surren und Klicken der Kamera Verschlüsse. Zwei Fernsehkameras schnarrten. Die Kollegen von der Flußpolizei bemühten sich nach Kräften, uns einen oder zwei Quadratmeter Standfläche auf dem Pier freizuhalten. Fragen prasselten auf uns ein.
»Sie sind FBI-Beamte?«
»Wann und wo haben Sie die Jacht aufgebracht?«
»Gibt es Erkenntnisse, wo das Schiff gestohlen wurde?«
»Wieviele Festnahmen hat es gegeben?«
»Haben Sie Hinweise auf die Leute, die hinter dieser Schieberei stecken?«
»Eine Vermutung, wohin die Jacht verschoben werden sollte?«
»Ist der rechtmäßige Eigentümer schon benachrichtigt?«
Milo und ich zündeten uns eine Zigarette an und warteten ab, bis ihr Fragenrepertoire erschöpft war. Nur für eine Atempause.
Auf der Jay Street verendeten die Sirenen mit langgezogenen Heultönen. Stimmen wurden laut. Befehlend und protestierend übertönten sie das Durcheinander in unserer unmittelbaren Umgebung. Die Reviercops waren zuverlässig wie immer. Wir konnten sie nicht sehen, wußten aber, daß sie sich einen Weg bahnten und Ordnung schafften. Ob unsere Kollegen Steve und Blacky schon eingetroffen waren, vermochen wir nicht festzustellen.
Die Frager ließen nicht locker. Mit ihrem Surren und Klicken entfachten die Kameras ein wahres Maschinengewehrfeuer. Die Fotografen versuchten jetzt, uns einzukreisen und sich bessere Bildwinkel zu verschaffen. Für die Cops von der Flußpolizei wurde es hart. Vier Beamte waren es, die sich redliche Mühe gaben, die hartnäckigen Burschen auf Abstand zu halten.
»Geben Sie wenigstens eine Stellungnahme ab!« schrie jemand aus dem gedrängten Kreis der Journalisten.
»Wir lassen uns nicht abspeisen!« rief ein anderer. »Schließlich sind wir herbestellt worden.«
Ich hob meine rechte Hand. Sofort kehrte Ruhe ein. Sie werteten es als ein Zeichen, daß ich auskunftsbereit war. Deutlicher hörte man jetzt die Reviercops, die nach wie vor damit beschäftigt waren, klare Verhältnisse zu schaffen.
»Interessant«, sagte ich. »Wer hat Sie herbestellt, Gentlemen?«
»Die Coast Guard«, kam die prompte Antwort. »Commander Cheney.«
»Das hört sich nach Zuständigkeitsgerangel an«, rief ein vollbärtiger Jüngling, der Mühe hatte, im Gedränge seinen Notizblock hochzuhalten. »Sie sind vom FBI, stimmts?«
»Allerdings«, entgegnete ich. Mehr nicht.
Sekundenlanges Schweigen.
»Geben Sie endlich Ihre Stellungnahme ab!« erscholl eine scharfe Stimme aus der dritten oder vierten Reihe.
»Sonst bringen wir das, was wir schon wissen!« schrie ein anderer.
»Gentlemen«, sagte ich so gelassen wie möglich. »Vom FBI gibt es keinen Kommentar. Da es sich um unseren Fall handelt, ist auch die Coast Guard nicht berechtigt…«
Wütendes Protestgeschrei ertönte.
Aus den Augenwinkeln heraus sah ich eine Bewegung, die mir nicht in den Kram paßte. Ich wirbelte herum.
Einer der Fotografen hatte es endlich geschafft. Ein drahtiger kleiner Kerl in Jeans und Parka mit zwei umgehängten Kameras. Er hatte einen der Flußpolizeibeamten zur Seite gestoßen und war mit einem Satz auf die Jacht gehechtet. Auf dem Achterdeck versuchte er, eine günstige Schußposition für seine Optik zu erwischen.
»So nicht«, knurrte ich. Zwei Schritte und ein federnder Sprung genügten für mich, um neben dem vorwitzigen Kameraschwinger auf dem Achterdeck zu landen.
Sein Verschlußwinder hatte bereits zu schnurren begonnen. Er nahm keine Notiz von mir, sondern fotografierte wie besessen in die Menge hinein.
»Aufhören, Mister!« sagte ich schneidend. »Niemand hat Ihnen die Erlaubnis gegeben, dieses Schiff zu betreten.«
Er gehorchte — aber erst nachdem er die Optik herumgeschwenkt und auch auf mich abgedrückt hatte. Dann ließ er die Kamera sinken. Sein Blick war giftig.
»Sie werden mich nicht an der Ausübung meines Berufs hindern!« fauchte er. »Das ist wieder mal typisch für FBI und Polizei. Pressevertreter werden mit Demonstranten und anderen Unbeteiligten über einen Kamm geschoren.«
»Halten Sie die Luft an!« sagte ich und bemühte mich, ruhig zu bleiben. Ich hörte, daß die anderen Journalisten sich inzwischen auf Milo gestürzt hatten. Er wimmelte sie ab. Die Reviercops waren inzwischen näher heran.
»Warum nehmen Sie mir nicht die Kameras weg?« schrie mein Gegenüber. »Haben Sie keinen Hartholzknüppel, mit dem Sie mir eins überziehen können?«
Ich trat auf ihn zu. Unwillkürlich wich er einen Schritt zurück.
Ich schüttelte verständnislos den Kopf.
»Erstens«, sagte ich energisch, »sehe ich hier nirgendwo eine Demonstration. Zweitens hindere ich Sie nicht an der Ausübung Ihres Berufes. Und drittens gehe ich nicht mit Gewalt gegen Sie vor. Ich fordere Sie lediglich auf, sofort dieses Schiff zu verlassen. Die gesamte Jacht dient zur Beweismittelsicherung in einem schwebenden Verfahren. Ich kann es nicht zulassen, daß Journalisten dieses Verfahren behindern. Haben Sie das begriffen?«
Er sperrte den Mund auf. Dann schluckte er.
»Wenn Sie meiner Anordnung nicht sofort folgen«, fuhr ich fort, »bin ich allerdings gezwungen, Sie unter Anwendung von Gewalt von Bord zu entfernen.«
An meiner Wortwahl hörte er, daß ich die einschlägigen Gesetzestexte sehr wohl kannte.
»Also gut, G-man«, zischte er. »Aber Sie können sich darauf verlassen, daß diese Geschichte bei uns in der Zeitung erscheint. Wieder mal ein Beispiel, welche Auffassung von Öffentlichkeitsarbeit beim FBI herrscht.«
Mit einem wütenden Ruck schwang er sich über die Reling. Unten auf dem Pier wurde er von den Flußpolizeibeamten betont freundlich in Empfang genommen. Einer notierte die Personalien des drahtigen kleinen Fotografen. Nun mußte er mit einer Anzeige rechnen. Immerhin hatte er einen der Cops angegriffen.
Als ich die Bayou Belle ebenfalls wieder verließ, hatten es die uniformierten Kollegen vom Revier endlich geschafft, Milo und mich von der Meute zu befreien. Eine Gasse entlang des Anlegers war frei. Empörtes Gebrüll begleitete uns auf dem Weg in Richtung Jay Street. Captain Leisenring winkte uns vom Vordeck der Potomac zu. Er zog es vor, noch nicht von Bord zu gehen. Dafür hatte er seine Gründe, wie wir gleich feststellen sollten. Der Kommandant des Patrouillenboots der Flußpolizei teilte uns mit, daß er und seine Männer für die Bewachung der Bayou Belle abkommandiert seien.
Vorn, an der Jay Street sahen wir Steve Tardelli und Blackfeather, die mit zwei anderen Männern in Zivil neben ihren Dienstfahrzeugen standen und offenbar in eine hitzige Diskussion vertieft waren. Während wir auf sie zutraten, hing uns das Protestgeschrei der Journalisten noch immer im Nacken. Die hitzige Debatte endete, als wir ins Blickfeld gelangten. Steve und Blacky atmeten sichtlich auf.
»Commander Cheney und Lieutenant Byrd, sein Assistent«, erklärte Steve.
»Unsere Kollegen Trevellian und Tucker«, fügte Blackfeather hinzu.
»Ich leite die Ermittlungen in diesem Fall«, sagte ich.
Cheney nickte grimmig. Er war ein hagerer Mann mit silbergrauem Haar. Ich schätzte ihn auf Mitte bis Ende 50. Der Typ des Armeeoffiziers, der mit Befehlen und Vorschriften am engsten befreundet ist.
»Von Ihren Kollegen mußte ich mir schon einige Unverschämtheiten bieten lassen, Mr. Trevellian. Ich hoffe, Sie werden diese Angelegenheit in Ordnung bringen.«
»Tut mir leid, Sir«, entgeghete ich hart. »Was Sie in Unordnung gebracht haben, werde ich nicht reparieren. Sie haben unberechtigterweise die Presse benachrichtigt. Zwar hat die Coast Guard uns Amtshilfe geleistet. Das bedeutet aber noch lange nicht…«
»Was nehmen Sie sich heraus!« fiel er mir barsch ins Wort. »Die Aktion aqf See war eine reine Angelegenheit der Coast Guard. Was sich hier an Land abspielt, ist Ihre Sache. Da können Sie meinetwegen machen, was Sie wollen. Ich denke, Sie haben sich alle ein bißchen im Ton vergriffen, Gentlemen.«
»Wir sind anderer Meinung, Sir«, entgegnete ich hartnäckig. »Über den Fall gibt es kein weiteres Wort an die Presse. Das ist eine Anordnung des FBI. Ich bin berechtigt, das durchzusetzen.«
Er lief dunkelrot an. Seine Kinnlade klappte herunter. Einen Moment lang sah es aus, als wolle er explodieren. Doch dann wurde seine Stimme leise und drohend.
»Dieser Vorfall wird ein Nachspiel haben, Trevellian. Machen Sie sich darauf gefaßt!« Ohne eine Antwort von mir abzuwarten, drehte er sich abrupt um und forderte seinen Assistenten mit einem herrischen Wink auf, ihm zu folgen.
Wir sahen den beiden nach, als sie in ihrem Dienstwagen davonrauschten. Auf dem Pier hatte sich das Stimmengewirr mittlerweile halbwegs beruhigt. Die Journalisten sahen ein, daß die Cops und wir hart blieben. Trotzdem war nicht zu verhindern, was Commander Cheney uns eingebrockt hatte. Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen würden über die FBI-Kaperfahrt in Sachen Bayou Belle berichten. So oder so. Wir konnten also nicht mehr verhindern, daß die, denen wir das Handwerk legen wollten, von der Sache Wind bekamen.
»Da wird sich ein Donnerwetter Über dir entladen, Alter«, meinte Milo nachdenklich.
»Dieser Cheney hängt wahrscheinlich schon am Funkgerät«, meinte Steve.
»Abwarten, wie gut seine Beziehungen nach Washington sind«, sagte Blacky lächelnd.
»Ich habe einen breiten Rücken, und wir alle haben einen guten Blitzableiter«, brummte ich. »Jonathan D. McKee.«
***
»Wie ist es gestern gelaufen?« fragte Frank Reynolds und blickte von seiner Zeitung auf.
»Bei der Besprechung?« entgegnete David Pearl.
»Es muß lange gedauert haben«, sagte Diana Dyer. »Wir hatten alle schon Feierabend, und die Gentlemen tagten immer noch.«
»Die Gentlemen«, wiederholte David gedehnt. »Wie sich das anhört!« Er hatte sich zur Frühstückspause in das Büro seiner beiden Mitarbeiter begeben und es sich auf dem Besuchersessel vor ihren Schreibtischen gemütlich gemacht. Es erschien ihm nicht sinnvoll, sich in seinem Office abzukapseln. Er hätte sich komisch dabei gefühlt.
»Natürlich gehören Sie zu den Gentlemen, David. So ist nun mal der offizielle Sprachgebrauch.« Diana Dyer lächelte. »Bleibt die Antwort auf Franks Frage ein Geheimnis?« .
»Überhaupt nicht.« David wiegte verlegen den Kopf auf den Schultern. Er zögerte. »Also, ich glaube, es hat sich niemand besonders über mich aufgeregt. Ich habe meinen Bericht erstattet, habe ein paar Fragen beantwortet und zugehört, was die anderen zu sagen hatten.«
»Wenn keiner Sie in die Mangel genommen hat«, sagte Frank Reynolds im Brustton der Überzeugung, »dann ist das ein gutes Zeichen. Dann sind sie wirklich zufrieden mit Ihnen.«
»Hören Sie bloß auf mit Ihrer Bescheidenheit, David!« rief Diana lachend. »Das ist das einzige, was Sie sich in diesem Job noch abgewöhnen müssen.«
»Ich werd’s versuchen«, murmelte David Pearl verschmitzt. »Vielleicht fange ich bei euch beiden an, den Boß herauszukehren.«
Sie lachten.
»Nichts dagegen einzuwenden«, sagte Frank Reynolds. »Wir machen alles mit.« Sie widmeten sich wieder ihren Sandwiches und dem Kaffee, den Diana aufgebrüht hatte. David spürte, daß sie ihm einen Blick zuwarf. Er sah sie an, und ihrem Lächeln las er etwas, das er nicht zu deuten vermochte. War es nur Freundlichkeit, eine Art Hilfsbereitschaft, ihn während seiner Anfangszeit in New York mit menschlicher Nähe zu unterstützen? Oder lag mehr in diesem Lächeln? David empfand abermals ein Gefühl von Wärme, die seinen Körper durchflutete.
»Nun hört euch das mal an!« sagte Frank Reynolds kopfschüttelnd, ohne von der Morgenausgabe der New York Daily News aufzublicken. »FBI beschlagnahmt Motorjacht. Kaperfahrt mit der Coast Guard. Bayou Belle in New Orleans gestohlen und umfrisiert?« Reynolds ließ die Zeitung sinken. »Was sie früher nur mit gestohlenen Autos gemacht haben, das versuchen sie jetzt anscheinend auch mit Jachten. Muß ein verdammt einträgliches Geschäft sein. Was schätzen Sie, was so ein Kahn kostet, David? Hier, sehen Sie sich das Bild an! Ich würde sagen, unter 100 000 ist so was nicht zu kriegen. Und dann noch meistens von den Banken finanziert.«
David Pearl nahm die Zeitung entgegen und setzte seine Kaffeetasse ab. Die gesamte erste Seite der Daily News war der Geschichte mit der Motorjacht gewidmet. David überflog Titelzeilen, Zwischentitel und Bildtexte. Die Story selbst war ihm zu lang. In einem Kommentar beklagte sich der Verfasser des Ganzen über die angeblich rüde Verhaltensweise von FBI-Beamten und Cops der New Yorker City Police. Eins der Bilder zeigte die Jacht am Pier. Menschen verdeckten das Schiff teilweise.
»Gehen wir lieber auf 200 000«, meinte David nach einer Weile. »Das ist ein hochseetüchtiges Luxusschiff.«
»Unten im Süden gibt’s mehr von der Sorte als bei uns hier oben, stimmt’s? Auch bei Ihnen in Alabama, David?«
»Das kann'ieh nicht beurteilen, Frank. Auf dem Hudson River habe ich auch schon ein paar hübsche Jachten gesehen.« David überflog den Rest der Seite. Da gab es Aufnahmen von einem Schnellboot der Coast Guard und von Polizeibeamten, die Neugierige zurückdrängten. Ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto zeigte einen Blick in die Menge, die das Geschehene verfolgte.





























