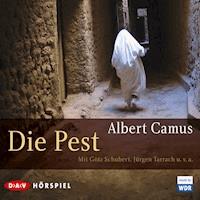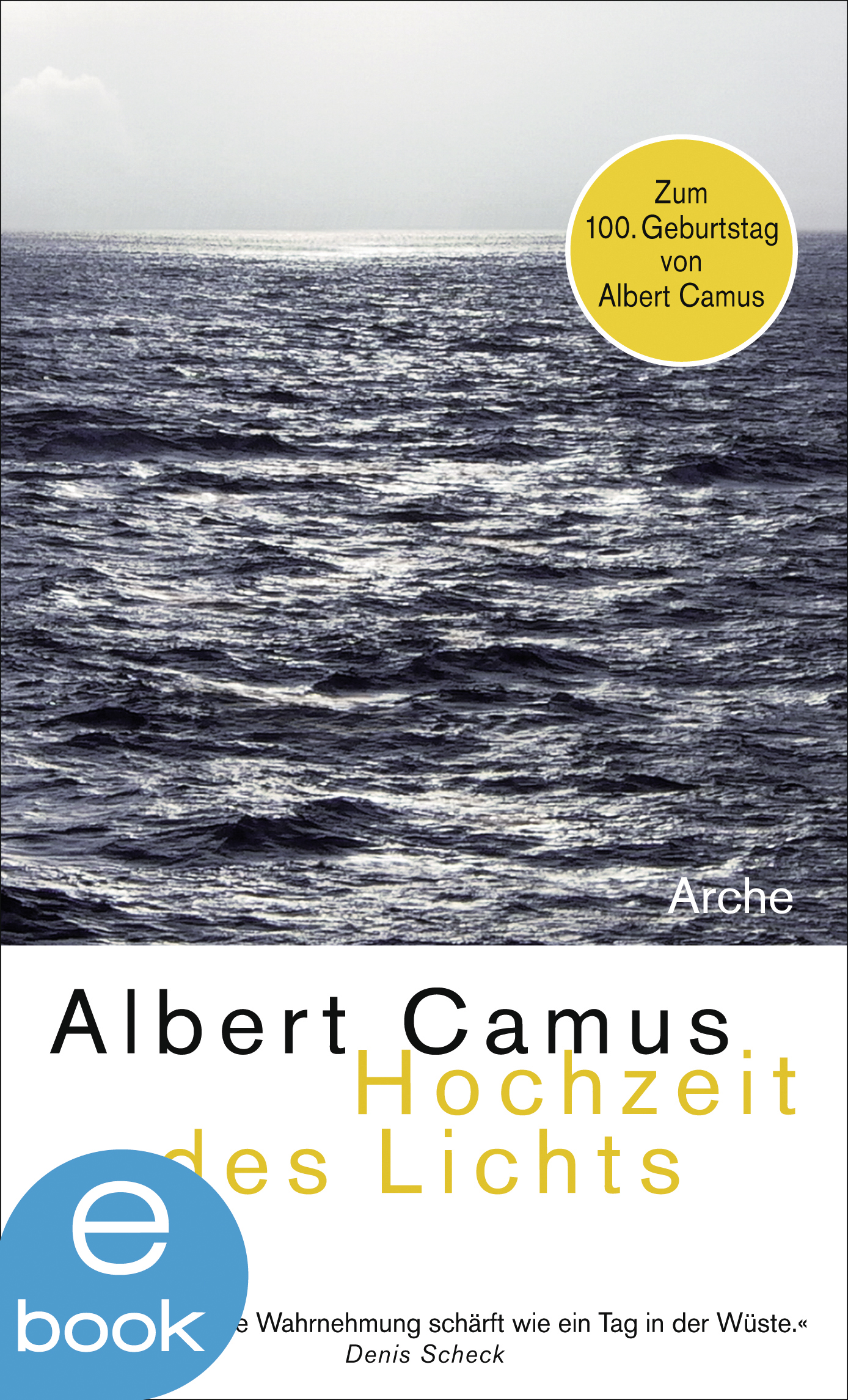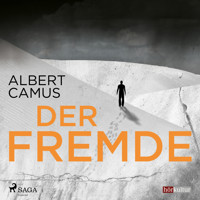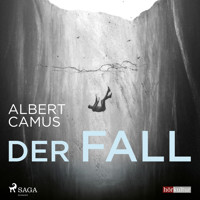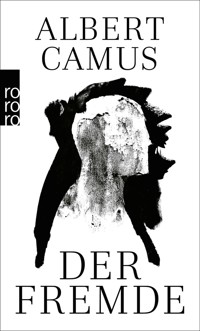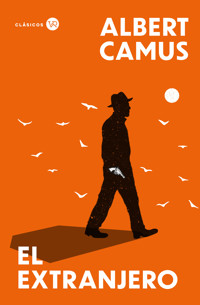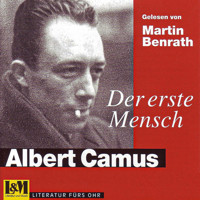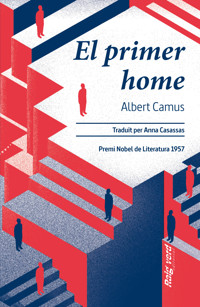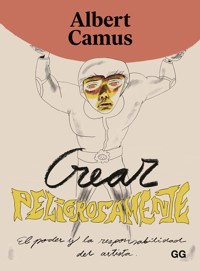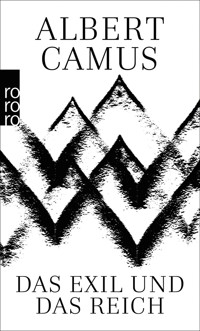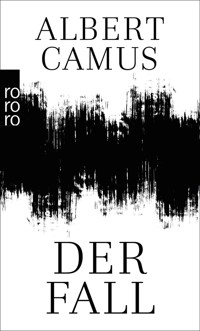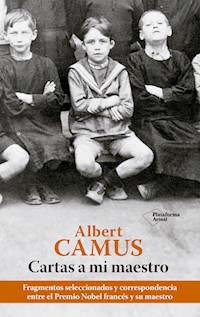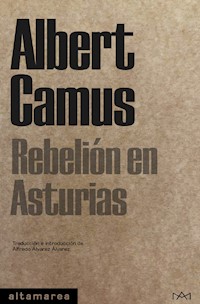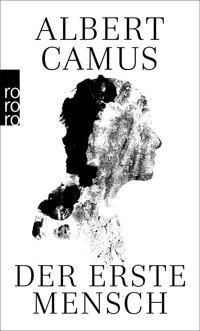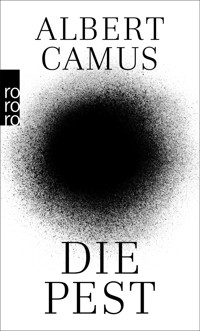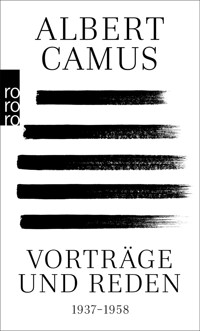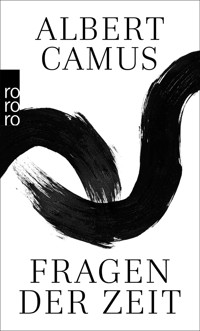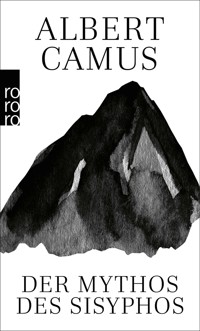
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mythos des Sisyphos - Albert Camus' zeitlose Reflexion über den Sinn des Lebens In seinem berühmten philosophischen Essay Der Mythos des Sisyphos stellt Albert Camus, Nobelpreisträger für Literatur, die zentrale Frage: Lohnt es sich, das Leben zu leben, angesichts der Sinnwidrigkeit der Welt? Camus entwickelt hier seine Philosophie des Absurden - dem Spannungsverhältnis zwischen der menschlichen Sehnsucht nach Sinnhaftigkeit und der scheinbaren Bedeutungslosigkeit des Daseins. Dieses Schlüsselwerk des Existenzialismus und der Phänomenologie zieht sich wie ein roter Faden durch Camus' gesamtes Oeuvre. Mit poetischer Präzision und scharfsinniger Argumentation ergründet er die Natur der menschlichen Existenz und unsere Suche nach Werten in einer unbegreiflichen Welt. In einer brillanten Neuübersetzung lädt Der Mythos des Sisyphos dazu ein, unsere Werteordnung zu hinterfragen und angesichts der Absurdität des Lebens dennoch Sinn und Erfüllung zu finden. Ein unverzichtbarer Klassiker der Weltliteratur, der auch heute nichts an Relevanz und Tiefe verloren hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Albert Camus
Der Mythos des Sisyphos
Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Vincent von Wroblewsky
Über dieses Buch
«Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen.» Albert Camus’ berühmtes Werk kreist um die zentrale Frage, «ob das Leben die Mühe, gelebt zu werden, lohnt oder nicht».
Impressum
Der Neuübersetzung liegt die 1965 in der «Bibliothèque de la Pléiade» erschienene Fassung zugrunde
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2013
Copyright © 1999 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Le Mythe de Sisyphe» Copyright © 1942, 1948, 1965 by Librairie Gallimard, Paris
Umschlaggestaltung any.way, Cordula Schmidt
All Rights Reserved.
ISBN Print 978-3-499-22765-3 (14. Auflage 2012)
ISBN 978-3-644-02661-2
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Widmung
Für Pascal Pia
Zitat
Liebe Seele, trachte nicht nach dem ewigen Leben, sondern schöpfe das Mögliche aus.
Pindar, Dritte Pythische Ode[1]
Eine absurde Betrachtung
Die folgenden Seiten handeln von einem Sinn für das Absurde, den man in unserem Jahrhundert immer wieder finden kann – und nicht von einer Philosophie des Absurden, die unsere Zeit, genau genommen, nicht kannte. Es ist also ein Gebot elementarer Redlichkeit, gleich zu Beginn festzustellen, was sie einigen zeitgenössischen Geistern verdanken. Ich möchte das gar nicht verheimlichen, vielmehr wird man sie überall in dem Buche zitiert und kommentiert finden.
Gleichzeitig aber ist die Bemerkung angebracht, dass das Absurde – das bisher als Schlussfolgerung verstanden wurde – in diesem Essay als Ausgangspunkt betrachtet wird. In diesem Sinne hat meine Erläuterung etwas durchaus Vorläufiges: man sollte über die Position, die ich damit beziehe, nicht voreilig urteilen. Man wird hier lediglich die Beschreibung eines geistigen Gebrechens im Reinzustand vorfinden. Keine Metaphysik, kein Glaube werden zunächst mit ihm vermengt. Das sind die Grenzen und die einzige Parteinahme dieses Buches.
Das Absurde und der Selbstmord
Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem: den Selbstmord[2]. Sich entscheiden, ob das Leben es wert ist, gelebt zu werden oder nicht, heißt auf die Grundfrage der Philosophie antworten. Alles andere – ob die Welt drei Dimensionen und der Geist neun oder zwölf Kategorien hat – kommt später. Das sind Spielereien; erst muss man antworten. Und wenn es wahr ist, dass – wie Nietzsche es verlangt – der Philosoph, um Achtung zu genießen, ein Beispiel geben muss[3], dann begreift man die Wichtigkeit dieser Antwort, da sie der endgültigen Tat vorausgehen wird. Für das Herz sind das unmittelbare Gewissheiten, die man jedoch vertiefen muss, um sie dem Geiste deutlich zu machen.
Wenn ich mich frage, wonach ich beurteile, dass diese Frage dringlicher als jene andere ist, dann antworte ich: der Handlungen wegen, die sie nach sich zieht. Ich kenne niemanden, der für den ontologischen Beweis gestorben wäre. Galilei, der im Besitz einer bedeutsamen wissenschaftlichen Wahrheit war, widerrief sie mit der größten Leichtigkeit, als sie sein Leben gefährdete. In gewissem Sinne tat er recht daran. Diese Wahrheit war den Scheiterhaufen nicht wert. Ob die Erde sich um die Sonne dreht oder die Sonne um die Erde – das ist zutiefst gleichgültig. Um es genau zu sagen: es ist eine nichtige Frage. Hingegen sehe ich viele Leute sterben, weil sie das Leben nicht für lebenswert halten. Andere wieder lassen sich paradoxerweise für die Ideen oder Illusionen umbringen, die ihnen einen Grund zum Leben bedeuten (was man einen Grund zum Leben nennt, ist gleichzeitig ein ausgezeichneter Grund zum Sterben). Also schließe ich, dass der Sinn des Lebens die dringlichste aller Fragen ist. Wie sie beantworten? Über alle wesentlichen Probleme (darunter verstehe ich Probleme, die möglicherweise das Leben kosten, oder solche, die die Leidenschaft zu leben vervielfachen) gibt es wahrscheinlich nur zwei Denkweisen: die von La Palisse[4] und die von Don Quichotte. Nur das Gleichgewicht von Evidenz und Begeisterung kann uns gleichzeitig Zugang zur Emotion und zur Klarheit verschaffen. Bei einem so schlichten und zugleich derart mit Pathos belasteten Thema muss also, wie man einräumen wird, die gelehrte, klassische Dialektik vor einer bescheideneren Geisteshaltung weichen, die ebenso vom gesunden Menschenverstand wie vom Mitgefühl ausgeht.
Man hat den Selbstmord immer nur als soziales Phänomen behandelt. Hier dagegen geht es zunächst einmal darum, nach der Beziehung zwischen individuellem Denken und Selbstmord zu fragen. Eine solche Tat bereitet sich in der Stille des Herzens vor, geradeso wie ein bedeutendes Werk. Der Mensch selbst weiß nichts davon. Eines Abends drückt er ab oder geht ins Wasser. Von einem Gebäudeverwalter, der sich umgebracht hatte, erzählte man mir, er habe vor fünf Jahren seine Tochter verloren und sich seitdem sehr verändert, die Geschichte «habe ihn ausgehöhlt». Einen treffenderen Ausdruck kann man sich nicht wünschen. Wenn man zu denken anfängt, beginnt man ausgehöhlt zu werden. Die Gesellschaft spielt dabei am Anfang keine große Rolle. Der Wurm sitzt im Herzen des Menschen. Dort muss er auch gesucht werden. Diesem tödlichen Spiel, das von der Klarsicht gegenüber der Existenz zur Flucht aus dem Licht führt, muss man nachgehen und es verstehen.
Ein Selbstmord hat vielerlei Ursachen, und im Allgemeinen waren die offensichtlichsten nicht die wirksamsten. Man begeht selten Selbstmord aus Überlegung (obwohl diese Hypothese nicht ausgeschlossen ist). Die Krise wird fast immer von etwas Unkontrollierbarem ausgelöst. Die Zeitungen sprechen oft von «heimlichem Gram»[5] oder von «unheilbarer Krankheit». Diese Erklärungen haben ihre Geltung. Wichtig wäre aber zu wissen, ob nicht am selben Tage ein Freund mit dem Verzweifelten in einem gleichgültigen Ton gesprochen hat.[6] Das ist der Schuldige. Denn das kann genügen, um allen bislang noch schwebenden Groll und allen Überdruss zu entfachen.[1]
Wenn es jedoch schwierig ist, den genauen Zeitpunkt, den winzigen Schritt zu bestimmen, da der Geist auf den Tod gesetzt hat, so ist es leichter, aus der Tat selbst die Folgerichtigkeit zu erschließen, die sie voraussetzt. Sich umbringen heißt, in einem gewissen Sinn und wie im Melodrama, ein Geständnis ablegen. Es heißt gestehen, dass man mit dem Leben nicht fertigwird oder es nicht versteht. Wir wollen aber in diesen Analogien nicht zu weit gehen und zur alltäglichen Ausdrucksweise zurückkehren. Es handelt sich einfach um das Geständnis, es sei «es nicht wert». Leben ist natürlich niemals leicht. Aus vielerlei Gründen, vor allem aus Gewohnheit, vollführt man weiterhin die Gesten, die das Dasein verlangt. Aus freiem Willen sterben setzt voraus, dass man, und sei es nur instinktiv, das Lächerliche dieser Gewohnheit erkannt hat, das Fehlen jedes tiefen Grundes, zu leben, die Sinnlosigkeit dieser täglichen Betriebsamkeit, die Nutzlosigkeit des Leidens.[7]
Was für ein unberechenbares Gefühl raubt denn dem Geist den lebensnotwendigen Schlaf? Eine Welt, die man – selbst mit schlechten Gründen – erklären kann, ist eine vertraute Welt. Aber in einem Universum, das plötzlich der Illusionen und des Lichts beraubt ist, fühlt der Mensch sich fremd. Aus diesem Exil gibt es keine Rückkehr, da es der Erinnerungen an eine verlorene Heimat oder der Hoffnung auf ein gelobtes Land beraubt ist.[8] Diese Entzweiung zwischen dem Menschen und seinem Leben, zwischen dem Handelnden und seinem Rahmen, genau das ist das Gefühl der Absurdität. Da alle gesunden Menschen an Selbstmord gedacht haben, wird man ohne weitere Erklärungen erkennen können, dass zwischen diesem Gefühl und dem Streben nach dem Nichts eine direkte Beziehung besteht.
Gegenstand dieses Essays ist ebendieser Zusammenhang zwischen dem Absurden und dem Selbstmord, das genaue Ermessen, wieweit der Selbstmord für das Absurde eine Lösung ist. Man kann den Grundsatz aufstellen, bei einem aufrichtigen Menschen werde das Handeln von dem bestimmt, was er für wahr hält. Der Glaube an die Absurdität der Existenz muss demnach sein Verhalten leiten. Mit berechtigter Neugier mag man sich fragen, offen und ohne falsches Pathos, ob ein derartiger Schluss verlangt, eine unverständliche Lage so rasch wie möglich aufzugeben. Ich spreche selbstverständlich hier von Menschen, die gewillt sind, mit sich selbst in Einklang zu sein.
Klar formuliert mag dieses Problem ebenso einfach wie unlösbar erscheinen. Aber man vermutet zu Unrecht, dass einfache Fragen ebenso einfache Antworten nach sich ziehen und dass Evidenz Evidenz impliziert. Ebenso wie man sich entweder umbringt oder nicht, scheint es a priori, indem man umgekehrt die Frage stellt, nur zwei philosophische Lösungen zu geben: ein Ja und ein Nein. Das wäre jedoch zu schön. Wir müssen jene berücksichtigen, die fortgesetzt Fragen stellen und keine Schlüsse ziehen. Ich sage das fast ohne Ironie: es handelt sich um die Mehrheit. Ebenso sehe ich, dass die Neinsager so handeln, als dächten sie ja. Wenn ich mir Nietzsches Kriterium[9] zu eigen mache, dann denken sie tatsächlich auf die eine oder andere Weise ja. Bei Selbstmördern dagegen kommt es oft vor, dass sie vom Sinn des Lebens überzeugt waren. Diese Widersprüche sind konstant. Man kann sogar sagen, dass sie nirgends so lebendig gewesen sind wie dort, wo im Gegenteil Logik so wünschenswert wäre. Es ist ein Gemeinplatz, die philosophischen Theorien mit dem Verhalten derer zu vergleichen, die sie lehren. Keiner der Denker, die dem Leben jeden Sinn absprachen, ist allerdings seiner Logik so weit gefolgt, dieses Leben zu verweigern – außer Kirilow[10], der der Literatur angehört, außer Peregrinos[11], der der Legende entstammt[2], und außer Jules Lequier[12], der das Geschöpf einer Hypothese ist. Man zitiert oft, um sich darüber lustig zu machen, Schopenhauer, der an einer gutgedeckten Tafel den Selbstmord pries. Das ist aber keineswegs zum Lachen. Diese Art, das Tragische nicht ernst zu nehmen, ist nicht so wichtig: doch letztlich fällt sie auf den Mann selbst zurück.
Muss man nun angesichts dieser Widersprüche und Unklarheiten annehmen, zwischen der Meinung, die man vom Leben haben kann, und dem Schritt, mit dem man es verlässt, bestehe keinerlei Beziehung? Wir wollen hier nichts übertreiben. In der Bindung des Menschen an sein Leben gibt es etwas, das stärker ist als alles Elend der Welt. Das Urteil des Körpers gilt allemal so viel wie das des Geistes, und der Körper scheut die Vernichtung. Wir gewöhnen uns ans Leben, ehe wir uns ans Denken gewöhnen. Bei dem Wettlauf, der uns dem Tode täglich etwas näher bringt, hat der Körper unwiderruflich den Vorsprung. Das Wesentliche dieses Widerspruchs liegt letztlich im «Ausweichen», wie ich es nennen möchte; es ist nämlich mehr und gleichzeitig weniger als die «Zerstreuung», von der Pascal spricht. Das tödliche Ausweichen, das dritte Thema dieses Essays – das ist die Hoffnung. Die Hoffnung auf ein anderes Leben, das man sich «verdienen» muss, oder die Betrügerei jener, die nicht für das Leben selbst leben, sondern für irgendeine große Idee, die das Leben überschreitet, es sublimiert, ihm einen Sinn gibt und es verrät.
So ist alles dazu angetan, Verwirrung zu stiften. Nicht umsonst haben wir bisher mit Worten gespielt und so getan, als glaubten wir, dem Leben einen Sinn abzusprechen führe notgedrungen zu der Erklärung, das Leben sei es nicht wert, gelebt zu werden. In Wahrheit gibt es zwischen diesen beiden Urteilen keine zwanghafte Verbindung. Wir dürfen uns nur nicht von den bisher angeführten Verwirrungen, Entzweiungen und Inkonsequenzen irreleiten lassen. Wir müssen alles beiseiteschieben und geradewegs auf das wirkliche Problem zugehen. Man bringt sich um, weil das Leben es nicht wert ist, gelebt zu werden – das ist zweifellos eine Wahrheit, freilich eine unergiebige Wahrheit, weil sie ein Gemeinplatz ist. Aber rührt diese Beleidigung der Existenz, diese Verleugnung, in die man sie stürzt, daher, dass sie keinerlei Sinn hat? Verlangt ihre Absurdität, dass man ihr mittels der Hoffnung oder durch den Selbstmord entflieht – eben das müssen wir erhellen, verfolgen und verdeutlichen und dabei alles Übrige außer Acht lassen. Verlangt das Absurde den Tod – dieses Problem hat Vorrang vor allen anderen, außerhalb aller Denkmethoden, aller Spielereien eines darüberstehenden Geistes. Nuancen und Widersprüche, die Psychologie, die ein «objektiver» Geist in alle Probleme einzuführen weiß, haben bei dieser Untersuchung und bei dieser leidenschaftlichen Sache nichts zu suchen. Hier ist nur rigoroses, das heißt logisches, Denken am Platze. Das ist nicht leicht. Logisch zu sein ist immer bequem. Nahezu unmöglich ist es aber, logisch bis ans Ende zu sein. Menschen, die von eigener Hand sterben, folgen damit bis zum Ende der Bahn ihrem Gefühl. Die Betrachtung des Selbstmordes gibt mir also Gelegenheit, die einzige mich wirklich interessierende Frage zu stellen: Gibt es eine Logik bis zum Tode? Das kann ich nur erfahren, wenn ich ohne regellose Leidenschaft, allein im Licht der Evidenz, die Betrachtung anstelle, auf deren Ausgangspunkt ich hier hinweise. Ich nenne sie eine absurde Betrachtung. Viele haben sie begonnen. Ich weiß aber noch nicht, ob sie bei ihr blieben.
Wenn Karl Jaspers die Unmöglichkeit aufdeckt, die Einheitlichkeit der Welt zu begründen, und erklärt: «Diese Begrenzung führt mich zu mir selbst. Ich bin ich selbst da, wo ich mich nicht mehr hinter einen objektiven Standpunkt zurückziehe, den ich lediglich repräsentiere – da, wo weder ich selbst noch die Existenz eines andern mehr Objekt für mich werden kann»[13], so beschwört er – nach vielen anderen – die verlassenen, ausgedörrten Stätten, in denen das Denken seine äußerste Grenze erreicht. Nach vielen anderen – gewiss; doch welche Eile hatten sie, sie schleunigst wieder zu verlassen! Diese letzte Windung, an der das Denken schwankt, haben viele Menschen erreicht und gerade auch die Unscheinbarsten. Die einen entsagten dem Teuersten, das sie besaßen: ihrem Leben. Andere, Fürsten im Reiche des Geistes, haben auch entsagt – jedoch durch den Selbstmord des Denkens im Moment seiner reinsten Auflehnung. Die wahre Anstrengung besteht vielmehr darin, sich dort so lange wie möglich zu halten und die barocke Vegetation dieser fernen Gegenden aus der Nähe zu erforschen. Ausdauer und Scharfblick sind bevorzugte Zuschauer dieses unmenschlichen Spiels, bei dem das Absurde, die Hoffnung und der Tod Rede und Gegenrede wechseln. Die Figuren dieses so elementaren wie subtilen Tanzes kann der Geist nun analysieren, um sie danach anschaulich zu machen und selbst zu durchleben.
Die absurden Mauern[14]
Wie große Kunstwerke bedeuten tiefe Gefühle immer mehr, als ihnen bewusst ist. Die Beständigkeit einer Regung oder eines Widerwillens in einer Seele findet sich in den Gewohnheiten des Denkens und des Handelns wieder, sie setzt sich fort in Wirkungen, von denen die Seele selbst nichts weiß. Die großen Gefühle führen ihre – glanzvolle oder jämmerliche – Welt mit sich. Sie erhellen mit ihrer Leidenschaft eine geschlossene Welt, die ihrem Klima entspricht. So gibt es eine Welt der Eifersucht, des Ehrgeizes, des Egoismus oder des Großmuts. Eine Welt – das heißt: eine Metaphysik und eine Geisteshaltung. Was von den bereits deutlich unterscheidbaren Gefühlen gilt, das trifft noch viel mehr auf Regungen zu, die ihrem Grund nach ebenso unbestimmt sind und zugleich ebenso verworren und so «sicher», so fern und auch so «gegenwärtig» wie jene, die das Schöne uns vermittelt oder die das Absurde hervorruft.
Das Gefühl der Absurdität kann an jeder beliebigen Straßenecke jeden beliebigen Menschen anspringen. Es ist in seiner trostlosen Nacktheit, in seinem glanzlosen Licht nicht zu fassen. Doch ist gerade diese Schwierigkeit des Nachdenkens wert. Wahrscheinlich ist es wahr, dass uns ein Mensch immer unbekannt bleibt und es in ihm immer etwas Unauflösbares gibt, das sich uns entzieht. Praktisch aber kenne ich die Menschen, und ich erkenne sie an ihrem Verhalten, an der Gesamtheit ihrer Handlungen, an den Folgen, die ihre Anwesenheit im Leben hervorruft. Ebenso kann ich alle irrationalen Empfindungen, die sich nicht analysieren lassen, praktisch definieren und praktisch bewerten, indem ich die Summe ihrer Folgeerscheinungen in einer rationalen Ordnung zusammenfasse, alle ihre Erscheinungsformen erfasse und festhalte, ihre Welt nachzeichne. Mag ich einen Schauspieler auch hundertmal gesehen haben, persönlich kenne ich ihn darum offensichtlich nicht besser. Nehme ich jedoch alle Helden, die er verkörpert hat, zusammen und behaupte, ihn nach der hundertsten Rolle ein wenig besser zu kennen, so fühlt man, dass daran etwas Wahres ist. Dieses offenkundige Paradox ist nämlich auch ein Gleichnis. Es enthält eine Moral. Sie besagt, dass ein Mensch ebenso sehr aus seinen Vorstellungen wie aus seinen aufrichtigen Regungen zu erklären ist. Ebenso verhält es sich, einen Ton tiefer, mit den Gefühlen, die, im Herzen unzugänglich, sich teilweise verraten durch Handlungen, die sie beenden, und durch Geisteshaltungen, die ihnen zugrunde liegen. Man spürt gewiss, dass ich damit eine Methode definiere. Man spürt aber auch, dass es eine Methode der Analyse, nicht der Erkenntnis ist. Denn Methoden implizieren eine bestimmte Metaphysik, sie verraten gegen ihren Willen Schlussfolgerungen, die sie manchmal noch nicht zu kennen behaupten. So sind die letzten Seiten eines Buches bereits in seinen ersten enthalten. Dieser Knoten ist unvermeidlich. Die hier definierte Methode bekennt sich zu dem Gefühl, dass jede wirkliche Erkenntnis unmöglich ist. Wir vermögen nur Erscheinungsformen aufzuzählen und das Klima spürbar zu machen.
Dieses unfassbare Gefühl der Absurdität, vielleicht können wir es in den verschiedenartigen und doch verwandten Welten des Geistes, der Lebenskunst oder der Kunst überhaupt einholen. Das Klima der Absurdität steht am Anfang. Das Ende ist das absurde Universum und jene Geisteshaltung, die die Welt in ihrem eigenen Licht erhellt, um so ihr besonderes und unerbittliches Gesicht aufleuchten zu lassen, das sie zu erkennen vermag.
Alle großen Taten und alle großen Gedanken haben einen lächerlichen Anfang. Die bedeutenden Werke werden oft an einer Straßenbiegung oder im Eingang eines Restaurants geboren. So ist es auch mit der Absurdität. Mehr als irgendeine andere Welt verdankt die Welt des Absurden ihren Adel dieser niedrigen Herkunft. Antwortet ein Mensch auf die Frage, was er denke, in gewissen Situationen mit «nichts», so kann das Verstellung sein. Verliebte wissen das genau. Ist diese Antwort jedoch aufrichtig, entspricht sie dem sonderbaren Seelenzustand, in dem die Leere beredt wird, die Kette alltäglicher Gesten zerrissen ist und das Herz vergeblich das Glied sucht, das sie wieder zusammenfügt – dann ist sie gleichsam das erste Anzeichen der Absurdität.
Manchmal stürzen die Kulissen ein. Aufstehen, Straßenbahn, vier Stunden Büro oder Fabrik, Essen, Straßenbahn, vier Stunden Arbeit, Essen, Schlafen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, immer derselbe Rhythmus – das ist meist ein bequemer Weg.[15] Eines Tages aber erhebt sich das «Warum», und mit diesem Überdruss, in den sich Erstaunen mischt, fängt alles an. «Fängt an» – das ist wichtig. Der Überdruss steht am Ende der Handlungen eines mechanischen Lebens, gleichzeitig leitet er aber auch eine Bewusstseinsregung ein. Er weckt das Bewusstsein und fordert den nächsten Schritt heraus. Der nächste Schritt ist die unbewusste Rückkehr in die Kette oder das endgültige Erwachen. Schließlich führt dieses Erwachen mit der Zeit zur Entscheidung: Selbstmord oder Wiederherstellung. An sich hat der Überdruss etwas Widerwärtiges. Hier jedoch muss ich den Schluss ziehen, dass er gut ist. Denn mit dem Bewusstsein fängt alles an, und nur durch das Bewusstsein hat etwas Wert. Diese Feststellungen sind keineswegs originell. Sie liegen vielmehr auf der Hand, und für eine summarische Erkundung der Ursprünge des Absurden genügen sie einstweilen. Die einfache «Sorge»[16] ist aller Dinge Anfang.
So trägt uns im Alltag eines glanzlosen Lebens die Zeit. Stets aber kommt ein Augenblick, da wir sie tragen müssen. Wir leben auf die Zukunft hin: «morgen», «später», «wenn du eine Stellung haben wirst», «mit den Jahren wirst du’s verstehen».[17] Diese Inkonsequenzen sind bewundernswert, denn schließlich geht es ums Sterben. Es kommt gleichwohl ein Tag, da stellt der Mensch fest oder sagt, dass er dreißig Jahre alt ist. Damit beteuert er seine Jugend. Zugleich aber situiert er sich im Verhältnis zur Zeit. Er nimmt in ihr seinen Platz ein. Er erkennt an, sich an einem bestimmten Punkt einer Kurve zu befinden, die er eingestandenermaßen durchlaufen muss. Er gehört der Zeit, und bei jenem Grauen, das ihn dabei packt, erkennt er in ihr seinen schlimmsten Feind. Morgen erst, wünschte er sich, morgen, während doch sein ganzes Selbst sich dem widersetzen sollte. Dieses Aufbegehren des Fleisches ist das Absurde.[3]
Eine Stufe tiefer – die Fremdheit: wahrnehmen, dass die Welt «dicht», ahnen, wie sehr ein Stein fremd ist, auf nichts zurückzuführen, und mit welcher Intensität die Natur oder eine Landschaft uns verneinen kann. In der Tiefe jeder Schönheit liegt etwas Unmenschliches, und diese Hügel, der sanfte Himmel, die Umrisse der Bäume – sie verlieren im Augenblick den trügerischen Sinn, in den wir sie hüllten, und sind von nun an ferner als ein verlorenes Paradies. Die ursprüngliche Feindseligkeit der Welt kommt, durch die Jahrtausende hindurch, wieder auf uns zu. Eine Sekunde lang verstehen wir die Welt nicht mehr, denn jahrhundertelang haben wir in ihr nur die Bilder und Gestalten gesehen, die wir zuvor in sie hineingelegt hatten, und nun fehlen uns die Kräfte, von diesem Kunstgriff Gebrauch zu machen. Die Welt entgleitet uns, da sie wieder sie selbst wird. Die von der Gewohnheit verstellten Kulissen werden wieder, was sie wirklich sind. Sie entfernen sich von uns. Wie es Tage gibt, an denen man unter dem vertrauten Gesicht einer Frau jene andere wie eine Fremde wiederentdeckt, die man vor Monaten oder Jahren geliebt hatte, so werden wir vielleicht gerade das begehren, was uns plötzlich so einsam macht. Doch ist die Zeit dafür noch nicht gekommen. Eines nur: diese Dichte und diese Fremdheit der Welt sind das Absurde.
Auch die Menschen sondern Unmenschliches ab. In gewissen hellsichtigen Stunden lässt das mechanische Aussehen ihrer Gesten, ihre sinnlose Pantomime alles um sie herum stumpfsinnig erscheinen. Ein Mensch spricht hinter einer Glaswand ins Telefon; man hört ihn nicht, man sieht nur sein sinnloses Mienenspiel: man fragt sich, warum er lebt.[18] Auch dieses Unbehagen vor der Unmenschlichkeit des Menschen selbst, dieser unberechenbare Sturz vor dem Bilde dessen, was wir sind, dieser «Ekel», wie ein Autor unserer Tage es nennt[19], ist das Absurde. Und auch der Fremde, der uns in gewissen Augenblicken in einem Spiegel begegnet, der vertraute und doch beunruhigende Bruder, den wir auf unseren eigenen Fotografien wiederfinden, ist das Absurde.
Endlich komme ich zum Tod und zu unserem Gefühl ihm gegenüber. Darüber ist schon alles gesagt worden, und wir sollten es vermeiden, pathetisch zu werden. Man kann jedoch nie genug darüber staunen, dass alle so leben, als ob niemand «wüsste». Tatsächlich gibt es vom Tod keinerlei Erfahrung. Erfahren im eigentlichen Sinne ist nur, was erlebt und bewusstgemacht wurde. Hier kann man bestenfalls von der Erfahrung des Todes der anderen sprechen.[20] Das ist ein Ersatz, eine geistige Sicht, die uns nie sehr überzeugt hat. Diese melancholische Konvention kann nicht überzeugend sein. Das Grauen rührt in Wirklichkeit von der rechnerischen Seite des Ereignisses her.[21] Wenn die Zeit uns erschreckt, dann, weil sie den Beweis führt, die Lösung kommt erst hinterher. Alle schönen Gespräche über die Seele bekommen hier, wenigstens vorübergehend, durch die Neunerprobe einen Beweis ihres Gegenteils. Aus dem leblosen Körper, auf dem eine Ohrfeige kein Mal mehr hinterlässt, ist die Seele verschwunden. Diese elementare und endgültige Seite des Abenteuers ist der Inhalt des absurden Gefühls. Im tödlichen Licht dieses Verhängnisses tritt die Nutzlosigkeit in Erscheinung. Keine Moral und keine Anstrengung lassen sich a priori vor der blutigen Mathematik rechtfertigen, die über uns herrscht.
Noch einmal: all dies ist wieder und wieder gesagt worden. Ich beschränke mich hier auf eine flüchtige Klassifizierung und auf die Andeutung dieser einleuchtenden Themen. Sie durchziehen alle Literatur und alle Philosophie. Auch das tagtägliche Gespräch lebt von ihnen. Es geht nicht darum, sie aufs Neue zu erfinden. Wir müssen uns lediglich dieser evidenten Tatsachen versichern, um uns dann über das Grundproblem befragen zu können. Ich wiederhole es noch einmal: Was mich interessiert, sind nicht so sehr die absurden Entdeckungen. Es sind deren Konsequenzen. Wenn man dieser Tatsachen sicher ist – was muss man aus ihnen schließen und wie weit muss man gehen, um nicht auszuweichen? Muss man freiwillig sterben oder trotz alledem hoffen? Zuvor jedoch müssen wir dieselbe skizzenhafte Bestandsaufnahme auf der Ebene des Verstandes vornehmen.
Der erste Schritt des Geistes besteht darin, Wahres von Falschem zu unterscheiden. Doch sobald das Denken über sich selbst reflektiert, stößt es auf einen Widerspruch. Es wäre eine unnötige Mühe, hier noch überzeugen zu wollen. Seit Jahrhunderten hat es niemand klarer und eleganter dargelegt als Aristoteles: «Alle solche Behauptungen geraten aber auch in die vielerwähnte Folgerung, dass sie sich selbst aufheben. Denn wer alles für wahr erklärt, der erklärt damit auch die der seinen entgegenstehende Behauptung für wahr, also seine eigene für falsch (da jene des Gegners seine eigne nicht für wahr erkennt). Wer aber alles für falsch erklärt, der erklärt auch seine eigene Behauptung für falsch. Wollte aber der eine die Behauptung des Gegners ausnehmen, als ob diese allein nicht wahr sei, der andere seine eigene, als ob diese allein nicht falsch sei, so würden sie nichtsdestoweniger dahin kommen, unendlich viele wahre und falsche Behauptungen annehmen zu müssen. Denn auch die Behauptung, welche erklärt, dass die wahre Behauptung wahr sei, würde selbst wahr sein, und dies würde ins Unendliche fortgehen.»[22]
Dieser circulus vitiosus ist nur der erste in einer Reihe, bei der der Geist, der sich über sich selbst beugt, in einen schwindelerregenden Wirbel gerät. Gerade die Einfachheit dieser Paradoxa macht sie unauflösbar. Welche Wortspiele und Verrenkungen die Logik auch anstellen mag – verstehen heißt vor allem vereinen. Das tiefe Verlangen des Geistes trifft sich selbst bei seinen verwegensten Schritten mit dem unbewussten Gefühl des vor seine Welt gestellten Menschen: das Bedürfnis nach Vertrautheit, das Verlangen nach Klarheit. Die Welt verstehen heißt für einen Menschen, sie auf das Menschliche zurückführen, ihr sein Siegel aufdrücken. Die Welt der Katze ist nicht die Welt des Ameisenbären. Nichts anderes besagt der Gemeinplatz: «Alles Denken ist anthropomorph.» So kann der Geist, der die Wirklichkeit verstehen will, sich erst dann zufriedengeben, wenn er sie auf Denkbegriffe zurückgeführt hat. Würde der Mensch erkennen, dass auch das Universum lieben und leiden kann, er wäre versöhnt. Wenn das Denken im Wechselspiel der Erscheinungen ewige Beziehungen entdecken würde, die diese Erscheinungen und sich selbst in einem einzigen Prinzip zusammenfassen könnten, dann könnten wir von einem Glück des Geistes sprechen, an dem gemessen der Mythos der Seligen nur ein lächerlicher Abklatsch wäre. Diese Sehnsucht nach Einheit, dieses Verlangen nach Absolutem enthüllt die wesentliche