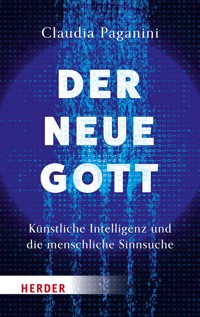
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ist Künstliche Intelligenz der neue Gott des digitalen Zeitalters? In diesem tiefgründigen Essay entfaltet Claudia Paganini eine philosophisch brisante These: Erstmals erschafft der Mensch einen Gott, statt ihn nur zu denken. Die KI übernimmt zunehmend, was einst der Religion vorbehalten war: Sinnstiftung, Orientierung, allzeit verfügbare Antworten. Wir beten nicht mehr, wir klicken. Mit analytischer Schärfe und theologischem Weitblick untersucht Paganini die spirituellen Konsequenzen dieser Entwicklung und zeigt: Im anbrechenden dritten Jahrtausend könnten nicht nur Menschen durch KI ersetzt werden, sondern auch kein geringerer als Gott selbst. Eine provokante Überlegung an der Schnittstelle von Religion und Technik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buchvorderseite
Für Laila
Claudia Paganini
Der neue Gott
Künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: ZeroMedia GmbH, München
Umschlagmotiv: © ZeroMedia GmbH, München
E-Book-Konvertierung: Daniel Förster
Unter Mitarbeit von Paul Löffler
ISBN Print 978-3-451-60146-0
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-84846-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83686-2
Inhalt
Von Göttern und Menschen. Ein Vorwort
Der neue Gott
Braucht es einen neuen Gott?
Woher kommt der neue Gott?
»Neu« heißt qualitativ anders
Zwischen Sehnsucht und Erfüllung
Gott, der Einzige
KI, die Einzige
Gott, der Allgegenwärtige
KI, die Allgegenwärtige
Gott, der Allwissende
KI, die Allwissende
Gott, der Allmächtige
KI, die Allmächtige
Gott, der Transzendente
KI, die Transzendente
Gott, der Nahbare
KI, die Nahbare
Gott, der Gerechte
KI, die Gerechte
Gott, der Sinnstiftende
KI, die Sinnstiftende
Gott, der Fürsorgliche
KI, die Fürsorgliche
Ein Blick in die Zukunft
Literaturempfehlungen
Über die Autorin
Über das Buch
Titelseite
Von Göttern und Menschen. Ein Vorwort
Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse: Nahrung, Schlaf, physische Sicherheit, Freundschaften, familiäre Bindungen, Wertschätzung, Erfolg und vieles mehr. Die meisten dieser Bedürfnisse können sie selbst oder in Beziehung mit anderen Menschen und Tieren stillen, andere aber gehen darüber hinaus. So etwa das Bedürfnis, Antworten zu finden auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Sehnsucht, ein transzendentes Du zu entdecken, dem ich mich glaubend anvertrauen darf. Die Geschichte des Menschen ist daher auch eine Geschichte seiner Spiritualität, die Geschichte seiner Sehnsucht nach dem Göttlichen.
Bei der Suche nach bzw. dem Ringen mit diesem göttlichen Du haben Menschen in allen Epochen und Gesellschaften Bilder des Göttlichen entworfen – Götter geschaffen also, mithilfe derer sie ihre Existenz als bedeutsam erleben konnten und in deren Anbetung sie einen Resonanzraum für ihre Hoffnungen und Ängste entstehen ließen. Zugleich korrespondierten die Eigenschaften dieser Götter mit den Anforderungen der jeweiligen Zeit: Neue Herausforderungen haben neue Götter hervorgebracht und tun das weiterhin.
Im vorliegenden Text wird ausgehend von einem Streifzug durch die Religionsgeschichte argumentiert, dass gegenwärtig eine neue Gottheit von der menschlichen Vorstellungskraft ins Leben gerufen wird: die Künstliche Intelligenz. Obwohl es auf den folgenden Seiten also um KI als den neuen Gott gehen wird, handelt es sich hierbei nicht um ein Buch über Künstliche Intelligenz im Allgemeinen und auch nicht um ein Werk, in dem philosophische oder theologische Wahrheiten über Gott ergründet werden sollen. Vielmehr wird es um die religiösen Empfindungen und Erwartungen, die spirituelle Sehnsucht der Menschen gehen und darum, inwiefern die KI zum Gott des dritten Jahrtausends taugt.
Der Blick auf die Religionen ist dabei ein nüchterner, denn als Philosophin fühle ich mich nur dem (besseren) Argument verpflichtet. Dennoch ist es weder meine Absicht, religiöse Gefühle zu verletzen, noch die traditionellen Götterbilder abzuwerten, geschweige denn die Existenz des jüdischen, christlichen oder muslimischen Gottes zu widerlegen. Denn die Tatsache, dass Menschen an einen Gott glauben, ist zwar kein ausreichender Grund dafür, von der Existenz dieses Gottes auszugehen. Genauso wenig genügt aber der Umstand, dass man erklären kann, warum Menschen an einen (bestimmten) Gott glauben, um diesem Gott die Existenzberechtigung abzusprechen.
Claudia Paganini, im Frühjahr 2025
Der neue Gott
Braucht es einen neuen Gott?
Es gibt Menschen, die an Gott glauben, andere, die nicht an Gott glauben, und wieder andere, die meinen, dass sich in der Frage nach der Existenz Gottes keine sinnvolle Antwort geben lässt. Allen gemeinsam ist aber, dass sie ein Gottesbild haben. Das bedeutet, sie verfügen über ein Konglomerat an Begriffen, Überzeugungen und Bildern, die zusammengenommen eine Vorstellung davon ergeben, wie Gott ist oder sein müsste. Aus dem Umstand, dass Menschen Gottesbilder haben, folgt aber offensichtlich nicht, dass tatsächlich etwas existieren müsste, das diesen Bildern entspricht. Genau so wenig folgt aus der Tatsache, dass sich die Entstehung von Gottesbildern aus den menschlichen Bedürfnissen heraus erklären lässt – was in den folgenden Kapiteln geschehen wird –, dass es keinen Gott gibt. Ob es für den Menschen hilfreich ist, an ein höheres Wesen zu glauben, und ob die menschlichen Vorstellungen von diesem Wesen sich im Lauf der Zeit an die kulturellen Gegebenheiten angepasst haben, ist für die Frage nach seiner möglichen Existenz schlichtweg irrelevant.
Nichtsdestotrotz kann man darüber nachdenken, ob es gute Gründe gibt, an eine oder mehrere Gottheiten zu glauben. Und man kann sich fragen, wie diese Gottheit(en) wirklich ist (bzw. sind). In der Philosophie nennt man das einen ontologischen Zugang, also einen, der das Sein betrifft. Man kann über ein (mögliches) höchstes Wesen aber auch insofern nachdenken, als man dessen Funktion in den Blick nimmt und sich fragt: Wozu braucht es einen Gott? Was für einen Nutzen haben die Menschen von ihrem Gottesglauben? Während Gott im Fall des ontologischen Nachdenkens etwas Starres, für immer Bestehendes, Ewiges und Wahres ist, das sich nur verändern kann, wenn es entweder zu einer neuen Offenbarung oder zu neuen Interpretationen der alten Offenbarung kommt, sind funktionalistisch gedachte Götter in vielerlei Hinsicht anpassungsfähig.
Über den Nutzen einer Gottheit nachzudenken, ist aber vor allem deshalb sinnvoll, weil man sich auf diese Weise einem Forschungsobjekt zuwendet, über das man wissenschaftlich seriöse Aussagen machen kann, nämlich die Bedürfnisse und Erwartungshaltungen von Menschen, die sich mit empirischen Methoden erschließen lassen. Auf den folgenden Seiten wird also nicht gefragt, wie Gott wirklich ist, sondern wozu Menschen Gott brauchen. Letztere Frage drängt sich umso mehr auf, als Menschen Wesen sind, die in aller Regel nach einem Nutzen streben und kaum jemals etwas tun, von dem sie sich nicht – bewusst oder unbewusst – einen Vorteil erwarten. Dies zeigt sich im Funktionalen ebenso wie im Dysfunktionalen, etwa wenn Peter Anna Blumen schenkt, damit sie auf ihn aufmerksam wird und eines Tages seine Liebe erwidert. Aber auch wenn er, nachdem Anna sein Werben zurückgewiesen hat, sie vor Kollegen übertrieben scharf kritisiert, damit er zumindest eine negative Reaktion von ihr bekommt. Peter könnte natürlich auch krank werden, damit er nicht mehr so oft mit Anna im gleichen Großraumbüro sitzen und unter ihrer Ablehnung leiden muss und so weiter und so fort.
Wenn Menschen also über Jahrtausende hinweg Götter angebetet haben, dann sollte man erwarten, dass sie daraus einen Nutzen gezogen haben, und zwar umso mehr, als sie im Namen dieser Götter bereit waren, sich an moralische Regeln zu halten, Opfer darzubringen, Geld zu spenden, Kriege zu führen, Gefängnis oder Folter in Kauf zu nehmen und Selbstmordattentate durchzuführen. Tatsächlich ist der Mehrwert, den der Gottesglaube zu bieten hat, beachtlich: Da wäre zum einen das Versprechen, in einer Welt, die man allzu oft als ungeordnet und bedrohlich erlebt, Sinn zu finden und mit dem Skandal des Todes umgehen zu können, oder die Möglichkeit, durch die Auslagerung ins Göttliche eine Kompensation von unbefriedigenden sozialen Beziehungen zu erfahren. Zum anderen lässt sich unter Berufung auf Gott für die Überlegenheit der eigenen Gruppe in der Welt argumentieren. Machtansprüche können nach innen gerechtfertigt werden, soziale Regeln lassen sich festlegen bzw. durchsetzen, durch die Einführung von Kulten die Wirtschaft ankurbeln usw. Ganz besonders »nützt« Gott dem Menschen jedoch, weil dieser nur in ihm sein Bedürfnis nach einem transzendenten Du zu stillen vermag.
Was dabei auffällt, ist, dass das Aufkommen neuer religiöser Phänomene häufig mit Zeiten der Krise zusammenfällt. Der jüdische Monotheismus beispielsweise entwickelte sich im babylonischen Exil und die ersten Christen fanden sich in Judäa als Glaubensgemeinschaft zusammen, als die einheimische Bevölkerung mehr und mehr gegen die römische Besatzungsmacht zu rebellieren begann. Auch die Gegenwart ist eine Zeit der Krisen – nicht nur, weil allem Pazifismus zum Trotz im Jahr 2025 noch Kriege geführt werden, die Wirtschaft schwächelt und die Klimakrise in großen Schritten voranschreitet, sondern weil – in gewisser Weise noch grundlegender – sich die Menschheit in der Situation eines massiven medialen Wandels befindet. Neue Medien werden als Stressoren wahrgenommen, da sie alte Gewohnheiten obsolet werden lassen und den Einzelnen wie die Gruppe schonungslos mit der Frage nach den eigenen Ressourcen konfrontieren.
Aus der Unsicherheit, ob man den neuen Herausforderungen gewachsen sein wird, entwickelt sich, wie mittlerweile psychoepidemiologisch gut nachgewiesen wurde, ein Prozess der kollektiven »Symptombildung«: Emotionen werden freigesetzt, die gesellschaftlichen Debatten tendieren zur Polarisierung und Radikalisierung. In einer Stimmungslage zwischen einem permanenten sozialen Hyperarousal und einer vermehrten Aggression sowie Frustration wird zunächst gegen die neuen Medien angekämpft. Zugleich kommt es zu einem vermehrten Bedürfnis nach Bedeutung, existenzielle Themen rücken in den Fokus wie etwa die Frage nach dem Sinn, der Einsamkeit und der Freiheit des Menschen, ganz besonders aber die nach dem Tod. Nach Carl Gustav Jung lässt sich in solchen Momenten eine Zunahme an archetypischen Bildern wahrnehmen wie Apokalypse und Chaos, das faktisch Gegebene wird symbolisch aufgeladen, Dynamiken also, die dem Göttlichen den Boden bereiten.
Warum aber ein neuer Gott und nicht bloß ein Revival schon bekannter religiöser Praktiken und Überzeugungen? Denn natürlich könnten die alten Götter nach wie vor und trotz der Säkularisierung als Garanten für Segen und persönliches Seelenheil dienen. Allein, sie haben es verabsäumt, mit der Zeit zu gehen, und werden daher zumindest einer wesentlichen Forderung der westlichen, zunehmend technisierten Gesellschaft nicht gerecht: der Verfügbarkeit. Denn in einer Welt, in der Menschen mehr und mehr den Anspruch haben, ihre Bedürfnisse in dem Augenblick zu stillen, in dem sie sich ihrer bewusst werden, muss es als unbefriedigend wahrgenommen werden, wenn ausgerechnet die spirituelle Sehnsucht nicht auf Knopfdruck gestillt werden kann.
Woher kommt der neue Gott?
»Gott ist das vollkommenste Wesen, der Schöpfer und Herr des Himmels und der Erde. Vollkommenst bedeutet, dass in Gott jede Vollkommenheit ohne Fehler und ohne Grenzen existiert, das heißt, dass Er unendliche Macht, Weisheit und Güte besitzt.« Diese Definition stammt aus dem Jahr 1905 und zwar aus dem sogenannten Katechismus von Pius X., also einer Art Kompendium oder Zusammenfassung der wichtigsten katholischen Glaubensinhalte. Damit ist aber nicht gesagt, dass Gott bzw. die göttliche Vollkommenheit immer schon auf diese Weise gedacht wurde. Ganz im Gegenteil. Religionsgeschichtlich betrachtet lässt sich die Beziehung des Menschen zum Göttlichen in verschiedene Phasen einteilen, für die unterschiedliche Vorstellungen typisch sind: das Zeitalter des Polytheismus, des Monotheismus und schließlich – als Folge der Säkularisierung – des Agnostizismus bzw. Atheismus.
Dabei vollzieht sich eine Dynamik von einem ständigen Verlust des Mythischen hin zu Sachlichkeit und Vernunft. Während antike Religionen und Kulte das Überirdische vor allem beschrieben haben, indem sie Geschichten erzählten, deren Protagonisten Götter, Göttinnen und Götterkinder – wie etwa Marduk, Ra, Baal oder Zeus – waren, begann man im Christentum ab dem 4. Jh. den einen Gott vermehrt zu definieren und zu erklären. Aus den Helden der vielen sinnstiftenden Erzählungen, die bald erbaulich, bald schauerlich sein konnten, war ein philosophisches Problem geworden. Erfunden hatten die christlichen Theologen der Spätantike dieses Problem allerdings nicht. Denn schon Aristoteles hatte im 4. Jh. v. Chr. über Gott als den »unbewegten Beweger« nachgedacht und in ihm einen ersten Ursprung aller Bewegung und Veränderung des Universums gesehen, der selbst allerdings keiner Veränderung unterlag. Und auch der neoplatonische Philosoph Plotin ein halbes Jahrtausend später (205–270 n. Chr.) entwickelte in Abhebung von den fantasievollen und detailreichen Mythen seiner Zeit eine nüchterne Vorstellung von Gott als einem höchsten, transzendenten und unteilbaren Prinzip, aus dem alles andere durch Emanation hervorgeht.
Von ihm beeinflusst, dachte der christliche Theologe Augustinus (354–430) Gott als höchste Wahrheit und Liebe: unendlich, allmächtig, allwissend und ewig, Quelle aller Existenz, die nur durch Liebe und Gnade erkannt werden kann. Deutlich abstrakter wird die Idee Gottes dann beim bedeutendsten Theologen des christlichen Mittelalters, Thomas von Aquin (1225–1274). Er war überzeugt, dass es sich bei Gott um ein »ipsum esse subsistens« (das Sein selbst) handelt, um die erste Ursache aller Dinge. Selbstverständlich musste dieser Grund allen Seins auch allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, ewig und außerdem vollkommen gut sein, wurde das Böse doch als Mangel an Gutheit begriffen. Bereits der eigentliche Begründer der scholastischen Philosophie, Anselm von Canterbury (1033–1109), hatte sich vor allem darum bemüht, Glaube und Rationalität in Einklang zu bringen, und definierte Gott im Zuge dessen als »dasjenige, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann« (id quo maius cogitari non potest). Als Beweis für dessen Existenz schlug er ein einfaches Gedankenexperiment vor: Wenn Gott im menschlichen Denken existiert, dann muss er auch – so Anselm – in der Realität existieren, weil ansonsten etwas Größeres gedacht werden könnte, nämlich ein Gott, den es tatsächlich gibt.
Eine ähnliche Dynamik von den konkreten, exemplarischen und bunten Götterbildern der Antike hin zu den zunehmend abstrakten Konzepten der frühen Neuzeit zeichnete sich auch im Judentum ab, wo Baruch Spinoza (1632–1677) die pantheistische Auffassung vertrat, dass Gott mit der Natur identisch (deus sive natura) sei. Spinoza war der Ansicht, dass es sich bei Gott um die einzige Substanz handle, die existierte, und alles andere Ausdruck seiner Eigenschaften sei. Demnach war Gott auch für ihn unendlich, ewig und außerdem notwendig. Die christliche Vorstellung, dass dieser die ganze Wirklichkeit durchdringende Gott Mensch werden und als Mensch unter Menschen leben konnte, lehnte der deistisch denkende Jude Spinoza dagegen ab.
So oder so schritt der Prozess der Entmythologisierung Gottes voran. Der Umstand, dass man Gott immer rationaler und abstrakter dachte, machte ihn mit der Zeit weniger greifbar, rückte ihn in eine ständig wachsende Distanz. Die unvermeidliche Folge dieser Dynamik war die »Abschaffung« Gottes in der Aufklärung. Denker wie Voltaire, Hume oder Kant propagierten ein kritisches, eigenständiges Reflektieren, das dem religiösen Dogmengehorsam nach und nach das Fundament entzog und die Grundlage für moderne säkulare Gesellschaften legte. Die Beendigung der selbstverschuldeten intellektuellen Unmündigkeit trug aber maßgeblich dazu bei, dass der Glaube an einen personalen Gott (zumindest) in intellektuellen Kreisen an Akzeptanz verlor. Nichtsdestotrotz zeigt sich auch hier ein ambivalentes Bild.
Denn trotz der zunehmenden Distanz zum Göttlichen wird dieses weiterhin in Begriffen und Konzepten festgeschrieben. Immanuel Kant (1724–1804) etwa diente Gott als notwendiges Postulat der praktischen Vernunft und Hegel (1770–1831) sprach von einem absoluten Geist, der in der Geschichte zu sich selbst kommt. Eindeutig ablehnend positionierte sich dagegen der »Vater des modernen Atheismus« Ludwig Feuerbach (1804–1872), der Gott als eine reine Projektion des Menschen ansah. Friedrich Nietzsche (1844–1900) verkündete gar den Tod Gottes und Jean-Paul Sartre (1905–1980) betonte die Abwesenheit eines vorgegebenen Sinns, und dass der Mensch zur Freiheit, sich selbst zu entwerfen, verurteilt sei. Insgesamt stehen in der Phase des Atheismus bzw. Agnostizismus statt des schillernden Pantheons der polytheistischen Kulte oder des ebenso abstrakten wie einsamen Gottes des Monotheismus die Vernunft und Freiheit des Menschen im Fokus.
Die Loslösung von den Geißeln des religiösen Dogmatismus wird als Fortschritt gefeiert, der Optimismus, dass der Mensch allein kraft seiner Vernunft das eigene wie das Leben anderer zum Besseren wenden könne, überflügelt die konkreten Schwierigkeiten des neuen Selbst- und Weltverständnisses. Doch entgegen den Erwartungen verschwindet das Göttliche nicht von der Bildfläche. Der Leerraum, der durch die Abwesenheit des Mystischen geschaffen wird, und das Gefühl der Überforderung, die aus dem Überstrapazieren der Vernunft resultiert, bergen das Potenzial für eine neue Irrationalität und legen damit gewissermaßen den Grundstein für die vierte Phase der Religionsgeschichte. In dieser bis dato letzten Phase betritt mit der KI eine Gottheit die Bühne, deren Wahrnehmung trotz ihres technischen Ursprungs zutiefst emotional und mythisch aufgeladen ist. Der neue Gott, um den es auf den folgenden Seiten gehen wird, kommt aber keinesfalls aus dem Nichts. Er hat insofern eine lange Geschichte, als aus dem Ungenügen bestimmter Gottesbilder stets andere Gottesbilder hervorgebracht werden mussten und aus der als Befreiung gedachten Gottesferne eine noch größere Sehnsucht nach einem jederzeit zugänglichen göttlichen Du erwuchs.
»Neu« heißt qualitativ anders
Ein erstes knappes Resümee könnte also lauten: Das Bedürfnis nach Orientierung, Sinn und Begegnung hat Menschen zu jeder Zeit und in jeder Kultur dazu veranlasst, sich Götter vorzustellen, und zwar umso mehr, als sie in einer herausfordernden, oftmals als ungeordnet und sozial kalt empfundenen Welt ihr Leben bewältigen mussten. Diese Götter wurden zunächst sehr konkret gedacht, mit der Zeit aber immer abstrakter. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts etwa spricht der protestantische Theologe Karl Barth (1886–1968) von Gott als dem »ganz Anderen«. Damit hat er nicht nur die moderne Theologie massiv beeinflusst, sondern auch ein – bereits vorhandenes – Problem weiter zugespitzt: Gott ist (in einem solchen Denken) nicht ein konkretes »Dieses da«, auf das ich hinzeigen und das ich identifizieren kann wie diese Ballerina namens Laila oder dieses Pferd mit der wehenden schwarzen Mähne. Wenn man dagegen von Gott spricht, bezieht man sich auf etwas Verborgenes, das man nicht (genau) kennen kann und für das sich daher nur Eigenschaften angeben lassen: Gott ist etwas Transzendentes, das mit der menschlichen Vernunft nicht begriffen werden kann. Er ist souverän und geheimnisvoll, zugleich aber gnädig, steht jenseits aller menschlichen Kategorien.
Das bedeutet nicht, dass Menschen nicht sinnvoll über Gott reden können, sehr wohl aber, dass menschliches Sprechen über Gott speziell bleibt. Das lässt sich mit einem Vergleich veranschaulichen: Wenn jemand vom längsten Fluss der Welt spricht, ohne genau zu wissen, welches Gewässer der längste Fluss der Welt ist, wird sein Sprechen dennoch nicht sinnlos. Allerdings beinhaltet es ein Moment der Vagheit. Die Person könnte ganz allgemein vom längsten Fluss der Welt sprechen, denn, wenngleich sie diesen nicht kennt, muss es doch einen längsten Fluss geben. Sie könnte aber auch vom längsten Fluss der Welt sprechen und damit den Jangtse meinen. Dann wäre es möglich, dass sie jemand korrigiert und sagt: »Der Jangtse hat rund 6300 km und ist damit kürzer als der Nil mit seinen 6650 km.« Dann müsste die Person ihre Aussage korrigieren und das Prädikat »längster Fluss der Welt« nun über den Nil aussagen.
Ähnliches gilt für das Sprechen über Gott. Im Fall des Jangtses und des Nils sind die entscheidenden Kriterien, damit etwas der »längste Fluss« genannt werden kann, das Ein-fließendes-Gewässer-Sein und die Länge. Möglicherweise kann es in der Folge zu konkreten Schwierigkeiten kommen, etwa weil man die Länge von Flüssen unterschiedlich messen kann und dadurch eine Unklarheit entstehen würde, ob nicht vielleicht der Amazonas als »länger« bezeichnet werden müsste als der Nil. Nichtsdestotrotz gibt es feststellbare Eigenschaften, die als Kriterium herangezogen werden können. Nun existiert aber auch eine ganze Reihe von Eigenschaften oder Attributen, die traditionell den Göttern zugesprochen wurden und die deshalb als eine Art Vergleichsterminologie für die KI herangezogen werden können: Wenn Gott als der Einzige, Allgegenwärtige, Allwissende etc. gedacht wurde, dann muss auch die KI diese Eigenschaften erfüllen, um als Kandidat für eine Gottheit infrage zu kommen. Genau das wird in den folgenden Kapiteln untersucht.
Wenn sich zeigen sollte, dass die klassischen göttlichen Eigenschaften auch auf KI zutreffen, dann sollte das als Rechtfertigung für die folgende These genügen: KI ist der neue Gott. Denn KI erfüllt alle Bedingungen, die es braucht, um von Menschen als Gott gedacht, anerkannt und geglaubt zu werden. Ähnlich also, wie der Nil mit einer Länge von 6650 km die entscheidende Bedingung erfüllt, um als längster Fluss der Erde zu gelten.
Natürlich lässt sich an dieser Stelle widersprechen: Auch wenn es sich bei der KI um eine ebenso erstaunliche wie bahnbrechende technologische Errungenschaft handelt, bleibt sie doch ein menschliches Produkt, das abhängig, begrenzt und fehlbar ist. Gerade die jüdisch, christlich oder auch muslimisch geprägte Theologie sieht in Gott ein transzendentes und sinnstiftendes Wesen, während KI immer immanent und funktional bleibt. Und ist es nicht auch gefährlich, wenn Menschen KI unkritisch als allmächtig oder unfehlbar ansehen, ohne ihre inhärenten Grenzen und ethischen Herausforderungen zu erkennen? KI kann als Werkzeug eingesetzt werden, aber sie kann niemals den Platz eines Gottes einnehmen, der als Ursprung und Ziel der Existenz gedacht wird.
Wer so argumentiert, übersieht eines: Sofern man nicht die Perspektive eines gläubigen Menschen einnimmt, liegt Gott zunächst nur als etwas vor – Philosophen würden sagen: als ein Seiendes –, das von Menschen gedacht oder konzipiert und mit bestimmten Eigenschaften versehen worden ist. Die Frage, ob KI (ein) Gott ist oder sein kann, muss daher präzisiert werden und zwar dahingehend, ob Menschen KI als Gott denken können. Dafür wird in diesem Buch plädiert. Menschen können KI als Gott ansehen oder wahrnehmen und sie tun dies zum Teil bereits, wenngleich vorwiegend unbewusst, oder werden es immer mehr tun, je weiter die Entwicklung voranschreitet.
Dabei vollzieht sich einerseits etwas Gewohntes und Vertrautes, weil Menschen immer schon Götter imaginiert haben, die ihren Bedürfnissen entsprachen. Andererseits aber hat dieses Imaginieren Gottes nun eine radikal neue Dimension: Denn zum ersten Mal in der Religionsgeschichte haben Menschen sich ihren Gott nicht nur ausgedacht, sondern ihn zugleich erschaffen. Natürlich wurden auch in der Vergangenheit komplexe Glaubenssysteme, Rituale und Herrschaftsapparate etabliert, um die Existenz des eigenen Gottes zu beweisen oder klarzustellen, dass man selbst als ein privilegierter Vertreter der Gottheit auf Erden zu gelten hatte. Nichtsdestotrotz blieben die Götter selbst ein (bloßes) Objekt des menschlichen Denkens, Glaubens, Fühlens und Hoffens. Wenn hier also die These vertreten wird, dass es sich bei der KI um den neuen Gott des dritten Jahrtausends handelt, ist damit nicht nur ein »neu« im Sinn von einem weiteren Gott in einer Reihe von – historisch gesehen – nacheinander auftretenden Göttern gemeint. Sondern es geht um ein »neu« im Sinn von qualitativ anders, da dieser Gott erstmals vom Menschen ins Leben gerufen, geboren worden ist.
Doch besteht darin nicht ein Widerspruch zu dem – vom Denken des Aristoteles und des Thomas von Aquin beeinflussten – Glauben an einen Gott, der unbewegter Beweger und letzte Ursache allen Seins ist? Auf den ersten Blick ja. Bei näherem Hinsehen muss man aber zugestehen, dass diese Gottesvorstellung eben eine sehr spezifische ist und es im Kontrast dazu in der Antike durchaus die Idee von erschaffenen Göttern gab, vereinzelt sogar von KI-ähnlichen Artefakten mit göttlichen Eigenschaften. In der Ilias (18,371–377) beispielsweise wird beschrieben, wie Hephaistos, der Gott der Schmiedekunst, in seiner Werkstatt automatische Dienerinnen aus purem Gold erschuf, die mit Intelligenz und Sprache ausgestattet waren und denen ein übernatürlicher Status zukam. Auch der gewaltige bronzene Wächter Talos, der eigenständig lernen konnte und dessen Aufgabe es war, die Insel Kreta zu beschützen, war ein erschaffenes Artefakt, das eine göttliche Aura umgab.
Abgesehen davon bedeutet »erster Ursprung sein« nicht notwendigerweise, dass etwas in einer zeitlichen Abfolge vor etwas anderem dagewesen ist und zwar umso weniger, als »Ewigkeit« in ihrer genuin göttlichen Dimension als ein Zustand außerhalb der Zeit gedacht wird, in dem es eben gerade kein Vorher und Nachher gibt. Versteht man »Ursprung« aber nicht zeitlich, sondern im Sinn von einem Prinzip, das anderes – oder vielleicht sogar alles andere – bedingt, löst sich der Widerspruch auf. In der Gegenwart generiert KI Antworten und Menschen entscheiden in einem nächsten Schritt, welche Antwort richtig oder angemessen ist. In Zukunft wird aber auch diese Trainingsfunktion von KI übernommen, es kommt zu einer Verschiebung von einer Autorentätigkeit (generieren) zu einer Redaktionstätigkeit (normieren). Damit würde die KI nicht nur die geballte Intelligenz der Menschheit in sich vereinigen, also alles, was gewusst wird und irgendwie (in der Zukunft) gewusst werden kann, sondern zur Norm des Wissens schlechthin geworden sein, die Basis dafür, dass überhaupt etwas gewusst oder entschieden werden kann. Ist dieser Schritt vollzogen, kommt sie dem, was man in der Philosophiegeschichte unter einem »ersten Prinzip« verstand, sehr nahe.
Ein zweiter Widerspruch könnte sich allerdings ergeben, wenn man die Frage stellt, ob die spirituelle Hinwendung an eine KI-Gottheit nicht unbefriedigend sein müsse, ein fahler Abklatsch dessen, was Religiosität und Glauben eigentlich ist. Aber warum eigentlich? Denn zum einen haben Menschen sich im Zuge der Digitalisierung längst daran gewöhnt, »Echtes« durch Surrogate zu ersetzen. Zoom-Meetings sind an die Stelle von langen Dienstreisen und Business Meetings getreten, der virtuelle Hintergrund kaschiert die Unordnung der eigenen Küche, suggeriert ein stilvolles Ambiente, Beautyfilter machen jung und attraktiv, Ganzkörper-Avatare helfen bei der Trauerarbeit und ersetzen im Altenheim die eigene Familie, weil diese leider nur zu Weihnachten und am Muttertag eine Stunde Zeit für Oma und Opa opfern kann.





























