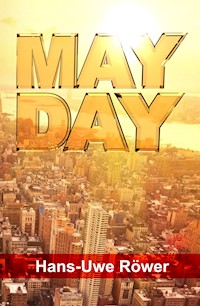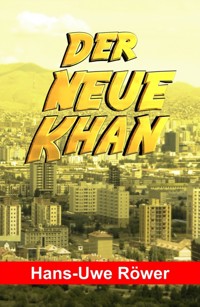
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
New York im Jahre 2136: Die Technik ist fortgeschritten und die politischen und wirtschaftlichen Interessen haben sich ausschließlich auf eine konsumorientierte Massengesellschaft konzentriert. Der junge und engagierte Journalist Tom Kolby wurde zusammen mit anderen Menschen in Ereignisse verstrickt, deren Zusammenhänge den Einzelnen nicht klar sind. Nachdem es ihm gelang, die illegalen Machenschaften des amtierenden Präsidenten aufzudecken und ihn zu Fall zu bringen, ist er zu einer neuen Größe im politischen Ränkespiel geworden. Die Pläne zur Eroberung des Weltraums, die von der internationalen Gemeinschaft verfolgt werden, treten in die entscheidende Phase ein und die Beteiligten setzen ihre Interessen mit immer härteren Methoden durch. Dann wird der Direktor der Weltraummission entführt und plötzlich erscheint so manches in einem anderen Licht. Das Schicksal der Menschheit könnte sich in der Mongolei entscheiden, wo das Volk nach der Erfüllung einer alten Prophezeiung verlangt. Dieser gesellschaftskritische Roman ist sowohl Science- als auch Social-Fiction. Die Protagonisten durchlaufen prägende Ereignisse, die sie verändern und zu dem machen, was ihre jeweiligen Aufgaben von ihnen verlangen. Nicht jeder kann die ihm zugedachte Rolle in diesem komplexen Spiel überleben, einige sollen es nicht und schaffen es dennoch, wodurch sie zu unkalkulierbaren Risiken werden für alle Beteiligten. »Der Neue Khan« ist der dritte Teil einer Serie, die mit einer langjährigen Expedition in den Weltraum ihren Höhepunkt erreichen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Hans-Uwe Röwer
Der neue Khan
Copyright: © 2017 Hans-Uwe Röwer
Lektorat: Erik Kinting / www.buchlektorat.net Satz & Umschlaggestaltung: Erik Kinting
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Über den Autor
Hans-Uwe Röwer, geboren 1938 in Kiel, wuchs in Hamburg und Umgebung auf. Nach seiner Heirat mit einer Mexikanerin lebt er seit 1970 in Mexiko. Er ist Autor zahlreicher Kurzgeschichten in spanischer Sprache. Sein besonderes Interesse gilt der Anthropologie, der Raumfahrt sowie der Veränderung der menschlichen Werte in der näheren Zukunft. »Der Neue Khan« ist der dritte Teil dieser Serie, die mit einer langjährigen Expedition in den Weltraum ihren Höhepunkt erreichen wird.
Band 1: Mayday
Band 2: Amerikas letzter Eskimo (Teil 1 und 2)
Band 3: Der neue Khan
Inhalt
Thomas J. Kolby
John Lee Russell
Hiro Akafuji
Melanie Belle-Isle
Crystal Klein-Skilton
Ben Ashton
Juliet Lindsey
Peter Kinsman
Kuyuk
Mongol Khan
Darkhan
Nessun Dorma!
Morgendämmerung
Ich war dabei
EPILOG
James Pinky
Paul Kinsman
Thomas J. Kolby
»Im Namen meiner Heimat Japan heiße ich Sie herzlich willkommen! Machen Sie es sich bequem und fühlen Sie sich wie zu Hause. Mein Name ist Izumi und es bereitet mir eine große Freude, Sie während des Fluges nach Tokyo bedienen zu dürfen.«
»Das ist lieb von Ihnen.«
»Darf ich Ihnen ein Gläschen unseres landesüblichen Begrüßungstrunks anbieten, Herr Kolby?«
»Bitte, gern.«
»Ebenfalls für Sie, Fräulein Belle-Isle?«
»Natürlich, gern.«
Tom half Melanie, es sich auf ihrem Platz bequem zu machen und bemerkte: »Du hast es gehört: Wir sind bereits in Japan.«
»Ja, die Japaner verstehen es, dem Reisenden das Leben angenehm zu machen. Stimmt es, dass wir in Tokyo keiner weiteren Kontrolle unterliegen?«
»Mein Freund Paul, der überall herumkommt, schwärmt davon. Der Umstand, dass wir an Bord sind, bedeutet bereits, dass alle Einreiseformalitäten erledigt wurden. Kein anderes Land ist derart feinfühlig und dennoch sorgfältig und akkurat in diesen Dingen. Wir werden völlig neue Dimensionen menschlicher Beziehungen, sozialer Sicherheit und technischer Errungenschaften kennenlernen, von denen der Rest der Welt nur träumen kann.«
»Deshalb ist man neidisch auf die Japaner und hasst sie.«
»Ja. Es ist einfacher, Vorurteile über Andersdenkende in den Köpfen der Bürger zu verankern, als sie dazu anzuspornen, die Anker ihrer eigenen Trägheit und Teilnahmslosigkeit zu lichten.«
Die Stewardess servierte das Getränk und sagte diskret lächelnd: »Möge Ihnen das Japanische Orakel einen angenehmen und Nutzen bringenden Aufenthalt in meinem Land vorsehen.«
»Danke, Sie sind wirklich lieb.«
»Was meint sie mit dem japanischen Orakel?«, fragte Melanie.
»Ich habe keine Ahnung. Ich weiß lediglich, dass die Lebensweise der Japaner auf Mythen und Traditionen beruht, deren Ursprünge Jahrhunderte zurückliegen, uns Amerikanern als völlig veraltet erscheinen und somit unverständlich.«
»Sie benutzte also eine für uns nichtssagende Begrüßungsfloskel?«
»Das glaube ich nicht. Ihre Dienstbeflissenheit ist kein Theater, sonst hätte ihre Aussage nicht unser Interesse am Sinn ihrer Worte erweckt.«
»Möge also das Japanische Orakel einen angenehmen und Nutzen bringenden Aufenthalt im Lande der Aufgehenden Sonne für uns vorsehen.« Sie erhob ihr Glas zum Toast.
Tom wiederholte ihren Spruch und fügte hinzu: »Möge außerdem der westliche Aberglaube, der dem heutigen Freitag dem dreizehnten schlechte Vorzeichen zuschreibt, in Vergessenheit geraten.«
Der Reiswein, dessen Geschmack dem eines gegorenen bitteren Apfelsafts ähnelte, schmeckte ihnen wie ein Liebestrank aus Rosentau und Kirschblütennektar.
Es war Freitag, der 13. Juli, 22:18 Uhr Lokalzeit, als die Maschine vom Flugplatz in Thule abhob. Die Tokyo-Zeit auf den Monitoren lautete: Sonnabend, 14. Juli 2136, 12:18 Uhr und die vorausgesehene Flugdauer wurde mit viereinhalb Stunden angegeben. Während sich die Maschine auf ihren Kurs begab, bewunderte das Liebespaar die Konstellation von Sonne, Mond und drei hell leuchtenden Planeten. Im Norden schien dicht über dem Horizont die Mitternachtssonne und im Süden, eine Handspanne hoch am Himmel, der Vollmond. Wann würden sie jemals wieder in diese polaren Breiten zurückkehren? Sie fassten sich bei der Hand und himmelten sich an.
Tom war von Melanie begeistert. Niemand sonst auf der Welt hätte es gewagt und fertig gebracht, ihn und Alex von der Eisinsel zu bergen; niemand sonst wäre imstande gewesen, Amerikas letzten Eskimo von dessen Rückzug ins ewige Eis abzubringen. Er war über alle Maßen in sie verliebt und wollte an nichts andres als an die kommenden Tage in Tokyo denken, die sie in intimer Hingabe miteinander genießen wollten.
Melanie fragte: »Warum hast du im Mercy Medical Center sofort zugesagt, deine Identität zu ändern?«
»Ich wollte dir den Spaß nicht verderben.«
»Bereust du es nun?«
»Ganz im Gegenteil: Hätte ich es nicht akzeptiert, säße ich jetzt in irgendeiner Klemme, statt im siebten Himmel zu schweben.«
»Macht es dir gar nichts aus deinen Namen, der doch so viel über dich aussagt, aufgegeben zu haben?«
»Ich bin und bleibe Thomas J. Kolby, aber wann immer ich mich mit meiner ID-Karte ausweise, wird das unter dem Decknamen Michael Zodiac an die WOSE1 weitergeleitet, nicht unter meinem richtigen Namen. Die WOSE registriert also genau, wo sich Mike befindet, nicht aber wo sich Tom Kolby befindet, welchen Service er beansprucht, was er kauft und was er sonst noch anstellt und hat mich dadurch zwar stets im Blick, aber eben inoffiziell.«
»So ist das bei Leuten, die für die Regierung arbeiten.«
»Der Unterschied bei WOSE liegt darin, dass unbekannt bleibt, wer Mike in Wirklichkeit ist. Innerhalb der Organisation besitze ich somit keinerlei Privilegien.«
»Dazu habe ich dich überredet?«
»Niemand außer Ben, du und ich kennen meinen Status und es muss unbedingt unter uns bleiben.«
»Ehrensache! WOSE bezahlt also all deine Reisekosten?«
»So ist es. Ich darf nur nicht über die Stränge schlagen.«
»Wann wäre das der Fall?«
»Wenn ich zum Beispiel nach Japan flöge, ohne dabei an die WOSE zu denken.«
»Bedeutet das, dass du mich verleugnest, damit man dir die Fahrkarte bezahlt? Ich habe nicht eine Sekunde gezögert, mein Kreditlimit zu strapazieren, um einige Tage mit dir zu verbringen.«
»Oh … Ich werde dich in den Armen halten, auf Händen tragen, an meiner Brust erwärmen, mit meiner Windmacherei erfrischen …«
»Es zieht mir bereits an den Beinen und ich bekomme eine Gänsehaut.«
»Ich werde dich in den Himmel heben, das volle Programm.«
»Aber denken wirst du dabei unentwegt an WOSE?«
»Das hast du mir eingebrockt.«
»Na ja, daran werde ich mich wohl gewöhnen müssen. Lass mich sehen und fühlen wie es ist, wenn WOSE deinen Geist beherrscht.«
Tom legte seinen Arm um ihre Hüfte, zog sie an sich und drückte ihr einen Kuss auf die Wange.
Sie sagte: »Wann immer ich mich nach dir sehne, werde ich dich Michael nennen.«
Er flüsterte ihr ins Ohr: »Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich!«
Tom kannte Melanie kaum zehn Tage lang. Sich und Alex von ihr retten zu lassen, war eher ein Scherz als eine wohlbedachte Absicht gewesen. Er empfand es nun wie eine Fügung des Himmels. Während der vergangenen Tage in Alex‘ Begleitung, hatte sich ihnen keine Gelegenheit geboten, über sich selbst zu sprechen und sich gegenseitig Einblick darüber zu gewähren, wer sie waren, was der eine vom anderen erwartete …
Melanie war acht Jahre älter als ‘Tom und ihre Lebenserfahrung dementsprechend größer. Sie war für ihn ein Buch mit sieben Siegeln, während er sich selbst als unbeschriebenes Blatt empfand. Er fragte sich, ob er sie über ihre Vergangenheit befragen sollte, wenn er selbst nichts Nennenswertes zu offenbaren hatte. Sich zu lieben, ohne das Wesentliche des Partners zu kennen, konnte seines Erachtens nicht von Dauer sein. Suchte er im Ernst eine feste Verbindung oder lediglich ein kurzes Abenteuer? Glaubte er an die Liebe auf den ersten Blick, in die man sich blindlings stürzt, oder an die wohlbedachte Entscheidung, einen Lebenspartner zu wählen? Er wusste es nicht. Die enttäuschende Erfahrung mit Linda Perkins zeugte von seiner Unbedarftheit in diesen Dingen. Tom war davon überzeugt, dass Melanie ihm mehr bedeutete. Mit ihr wäre es möglich, Pläne zu realisieren, welche das Leben als eine zielgerichtete Ordnung darstellen. Er glaubte an den Wert der guten Absicht, an die Kraft des positiven Tuns, an den Ernst des offenen Wortes, an die Verantwortung für eine begangene Tat. Ihm schien, dass Melanie nach eben diesen Grundsätzen lebte.
Melanie hingegen sah in Tom das Ideal eines Mannes. Schon als Mädchen hatte sie von jemandem wie ihm geträumt, jedoch nicht als Liebhaber oder Ehemann, sondern als Vater. Ihr Vater war ein bescheidener, unauffälliger, pflichterfüllender, nichtssagender Mensch gewesen, der sie geliebt und ihr viel Zeit gewidmet, sie jedoch mit keinerlei Emotionen in Berührung gebracht hatte. Später hatte sie dann beobachtet, wie die anderen Väter, gegen die sie den ihren vorher gern getauscht hätte, das eigene Leben und das ihrer Familien in den Abgrund stürzten. Tom besaß zweifellos die ihr zusagenden Qualitäten, aber als Prospekt für ein stabiles Zusammenleben war er ihr zu jung. Sie sehnte sich nach dem Vaterersatz. Während ihres Psychologiestudiums hatte sie sich zur Genüge analysiert und festgestellt, dass sie sich von dieser fixen Idee nicht lösen konnte. Mit Tom würde sie einige erfrischende Monate verbringen und ihn dann ziehen lassen. Das war kein hinterhältiges Spiel, denn sie war bereit, Dinge mit ihm zu teilen und sein Leben zu bereichern.
Dinge mit ihm zu teilen … Nicht umsonst trug sie das Schächtelchen mit dem Paar Liebesperlen immer bei sich. Einmal zuvor hatte sie bereits damit experimentiert und den Mann dabei zugrunde gerichtet, Tom hingegen würde bestimmt nur Nutzen daraus ziehen.
Er war eingedöst. Melanie rüttelte ihn wach: »Träumst du von mir?«
Tom antwortete nicht, sondern küsste sie auf die Wange.
»Ich möchte dir von einer Begegnung vor vielen Jahren erzählen.«
»Lass hören!«
»Ich erinnere mich genau: Es war am 31. Dezember des Jahres 28 in Paris, der Stadt der Liebe. Vor dem Eingang eines Festsaals, wo ich mit Freunden Sylvester feiern wollte, saßen Straßenhändler mit Andenken und Kuriositäten. Die ausgelegten Dinge interessierten mich kaum, die Gesichter der Typen, die dort hockten und hofften, jemandem etwas andrehen zu können, hingegen sehr. Besonders ein alter dunkelhäutiger Händler mit vielen Narben im Gesicht erweckte meine Aufmerksamkeit. Er saß da und wies mit seinen mageren Händen auf zwei kleine hölzerne Schächtelchen. Ich starrte ihn an und wunderte mich über seine Anziehungskraft. Er schien zu lächeln und ich lächelte nervös zurück. Mit meinem stümperhaften Französisch fragte ich ihn, was er verkaufen würde. Er gab eine leise, mir unverständliche Antwort. Ich beugte mich zu ihm hinunter und stellte meine Frage noch einmal und hörte ihn sagen: Liebesperlen!Liebesperlen?, rief ich und lachte. Er nickte, nahm eines der Schächtelchen, öffnete es und hielt es mir hin. Zwei kleine Kugeln lagen darin …« Melanie nahm das Schächtelchen aus ihrer Blusentasche, öffnete es und zeigte es Tom. Sie fuhr fort: »Ich war neugierig und fragte: Was kann man mit den Liebesperlen anfangen? Er sagte: Sie öffnen das Herz und die Augen der sich Liebenden. Jeder Partner muss eine hinunterschlucken. Sie stellen die Liebe auf die Probe.Sie sind ein wunderbares Produkt menschlicher Intelligenz. Ich hakte nach und fragte: Sie meinen sicher menschlicher Fantasie. Aber er beharrte darauf, dass er das nicht meine. Der Preis jedoch ist fantastisch, sagte er zum Schluss und nannte mir einen unglaublich hohen Preis.«
»Wie ich sehe, bist du den Kauf eingegangen.«
»Ich versuchte, den Preis herunterzuhandeln, er ging jedoch nicht darauf ein.« Sie erzählte nicht, dass sie beide Schachteln erworben und eine bereits ausprobiert hatte. Sie verschwieg ebenfalls, dass es wirklich Wunderwerke waren.
»Darf ich sie mir einmal aus der Nähe anschauen?«
Sie fingerte das Paar aus der Schachtel und legte es in seine Handfläche.
Die Kugeln sahen nicht nur wie Perlen aus, sondern fühlte sich auch so an, nur waren sie wesentlich schwerer. Sie schienen zusammengeklebt zu sein. Tom nahm sie zwischen Daumen und Zeigefinger beider Hände und trennte sie voneinander. Eine hatte einen kleinen Stift und die andere ein Loch, in welches dieser hineinpasste. Er hielt ihr beide entgegen und meinte grinsend: »Diese symbolisiert das Männchen und diese das Weibchen … wie klar ersichtlich ist.«
»Du bist ein schlauer Kopf.«
Tom schloss die Hände, öffnete sie nach einigen Sekunden und die Perlen waren verschwunden. Er beteuerte lachend: »Ich habe sie weggezaubert.«
Melanie konnte ihr Erschrecken nicht verbergen. »Um Gottes Willen, Tom, hast du sie fallen lassen?«
Er schloss und öffnete die Hände nochmals und die Perlen waren wieder da. »Natürlich nicht! Möchtest du nun, dass ich meine Liebe zu dir auf die Probe stelle?«
»Es beruht auf Gegenseitigkeit: Möchtest du, dass ich meine Liebe zu dir auf die Probe stelle?«
»Warum warten wir nicht damit, bis wir in Japan sind?«
»Einverstanden! Das ist eine gute Idee.« Sie wollte Tom beide Perlen aus der Hand nehmen, um sie ins Kästchen zurückzulegen, er aber schloss die Hand mit der männlichen Kugel und sagte: »Ich werde die meine bereits behalten und sie schlucken, wann immer ich mich in der geeigneten Stimmung fühle: Kerzenlicht … romantische Musik … eine Flasche Champagner …«
So hatte Melanie sich das nicht vorgestellt, ging jedoch darauf ein: »Das nenne ich faires Spiel. Damit wir sicher sein können, dass sie wirklich funktionieren, müssen wir sie testen.«
»Wie funktioniert das?«
»Drücke den kleinen Stift hinein.«
Tom tat es. Der Stift versank im Innern der Perle und die Stelle hinterließ kein ersichtliches und ertastbares Merkmal. Er sah Melanie erstaunt an.
Sie zeigte ihm die ihre und sagte: »Sie funktionieren! Sieh, bei meiner hat sich die Perforation geschlossen.«
Tom war verblüfft. »Nun kann man sie nicht mehr voneinander unterscheiden. Wenn wir sie nun tauschen …«
»Nichts da. Jeder passt auf seine auf.«
Sie legte ihre Perle in das Schächtelchen, schloss es und verwahrte es wieder in ihrer Blusentasche.
Tom merkte ihr an, dass sie beleidigt war, und tröstete sie: »Ich liebe dich, Melanie, und möchte diese Liebe nicht bei einem Spiel auf die Probe stellen.«
»Du hast recht, die Liebe ist kein Spiel. Ich werde meine Perle hüten und sie schlucken, wann immer ich mich verzweifelt nach dir sehne.« Sie kuschelte sich an Toms Schulter und schloss die Augen.
Tom nahm sein Handy vom Gürtel und las zum dritten Mal die Nachricht seines Bruders James, die eine Woche lang in seinem Haus-Computer auf seine Einsichtnahme gewartet hatte:
Mein hochgeachteter großer Bruder Tom:
Mir geht es gut. Ich vermisste Dich bei den vergangenen Achter-Rennen. Ich weiß nicht, wo Du steckst, aber ich halte Ausschau, wo immer Staub aufgewirbelt wird. Unsere Bekannte, die Schachspielerin – sie ist, wie Du bestimmt weißt, ein wenig in den Hintergrund getreten – hat mich mit einer Stippvisite beehrt, nicht länger als fünf Minuten. Sharon war dabei, denn die Schach-Lady setzt keinen Stein ohne Zeugen. Sie empfiehlt mir, den Namen Kolby eine Weile in einen Safe zu legen und mich ein wenig in der Welt umzusehen: Sie hatte zufällig ein paar Dokumente für mich dabei, ich könne sofort abreisen, meinte sie und setzte mich dann auch gleich am Flughafen ab. Von einem öffentlichen Info-Center hier schicke ich Dir diese Nachricht, damit Du nicht auf den Gedanken kommst, meinen neuen Netz-Briefkasten mit Glückwunschpost zu überfüllen. Du kannst Dich darauf verlassen, dass ich mich eines Tages bei Dir melde. Wenn Mom, Dad oder Alice nach mir fragen, hast Du bestimmt die korrekte Auskunft parat. Mach Dir keine Sorgen um mich, mein Namensvetter ist 85 geworden, da bleiben mir noch über 60 Jahre, um für Deine Kinder der nette Onkel James zu sein. Denk an mich und vergiss nicht, dass jetzt der einzig richtige Augenblick zum Handeln ist.
Dein kleiner Bruder James
Tom ließ die Erinnerungen der letzten Begegnung mit James im Flughafen von Atlanta Revue passieren und schmunzelte. Er nahm sich vor, sobald wie möglich seine Eltern von dieser Neuigkeit zu unterrichten.
Das Schaubild der Flugroute besagte, dass bereits über zwei Stunden Flugzeit zurückgelegt worden waren, dass man sich noch in den Breiten der Mitternachtssonne befand, in einer Höhe von 16.000 Metern flog, eine Reisegeschwindigkeit von 1.950 km/h einhielt und sich der Küste Sibiriens näherte. Eine Wetterkarte skizzierte die klimatischen Bedingungen auf den japanischen Inseln.
Tom blickte aus dem Fenster. Das unter ihnen liegende Gebiet war von einer dichten weiß strahlenden Wolkenschicht bedeckt. Aber was war das? In weiter Entfernung sah er eine sonderbare Erscheinung. Tief unten wurde die Maschine von einem Geschwader schwarzer Punkte verfolgt. Langsam, sehr langsam näherten sie sich.
Er bat Melanie, ihm den Fensterplatz abzutreten.
»Was gibt es zu sehen?«
»Schau selbst.« Tom deutete hinunter.
Bald darauf entschwanden die Punkte ihrem Blickfeld, denn sie legten sich genau hinter die Linienmaschine.
»Was bedeutet das?«
»Wir werden entweder begleitet oder verfolgt.«
»Verfolgt?«
»Es wäre doch möglich.«
»Von wem?«
»Wir werden in wenigen Minuten ein abgelegenes russisches Gebiet überfliegen.«
»Das ist doch mit keinerlei Risiko verbunden.«
»Was wissen wir schon von den Russen? Sicher ist, dass bei Überschallgeschwindigkeit nur militärische Jagdmaschinen in Formation fliegen.«
»Es muss nicht unbedingt etwas mit uns zu tun haben.«
»Spricht da das Orakel in dir?«
»Es ist wohl eher meine Ahnungslosigkeit.«
»Wenn ich Kriegsmaschinen in Aktion sehe, seien sie von der Luftwaffe, der Marine oder dem Heer, amerikanischer, europäischer oder asiatischer Herkunft, spüre ich immer eine ahnungsvolle Ungewissheit. Ich werde den Flugkapitän davon in Kenntnis setzen.«
»Vielleicht ist er bereits im Bilde.«
»Über meine ahnungsvolle Ungewissheit?«
»Nein, über … du bist unverbesserlich, Tom.«
Tom rief die Stewardess herbei: »Würden Sie so lieb sein, mich telefonisch mit dem Piloten zu verbinden?«
»So gerne ich Ihnen diesen Wunsch erfüllen möchte, ist es uns Stewardessen leider nicht gestattet, Kontakte zwischen Passagieren und Flugleitung herzustellen.«
»Und wie wäre es, wenn der Pilot Kontakt zu einem Passagier aufnehmen würde?«
»Das kann nur der Pilot entscheiden.«
»Ist es Ihnen gestattet, den Piloten danach zu fragen, welche Kriterien seinen Entscheidungen zugrunde liegen?«
»Ich verstehe Sie nicht, Herr Kolby.«
»Ist es Ihnen gestattet, den Piloten danach zu fragen, ob seine Kriterien vom japanischen Orakel beeinflusst werden?«
»Ich würde es mir nicht anmaßen. Wir Japaner behandeln das Verhältnis jedes Einzelnen zum Orakel mit äußerster Diskretion.«
»Das ist verständlich. Würden Sie den Mut dazu aufbringen, den Piloten darum zu bitten, die Passagiere davon in Kenntnis zu setzen, dass unsere Maschine von russischen Jagdflugzeugen verfolgt wird, und dass einer der Reisenden von einem alarmierenden Vorgefühl belastet ist?«
»Sie meinen das doch nicht im Ernst, Herr Kolby?«
»Sie sind so lieb und pflichtbewusst, Izumi, niemand könnte das leugnen. Seien Sie es auch, wenn es darauf ankommt.«
Izumi schluckte einen unförmigen Bissen der Unentschlossenheit hinunter und ging.
Es dauerte lediglich einige Minuten, bis sie wieder zur Stelle war. Bescheiden lächelnd sagte sie: »Darf ich Sie zu einem internen Bildtelefon begleiten? Unser Kapitän würde gern einige Worte an Sie richten.«
»Natürlich.«
Das Gespräch war kurz. Zunächst bedankte sich der Pilot für den Hinweis. Dann gab er ganz klar zu verstehen, dass die Situation in jeder Hinsicht unter Kontrolle sei und beendete das Gespräch.
Tom hatte das Gefühl, dass da irgendetwas verschleiert wurde.
»Was hast du erfahren?«, frage Melanie, als er zurückkam.
»Nichts. Mein Unbehagen jedoch steigert sich.«
»Du bist so pessimistisch, Tom. Denk positiv! In einigen Stunden werden wir in Tokyo landen und alles um uns herum vergessen.«
»Ich wünsche es uns! Nun aber sitzen wir in diesem Überschallkäfig und werden von irgendwelchen Jägern verfolgt. Das färbt all meine Gedanken negativ. Lass uns auf der Hut sein.«
Sie drückte seine Hand und schwieg.
Toms Gefühl der Ungewissheit ließ sich nicht verdrängen. Wenn er aus dem Fenster schaute, malte er sich aus, einen der Jäger in unmittelbarer Nähe auftauchen zu sehen; wenn er die Position seines Sitzens veränderte, glaubte er eine Anomalie im Flug zu verspüren; wenn sich die Stewardess näherte, schien es ihm, als ob sie ein besonderes Augenmerk auf ihn richtete. Das Schaubild der Flugroute besagte, dass bereits 2:39 Stunden Flugzeit zurückgelegt worden waren, dass man sich der Küste Sibiriens näherte, in einer Höhe von 11.000 Metern flog und eine Reisegeschwindigkeit von 1.250 km/h einhielt. Dann verlosch es.
Tom wurde stutzig: Hatte da nicht vor Kurzem 16.000 Meter bzw. 1.950 km/h gestanden? Was bedeutete die Herabsetzung von Höhe und Geschwindigkeit? War die Flugleitung den Passagieren gegenüber nicht eine Erklärung schuldig? Er hasste es, zu Untätigkeit verdammt zu sein.
Melanie bemerkte seine Nervosität. »Was bedrückt dich, Tom? Sprich dich aus. Hat es etwas mit mir zu tun? Bedränge ich dich zu sehr? Wärst du lieber allein?«
»Ich fühle mich nicht wohl, das ist alles.«
»Du hast in den vergangenen Wochen sehr viel durchgemacht und all das hat deine Kräfte aufgezehrt. Allein der Unfall in Baltimore hätte jeden anderen tagelang außer Gefecht gesetzt, du hingegen bist unverzüglich aufs Neue losgestürmt.«
»Ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Vielleicht bin ich überreizt. Meine Schwarzseherei ist höchstwahrscheinlich die Folge einer psychischen Überbelastung.«
»Denkst du immer noch an die Militärmaschinen?« »Ich denke nicht nur an sie, ich glaube, sie jeden Augenblick im Fensterrahmen in Erscheinung treten zu sehen.«
Melanie schaute hinaus, um Tom diese Befürchtung ausreden zu können. Ihr stockte der Atem, als sie genau das Gegenteil des Erhofften erblickte: Über dem Flügelende ihrer Maschine stand – die Überschallgeschwindigkeit, mit der sie unterwegs waren, ließ sich nicht erkennen – ein Kampfflugzeug. Es besaß einen eleganten lang gestreckten Rumpf, schmale eng angelegte Stummelflügel, eine spitze hoch aufstehende Heckflosse und an Stelle des Cockpits befand sich eine kleine ovale Wölbung. Die Kampfmaschine schien jegliches Licht zu absorbieren; ihre gesamte Oberfläche war mattschwarz wie der Schatten der Finsternis. Auf der Heckflosse prangten ein gelber Totenschädel und darunter ein Paar ausgebreiteter Flügel. Melanie brachte kein Wort über die Lippen.
Da ertönte eine Durchsage: »Äußere Umstände zwingen uns, eine Notlandung einzuleiten. Die Situation befindet sich unter Kontrolle. Bitte schnallen Sie sich an und bewahren Sie die Ruhe.«
Die äußeren Umstände bestanden nun offen sichtlich aus sechs schwarzen Jagdmaschinen, die in Formation in unmittelbarer Nähe der Linienmaschine schwirrten – Luftpiraten!
Tom erinnerte sich vage an einen Fall von Luftpiraterie, der einige Jahre zurücklag. Wochenlang hatten die Medien den Vorfall wachgehalten, bis er schließlich doch einschlief, weil keinerlei Anhaltspunkte über den Verbleib der entführten Maschine gefunden werden konnten. Es blieb ein Mysterium. Viele Stimmen behaupteten, dass irgendeine Weltmacht die Finger im Spiel gehabt habe, andere glaubten an eine Entführung vonseiten einer außerirdischen Zivilisation. Das Erstere hatte Tom für möglich gehalten. Würde er nun am eigenen Leibe miterleben, wie sich dieses abscheuliche, seit alten Zeiten praktizierte Laster der menschlichen Gesellschaft der Moderne anpasste?
Tom fühlte sich hilflos, nutzlos und mit gewaltiger Schuld beladen. Er hatte Melanie in sein Leben gezogen und führte sie nun ins Unheil. Eine erzwungene Notlandung versprach nichts anderes als den Tod. Was sonst ließ sich erhoffen? Der Flugroute nach befanden sie sich über dem Arktischen Ozean oder über Ostsibirien, weitab von jeglicher Zivilisation. Selbst wenn die Landung glücklich verlaufen sollte, gab es kaum eine Chance, weitere unvorhersehbare Umstände zu bewältigen. Er drückte Melanies Hand und suchte vergebens nach Worten, um ihr Mut zu machen.
Die Maschine tauchte in die dichte Wolkenschicht, was die Geschwindigkeit abrupt herabsetzte. Je tiefer sie sackte, desto heftiger wirkten sich die von den Jägern verursachten Turbulenzen aus. Sie bebte und zitterte – dass sie nicht auseinanderbrach, war wie ein Wunder.
Etwa 1000 Meter über dem Boden wurde die Sicht frei. Eine schmale wellige Landebahn tauchte auf. Der vorderste Jäger flog dicht voraus und machte vor, wo und wie aufgesetzt werden sollte. Die Passagiermaschine berührte kurz darauf den Boden, brachte die Bremsturbinen auf Hochtouren und bremste entgegen allen üblichen Vorschriften der zivilen Luftfahrt, um auf der viel zu kurzen Landebahn ein Unglück zu verhindern. Die sechs Piratenmaschinen landeten indes nicht, mit dem Herbeilotsen der Beute war ihre Aufgabe offenbar erfüllt. Sie legten sich in Formation, stiegen auf und verschwanden in den Wolken.
Tom blickte aus dem Fenster und sah einen trüben Tag. So weit das Auge reichte, zeigte sich ihm eine kahle, flache Landschaft mit karger, niedriger Vegetation: Tundra. In circa 100 Meter Entfernung parkten zwei klobige Jets aus alten Zeiten, deren Rumpf und Flügel mit grau-braun-olivgrünen Tarnmustern bemalt waren. Tom hielt sie für ausgediente Truppentransporter. Es gab ebenfalls einige Lastund Geländewagen gleichen Stils und Alters. Nichts rührte sich. Mehr ließ sich nicht ausmachen, zumal der Blickwinkel aus dem kleinen Fenster sehr beschränkt war.
Melanie fragte: »Was wird geschehen? Was sollen wir tun?«
Tom hatte keine Antwort parat.
Eine Durchsage verkündete: »Bitte, bleiben Sie auf Ihren Plätzen und bewahren Sie Ruhe. Wir werden Sie zur gegebenen Zeit über den Weiterverlauf unseres Fluges unterrichten. Es tut mir leid, Ihnen im Moment keine weiteren Einzelheiten bekannt geben zu können.«
Melanie flüsterte: »Niemand wird diesem Hinweis folgen. In einer Minute ist hier die Hölle los.«
Sie hatte sich verschätzt: Es dauerte lediglich 30 Sekunden. Zunächst erhob sich ein unruhiges Getuschel zwischen Sitznachbarn, dann standen die Ersten auf und unterhielten sich mit den Leuten vor und hinter ihnen. Schon drängten sich die Leute in den Gang und ihre Forderungen nach Information wurden rasch lauter und aggressiver. Man verlangte, dass der Flugkapitän persönlich in Erscheinung trete; man bestand auf Getränken, einige forderten die Temperatur der Klimaanlage niedriger, andere, sie höher zu stellen; viele hatten das Bedürfnis, Bildgespräche führen zu müssen und schrien nach diesem Service. Man redete auf die Stewardessen ein, die mit stoischer Gelassenheit um Geduld und Ruhe baten.
Tom und Melanie blieben auf ihren Plätzen und hielten sich an den Händen. Das war das Einzige, so empfanden es beide, was sie im Moment tun konnten. Die Maschine war gezwungen worden zu landen und das hatten sie schon mal heil überstanden.
Die Zeit verstrich. Abwarten und Ruhe bewahren war nie Toms Stärke gewesen, jetzt jedoch hielt er es für angemessen, seinen Tatendrang zu zügeln. Auch Melanie beherrschte ihre Erregung.
Nach etwa zehn Minuten folgte eine langatmige Durchsage auf Japanisch, unverständlich für Tom und Melanie. Die meisten Passagiere jedoch verstanden sie genau, denn es versetzte sie in panischen Schreck. Sie hasteten zu ihren Plätzen und wurden mucksmäuschenstill.
Dann sprach jemand in gebrochenem Englisch: »Wir erteilen unsere Befehle nur ein einziges Mal. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann zögert keinen Moment, sie zu befolgen. Wer sich sträubt oder das Maul aufreißt, stirbt. Beim geringsten Widerstand fliegt die ganze Maschine in die Luft. Das sind die Regeln. Setzt euch auf eure Plätze, schnallt euch an und seid ruhig.«
Tom ergriff Melanies Hand, drückte sie fest und blickte ihr tief in die Augen. Er hatte ihr sehr viel mitzuteilen, was er aber nicht laut aussprechen wollte: Die Situation ist ernst. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, aber ich lasse dich nicht in Stich, und wenn es sein muss, gebe ich mein Leben für dich.
Geräusche im Unterteil der Maschine deuteten darauf hin, dass man sich mit der Fracht zu schaffen machte. Der Flug war ursprünglich aus Nordostbrasilien gekommen und wer wusste schon, woraus die Ladung bestand. Es war kaum anzunehmen, dass man nach Koffern mit schmutziger Unterwäsche suchte. Es dauerte ungefähr 20 Minuten, dann wurde es ruhig.
Melanie flüsterte: »Vielleicht begnügen sie sich mit der Ladung und lassen uns ungeschoren?«
»Hoffentlich.«
Diese Hoffnung wurde alsbald zunichtegemacht. Drei Gestalten kamen durch den Gang. Sie waren von kleiner Statur und mit orangfarbenen Overalls bekleidet. An ihren dunkelroten Pilotenhelmen war das Sonnenschild herabgezogenen und hielt somit ihre Gesichter hinter der Spiegelfläche verborgen. Die Uniformen und Helme trugen die gleichen Insignien wie die Jagdmaschinen – hier jedoch in weißer Farbe auf einer schwarzen Kreisfläche. Sie trugen moderne kurze Handwaffen, die sie im Vorbeigehen auf den einen oder anderen Passagier richteten. Sie begaben sich bis ins Heck der Kabine und von dort hörte Tom dann laute Befehle.
Passagiere kamen den Gang entlang. Ihre kreidebleichen Gesichter zuckten; ihre Kiefer zitterten, jeglichen Laut unterdrückend; kalter Schweiß stand ihnen auf der Stirn und aus den Augenwinkeln rannen stumme Tränen. Tom zählte die Vorbeigehenden: … 8 … 9 … 10 … Es waren überwiegend Frauen. Bei Nummer 12 ertönte ein Schuss. Jemand stöhnte auf und jemand anders schrie. Tom vergaß das Zählen. Er hörte die Stimmen in der Nähe. Es waren Befehle. Ein Wortschwall ertönte. Es klang wie wütende Flüche in englischer Sprache. Ein zweiter Schuss fiel. Stille trat ein. Die Befehle waren nur noch zwei Sitzreihen von Tom entfernt. Er hatte Angst. Er drückte Melanies Hand und fühlte sich dabei hilflos. Seine Sinne vibrierten in der Frequenz eines einzigen Gedankens: Ich lasse dich nicht in Stich, ich lasse dich nicht in Stich, ich lasse dich nicht in Stich …
Dann standen zwei Piraten neben ihm. Einer richtete die Waffe auf Melanie und forderte sie mit unmissverständlicher Zeichensprache auf, sich zu erheben und den anderen Passagieren zu folgen. Sie erstarrte, ihr Atem stockte und Tom fühlte ihre Hand – kalt wie Eis. Sie rührte sich nicht. Der Pirat fauchte sie an. Sprach er Japanisch, Chinesisch, Koreanisch? Es war zweifellos ein Befehl!
Den Entschluss, alles aufs Spiel zu setzen, um für Melanie zu kämpfen, hatte Tom seit Langem gefasst. Wenn das Hier und Jetzt keine akzeptable Zukunft in Aussicht stellte, besaß das eigene Leben keinerlei Bedeutung mehr. – Auf dieser Prämisse fußte Toms Lebensphilosophie und es gab nun keine Zeit mehr, das nochmals zu überdenken. Er öffnete den Verschluss seines Sicherheitsgurts, schnellte vom Sitz hoch – er überragte den vorderen Piraten um etliches – und warf sich ihm entgegen. Dessen Arm mit der Waffe wurde zwischen beide Körper gepresst. Ein Schuss fiel. Tom spürte keine Verletzung. Er umfasste den Piraten in Schulterhöhe, drückte ihn sich wie ein Federkissen fest gegen die Brust und hob ihn einige Zentimeter in die Höhe. Mit diesem Polster warf er sich dann gegen den zweiten Piraten, der sich der gegenüberliegenden Sitzreihe zugewandt hatte. Dieser hatte keine Chance zu reagieren, rutschte aus und verlor das Gleichgewicht; er schlug mit der Brust gegen die Armlehne eines Sitzes und blieb mit dem Kinn daran hängen – seine Wirbelsäule krümmte sich, seine Hände verloren die Waffe und suchten irgendeinen Halt. Es war vergebens. Mit einem Schritt war Tom bei dem Mann und trat ihm mit voller Wucht gegen den Kopf. Lautlos sackte der Pirat zusammen. Tom hielt dabei ununterbrochen den anderen Mann vor seine Brust gepresst. Zwei Sitzreihen entfernt stand der dritte Pirat unschlüssig wie zur Salzsäule erstarrt, die Waffe auf Tom gerichtet. Er drückte nicht ab, denn sein Kumpan wurde ihm ja als Schild entgegengehalten. Als Tom jedoch losstürmte, blieb dem Mann keine Wahl und er schoss … Den getroffen schreienden Mann loslassend, warf sich Tom auf den Schützen und riss ihn zu Boden. Ein anderer Passagier kam zu Hilfe und nahm die Waffen der Piraten an sich. Tom kniete sich auf die unter ihm liegenden Körper, von denen der eine bewegungslos zur Seite kippte und der andere wild strampelnd aus voller Kehle schrie. Tom verstand die Sprache nicht, erkannte aber, dass es eine Frauenstimme war. Er riss ihr den Helm vom Kopf und enthüllte das wütende Gesicht einer Asiatin. Auch die beiden anderen entpuppten sich als weibliche Piraten. Einige Passagiere halfen dabei, die beiden in Gewahrsam zu nehmen.
Die zum Verlassen der Maschine zusammengetriebenen Passagiere drängten in den Vorderteil der Kabine und wurden dort von zwei Piraten gezwungen, den herabgelassenen Notabstieg hinunterzurutschen. Als sie die Schüsse hinter sich hörten, gerieten sie in Panik und stürmten so schnell durch die Luke, dass die Piraten, die sie durch Tritte und Schläge mit Gewehrkolben antrieben, dabei fast umgerissen worden wären. Es dauerte ein paar Sekunden, bis diese sich wieder gefangen hatten.
Da war Tom bereits mit der erbeuteten Waffe heran und schoß auf den ersten Piraten, auf den er freies Schussfeld bekam. Da explodierte ein brennender Schmerz in seinem Rücken und raubte ihm die Sinne.
***
Drei Piraten blieben bis zum letzten Augenblick im Cockpit des Linienflugzeugs, um die Piloten in Schach zu halten. Erst als die Fluchtfahrzeuge, relativ kleine Propellermaschinen, startklar auf der Rollbahn standen, verließen sie das Flugzeug über die Notrutsche.
Die für widrige Umstände konstruierten Transportmaschinen konnten ohne Probleme auf der kurzen Piste starten, obwohl man ihnen die deutliche Zuladung anmerkte – sie benötigten einige Minuten, um Höhe zu gewinnen, bald jedoch verschluckte die dichte Wolkendecke die sich entfernenden Triebwerksgeräusche. Keine Menschenseele rührte sich mehr in der Umgebung; die zuvor in Brand gesetzten Landfahrzeuge loderten und qualmten vor sich hin.
Der Flugkapitän übernahm die Verantwortung und traf die Entscheidungen. Zunächst ordnete er an, dass sich die dazu fähigen Passagiere daran beteiligen sollten, alle überflüssigen Gegenstände von Bord zu schaffen. Das Gewicht der Maschine musste so weit wie möglich reduziert werden, um von der zu kurzen Startbahn abheben zu können. Auf Rettung zu warten erschien ihm zu gefährlich, immerhin war es nicht sicher, dass die Piraten nicht zurückkamen, aus welchem Grund auch immer. Gepäck, freie Sitze, Kleidungsstücke, Küchengegenstände, Rettungsausrüstungen und vieles mehr wurden aus den Luken geworfen. Das Frachtgut und insgesamt 69 Passagieren fehlten bereits. Auch Treibstoff wurde abgelassen, lediglich das nötige Minimum für den Weiterflug verblieb in den Tanks.
Das Wenden der Maschine auf der schmalen Bahn war Millimeterarbeit und dauerte lange. Nachdem alle nötigen Systeme und die aktuellen Bedingungen mehrfach überprüft worden waren, riskierten Pilot und Kopilot den Start und schafften es tatsächlich, die Maschine vor Ende der Landebahn in die Luft zu bekommen. Der Jubel an Bord war unbeschreiblich.
Tom erlangte das Bewusstsein erst wieder, als die Maschine bereits unterwegs war. Man hatte ihn auf einen Liegesitz gebettet. Es dauerte lange, bis er einen klaren Gedanken fassen konnte. An das, was ihm zugestoßen war, konnte er sich nicht erinnern.
Ein Mann beugte sich über ihn und sagte: »Sie haben Glück gehabt. Fühlen Sie sich okay?«
»Was ist geschehen? Warum liege ich hier?«
»Sie sind verletzt worden.«
»Was?«
»Die Luftpiraten! Man hat auf Sie geschossen?«
Tom fühlte den Schmerz im Rücken. Er versuchte, sich aufzurichten, es fehlte ihm jedoch an Kraft. Er strengte sich an, sein Gedächtnis in Gange zu bringen: Alex … Grönland … der Flug nach Tokyo … Melanie … Melanie! Er erschrak.
»Wo ist meine Freundin?«
»Ja, wissen Sie … Es gibt da schlechte Nachrichten!«
»Wo ist sie?«
»Nun … man hat alle Frauen, bis auf zwei alte Damen, entführt.«
Tom wurde mehrmals kurz schwarz vor Augen und er sackte in seinem Sitz zusammen. Allmählich ordnete sein Gehirn die Erkenntnisse und sein Herz begann zu rasen.
»Ich möchte mit einer Stewardess sprechen.«
»Auch alle Stewardessen sind entführt worden«, sagte der Mann mit Bedauern, aber außerordentlich ruhig. Offenbar war er nicht in Begleitung seiner Frau unterwegs.
Tom schloss die Augen. Seine Gedanken überschlugen sich, sein Puls raste, ihm fehlte Luft zum Atmen, sein ganzer Körper zitterte … und dann überkam ihn eine entspannende Ermattung. Er fühlte seine Glieder weit entfernt und versuchte auch nicht, sie zu bewegen. Er war verzweifelt und schwieg. Die Zeit verging, ihm fehlten jedoch jegliche Anhaltspunkte, um eine Minute von einer Stunde zu unterscheiden. Irgendwann brachte man ihm Wasser und er trank es mit hastigen Zügen.
***
Es war fast Mitternacht, als die Maschine auf einem Militärflugplatz am Ostzipfel der Insel Hokkaido landete. Physisch hatte Tom sich einigermaßen erholt, psychisch jedoch fühlte er sich am Boden zerstört: Melanie war entführt worden! Was interessierten ihn die Stewardessen und die anderen Frauen. Eines musste Tom zugeben: Die Piloten hatten eine unvergleichliche Tat vollbracht, den transozeanischen Superjet erneut in die Luft zu bringen und weiter bis nach Japan zu fliegen – aus ihrer Sicht die einzige Option. Gab es ein japanisches Prinzip, das sagt: Wir schaffen es oder gehen alle zugrunde? Es wäre den Japanern zuzutrauen.
Wie würde es jetzt weitergehen? Er sah sich bereits in Händen von japanischen Ärzten und Psychologen, außerstande sich selbst um Melanie zu kümmern. Gemäß dem westlichen Modell würde man ihm und allen anderen Passagieren zunächst 1000 unnütze Fragen stellen und deren Antworten protokollieren. Danach würden sich dann die Medien wie blutdurstige Hyänen auf sie stürzen und sie zerfleischen. Seine Gedanken drehten sich im Kreise und er kam zu keinem vernünftigen Entschluss.
Die Passagiere wurden schließlich, nachdem die Maschine schon eine ganze Weile gelandet war, gebeten auszusteigen. Es gab keinerlei Hektik während dieser Prozedur, eine erhabene Ruhe schien die Leute befallen zu haben. Tom wurde davon angesteckt. Galt es nicht Gott, dem Orakel, dem Schicksal, den Piloten oder dem Himmel zu danken, sicheren Boden betreten zu können? Es würde auf zehn Minuten mehr oder weniger nun auch nicht mehr ankommen.
Man brachte einen Rollstuhl und half ihm, sich zu setzen.
»Herr Kolby, wenn sich irgendwelche persönliche Gegenstände an ihrem Platz befinden, holen wir sie ab.«
»Wir hatten keine Koffer dabei, nur ein wenig Handgepäck.«
Man schob ihn zu seinem ursprünglichen Platz und Tom nahm seine Jacke und eine kleine, von Melanie hinterlassene Handtasche aus dem Gepäckfach – alles andere hatte man über Bord geworfen, um Gewicht zu sparen. Am Ausgang identifizierte er sich mit seiner Karte. Mit einem Lastenheber brachte man ihn zu Boden und über ein provisorisch installiertes Laufband beförderte man ihn zum offenstehenden Portal eines flachen Gebäudes. Augenblicke lang befand er sich unter freiem Himmel, der sich jedoch wegen der grellen Scheinwerferbeleuchtung nicht erkennen ließ.
Es schien der Hangar eines Militärflugplatzes zu sein, den man in aller Schnelle zu einer Empfangsstation umgebaut hatte. Wo befanden sich die vor ihm von Bord gegangenen Passagiere?
Ein junger Agent der Luftfahrtlinie – so war er gekleidet, Tom glaubte jedoch, die Züge eines gedrillten Soldaten in seinem Gesicht zu erkennen – trat ihm entgegen und sagte auf Englisch: »Willkommen in Japan, Herr Kolby. Begleiten Sie mich bitte zu einem Privatabteil, wo wir gern Ihre persönlichen Wünsche bezüglich des Fluges und Ihres Aufenthalt in Japan begutachten und in Betracht ziehen werden.«
Tom nickte lediglich. Begleiten war nicht gerade der geeignete Begriff, wenn man in einem Rollstuhl geschoben wurde.
In dem kleinen Raum standen drei Männer, einer von ihnen uniformiert, und eine Frau. Sie zeigten freundliche Mienen.
Der Uniformierte sprach auf Japanisch und die Frau übersetzte: »Japan bedauert es sehr, dass Ihr Besuch in unserem Lande mit einer unvorhergesehenen Notlage beginnt, Herr Kolby. Wir werden bemüht sein, Ihren Aufenthalt in der von Ihnen gewünschten Form und Ihrer persönlichen Situation entsprechend zu gestalten. Ich spreche zu Ihnen als Beauftragter der japanischen Wehrmacht, weil die Angelegenheit die japanische Sicherheit betrifft. Der Vorfall ist bislang nicht veröffentlicht worden und deshalb bitten wir Sie, innerhalb der nächsten zwölf Stunden keinerlei Einzelheiten darüber verlauten zu lassen, weder im direkten Gespräch, noch telefonisch oder mit anderen Mitteln. Sie sind Journalist und verstehen sicherlich, dass eine subjektive Version eines Geschehens dessen objektive Version verzerren kann. Bevor wir die offiziellen Tatsachen bekannt geben, wollen wir das Vorgefallene in allen Einzelheiten analysieren. Dazu sind wir verpflichtet. Japan bittet Sie um Ihre Kooperation in diesem Sinne. Können Sie diese Bedingung akzeptieren?«
Tom nickte erneut, was blieb ihm auch übrig.
»Ich lasse Sie somit in Händen eines Repräsentanten Ihrer Botschaft und eines Bevollmächtigten des japanischen Innenministeriums. Man wird Ihnen keinerlei Fragen stellen, im Gegenteil, Sie beraten uns dahingehend, wie wir Ihren weiteren Aufenthalt in unserem Lande Ihren Anforderungen entsprechend so angenehm wie möglich gestalten können.« Der Uniformierte grüßte mit einem kaum merklichen Kopfnicken und verließ den Raum.
Tom fühlte sich einige Momente lang unfähig, auch nur eine der vielen Fragen und Zweifel, welche durch sein Gehirn jagten, in Worte zu fassen.
Nach einer Weile des Schweigens, ließ sich der japanische Beamte von der Dolmetscherin übersetzen: »Das japanische Innenministerium ist während Ihres Aufenthalts in unserem Land auf Ihr Wohl bedacht und erlaubt sich, da Sie unsere Sprache nicht sprechen, Ihnen eine Übersetzerin zur Verfügung zu stellen. Frau Kawaguchi …«, sie verbeugte sich ehrfürchtig, »… ist für diese Aufgabe ausgewählt worden. Sie steht zu Ihren Diensten.«
Tom zeigte sich verblüfft, als er erfuhr, dass die ihn stets bei allen Unternehmungen innerhalb Japans begleiten würde.
Nach einigen weiteren umständlichen Phrasen, die sie übersetzen musste, reichte der Mann vom Innenministerium Tom schließlich seine Karte. Dann ließen er und Frau Kawaguchi ihn mit dem Vertreter der amerikanischen Botschaft allein, der sich sogleich vorstellte:
»Nennen Sie mich schlicht Itoko, Herr Kolby. Ich bin Japaner, wie Sie sehen, und arbeite seit einigen Jahren für die amerikanische Botschaft. Man hat mich herbeordert, um Sie im Namen Ihrer Botschaft in Ihren Rechten als amerikanischer Staatsbürger zu unterstützen. Stellen Sie mir bitte alle Fragen, die Ihnen auf dem Herzen liegen, und ich werde versuchen, diese direkt und unverblümt zu beantworten. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die in diesem Raum geführten Gespräche aufgezeichnet werden und dass Sie, nach der zuvor erwähnten Frist von zwölf Stunden, eine Kopie davon erhalten. Ist Ihnen das klar?«
»Es ist mir klar.«
»Dann schießen Sie los!«
Wo sollte Tom beginnen? Er wollte alles wissen, vor allem jedoch, was mit den Entführten, unter ihnen Melanie, geschehen war. »Ich reiste zusammen mit meiner Freundin Melanie Belle-Isle. Sie ist entführt worden. Weiß man etwas von den Entführten?«
»Die japanische Regierung hat bis zu diesem Zeitpunkt keine offizielle Bekanntgabe veröffentlicht. Wir wissen lediglich, dass man den Nachbarländern Russland, China und Korea ein kurzfristiges Ultimatum gestellt hat, diesen Vorfall aufzuklären.«
»Die Landung wurde auf russischem Terrain erzwungen und die Piraten schienen Koreaner zu sein, warum wird China darin verwickelt?«
»Satelliteninformationen weisen auf Flugverkehr zwischen der Landestelle und der Mongolei hin, welche lediglich über China und Russland diplomatisch erreichbar ist.«
»Was sagen die Medien?«
»Wenn die Sicherheit des Landes betroffen ist, verlangt man den Medien Stillschweigen ab.«
»Wer sind die Entführten? Melanie ist eine Durchschnittsamerikanerin. Welchen Nutzen kann sie den Entführern bringen?«
»Morgen früh werden wir mehr wissen.«
»Und was soll ich bis dahin machen? Däumchen drehen?«
»Ich verstehe Sie. Sie sind ein sehr aktiver, handlungsfähiger Journalist. Im Augenblick jedoch ist es ratsam, den Anweisungen der japanischen Obrigkeit zu folgen.«
Tom schwieg. Er befand sich in Japan. An wen sollte er sich wenden? Mit wem Kontakt aufnehmen? Welche Hebel in Bewegung setzen?
Itoko sagte: »Man wird Sie ärztlich untersuchen und Ihnen ein Notlager zuweisen. Es gibt hier leider keine Hotels. Morgen fliegt man Sie nach Tokyo, wo Sie dann über Ihren Aufenthalt in Japan oder den Rückflug in die USA entscheiden können.«
»Ist es mir erlaubt, Netzgespräche zu führen?«
»Warum schalten Sie Ihr Handy vorerst nicht lieber aus? Nach der offiziellen Bekanntgabe werden Ihnen keinerlei Einschränkungen auferlegt, solange Sie die hiesigen Gesetze nicht übertreten.«
»Okay.«
»Frau Kawaguchi wird Sie dann zur Krankenstation führen. Ich gebe Ihnen meine Karte. Sie können mich oder die Botschaft jederzeit ansprechen.«
»Das werde ich.«
Tom nahm das Handy vom Gürtel und schaltete es aus. Einkommende Gespräche erwartete er sowieso nicht, sie wurden alle von seinem Computer in New York abgefangen.
Frau Kawaguchi hatte vor der Tür auf Tom gewartet und schob ihn nun zu einer provisorisch ausgestatteten Krankenstation. Sie zog sich zurück, als ihn zwei Ärzte in Empfang nahmen. Er musste sich auf einen Untersuchungstisch legen und mit elementarem Englisch nannten sie ihm die erzielten Ergebnisse. Die Werte lagen im Bereich der üblichen Parameter. Man erklärte ihm, dass es sich bei dem auf ihn abgefeuerten Schuss um ein Betäubungsmittel in kristalliner Form gehandelt habe und dass die dadurch entstandene Wunde in einigen Tagen verheilt sein würde. Sie klebten ein Pflaster darüber. Er zeigte sich fähig, wenn auch nur mit langsamen Schritten, auf eigenen Füßen gehen zu können. Man fragte ihn, ob er ein Beruhigungsmittel einnehmen wolle und er ließ sich ein Päckchen mit einigen Tabletten übergeben:
»Zwei Tabletten, nicht mehr!«
Nicht eine einzige!, dachte er grimmig. Er wollte lediglich die Fürsorglichkeit der Mediziner nicht enttäuschen. Was er brauchte, waren 1000 schlaflose Nächte in einem Rutsch, um seine Gedanken kreisen zu lassen und Schlüsse zu fassen.
Frau Kawaguchi hatte in der Zwischenzeit eine Schachtel mit Esswaren und Getränken herbeigebracht und übergab sie Tom. Dann begleitete sie ihn zu einem Schlafabteil und zeigte ihm den Eingang zu den sanitären Einrichtungen. Hier wimmelte es von Passagieren.
Tom streckte sich auf dem Bett aus, legte die Arme unter den Kopf und überlegte: Was kann ich tun? Werde ich Melanie je wiedersehen? Wie geht es ihr? Wo befindet sie sich? Russland, Korea, Mongolei? Alles Länder, deren Sprachen ich nicht spreche.
Er fühlte sich müde, kämpfte jedoch dagegen an einzuschlafen.
Was kann ich tun, um Melanie zu finden?
Was wusste er von ihr? Nicht mehr, als sie selbst ihm anvertraut hatte. Sie war Psychologin und arbeitete seit zwei Jahren im Mercy Medical Center in Baltimore. Er hielt sie für außerordentlich begabt und versiert. Sie war jugendlich spontan, aufrichtig in ihren Gefühlen, selbstbewusst, tolerant, intelligent und lebenserfahren. Es machte ihm nichts aus, dass sie acht Jahre älter war als er.
Nachdem er noch etwas in den kurzen gemeinsamen Erinnerungen der letzten Tage geschwelgt hatte gestand er sich ein, sie praktisch nicht zu kennen. Konnte man überhaupt jemanden in zehn Tagen kennenlernen?
Wie schnell er doch Feuer fing. Voller Abscheu dachte er an sein Abenteuer mit Linda. Vor zehn Tagen hatte er mit der einen Schluss gemacht und mit der anderen begonnen. Mit Linda hatte der Spaß ganze drei Monate gedauert … Er erinnerte sich an die Sache mit den Liebesperlen und bedauerte, Melanie nicht den Gefallen getan zu haben, eine zu schlucken. Wann immer ich mich in der geeigneten Stimmung fühle. Er hätte ebenso gut sagen können: Was soll der Quatsch. Er holte die Perle aus der Hosentasche heraus, wo sie glücklicherweise gut verwahrt war, und betrachtete sie: eine Perle, eine mysteriöse Liebesperle. War er es ihr nunmehr nicht schuldig, sie zu schlucken? Wie hatte sie es ausgedrückt? Wann immer ich mich verzweifelt nach dir sehne. Diesen Fall konnte er jetzt ja wohl voraussetzen.
Leise sagte er: »Melanie, ich bin bereit, meine Liebe zu dir auf die Probe zu stellen.«
Er steckte die Perle in den Mund und mit einem Schluck Eistee spülte er sie hinunter.
Tom war eingeschlafen, ohne das Licht auszumachen. Als er die Augen öffnete, war er erst mal geblendet. Wo befand sich der Schalter? Er tastete mit der Rechten die Wand am Kopfende des Bettes ab und fühlte einen fremden Arm. Er schrak hoch. Neben ihm saß ein Uniformierter. Dieser schnellte von seinem Sitz und postierte sich stramm vor der Tür.
»Was hat das zu bedeuten?«, rief Tom erschrocken. »Warum passen Sie auf mich auf?«
Der Soldat verzog keine Miene. Verstand er Tom nicht oder tat er nur so?
»Ich möchte mit meiner Dolmetscherin sprechen!«
Keine Reaktion.
»Meine Dolmetscherin, Frau Kara…« Er hatte sich den Namen nicht richtig eingeprägt. Er wurde ungeduldig und barsch: »Mein Gott! Ich möchte mit der Dame sprechen, die mir zugeteilt wurde, um für mich zu übersetzen.«
Der Soldat rührte sich nicht.
Tom sah ein, dass er mit Schreien nicht weiterkam. Er fingerte die Karte des Mannes von der Botschaft heraus, nahm das Handy und wählte die Nummer.
Es klingelte eine Weile, bevor Itoko sich meldete: »Herr Kolby, wir waren so verblieben, dass …«
»Warum werde ich von einem Soldaten bewacht?«
»Was sagen Sie da?«
»Sie haben richtig gehört. Ich verlange sofortige Aufklärung.«
Itoko schwieg einen Moment verblüfft und sagte dann: »Seien Sie unbesorgt, ich werde mich darum kümmern.«
»Unbesorgt?«
»Geben Sie mir einige Minuten, um herauszufinden, was los ist …«
1Welt Organisation für Weltraum Exploration (siehe Band 1 und 2)
John Lee Russell
Tokyo, Sonnabend, der 14. Juli 2136. Juliets Nachrichtenspot um 17:00 Uhr wurde abermals zur Botschaft des japanischen Orakels. Die einige Minuten zuvor eingetroffenen Passagiere eines Flugs aus Hawaii hörten ganz klar ihre Worte, mit denen sie in ähnlicher Weise jede Episode abschloss: Das geglückte Ende dieser Affäre verdanken wir ausschließlich der opportunen und selbstlosen Einschaltung von Thomas Kolby. Und natürlich: Ich war dabei!
John Lee Russell sagte: »Ich war auch dabei!«
Britannia meinte: »Ist es nicht seltsam, dass wir beim Betreten Japans an jenen schrecklichen Maitag erinnert werden?«
»Ich trage es immerfort wach im Gedächtnis. Andere Umstände lassen mich derzeit aufmerken.«
»Was ist es?«
»Ich wollte unbedingt zur WOSE in Manhattan und nun sind wir hier, weil ich unbedingt das WOSE-Zentrum in Tokyo besichtigen möchte. Ich wiederhole die gleichen Fehler.«
»Das musst du nicht so sehen. Erstens: Du bist eingeladen worden, nach Tokyo zu kommen. Zweitens: Nach unserem Aufenthalt auf Hawaii lag Japan wirklich nur einen Katzensprung entfernt.«
»Kolby war mein Schutzengel in New York, wir sollten auch hier nach ihm Ausschau halten.«
Britannia spürte etwas. Sie blieb stehen, wandte sich um und warf einen prüfenden Blick auf den hinter ihnen fließenden Menschenstrom.
John Lee meinte: »So wörtlich solltest du mich nicht nehmen.«
»Warte! Jemand folgt uns.« Sie hatte etwas entdeckt.
John Lee kannte die plötzlich auftauchenden Gefühlsimpulse seiner Frau und schwieg. Sie beäugte die vorbeigehenden Menschen und suchte nach einem bekannten Gesicht. Schließlich sah sie es: Es gehörte einer großen, breitschultrigen Gestalt, die mit ausholenden Schritten auf sie zukam: Ben Ashton!
Diese Begegnung war kein Zufall, aber Ben behielt es für sich. Er zeigte sich überrascht: »Sind Sie nicht Frau …?«
»Russell, Britannia Russell. Und das ist mein Mann Dr. John Lee Russell.«
Ben begrüßte Britannia mit einem Handkuss und streckte dann John Lee seine Rechte entgegen: »Angenehm! Mein Name ist Ben Ashton, Sicherheitsbeauftragter bei WOSE. Es freut mich außerordentlich, Sie wohlauf zu sehen. Ihre Frau …«
»Meine Frau hat mir von Ihrer Intervention an jenem bedauernswerten Tag in New York berichtet. Ich bedankte mich dafür.«
»Ich habe getan, was …« Britannias Blick ließ ihn sofort verstummen.
Sie lächelte und sagte: »Wir sind auf dem Wege zum Festakt. Werden auch Sie dort in Erscheinung treten?«
In Erscheinung treten war genau das, was er auf alle Fälle vermeiden wollte. Von ihr durchschaut zu werden, machte seine Aufgabe in dieser Hinsicht jedoch zu einem Versteckspiel im Rampenlicht. »Es ist durchaus möglich.«
»Wir werden auf alle Fälle dort sein! Es hat mich gefreut, Sie wiederzusehen.«
»Ganz meinerseits.«
John Lee verabschiedete sich von Ben mit einem knappen Wink seiner Rechten.
Als Ben außer Sichtweite war, fragte John Lee seine Frau: »Glaubst du, dass er uns auf den Fersen ist?«
»Durchaus möglich.«
»Es sind einige tausend Reisende mit der gleichen Absicht wie wir in Tokyo, die können doch nicht alle überwachen …«
»Japan ist ein vorsichtiges, vorsorgliches Land und bestimmt darauf bedacht, seinen Besuchern einen makellosen Aufenthalt zu gewährleisten.«
»Das wäre übertrieben. Na ja, jetzt wollen wir die Begegnung vergessen. Wenn er uns nochmals in die Quere kommt, stelle ich ihn zur Rede.«
Es gab ein großes, schwerwiegendes Geheimnis zwischen Britannia und John Lee: Sie kannte die Pläne, nach denen sich sein zukünftiges Leben richten würde. Und … sie musste es für sich behalten. Das war eine Bürde, die sie sich selbst auferlegt hatte und bereitwillig zu tragen gedachte. Bisweilen jedoch, wie in diesem Moment, schien sie die Last in die Knie zu zwingen. Sollte sie ihm nicht alles anvertrauen und ihr Gewissen erleichtern? War nicht gerade der jetzige Augenblick der geeignetste dazu? Es gab sehr viele Gründe dagegen, aber nur einen einzigen dafür: sich selbst das Dasein zu erleichtern. Wenn sie wenigstens mit jemandem ein offenes Wort darüber wechseln könnte! Ben Ashton besäße vielleicht ein offenes Ohr, wie und wann jedoch ließe sich ein Gespräch mit ihm durchführen? Nie zuvor hatte Brit einen so intensiven Drang verspürt, sich auszusprechen.
***
Im Festsaal des WOSE-Zentrums herrschte Aufregung und Nervosität. Zum dritten Male wurde eine Verzögerung in der Ankunft der obersten Persönlichkeiten angekündigt: es fehlten Japans Premierminister und der WOSE-Generalsekretär Hiro Akafuji. Mehr als 4000 geladene Gäste aus aller Welt und eine Unzahl Funktionäre wurden ungeduldig. Die japanischen Medien, für die Direktübertragung verantwortlich, füllten die Zeit mit vorfabrizierten Berichten über den Bau der Astroinsel BETA.
Endlich, eine ganze Stunde nach dem offiziellen Termin, erschien der Premier und gab sofort eine Erklärung ab: »Liebe Gäste, Freunde, Fürsprecher des BETA-Projekts: Bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Höhere Gewalt hat mich daran gehindert, pünktlich zu sein. Etwas Unerwartetes ist eingetreten: WOSE-Generalsekretär Hiro Akafuji ist vor circa einer Stunde an den Folgen eines Unfalles ums Leben gekommen. Auf dem Wege zu dieser Einweihungsfeier hat ihm das Schicksal aus unserer Mitte gerissen. Sein unermüdlicher Drang, während der häufig so widersprüchlichen Gegenwart verheißungsvolle Zukunftspläne zu realisieren, wurde abrupt unterbrochen. Wir haben einen großen Menschen verloren, aber sein Werk existiert weiter: BETA und die bevorstehende BETA-Mission. Keine Rede vermag zusammenzufassen, was wir ihm zu verdanken haben. Wir wollen darum keine Worte verlieren, sondern uns sofort seinem Testament zuwenden, in dem alle von uns aufgefordert werden, sein Lebenswerk, das BETA-Projekt, als BETA-Mission in die Tat umzusetzen. Das bedeutet, alle beabsichtigten und geplanten Schritte müssen eingehalten werden. In den kommenden Tagen wird die WOSE-Vollversammlung über die nötigen Änderungen entscheiden. Wollen wir nun diesem vorbildlichen Menschen und Freund, Hiro Akafuji, mit einer Minute des Schweigens gedenken.«
Es war ein Schweigen voller lautloser Fragen: Was war passiert? Warum war es gerade an diesem Tage geschehen? Hätte man mit dieser Nachricht nicht bis morgen warten können? Würde wirklich alles so weitergehen wie geplant? Brächte dieser Umstand wieder die latenten Meinungsverschiedenheiten der beteiligten Nationen auf die Tagesordnung? Wäre es nicht der passende Augenblick, Japan das Projekt zu entreißen und es nach Europa oder Amerika zu bringen? Wäre es nicht der passende Augenblick, das Projekt für undurchführbar, unnütz … für absurd zu deklarieren und es aufzugeben? Niemand kannte die Zukunft und keine Frage fand eine überzeugende Antwort.
Jemand, dessen Uhr schneller zu laufen schien als die aller anderen, brach das Schweigen: »Kann das denn wahr sein?«
Dann redeten alle durcheinander. Man sah einige Funktionäre vor dem Rednerpult, die sich über die Lautsprecheranlage Gehör zu verschaffen suchten, aber die Dissonanz der sich überlagernden Fremdsprachen aus Tausenden Mündern übertönte sie. Wer auf die riesigen Leinwände blickte, sah inmitten dieser Kakofonie die Projektionen der Liveübertragungen von der Astroinsel BETA und wer in der Nähe der Lautsprecher saß, hörte gedämpfte japanische Musik.
Britannia und John Lee Russell teilten den Tisch mit vier Ehepaaren aus der Europäischen Union. Jeder hatte seine Namenstafel mit Titeln und Tätigkeitsbereich vor sich stehen, sodass man sofort im Bilde war, mit wem man es zu tun hatte. Nur zwei der Herren kannten sich bereits. Das Gesprächsthema war zunächst der unerwartete Tod des Mannes, der es fertiggebracht hatte, der modernen Raumforschung eine Richtung zu weisen. Einer behauptete, ihn vor einigen Jahren persönlich kennengelernt zu haben:
»Akafuji zeigte sich wie ein sanfter, samtener und makelloser Pfirsich, aber sein Charakter war härter, schroffer und unzerbrechlicher als ein Pfirsichkern. Er war kein Unmensch, aber von denen, die es mit ihm zu tun hatten, verlangte er Übermenschliches. Ich kann da aus Erfahrung sprechen.«
Brit fühle ihren Blutdruck sinken. Sie atmete mit tiefen Zügen und bat: »Lassen wir die Toten ruhen!«
Man wechselte das Thema und sprach über die BETA-Mission, woran sich die Damen kaum beteiligten.
Einen günstigen Augenblick nutzend, schlug Brit vor: »Warum setzen wir Frauen uns nicht auf einer Seite des Tisches zusammen und überlassen unseren Männern den übrigen Teil des Weltalls?«
Man hielt das für eine gute Idee und tauschte die Plätze. Zunächst wurde oberflächlich geplaudert, aber dann kam das Thema die Frau im Weltraum zur Sprache. Jede der Anwesenden hatte dazu eine eigene Ansicht.
»Eine Reise, die Jahre dauert, entfernt das Paar nicht nur in räumlicher Distanz voneinander.«
»Eine Reise wie die BETA-Mission ist ein Ausflug ohne Rückkehr!« Brit erschrak, das gesagt zu haben. Selbst die Männer hatten es mitbekommen und horchten auf.
Sie relativierte ihre Aussage sofort: »Eine Reise, die zwölf Jahr dauert, verändert den Menschen der reist und den, der zurückbleibt derart, dass man sich am Ende gar nicht wiedererkennt. Nur im Zusammensein bleibt die Liebe erhalten.«
Man stimmte ihr nur halbwegs zu, weil man glaubte, dass Trennungen auch das Gegenteil zur Folge haben könnten.
Doch John Lee gab ihr recht: »Ich würde nie auch nur einen Schritt ohne meine Frau in den Weltraum tun, mit ihr zusammen jedoch reise ich, wohin immer sie will.«
Jemand meinte: »Wir können von Weltraumreisen reden, aber dafür ausgewählt zu werden, steht auf einem anderen Blatt. Übrigens: Gibt es schon Kandidaten für die Mission?«
»Betanauten?«
»Man hat nie etwas davon gehört.«
»Vielleicht ist man sich noch nicht einig, welche Kriterien der Auswahl zugrundeliegen sollen.«
»Man möchte vielleicht niemandem so lange im Voraus die Hölle heiß machen.«
»Wer entscheidet über diese Dinge?«
»Bestimmt existiert seit Langem eine Kommission, die sich mit den menschlichen Faktor der Mission befasst. Nur die Besten und Fähigsten sollten auf der Liste stehen.«
»Glückliche Reise! Wir Normalen bleiben gern zu Hause.« John Lee hatte gesprochen.
Um Punkt 23:00 Uhr wurde das Essen serviert. Man hatte Hunger und nahm statt unterhaltender Worte leckere Bissen in den Mund. Kleine harmlose Witze halfen, die Kehle zu öffnen, und exquisite Getränke lockerten den Geist und folglich die formellen Beziehungen zueinander.
Mit vollem Munde prustete einer über den Tisch: »Ich wette tausend Dollar, dass die BETA-Mission misslingt, wenn man nicht wenigstens einen von uns daran mitwirken lässt. Ich zum Beispiel würde einen ausgezeichneten Raumpfleger abgeben. Was hältst du davon, John Lee?«
»Ich wette nicht. Ich kann dir aber versichern, dass sie misslingt, wenn man mich daran teilnehmen lässt. Ich bin manchmal so kleinlich und der Raum ist doch so großzügig.«
Brit lockte John Lee vom Tisch fort: »Begleitest du mich bitte zu den Waschräumen? Ich möchte mich frisch machen.«
Sie entschuldigten sich und verließen den Saal.
Britannia verließ den Toilettenraum und trat ins Foyer der Halle. John Lee stand neben einem Marmorsockel mit einer antiken hölzernen Statue und unterhielt sich mit einem Paar; er klein, schmal und um etliches älter als sie, sie wunderschön mit dichtem schwarzen Haar, dunklen leuchtende Augen und dunkelhäutig; ein Gesicht, das Brit irgendwann gesehen zu haben glaubte. Natürlich: die Sängerin Naya Yupam. Die drei zeigten ernste Mienen.
Brit hatte John Lee aus dem Festsaal gelockt, um ihm endlich zu beichten, vor zwei Jahren eine Begegnung mit Hiro Akafuji gehabt zu haben. Nun, da dieser tot war, waren seine persönlichen Ansichten bezüglich ihres Mannes bedeutungslos geworden. Eine passende Gelegenheit also, sich von der sich selbst auferlegten Bürde zu befreien. Heute oder nie! Sie schritt auf die Gruppe zu und trat neben John Lee.
Sofort zog er sie an sich und scherzte: »Mein Sternbild, Britannia.«
Das Paar lächelte und Brit reichte ihr und dann ihm die Hand.
John Lee nannte die Namen und Brit meinte: »Mein Mann sieht in mir ein Sternbild, die ganze Welt hingegen erkennt in Ihnen das komplette Universum, Naya. Ich habe Sie nur einmal gehört, in einem Medienkanal, und das vibriert immer noch in meinen Adern.«
Naya lächelte und ihr Galan schäumte über vor Genugtuung.
Brit bemerkte: »Im Festprogramm gibt es keinen Hinweis darauf, dass Sie singen werden.«
Der Galan, es war Paul Kinsman, antwortete: »Der geladene Gast bin ich, Naya ist heute leider nur meine Begleiterin.«
»Leider!« Das war Brit entglitten und sie wollte sich umgehend entschuldigen, doch Naya ließ es nicht dazu kommen:
»Ich schenke Ihnen ein Lied! Sagen Sie mir welches.«
Brit verschlug es den Atem. »Das kann ich doch nicht … Ich bin manchmal so impertinent …«
Paul wischte ihr Stottern mit einer Geste weg: »Nayas Wünsche darf niemand versagen … nicht einmal ich.« Er machte ein trauriges Gesicht und entlockte damit Brit ein Lachen.
Naya sagte mit gekünstelt ernster Miene: »Wie Sie sehen, zwingt Paul mich dazu.«
Paul schäumte über vor Freude: »Naya wird am Dienstag in Kyoto singen und am Sonntag darauf in Ulan Bator. Dort wird es ein großes nationales Fest geben. Kommen Sie doch mit uns.«
Das ging John Lee zu weit. Er empfand, dass die Begegnung mit der Sängerin und deren Galan in eine zu intime Bekanntschaft ausarten könnte und sagte: »Sie sind so außerordentlich liebenswürdig, aber mein Sternbild und ich hatten bereits beabsichtigt, hinter dem Horizont zu versinken. Die vielen Menschen hier machen uns nervös.«
Britannia kannte ihren Mann sehr gut. Nie zuvor hatte er eine sie beide betreffende Entscheidung so spontan und ohne ihre Fürsprache zum Ausdruck gebracht. Sie akzeptierte es und sagte: »Das ist wahr, wir sind keine Nachtmenschen.«
Paul zeigte sich enttäuscht, Naya während dieser Nacht nicht singen zu hören: »Leider!«
Brit hörte das gleiche Leider, welches sie selbst zuvor ausgesprochen hatte. Es klang so melancholisch, so bittend, so herzbetörend, dass sie sich nun genötigt fühlte, ihm einen Gefallen tun zu müssen: »Wir sind keine erprobten Nachtmenschen. Sollten wir nicht einmal probieren, John Lee, erst nach Mitternacht schlafen zu gehen?«
»Wir wollen doch die Herrschaften nicht von ihrem geplanten Programm abbringen.«
Paul sprang ihr sogleich bei: »Auf gar keinen Fall, tun Sie das. Mir geht es wie Ihnen: Die vielen Menschen hier machen mich nervös. Was meinst du, Naya, begeben wir uns zu einem gemütlicheren Plätzchen?« Naya nickte lächelnd und Paul war überaus glücklich: »Sie sind natürlich meine Gäste. Ich kenne ein niedliches japanisches Gästehaus in der Chiba Provinz, mit einem Flugtaxi sind wir im Nu dort.«
Einstimmig kam die Antwort von Brit und John Lee: »Das können wir wirklich nicht …«