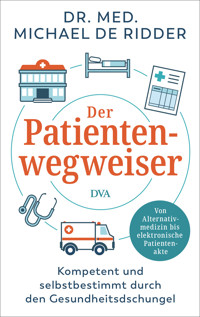
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Von Alternativmedizin bis Überversorgung: Ein praktischer Leitfaden für den selbstbestimmten Patienten
In seinem neuen Buch vermittelt der erfahrene Arzt Michael de Ridder dem Patienten Wissen und Wege, wie man die eigene Gesundheit selbst in die Hand nehmen und selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann, ohne dabei gesundheitliche Risiken einzugehen oder hohe Kosten zu tragen. Er erläutert unter anderem:
• welche Rechte uns als Patienten zustehen,
• was es mit der Patientensicherheit auf sich hat,
• was einen guten Arzt ausmacht und woran man ihn erkennt,
• wie wir gegen Behandlungsfehler und ärztliches Fehlverhalten vorgehen können,
• welche alternativen Heilmethoden helfen,
• wie wir es durch Prävention schaffen, von Krankheiten verschont zu bleiben,
• und was wir im Alltag für unsere Gesunderhaltung tun können.
Ein kluger Kompass für das Gesundheitssystem – und ein praktischer Leitfaden, die eigene Gesundheitskompetenz und damit auch die eigene Gesundheit zu stärken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
In seinem neuen Buch gibt der erfahrene Arzt Michael de Ridder dem Patienten Wissen und Wege an die Hand, wie man die eigene Gesundheit selbst in die Hand nehmen und selbstbestimmt Entscheidungen treffen kann, ohne dabei gesundheitliche Risiken oder hohe Kosten einzugehen. Er erläutert, welche Rechte dem Patienten zustehen und was es mit der Patientensicherheit auf sich hat. Er stellt die Frage, was einen guten Arzt ausmacht und woran man ihn erkennt. Er widmet sich den Themen Übertherapie, alternative Heilmethoden und der immensen Bedeutung der Krankheitsprävention. Und er beschreibt – nicht zuletzt aufgrund eigener Erfahrungen mit ernsthaften Erkrankungen –, was jeder von uns in seinem Alltag selbst für seine Gesunderhaltung tun kann. Michael de Ridders Buch ist nicht nur eine Orientierungshilfe in einem allmächtigen Medizinbetrieb und Gesundheitsmarkt, sondern auch ein praktischer Leitfaden, die eigene Gesundheitskompetenz und damit seine Gesundheit zu stärken.
Zum Autor:
Michael de Ridder hat jahrzehntelange Erfahrung als Arzt, zuletzt als Chefarzt der Rettungsstelle eines Berliner Krankenhauses und als Geschäftsführer des von ihm mitbegründeten Vivantes Hospiz. Als Vorsitzender einer Stiftung für Palliativmedizin befasst er sich seit vielen Jahren kritisch mit dem Fortschritt in der Medizin, Fragen der Gesundheitspolitik und der Stärkung der Patientensouveränität und erörtert dies immer wieder in den Medien. Als Befürworter der Palliativmedizin wird er von vielen schwerkranken Menschen um Rat gebeten. Bei DVA sind von ihm u. a. der viel diskutierte Bestseller Wie wollen wir sterben? und zuletzt Wer sterben will, muss sterben dürfen erschienen. Für sein Wirken wurde er vielfach ausgezeichnet, etwa von der Stiftung Gesundheit für sein publizistisches Lebenswerk.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Dr. med. Michael de Ridder
Der Patienten-wegweiser
Kompetent und selbstbestimmt durch den Gesundheitsdschungel
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2025 by Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagabbildungen: FinePic®, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-32251-9V001
www.dva.de
Inhalt
Einführung
Kapitel 1 Gesundheit: ein Begriff, viele Bedeutungen
Kapitel 2 Schlüssel zur Gesundheit: sozioökonomischer Status, Verhalten und Umweltfaktoren
Kapitel 3 Normabweichung – Befindlichkeitsstörung – Krankheit
Kapitel 4 Der sogenannte Notfall – zwischen Lebensgefahr, psychosozialer Krise und Bagatellerkrankung
Kapitel 5 Eine Frage der Erkrankung: wissenschaftliche Medizin, Alternativmedizin oder Naturheilkunde?
Kapitel 6 Patientensicherheit – UFOs im Bauch?
Kapitel 7 Patientenrechte – nur auf dem Papier?
Kapitel 8 Behandlungsfehler
Kapitel 9 Überversorgung – im Zweifel Aktionismus
Kapitel 10 Woran Sie einen »guten« Arzt erkennen
Kapitel 11 Ärztliches Fehlverhalten
Kapitel 12 Wenn überzählige Pfunde krank machen: Übergewicht und Fettleibigkeit (Adipositas)
Kapitel 13 Nahrungsergänzungsmittel – fragen Sie nicht Ihren Apotheker!
Kapitel 14 Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)
Kapitel 15 Die elektronische Patientenakte (ePA)
Kapitel 16 Bevor die Krankheit gewinnt: Chancen und Risiken der Prävention
Kapitel 17 Ein gesundes Leben bis ins hohe Alter
Kapitel 18 Der gebrechliche Mensch – krank oder nur alt?
Kapitel 19 Alzheimer-Demenz – die Kontroverse um die Frühdiagnostik
Kapitel 20 Das Lebensende: Vorsorge für das Unausweichliche
Kapitel 21 Organspende – Zustimmungs- oder Widerspruchslösung?
Kapitel 22 Wie der Patient wieder mehr in den Mittelpunkt rücken kann
AusblickGesundheit in Zeiten der Desinformation
Links und Adressenfür vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen
Weiterführende Literatur
Quellenverzeichnis
Personen- und Sachregister
Gewidmet allen meinen Patienten, die, indem ich von ihnen lernte, meine ärztlichen Erkenntnisse und Erfahrungen bereichert haben.
Das gute Leben ist beseelt von Liebe und geleitet von Wissen.
Betrand Russell
Einführung
Wir leben in einer Zeit rapiden medizinisch-wissenschaftlichen Fortschritts, in der Beratungs-, Diagnostik- und Therapieangebote nicht mehr allein auf gesichertem Wissen beruhen, sondern vielmehr von Meinungen, Spekulationen, falschen Versprechungen und irreführenden Hoffnungen, denen vielfach allein finanzielle Interessen zugrunde liegen, durchkreuzt und überlagert werden. Einer aktuellen repräsentativen Studie der Technischen Universität München (2025) zufolge finden sich 75 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland nicht mehr im Dickicht gesundheitsrelevanter Informationen zurecht. Sie haben erhebliche Schwierigkeiten, Informationen etwa zur Prävention und Behandlung von Krankheiten zu finden, zu verstehen und auf die eigene Lebenssituation anzuwenden (was allein im Jahr 2022 Mehrkosten von 22 Milliarden Euro verursacht hat). Mit meinem Patientenwegweiser möchte ich dieser Rat- und Hilflosigkeit – ja oft sogar Verzweiflung – vieler Bürger* entgegenwirken. Er soll mehr Orientierung im Gesundheitsdschungel bieten und gleichzeitig die Gesundheitskompetenz jedes Einzelnen stärken. Mein Anliegen ist es, sowohl Gesunde als auch Kranke zu ermutigen, ihre gesundheitliche Selbstbestimmung bewusster wahrzunehmen und Eigenverantwortung aktiv zu leben. Im Kern geht es um nichts weniger als die Emanzipation jener, für die unser Gesundheitswesen geschaffen wurde: aller Bürger – und um ihr Wohl.
Emanzipation ist ein Terminus, der im römischen Recht wurzelt und einen Rechtsakt bezeichnet, in dem der Vater seinen Sohn aus der Vormundschaft freigibt: Der Sohn wird zu einer eigenständigen Rechtsperson. Im 17. und 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung, erfuhr der Begriff, der auch heute noch eng verknüpft ist mit dem der Mündigkeit, einen Bedeutungswandel: Freiheit, Gleichheit und Mündigkeit der Individuen wurden seitdem in den westlichen Nationen zu einem überragenden politischen und gesellschaftlichen Anliegen, das indes auch heute noch gegen hegemoniale und paternalistische Strukturen und Systeme verteidigt und erkämpft werden muss.
Die Befreiung des Menschen hin zur Eigenständigkeit im Denken, Wollen und Handeln – exemplarisch dafür steht heute die Bezeichnung »mündiger Bürger« – umfasst auch seinen Status als mündiger Patient. Als solcher erhält er Rückendeckung und Förderung durch die Rechtsprechung, was mittlerweile auch in der Politik und der Ärzteschaft breite Akzeptanz gefunden hat.
So ist es schon seit Jahrzehnten ein zentrales Anliegen unseres Gesundheitssystems, dem Patienten als individuellem Akteur innerhalb seiner gesundheitlichen Versorgung, insbesondere bei medizinischen Vorgehensweisen und ärztlichen Behandlungsentscheidungen bzw. -empfehlungen, mehr Gewicht, d. h. ein Mehr an Selbstbestimmung, zu ermöglichen.
Damit soll auch gleich gesagt sein, was dieses Buch weitgehend außer Acht lässt bzw. nur am Rande behandelt: Es geht nicht um die strukturellen Probleme unseres Gesundheitssystems, wie den von den Bürgern seit Langem beklagten Ärztemangel und den Pflegenotstand, nicht um überbordende Bürokratie in Kliniken und Arztpraxen, den Rückstand bei der Digitalisierung und die anstehende Krankenhausreform. Vielmehr geht es vorrangig um die Position des Bürgers und Patienten innerhalb des existierenden Systems unserer Gesundheitsversorgung: Im Mittelpunkt stehen seine Interessen, seine Rechte und, nicht zuletzt, auch seine moralische Pflicht, für die eigene Gesundheit selbst Sorge zu tragen.
Dass Patienten die eigenen Interessen artikulieren und auch durchsetzen, ist eine vergleichsweise junge Entwicklung. Noch bis in die 1990er-Jahre hinein lag die Expertise, über den Gang der Behandlung eines Patienten zu entscheiden, traditionell allein in ärztlicher Hand. Die ärztliche Autorität infrage zu stellen, ihr gar zu widersprechen, kam einem Sakrileg gleich. Mit anderen Worten: Der Kranke hatte faktisch kein Mitspracherecht; der Arzt behandelte ihn im Sinne des benevolenten (wohlmeinenden), indes autoritativen Paternalismus – mehr oder weniger – wie ein unwissendes und unmündiges Kind. Dabei wurde ihm ein allgemeines Interesse an der eigenen Gesunderhaltung unterstellt.
Dieses Leitbild gehört glücklicherweise der Vergangenheit an. Rufe und Forderungen nach mehr Patientenautonomie, Patientensouveränität, Patientenmündigkeit und Patientenrechten haben auch deswegen Wirkung gezeitigt, weil der Patient zunehmend als Kunde, Verbraucher und Konsument, der eigenverantwortliche Entscheidungen trifft, in den Blick gerückt ist.
Dieses neue Leitbild bleibt nicht unwidersprochen, aus guten und nachvollziehbaren Gründen. Zwar macht der mündige Bürger vor dem mündigen Patienten sicher nicht halt, indes ist zwischen beiden zu unterscheiden: Denn gerade sein Dasein als Patient – verstanden als das eines kranken, leidenden, hoffenden, vielfach angstbesetzten und zudem meist unwissenden Menschen – stellt ein enormes Hindernis dafür dar, von Wahlfreiheit, Urteilsfähigkeit und selbstbestimmten Entscheidungen Gebrauch zu machen. Ihm gegenüber steht der Arzt mit seiner traditionell hohen Autorität und seinem überlegenen Kenntnisstand, der das prinzipiell asymmetrische Verhältnis von Patient und Arzt begründet.
Umso mehr bleibt es eine Aufgabe der Gesundheitspolitik, mehr noch der Ärzteschaft, den Patienten mittels umfassender Information und Aufklärung in die Lage zu versetzen, eine selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können. Das erfordert Dialogbereitschaft und Dialogfähigkeit auf beiden Seiten und führt idealerweise zu einer partizipativen Entscheidungsfindung zwischen Patient und Arzt – und zwar auf »Augenhöhe«.
Aufklärung – im Sinne einer transparenten Darstellung aller Chancen, Risiken und Unsicherheiten einer medizinischen Maßnahme auf Basis bestmöglicher wissenschaftlicher Evidenz – ist die unverzichtbare Grundlage für eine vernünftige, abgewogene und selbstbestimmte Patientenentscheidung. Dem Patienten eine solche Entscheidung zu ermöglichen, ist ein zentrales Anliegen dieses Buches: Die Akteure im Gesundheitswesen müssen, um es in ein medizinisches Bild zu kleiden, zum Geburtshelfer der Patientenautonomie werden.
Aber: Information und Aufklärung des Patienten in dem genannten Sinne sind, um es zurückhaltend auszudrücken, seit jeher Stiefkinder der Gesundheitsversorgung. Nicht nur, dass außerhalb der wissenschaftlichen Medizin ein grenzenloser und von zweifelhaften, falschen, vielfach auch gefährlichen Informationen und Behandlungsangeboten durchsetzter Gesundheitsmarkt in nahezu allen Medien tagtäglich auf Gesunde wie Kranke einwirkt; auch Ärzte und ihre Verbände sowie andere mit Gesundheitsfragen betraute staatliche Einrichtungen wie beispielsweise die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZGA) vermitteln häufig einseitige Gesundheitsinformationen und -aufklärung, die oft mehr den Interessen ihrer Anbieter als denen der Bürger und Patienten folgen. Lobend sind hier der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) und das in seinem Auftrag arbeitende Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) zu nennen. Deren Verlautbarungen etwa zur Krankheitsprävention und zu neuen Behandlungsmethoden sind zu Recht als verlässlich zu werten, eben weil sie kritisch und nach bestem aktuellen Wissen informieren. Auch einige wenige Printmedien, wie etwa die vorbildlichen Gesundheitsbeilagen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, geben hilfreiche und verständliche Orientierung.
Dem atemberaubenden und unaufhaltsamen Fortschritt der Medizin und den mit ihm verknüpften Verheißungen von Gesunderhaltung und Langlebigkeit schenken wir nur allzu gern Glauben. Aus ihnen schöpfen die Anbieter von Gesundheitsleistungen jedweder Art ihre Macht und mit ihr auch die Manipulationsmöglichkeiten gegenüber Gesunden und Kranken. Hier lauert eine kaum zu unterschätzende Gefahr, weil Letztere leicht zum Spielball ihrer Interessen werden und damit ihre eigene kritische Urteils- und Entscheidungsfähigkeit unterminiert wird.
Die Emanzipation des gesunden und kranken Bürgers sollte darauf zielen, seine Eigenverantwortung ernst- und wahrzunehmen, von seinen Rechten als Patient sinnvollen Gebrauch zu machen und seinen Willen respektiert und letztlich akzeptiert zu wissen. Pointiert formuliert heißt dies: Er muss seine Emanzipation auch wollen!
Im vorliegenden Buch indes jeden Winkel der gesundheits- und krankheitsbezogenen Handlungsfelder auszuleuchten, die für den emanzipierten Bürger von Wert sind, ist aus Platzgründen nicht möglich. Ich beschränke mich daher auf ausgewählte Handlungsfelder, die mir erfahrungsgemäß als besonders wichtig erscheinen.
Kapitel 1 befasst sich mit dem Begriff »Gesundheit« und seinen verschiedenen Facetten. Die Faktoren und Einflüsse, die unser gesundheitliches Niveau bestimmen, erörtert Kapitel 2. Kapitel 3 gibt einen Überblick darüber, wie wirkliche Krankheit von Befindlichkeitsstörungen und Normabweichungen abzugrenzen ist, während Kapitel 4 plausibel macht, dass Symptome oder Beschwerden, die ein Mensch als Notfall erlebt, keineswegs mit dem gleichzusetzen sind, was medizinisch tatsächlich ein Notfall ist. Kapitel 5 greift die wohl nie endende Kontroverse zwischen der konventionellen wissenschaftsbasierten Medizin, Naturheilverfahren und alternativmedizinischen Behandlungsmethoden auf. Patientensicherheit ist das Thema von Kapitel 6: Sie umfasst alle Maßnahmen in Arztpraxen, Kliniken und anderen Gesundheitseinrichtungen, die darauf abzielen, Patienten vor vermeidbaren Schäden in Zusammenhang mit der Heilbehandlung zu schützen. In engem Zusammenhang damit steht Kapitel 7, das für die Rechte sensibilisiert, die Patienten zustehen und von Behandlern und Kostenträgern unbedingt zu respektieren sind. In Kapitel 8 erfahren Sie, welche Möglichkeiten Ihnen als Patient bei Behandlungsfehlern seitens medizinischen Personals zustehen. Kapitel 9 geht auf die Themen Überdiagnostik und Übertherapie ein – also für die Gesunderhaltung nicht notwendige medizinische Leistungen, die weder die Qualität des Lebens noch dessen Dauer erhöhen. Kapitel 10 stellt die komplexe Frage nach dem »guten« Arzt. Was ihn ausmacht und woran er für den Patienten erkennbar ist, dazu gibt dieser Abschnitt des Buches Hinweise und Empfehlungen. Kapitel 11 zeigt, wie sich ärztliches Fehlverhalten, das zusehends häufiger wird, bekämpfen lässt. Die »Volkskrankheit Übergewicht« steht im Fokus von Kapitel 12 ebenso wie die am Horizont erscheinende Abnehmspritze, in die Millionen von Menschen ihre Hoffnung setzen. Nahrungsergänzungsmittel (NEM) sind buchstäblich in aller Munde – Pro und Contra und wo gegebenenfalls auch Gefahren liegen, diskutiere ich in Kapitel 13. Kapitel 14 nimmt die oftmals von Ärzten angebotenen Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) in den Blick, während Kapitel 15 die Vor- und Nachteile der elektronischen Patientenakte (ePA) erläutert. Kapitel 16 widmet sich dem virulenten Thema Prävention. Welchen Gewinn ziehen die unterschiedlichen Präventionsstrategien nach sich? Und welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll? Gesundheit bis ins hohe Alter zu erhalten, ist ein Desiderat westlicher Gesellschaften. Wie das mit geringem Aufwand und zudem ohne Kosten bis ins hohe Alter gelingt, steht in Kapitel 17 zu lesen. Kapitel 18 wendet sich dem Zusammenhang von Gebrechlichkeit und Alter zu. Kapitel 19 erörtert das Für und Wider der Alzheimer-Frühdiagnostik, die seit einigen Jahren möglich ist. Und schließlich wende ich mich in Kapitel 20 dem Lebensende zu und erörtere insbesondere die Optionen, die nicht allein schwerst leidenden Menschen offenstehen: Patientenverfügung, Palliativmedizin, ärztliche Suizidbeihilfe. Kapitel 21 widmet sich dem hoch umstrittenen Thema Organspende, während das letzte Kapitel Vorschläge macht, wie der Patient in der derzeitigen Verfassung unseres Gesundheitssystems wieder mehr in den Mittelpunkt rücken kann. Zu guter Letzt geht es um die Gefahren, denen man sich aussetzt, wenn man gerade auf den großen Social-Media-Plattformen erscheinende Gesundheitsinformationen unkritisch zur Kenntnis nimmt.
*
Ich habe dieses Buch als Arzt geschrieben, der seit über vier Jahrzehnten Patienten berät und behandelt, aber auch als Patient, der selbst seit vielen Jahren mit mehreren ernsthaften Erkrankungen lebt. Aus beiden Erfahrungen heraus kenne ich die zentralen Felder unserer gesundheitlichen Versorgung, zumal die spannungsreiche Beziehung von Patient und Arzt, von Eigenverantwortung und Anspruch auf medizinische Versorgung, nur zu gut – und weiß, wo ihre Herausforderungen und Defizite liegen.
Als Arzt verfüge ich über umfangreiche Erfahrungen in mehreren medizinischen Fachgebieten: Zunächst war ich in der Anästhesiologie, Gynäkologie, Unfallchirurgie an verschiedenen norddeutschen Kliniken tätig, ehe ich mich schließlich in Berlin auf die Innere Medizin konzentrierte und 1991 die Anerkennung als Internist und später auch als Notfallmediziner erhielt. Zwischenzeitlich arbeitete ich als Praxisvertreter, als Schiffsarzt auf einem EU-Fischereischutzboot und nahm in den 1980er-Jahren an einem Nothilfeprojekt teil, das über mehrere Monate kambodschanische Pol-Pot-Flüchtlinge in thailändischen Lagern ärztlich versorgte. Am Berliner Urban-Krankenhaus engagierte ich mich über Jahre hinweg für die hier zahlreich eingelieferten Opiatabhängigen und ihre klinische Versorgung mit Methadon. Als Stationsarzt oblag mir zunächst die Behandlung internistischer, insbesondere kardiologisch erkrankter Patienten, es folgten sechs Jahre Intensivstation einschließlich regelmäßiger Notarztwageneinsätze. Während meiner letzten Jahre übernahm ich als Chefarzt die Leitung der Rettungsstelle der Klinik. Meine letzte Aufgabe vor meiner Pensionierung 2013 war die Mitgründung eines Hospizes in Berlin. Bis heute bin ich privatärztlich tätig, nehme an der Notfallversorgung von Patienten teil und betreue schwer erkrankte Patienten.
Vier Anliegen, Merkmale und Verpflichtungen ziehen sich durch meine Tätigkeit als Arzt wie ein roter Faden:
Immer versuche ich, die Behandlung eines Patienten so zu gestalten, dass sie für ihn mit den geringstmöglichen Belastungen und Risiken einhergeht, nach bestem Wissen und Gewissen. Wichtigstes Mittel hierzu ist das anamnestisch-diagnostische Gespräch, das dem Patienten allzu oft überflüssige, risikoreiche und kostspielige Behandlungen erspart.Mein ärztliches Selbstverständnis ist eher das eines »Generalisten« in dem Sinne, dass ich mir zutraue, bei bestimmten Symptomen oder Krankheitserscheinungen eine bestimmte Vorgehensweise zu indizieren oder zu empfehlen, ohne sie selbst auch praktisch durchzuführen. Beispielsweise ist es eine Sache, zu wissen, wann eine Magenspiegelung angezeigt ist; eine andere, sie auch selbst vorzunehmen oder vornehmen zu können. Damit verknüpft ist meine Hochschätzung kollegialen Rats (Zweitmeinung), gerade dann, wenn für einen Kranken mehrere Behandlungsoptionen existieren. Denn eine Behandlungsentscheidung grundsätzlich auf mehrere Schultern zu verteilen, dient dem Patienten und entlastet den einzelnen Arzt.In gewisser Weise hatte ich immer auch das Selbstverständnis eines »Randgruppenarztes«: Mich sozial Benachteiligten, Suchtkranken, chronisch Kranken und Sterbenden zuzuwenden, war mir immer ein besonderes Anliegen.Verpflichtend und maßgeblich für ärztliches Handeln und Entscheiden ist für mich die »Charta zur ärztlichen Berufsethik«. In ihr heißt es gleich zu Anfang: »Das Primat des Patientenwohls beruht auf der grundsätzlichen Verpflichtung des Arztes, den Interessen des Patienten zu dienen (…) die Interessen des Patienten sind über die des Arztes zu stellen (…).« Diesem Prinzip zu folgen, war mir in meiner ärztlichen Arbeit immer ein prioritäres Anliegen, das sich nicht zuletzt auch in zahlreichen von mir verfassten Zeitschriftenartikeln und Büchern widerspiegelt.Andererseits: Auch ich erlag, vergleichsweise früh, dem Dasein als Patient. Bis dahin war ich dem Trugbild verfallen, ein Attribut meines ärztlichen Berufs sei eine quasi natürliche persönliche Krankheitsresistenz, indes eine geradezu törichte Selbsttäuschung, die maßgeblich dazu beitrug, dass ich mit mir selbst wenig achtsam umging. Ich war übergewichtig, aß zu kalorienreich, oft anfallsartig, rauchte und bewegte mich kaum. Mein Blutdruck war zu hoch, meine Blutfettwerte ebenfalls. Über Jahre absolvierte ich monatlich fünf Nachtdienste, litt unter hohem Stress und konnte kaum Zeit für mich selbst und mein Sozialleben erübrigen. Und so kam es, wie es kommen musste: Nach einem Herzinfarkt vertauschte ich im Dezember 2003 erstmals meinen weißen Kittel mit einem lindgrün geschlitzten Klinikhemd und fand mich dort wieder, wo ich vormals jeden Morgen meine Patienten begrüßt hatte – in einem Klinikbett. Es sollte nicht das letzte bleiben, denn auch von einer Krebserkrankung blieb ich nicht verschont.
Auch wenn mir als Kollege nicht selten eine gewisse Vorzugsbehandlung zuteil wurde, erlebte und durchlebte ich doch immer wieder alle Ängste, Zweifel und Fragen, die mehr oder weniger alle Patienten umtreiben, gerade dann, wenn die Behandlung einer lebensbedrohlichen Erkrankung ansteht; einen Arzt wie mich umso mehr, als ich mich bezüglich der Chancen, Unwägbarkeiten und möglichen Fehlerhaftigkeit einer Behandlung besser auskannte als sogenannte Normalpatienten: War ich in den Händen der mich jeweils behandelnden Kollegen wirklich bestmöglich aufgehoben? Welche Qualifikation und Erfahrung war ihnen eigen? Konnte ich ihnen vertrauen? Was lag in ihrer »Macht« und was nicht? Über welche Sorgfalt und manuelle Geschicklichkeit verfügten sie, etwa bei körperlichen Eingriffen wie Operationen, Katheterinterventionen oder einer Tumorbehandlung? Hinzu kamen beunruhigende Fragen gänzlich anderer Art, Fragen, die ich an mich selbst zu richten hatte: Was hatte ich selbst für meine Gesunderhaltung getan, was hatte ich versäumt? Auch über mein eigenes Lebensende dachte ich immer wieder nach: Was würde ich wollen, wenn mein Leben irgendwann möglicherweise als Wachkomapatient oder Hirntoter enden sollte? Wäre ich zu einer Organspende bereit? Stand ich auch als Kranker noch zu dem, was ich Jahre zuvor in gesunden Tagen in meiner Patientenverfügung niedergelegt hatte?
Meine hier in aller Kürze dargestellten Erfahrungen als Arzt und Patient gehören zum »Unterholz« – ein IT-Spezialist würde sagen, zum »Bios« – des vorliegenden Buches. Sie haben den Boden dafür bereitet, eine Orientierungshilfe für Patienten zu schaffen, die es ihnen ermöglicht, sich besser in unserem Gesundheitssystem zurechtzufinden. Zudem ist es mir ein Anliegen, ihnen die nötigen Mittel und Wege an die Hand zu geben, um ihre Autonomie und Kompetenz als Patienten zu stärken, ihre Selbstwirksamkeit zu fördern und sie damit in die Lage zu versetzen, selbstbestimmt im Medizinbetrieb zu agieren.
* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die weibliche Sprachform verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Kapitel 1 Gesundheit: ein Begriff, viele Bedeutungen
Gesundheit ist ein vielschichtiger Begriff. Seit jeher setzen sich Ärzte, Philosophen, Theologen, politische Entscheidungsträger und andere Berufene mit der Bedeutung und dem Wesen von individueller und kollektiver Gesundheit auseinander. Bereits vor über 2000 Jahren wurde Gesundheit als ein Zustand verstanden, der zum einen durch den individuellen Lebensstil erhalten, zum anderen durch die Behandlung von Krankheit wiederhergestellt werden kann – eine Sichtweise, die bis heute Gültigkeit beansprucht. Doch auch wenn damit zwei zentrale Einflussfaktoren benannt werden, beschreibt diese Definition lediglich, was auf Gesundheit wirkt – nicht jedoch, was sie im Kern ausmacht. Aus einem einfachen Grund: Eine Definition des Begriffs »Gesundheit« ist deswegen bis heute nicht gelungen, weil je nach Zeitalter, naturwissenschaftlichem Kenntnisstand, medizinischer, philosophischer oder theologischer Denkrichtung unterschiedliche Perspektiven auf das, was Gesundheit ihrem Wesen nach ist, wirksam wurden und werden.
Die WHO-Definition der Gesundheit
Unbestreitbar ist, dass Gesundheit ein elementares menschliches Anliegen und Bedürfnis ist. Zu Recht wurde Gesundheit deshalb 1945 als Grundrecht in die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« (Artikel 25) aufgenommen. In ihrem Kontext veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im darauffolgenden Jahr eine bahnbrechende Neudefinition von Gesundheit, die, trotz mancher Kritik an ihr, immer noch die vorherrschende ist: »Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen.«
Genau genommen – das geht aus der Präambel zu Artikel 25 klar hervor – formuliert die WHO hier Grundsätze (principles) und keine Definition, die wissenschaftlichen Kriterien genügt; dennoch hält sich die Formel »WHO-Definition« bis heute. Ihr Verdienst besteht darin, dass sie das Verständnis von Gesundheit aus der traditionellen Zuständigkeit der Medizin gelöst hat und damit nicht mehr nur krankheitsbezogen definiert. Gesundheit erfordert vielmehr die Wirksamkeit positiver kultureller, ökonomischer und sozialökologischer Voraussetzungen. Damit bereitete die WHO-Definition den Weg für das erst Jahrzehnte später entwickelte »bio-psycho-soziale Modell« von Gesundheit und Krankheit.
Kritik zog und zieht die WHO-Definition auch deshalb auf sich, weil sie angesichts der konkreten, vielfach katastrophalen Lebensbedingungen des größten Teils der Menschheit (insbesondere auf der südlichen Erdhalbkugel) als Illusion erscheinen muss. Beanstandet wurde zudem, dass die WHO-Definition Gesundheit als einen statischen Zustand bezeichnet und nicht als einen Prozess, der Veränderung beinhaltet.
Befragungen der Bürger ergeben regelmäßig: »Gesundheit ist das höchste Gut.« Eine apodiktische Aussage, die, wenn man sie ernst nimmt, irritiert. Ist sie mehr als eine dahingesagte Floskel, eine Plattitüde? Was verbirgt sich dahinter? Was folgt aus ihr? Gibt es überhaupt die Gesundheit?
Ein Mensch, der sich gesund »fühlt«, wird sich kaum weiteren Gedanken über sie hingeben, bestenfalls wird er dafür Sorge tragen, dass sie ihm erhalten bleibt. Ein (chronisch) Kranker oder Behinderter wird sie herbeisehnen, vielleicht ein Leben lang um sie kämpfen, möglicherweise darüber depressiv werden und sich ausgeschlossen fühlen.
Wenn ich in der Notfallambulanz bei einem mir bis dahin unbekannten Patienten die Anamnese erhebe, frage ich eingangs: »Waren Sie bisher gesund? Waren Sie schon einmal im Krankenhaus? Nehmen Sie Medikamente ein?« Diejenigen, die sich für gesund halten (und weder Klinikaufenthalte hinter sich haben noch Medikamente einnehmen), antworten mit einem knappen »Ja«, »Ich hoffe doch!«, »Ich fühle mich bestens«, »Selten hab ich mal Kopfschmerzen, aber nur vorübergehend« oder Ähnlichem.
Menschen mit Vorerkrankungen reagieren verständlicherweise völlig anders, jedoch sehr unterschiedlich; manche fatalistisch, selbstmitleidig, offen oder verhalten depressiv: »Gesundheit? Das war einmal … seit meiner Darmkrebsoperation und der Anlage eines Anus praeter bin ich nur noch ein halber Mensch, ich schäme mich.« Ein anderer: »Irgendwie muss es ja weitergehen nach meinem Schlaganfall, aber die Freude am Leben ist mir seit Langem vergangen.« Manche hingegen reagieren tapfer und couragiert: »Vor einem halben Jahr wurde mir die linke Brust abgenommen, seitdem mache ich Chemo, die vertrage ich ganz gut, und eigentlich fühle ich mich doch ziemlich gesund.« Eine junge Diabetikerin, die mich wegen einer Handverletzung aufsuchte, bemerkte beiläufig: »Jeden Tag Blutzucker messen, Insulin spritzen und Diät halten … schön ist das nicht, fühle mich aber sonst ganz fit … man gewöhnt sich an alles.«
Dass selbst im Zustand schwerster Erkrankung oder Behinderung eine Deutung der eigenen Lebenssituation nicht allein als erträglich, sondern sogar als Zustand des Wohlbefindens erlebt werden kann, mag ein weiterer meiner Patienten illustrieren.
Thomas S., 32 Jahre alt, war seit vier Jahren infolge eines Unfalls vom Hals an abwärts querschnittsgelähmt und damit vollständig von seinen Mitmenschen abhängig, Atmung und Sprachvermögen waren nicht beeinträchtigt. Weil es sich um einen Arbeitsunfall handelte, war durch die Berufsgenossenschaft eine optimale Behandlung und pflegerische Versorgung sichergestellt, im Falle von Herrn S. eine Rund-um-die-Uhr-Pflege durch drei gleichaltrige männliche Pflegekräfte, von denen immer eine in seiner Nähe war. Tagsüber saß er im Rollstuhl, unternahm mit seinen Pflegern Einkaufs- und Spazierfahrten, Konzertbesuche und sogar Urlaube. Abends hievten sie ihn ins Bett und morgens wieder in den Rollstuhl. Morgentoilette und Frühstück schlossen sich an, er wurde gefüttert. Eben das aber machte, wenn auch selten, Komplikationen: Er verschluckte sich und begann, heftig zu husten und zu würgen, weil Nahrung und Flüssigkeit in Luftröhre und Lunge statt in Speiseröhre und Magen gelangt waren. Dann veranlassten seine Pfleger, die Thomas S. »meine Freunde« nannte, eilends einen Transport in die Rettungsstelle – glücklicherweise wohnte er in der Nähe unserer Klinik –, weil er abgesaugt werden musste; eine unangenehme Prozedur, bei der er nach Kräften mitarbeitete. War das Absaugmanöver überstanden, entspannte er sich und lächelte selig: »Ach, was hab ich für ein Glück, jetzt geht’s mir wieder richtig gut!« Beim Verlassen der Rettungsstelle raunte mir einer seiner Pfleger zu: »Nie hadert er mit seinem Schicksal, keine Spur von Depressionen, immer hat er Ideen, will etwas unternehmen und ist zu Späßen aufgelegt. Es macht uns eine Riesenfreude, für ihn da zu sein.«
Nicht verkannt werden darf, dass Thomas S. – wenn auch von empathischen Menschen umgeben und versorgt – offenbar über ungewöhnliche psychische und mentale Ressourcen verfügt, die ihn sein schweres Schicksal nicht nur ertragen lassen, sondern es in Lebenszufriedenheit, ja sogar in ein Stückchen Glück wenden. Diese Ressourcen bestehen in dem Vermögen, sich an wandelnde Daseinsbedingungen im Sinne der Resilienz zu adaptieren. Nicht wenige Patienten, die sich mit vergleichbar schweren Erkrankungen oder Behinderungen dahinquälen, können solche Ressourcen nicht mobilisieren; im Gegenteil, sie wünschen vielmehr – nachvollziehbar – ein Ende ihres Leidens.
Gesundheit – die Sicht der Ärzteschaft
Die Medizin bzw. die Ärzteschaft hat bis heute kein eigenes Konzept von Gesundheit, im Sinne eines positiven Gesundheitsbegriffs, erarbeitet. Zwar hat die Medizin in vielen ihrer Teilgebiete (Physiologie, Molekularbiologie, klinischer Chemie u. a.) zu einem Verständnis beigetragen, was Gesundheit auch ist, dass sie nämlich gewissen morphologischen und funktionalen Bedingungen unterliegt; doch bestimmt sich im Kern ihr Gesundheitsbegriff immer noch in der Abwesenheit von Krankheit (wenn man so will, eine negative »Definition« von Gesundheit). Hier, in der Definition von pathophysiologisch fassbarer Krankheit, liegen ihre eigentlichen Meriten. Also darin, wie der Körper unter den krankhaften Veränderungen abweichend funktioniert und welche Funktionsmechanismen zu der krankhaften Veränderung führen (Pathogenese).
Demzufolge konnte es nicht ausbleiben, dass die Medizin sich einem immer komplexer werdenden, weitestgehend biologistischen Krankheitsverständnis verschrieb: Krankheit wird (wieder!) gemessen, und zwar in Bildern und Zahlen. So wird beispielsweise auf Basis epidemiologischer Daten das Blutdruckverhalten der Bevölkerung ermittelt, um daraus Normwerte für den systolischen und diastolischen Blutdruck zu definieren. Ähnlich wird festgelegt, was eine normale (= gesunde) Körpertemperatur ist. Jedes Organ, ob gesund oder krank, gehorcht in der Bildgebung (CT, Angiographie, Sonographie u. v. m.) bestimmten strukturellen Kriterien. Ebenso zeigen Laborwerte (Zahlen) an, ob ein Organ oder Organsystem aus seinem physiologischen Gleichgewicht geraten ist. Kurvenverläufe wie EKG, EEG, EMG »beweisen« bestimmte Funktionseinschränkungen der Organe und damit Krankheit oder Gesundheit.
Relative, bedingte und funktionale Gesundheit
Seit der 80 Jahre zurückliegenden WHO-Definition sind immer wieder Versuche unternommen worden, diese Definition zu erweitern bzw. sich einer aktuelleren Definition anzunähern. Denn die zunehmende Hochaltrigkeit sowie die Fortschritte der Medizin in Diagnostik und Behandlung chronisch degenerativer Erkrankungen (Hochdruck, Krebs, HIV-AIDS u. v. m.), die vormals meist tödlich verliefen, haben ihr Management massiv verändert: Derartige Erkrankungen können heute durch lebensbegleitende Therapie und Gesundheitsförderung so verlaufen, dass an ihnen Erkrankte bei weitestgehender Beschwerdefreiheit eine Lebenserwartung haben, die der eines nicht erkrankten Menschen entspricht. Ein klassisches Beispiel ist der übergewichtige Diabetiker, der, wenn er mit Antidiabetika behandelt wird, seinen Blutzucker kontrolliert, sich an Diät hält, sein Körpergewicht reduziert und sich ausreichend bewegt, ein bis ins hohe Alter normales Leben führen kann. In den Vereinigten Staaten spricht man von half-way-technologies (zu denen übrigens auch die Organtransplantation zählt): Zahlreiche Krankheiten und ihre Symptome lassen sich zwar nicht ursächlich behandeln, doch lassen sie sich so weit kontrollieren, dass ein der Gesundheit vergleichbarer Zustand resultiert.
Offensichtlich ist: Die Gesundheit gibt es nicht. Sie trifft vielmehr dann auf einen Menschen zu, wenn er über die Fähigkeit verfügt, die schicksalhaften Herausforderungen des Lebens aktiv und produktiv anzugehen und zu gestalten.
Die meines Erachtens durchdachteste und umfassendste Annäherung an einen integrativen und interdisziplinären Begriff von Gesundheit legten die Gesundheitswissenschaftler Klaus Hurrelmann und Peter Franzkowiak 2013 vor. Bezeichnenderweise enthält sich ihre »Definition« der körperlichen Seite der Gesundheit: »Gesundheit bezeichnet den Zustand des Wohlbefindens einer Person, der gegeben ist, wenn diese Person sich psychisch und sozial in Einklang mit den Möglichkeiten und Zielvorstellungen und den jeweils gegebenen äußeren Lebensbedingungen befindet. Gesundheit ist nach diesem Verständnis ein angenehmes und durchaus nicht selbstverständliches Gleichgewichtsstadium von Risiko- und Schutzfaktoren, das zu jedem lebensgeschichtlichen Zeitpunkt immer erneut in Frage gestellt ist. Gelingt das Gleichgewicht, dann kann dem Leben Freude und Sinn abgewonnen werden, es ist eine produktive Entfaltung der eigenen Kompetenzen und Lernpotenziale möglich, und es steigt die Bereitschaft, sich gesellschaftlich zu integrieren und zu engagieren.«
Hurrelmann spricht an anderer Stelle auch von relativer Gesundheit im Sinne eines Gesundheits-Krankheits-Kontinuums: Von psychischen oder körperlichen Störungen oder Erkrankungen beeinträchtigte Menschen bewältigen diese in unterschiedlichem Ausmaß. Sie sind nicht ausschließlich krank; sie verfügen meist über Energien und Ressourcen, die ihnen ein Leben in relativer oder bedingter Gesundheit ermöglichen.
Das derzeit dominierende Gesundheitskonzept fußt auf dem »bio-psycho-sozialen Modell«, das im ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) niedergelegt ist. Laut ihm gilt (nach Hurrelmann) eine Person dann als funktional gesund, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:
ihre körperlichen Funktionen einschließlich des seelischen Bereichs und der Körperstrukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzept der Körperfunktionen und -strukturen);sie all das tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsprobleme erwartet werden darf (Konzept der Aktivitäten);sie ihr Dasein in allen ihr wichtigen Lebensbereichen in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitliche Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Teilhabe).Dieses Gesundheitskonzept setzt das WHO-Modell nicht außer Kraft, es konkretisiert und überschreitet es jedoch: Nicht mehr Krankheit und ihre Folgen stehen in seinem Mittelpunkt. Es orientiert sich vielmehr am Vermögen einer Person, die sie betreffende Realität produktiv zu verarbeiten und zu gestalten.
Dass chronische Krankheit, Immobilität oder andere Weisen der Behinderung bei den von ihnen betroffenen Menschen – nach meiner Erfahrung sogar in der Mehrzahl der Fälle – nicht mit Depressionen, Niedergeschlagenheit und Teilnahmslosigkeit einhergehen, hat mich immer wieder überrascht, wofür auch mein Patient Thomas S. ein treffendes Beispiel abgibt. Besonders das Schicksal blinder Menschen, denen trotz ihres schweren Leidens Zuversicht, Lebensfreude, Anpassungs- und Leistungsfähigkeit nicht fremd sind, gegenwärtig von der erblindeten Präsidentin des Sozialverbandes VdK und ehemaligen Biathletin Verena Bentele eindrucksvoll verkörpert, ringt mir Bewunderung ab. Ein Paradox scheint mir solchem Behauptungswillen zugrunde zu liegen: Offenbar können gerade gesundheitliche Beeinträchtigungen in Menschen ungeahnte Potenziale und Ressourcen freisetzen und sie subjektiv Gesundheit und Lebenszufriedenheit erleben lassen, die sie vielleicht ohne gesundheitliche Einbußen niemals erfahren hätten.
Der ärztliche Auftrag – zwischen Krankenbehandlung und Patientenwünschen
Wir leben in einer Zeit, in der das, was die bestmögliche Entfaltung des Ego – vulgo: Selbstverwirklichung – betrifft, zu einem überragenden individuellen Desiderat geworden ist (eher allerdings für Angehörige der Ober- und Mittelschicht unserer Gesellschaft als für diejenigen, die unter prekären Verhältnissen zu leben genötigt sind). Die Sorge und das Bemühen um Gesunderhaltung und Fitness rangieren dabei auf einem der vordersten Plätze. Ein unübersehbares und florierendes Konglomerat ebenso verheißungsvoller wie zweifelhafter Angebote hat eine Gesundheits-, Wellness- und Anti-Aging-Industrie geschaffen, der sich kaum ein Mensch entziehen kann und mag: Sie reicht von Stressreduktions-Seminaren, zertifizierten Life-Coaches und Wellness-Quickies an Flughäfen über Ayurveda, Selbstmedikation mit sogenannten Vitalstoffen und astrologischer Orientierung am sogenannten sechsten Haus der Gesundheit bis hin zu Lomi-Lomi-Nui-Massagen und Einreibungen mit Goldstaub. Ein grenzenloser Markt, dem es auch darum geht, »eine positive Sucht aufzubauen«, wie es der Freizeit-Unternehmensberater Carl-Otto Wenzel bereits 2004 zutreffend formulierte. Diesem übermächtigen Markt hängen in den westlichen Gesellschaften zunehmend mehr Menschen an. Die vormals schlichte Frage »Was ist gesund? Wie bleibe ich es?« steht längst im Schatten der drängenderen Frage nach dem ultimativen Glück. Und deren Beantwortung ist, wenn auch uneingestanden, eng verknüpft mit der Aussicht auf ein tendenziell ewiges Leben. Die Definition der Gesundheit als »das Schweigen der Organe« – so noch von dem Philosophen Hans-Georg Gadamer auf eine schlichte Formel gebracht – oder, wie im vorigen Kapitel dargestellt, als der außergewöhnliche Zustand körperlichen, geistigen seelischen und sozialen Wohlbefindens ist zwar nach wie vor gültig, faktisch indes ein alter Hut.
Die Avantgarde der Gesundheitsbewegten will mehr: Souveränitätsgewinn, Erlebnisintensivierung und Leistungssteigerung stehen auf ihrer Agenda, mit welch zweifelhaften Mitteln und auf welchen Wegen auch immer. Getrieben wird sie von milliardenschweren Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, deren Verheißungen letztlich darauf zielen, das Schicksalhafte eines jeden menschlichen Lebens aus diesem auszutreiben. Gesundheit ist nicht mehr allein Lebensmittel, sie wird für mehr und mehr Menschen zum Lebenszweck, zu einer Aufgabe, die die permanente Selbstoptimierung anstrebt, »wenn auch auf Kosten des selbstvergessenen Genusses, der reinen Freude am Dasein und der Hingabe an etwas anderes als sich selbst«, so die Kulturjournalistin Brigitte Scherer.
Nüchterner formuliert geht es um das, was als »wunscherfüllende Medizin« – treffender: Medizin ohne Krankheitsbezug – in der Ärzteschaft, unter Ethikern und in der Öffentlichkeit seit Jahren kontrovers diskutiert wird. Ist es legitim, dass ein gesunder, also nicht kranker einwilligungsfähiger Mensch von Ärzten erwarten oder gar fordern darf, seine Wünsche nach körperlicher Neugestaltung oder mentaler Optimierung zu erfüllen? Vice versa: Ist es mit der ärztlichen Ethik vereinbar, dass ein Arzt seinen klassischen Heilauftrag, nämlich Kranke zu behandeln, derart »überdehnt«, dass er auch Gesunde auf ihren Wunsch hin quasi als Kranke behandelt; letztlich bis hin zu Menschen mit dem bizarren Begehren nach der Amputation einer Extremität, fachsprachlich Apotemnophilie** genannt?
Der klassische ärztliche Heilauftrag hat immer und ausschließlich Bezug zu dem, was im konventionellen Sinn als Krankheit verstanden wird. Ihm sind fünf unbestrittene Merkmale eigen:
Prävention von Krankheit und Förderung von GesundheitLinderung bei Leid und SchmerzHeilung/Behandlung von KrankheitVermeidung eines vorzeitigen TodesUmfassende Sorge für ein friedliches SterbenDieser Heilauftrag wiederum gehorcht der allein vom Arzt zu stellenden und von ihm zu begründenden Indikation (oder Kontraindikation) für eine diagnostische oder therapeutische Maßnahmeunter der Bedingung eines erwartbaren Nutzens und einer Vermeidung von Schaden für den Patienten. Vor der Umsetzung der Indikation in ärztliches Handeln (chirurgischer Eingriff, Medikamentenverordnung u. v. a.) muss der Arzt sodann das informierte Einverständnis des Patienten einholen. Damit ist ein Kernstück ärztlicher Identität formuliert und zugleich die Beziehung zwischen Patient und Arzt.
Fakt ist: Längst orientiert sich der ärztliche Heilauftrag nicht mehr allein am Krankheitsbezug, also auf die Vorbeugung und Behandlung dessen, was traditionell unter Krankheit verstanden wird; vielmehr wird aufgrund des medizinischen Fortschritts die Erfüllung von Wünschen gesunder Menschen zusehends zu einer Option ärztlichen Handelns (auf das durchaus auch ökonomische ärztliche Eigeninteressen Einfluss nehmen): Ob kosmetische Chirurgie, Reproduktionsmedizin, Lifestyle-Medizin, legale Leistungssteigerung im Sport oder mentales Enhancement – grenzenlos erscheinen die medizinischen Möglichkeiten, die menschliche Existenz vermeintlich oder tatsächlich aufzuwerten und zu vervollkommnen. Dies illustrieren auch die folgenden beiden Fälle:
Ein 25-jähriger junger Mann kam mit einem ungewöhnlichen Anliegen in die Rettungsstelle, nachdem es zuvor mehrere niedergelassene Ärzte abgelehnt hatten, diesem zu entsprechen: Im Rahmen seines Bodybuilding-Trainings wünschte er von mir ein Rezept für ein Testosteron-Präparat, um seinen Muskelaufbau zu beschleunigen, in der Überzeugung, damit seinem Körperbild näher zu kommen. Nach Anamneseerhebung und einer körperlichen Untersuchung schien er mir in bester körperlicher Verfassung, die im Übrigen von einer ausgeprägten Muskulatur zeugte. Ich lehnte eine Testosteron-Verschreibung daher mit dem Hinweis ab, dass es sich in seinem Fall um pures Doping handele. Testosteron sei nur bei einem klinisch oder labormedizinisch nachgewiesenen Mangel verschreibungsfähig, der bei ihm sicher nicht vorliege. Zudem seien erhebliche Nebenwirkungen, wie eine erhöhte Thromboseneigung, Leberschäden und eine verminderte Spermienqualität, nicht auszuschließen. Bezüglich seines Verschreibungswunsches von Testosteron bestehe also eine klare Kontraindikation. Bedauerlicherweise erwies er sich trotz eingehender Aufklärung als beratungsresistent und verließ den Behandlungsraum mit der Bemerkung, dass er dann versuchen werde, sich im Darknet das Medikament zu beschaffen.
Erwägungen dessen, was als natürlich oder als krankhaft anzusehen ist, haben an Bedeutung verloren. An ihre Stelle treten zusehends individuell zu definierende »Gesundheiten«, wie sie schon in einem berühmten Aphorismus Friedrich Nietzsches zum Ausdruck kommen: »Denn eine Gesundheit an sich gibt es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren, sind kläglich missraten. Es kommt auf dein Ziel, deinen Horizont, deine Kräfte, deine Antriebe, deine Irrtümer und namentlich auf die Ideale und Phantasmen deiner Seele an, um zu bestimmen, was selbst für deinen Leib Gesundheit zu bedeuten habe. Somit gibt es unzählige Gesundheiten deines Leibes.« Das zeigt auch der folgende Fall:
Meine Tochter – ich bin nicht ihr leiblicher, doch ihr sozialer Vater –, heute eine erwachsene junge Frau, litt schon als Mädchen unter ihren abstehenden, von ihr selbst so genannten »Segelohren«. Ihre Freundinnen und Mitschüler verspotteten sie als »Dumbo« (nach dem Disney-Film Dumbo, der fliegende Elefant





























