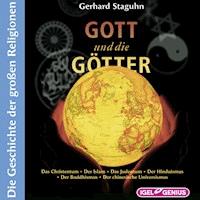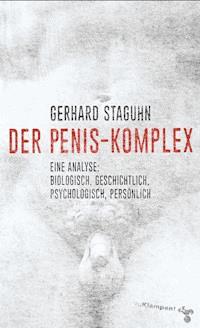
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum ist der Penis des Mannes im Verhältnis zu seiner Körpergröße der größte in der Tierwelt und wieso ist nur der erigierte Penis obszön? Hatte Freud mit dem Penisneid Unrecht, und welche Rolle spielt der Busenneid in der männlichen Entwicklung? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Onanie und Penismessung? Ist die männliche Penisfixierung ein Fetischismus und verdrängt der Dildo den Mann aus dem Schlafzimmer? Kommt Impotenz aus dem Zwang zum Geschlechtsverkehr und wird sie zum Symbol des Niedergangs des männlich dominierten Kapitalismus? Dieser dem Penis in ironischer Verehrung zugeneigte Essay versucht, Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden. Dazu betrachtet Gerhard Staguhn das primäre männliche Geschlechtsorgan aus biologischer, kulturwissenschaftlicher sowie soziologischer, psychologischer, sogar linguistischer Perspektive und schildert mit einem Augenzwinkern eigene peinliche bis komische Erlebnisse und Erfahrungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Staguhn
Der Penis-Komplex
Eine Analyse:
biologisch, geschichtlich, psychologisch, persönlich
Dieses Werk wurde vermittelt durch Schoneburg. Literaturagentur und Autorenberatung, Berlin.
© 2017 zu Klampen Verlag · Röse 21 · 31832 Springe
www.zuklampen.de
Satz: Germano Wallmann · Gronau · www.geisterwort.de
Umschlaggestaltung: © Hildendesign · München · www.hildendesign.de
Bildmotiv: © HildenDesign unter Verwendung eines Motivs
von shutterstock.com/Gilmanshin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017
ISBN 978-3-86674-653-4
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Penis (lat. eigtl. ›Schwanz‹) der (Rute, männliches Glied, Phallus), männl. Begattungsorgan bei vielen Tieren und beim Menschen; dient der Samenübertragung in den Körper des weibl. oder zwittrigen Geschlechtspartners, v.a. bei Bandwürmern auch in den eigenen (zwittrigen) Körper.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Definition
Vorwort
1. Kapitel: Die biblische Penis-Genese
2. Kapitel: Die biologische Penis-Genese
3. Kapitel: Ein aufrichtiges Organ
4. Kapitel: Der berühmteste Penis der Kunstgeschichte
5. Kapitel: Doktorspiele
6. Kapitel: Brüste, Brüste, Pollutionen
7. Kapitel: Von A (wie Antenne) bis Z (wie Zipfel)
8. Kapitel: Der einsame Onan
9. Kapitel: Penetrations-Phobien
10. Kapitel: Der ideale Penis
11. Kapitel: Die Schule des Fetischismus
12. Kapitel: Auf Umwegen zum Koitus
13. Kapitel: Das Fellatio-Problem
14. Kapitel: Die Antinomie der Geschlechter
15. Kapitel: Der pornografische Penis
16. Kapitel: Der künstliche Penis
17. Kapitel: Der impotente Penis
18. Kapitel: Der Penis der Zukunft – Die Zukunft des Penis
Verzeichnis der verwendeten Bücher
Der David, Statue von Michelangelo, Florenz
Vorwort
Als Autor weiß man, dass sich Franz Kafkas berühmte Sentenz »Wer sucht, findet nicht, aber wer nicht sucht, wird gefunden« nicht nur in der Liebe, sondern auch im Finden eines geeigneten Buch-Themas bewahrheitet. Bloß nicht verkrampft danach suchen! Beim vorliegenden Buch war es tatsächlich so, dass ich von diesem für einen Mann zwar nahe liegenden, für einen seriösen Autor gleichwohl etwas abwegig erscheinenden Thema gefunden, fast möchte ich sagen: heimgesucht wurde. Unangemeldet klopfte es ziemlich ungestüm an die Tür, wobei man als Freund des Kalauers geneigt ist, von der Hosentür zu sprechen.
Dass mir diese thematische Heimsuchung erst an der Schwelle zum Alter widerfuhr, erscheint plausibel. Im Alter wird sogar der Angsthase mutig – weil er, was sein bescheidenes Renommee betrifft, nichts mehr zu verlieren hat. Ein bisschen Autoren-Mut wird beim Thema ›Penis‹ in der Tat verlangt, zumal in Zeiten, die prüder sind, als man bei oberflächlicher Betrachtung meinen könnte. So ein Penis ist zwar das Natürlichste von der Welt, doch sobald man sich anschickt, ihn eingehender unter die Lupe zu nehmen, betritt man – wie sollte es anders sein? – das heikle Feld des Obszönen. Dieses ist bestens geeignet, einen Autor ins trübe Licht der Peinlichkeit zu rücken. Das Obszöne des ›Gegenstands‹ färbt auf den Autor ab, spätestens von dem Moment an, da er mit seinem Penis-Essay an die Öffentlichkeit tritt. Diesen Umstand zu beklagen, wäre allerdings nur larmoyant; schließlich zwingt einen niemand dazu, sich eingehend mit dem Geschlechtsteil des Mannes zu befassen, ihm schreibend auf den Grund zu gehen – und sich selbst gleich mit dazu.
Dabei hatte ich schon zu Beginn der Schreibarbeit, und erst recht in ihrem weiteren Verlauf, das dumpfe Gefühl, dass dieses Thema spätestens seit den krisenhaften Zeiten der Pubertät in mir geschlummert hat, tief versunken im Dornröschenschlaf der Verdrängung. Doch alles Verdrängte und Unerledigte kehrt irgendwann zurück. Diese Rückkehr kann faszinierend oder erschreckend sein; meistens ist sie beides zugleich.
Kurzum, das Thema ›Penis‹ birgt für einen Autor ein gewisses Gefahrenpotenzial. Es legt einem so manchen Fallstrick in den Weg. Es kollidiert mit der eigenen Schamgrenze, die sich zuweilen selber als Fallstrick erweist. Schreibend fühlt man sich ständig hin- und hergerissen zwischen Benennen und Verschweigen, Übertreiben und Verharmlosen, zwischen Erkennen, Bekennen und Verkennen, zwischen Entblößen und Verhüllen, Inszenieren und Zensieren. Das heißt, man muss erst mal herausfinden, wo die eigene Schamgrenze, dieses zensierende Geistgebilde aus Selbstschutz und Verklemmtheit, verläuft – und wo die mutmaßlichen Schamgrenzen der mutmaßlichen Leserinnen und Leser verlaufen könnten, wohlwissend, dass jeder Mensch seine ganz persönliche, mehr oder weniger flexible Schamgrenze hat, entsprechend seiner einmaligen Sexualität.
So richtig offenbart sich dieses Problem aber erst in dem Moment, da man als Autor meint, beim Thema ›Penis‹ sich selbst – inklusive Geschlechtsteil – ins Spiel bringen zu müssen. Das weckt verständlicherweise den Verdacht einer exhibitionistischen Neigung des Autors. Mit diesem Verdacht lässt es sich freilich in einer Gesellschaft, die ausgiebig dem Exhibitionismus (und Voyeurismus) frönt, sehr gut leben.
Mich und meinen Penis aus dem Spiel zu lassen, hätte in mir das ungute Gefühl erzeugt, mich schreibend aus dem Staub zu machen, mehr noch: mich schreibend zu kastrieren. Denn eine trockene akademische Studie zu verfassen, etwa unter dem Titel »Penis und Patriarchat unter besonderer Berücksichtigung von diesem und jenem« erschien mir alles andere als verlockend. Ich hätte mich beim Schreiben gelangweilt; und das ist wohl die schlechteste Voraussetzung für ein Buch, das kurzweilig sein will.
Zugegeben, der Penis des Autors ist so interessant nun auch wieder nicht. Er ist nur dann von Interesse, wenn die literarische Beschäftigung mit ihm das eine oder andere zum allgemeinen Erkenntnisgewinn beiträgt. Das ist nur dann der Fall, wenn sehr persönliche sexuelle Erfahrungen auf eine analytisch erzählende, bei Gelegenheit auch ironische oder komische Weise vermittelt werden. Das eröffnet dem Leser die Möglichkeit, sich im Erzählten wiederzuerkennen, ohne über sich selbst (und den Autor) bestürzt zu sein. Leser und Autor werden so zu Verbündeten.
An diesem Punkt meldete sich, bei allem Autorenmut, dennoch meine innere Schamgrenzen-Stimme und forderte eindringlich eine angemessene zeitliche Distanz zum literarisch entblößten Autoren-Penis. Angemessen, so ließ die Stimme verlauten, seien fünfzig Jahre. Das ist fürwahr eine lange Zeit. Und so erwies sich mein fortgeschrittenes Alter ein weiteres Mal als ein Vorteil: Ich würde mich und meinen Penis, der eigenen Schamgrenze zuliebe, nur im Hinblick auf Kindheit und Pubertät dem gnadenlosen Licht der Öffentlichkeit preisgeben. Die geschilderten intimen Erlebnisse würden in gewisser Weise verjährt sein. Sie hätten nur noch ganz entfernt mit mir, dem alten Mann von heute, zu tun. Ihre obszönen Peinlichkeiten wären über die Distanz eines halben Jahrhunderts hinweg nicht mehr in der Lage, mich in meinem jetzigen Dasein zu desavouieren; sie wären mit einer schützenden Patina aus Komik und Ironie literarisch derart veredelt, dass sie auch für andere genießbar sein sollten als aufrichtige Beispiele des Menschlich-Allzumenschlichen auf dem Feld der kindlichen und pubertären Sexualität. Das ist zumindest meine (vielleicht naive) Hoffnung.
Ziemlich überrascht war ich allerdings über das den Buchmarkt betreffende Faktum, dass es bis dato (außer einigen gut gemeinten und auch recht gut gemachten Aufklärungsbüchern für die pubertierende Jugend, dem einen oder anderen urologischen Ratgeber, und gleich mehreren Werken, die sich mit dem unverwüstlichen, wahrscheinlich seit dem Neolithikum die Männerseele bedrängenden Thema ›Penisverlängerung‹ befassen) kein einziges Werk gibt, das den Penis nicht nur als männliches Geschlechtsteil, sondern vor allem als ambivalentes Symbol der patriarchalischen Ordnung aus möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten und zu verstehen versucht. Wenn man so will, dann ist die vorliegende Arbeit – bei aller gebotenen Bescheidenheit! – der erste Versuch einer umfassenden Monografie über das angeblich beste Stück des Mannes. So liefert dieses Buch endlich den Beweis, dass der Penis nicht nur aus biologischer oder medizinisch-hygienischer, sondern viel mehr noch aus kulturgeschichtlicher, soziologischer, psychologischer und nicht zuletzt persönlicher Sicht von einigem theoretischen Interesse ist, ganz abgesehen von seinem allseits bekannten praktischen Nutzen.
Neben der von mir unterstellten schriftstellerischen Berührungsangst gegenüber dem Thema ›Penis‹ gibt es vielleicht noch einen weiteren Grund für die bisherige Zurückhaltung von Autoren und Verlegern ihm gegenüber: Man traut dem Penis nicht zu, gleich ein ganzes, womöglich sogar kurzweiliges Buch zu füllen. Oder mit den Worten meiner 83-jährigen Schwiegermutter beim Anblick des fertigen Manuskripts: »Wie kann man nur so viel schreiben« – Pause – »über so ein winziges Ding!«
Mal davon abgesehen, dass dieses ›Ding‹, zumal im erigierten Zustand, so winzig nun auch wieder nicht ist – als Thema ist es alles andere als winzig. An ihm lässt sich buchstäblich die ganze, bei Adam und Eva beginnende Geschichte des Patriarchats aufhängen, einschließlich seines schleichenden Niedergangs, der notgedrungen auch ein Niedergang des Penis ist – mitsamt dem Mann, der dranhängt.
Und mit der Nennung von Adam und Eva sind wir auch schon im ersten Kapitel.
Erstes Kapitel
Die biblische Penis-Genese
Mit der Genesis, dem Ersten Buch Mose, wird die Bibel eröffnet. Sie beginnt mit der Erschaffung der Welt durch Gott, für die er sechs Tage benötigt. Danach ist der Schöpfer erschöpft und gönnt sich am siebten Tag Ruhe. Die meiste Kraft, so scheint es, raubt ihm die Erschaffung des Menschen; sie will nicht so recht gelingen. Das Problem liegt wohl darin, dass Gott meint, den Menschen nach seinem Bilde gestalten zu müssen. Zumindest äußerlich soll der Mensch ein Ebenbild der göttlichen Vollkommenheit sein. Er soll aussehen wie Gott. Aber er darf nicht sein wie Gott – ein paradoxes Unterfangen, das selbst Gott zu überfordern scheint.
Diese Paradoxie der Ebenbildlichkeit von Gott und Mensch ist freilich keine biblische Erfindung, sondern bereits in der archaischen und später der klassischen Kunst der Griechen vorgegeben. Das menschliche Abbild verkörpert auch dort das göttliche Urbild: Der Mensch ist nach göttlichem Maß gebildet. Die Gottheit ist im Menschenbild gegenwärtig.
Bis zur Erschaffung des Menschen hätte Gottes Weltschöpfung nicht besser funktionieren können; das geht wie am Schnürchen. Was sein soll, muss von Gott nur benannt werden, und schon ist es da. Im doppelten Sinne des Wortes drückt Gott die Welt aus: sprachlich und materiell. Er drückt die Welt buchstäblich aus sich heraus, Er gebiert sie durch die Hebammenkraft seines sprechenden Geists, durch das Wort. Dass das Göttliche sich im Wort offenbart, ist das ursprüngliche Ereignis des biblischen Schöpfungsmythos. Aus Geist wird Materie.
Der sprechende Geist Gottes wird im Hebräischen ruach genannt: ein lautmalerisches feminines Substantiv. Der Geist Gottes ist weiblich. Gott gebiert die Welt wie eine Göttin. Er ist eigentlich eine Sie.
Allein bei der Erschaffung des Menschen verlässt sich Gott nicht auf die Allmacht seines weiblichen Schöpfergeists. Er gebraucht dazu die Hände. Ganz profan und sehr männlich, in der Art eines Bildhauers, formt Gott den Menschen aus einem Erdenkloß, nicht anders als Prometheus im griechischen Mythos. Hier zeigt sich Gott nicht mehr weiblich gebärend, sondern männlich fabrizierend. Das gibt zu denken. Fast möchte man meinen, der Mensch sei es nicht wert, vom weiblichen ›Geist Gottes‹, allein durch das schöpferische Wort, in die Welt ›ausgedrückt‹ zu werden. Selbst den Tieren wurde diese Ehre zuteil. Wie zum Hohn wird der Mensch dagegen aus dem wertlosen Staub auf dem Acker gemacht. Acker/Staub heißt im Hebräischen Adama. Und so ist Adam ursprünglich kein Eigenname, sondern das von Adama sich ableitende Wort für Mensch. Adam ist der von Gottes Hand aus Adama Gemachte: der Acker- und Staub-Mensch.
Wenn’s denn so einfach wäre! Tatsächlich wird die Erschaffung des Menschen in der Bibel gleich zweimal erzählt, und zwar auf vollkommen unterschiedliche Weise. Das macht die Sache kompliziert. Im ersten Kapitel der Genesis, Vers 26, heißt es: »Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei […]« Wohlgemerkt: gleich und nicht nur ähnlich! Demnach schuf Gott kraft seines weiblichen Geists auch den Menschen zuerst durch das Wort, wenngleich er, anders als bei den vorangegangenen Schöpfungsakten, hier nicht explizit die Schöpfungsformel »Es werde …« ausspricht.
Nicht ein einzelner Mensch soll gemacht werden, sondern derer zwei: ein Mann und eine Frau, wie weiter zu lesen ist: »Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn: und schuf sie, einen Mann und ein Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan […]« (Kapitel 1, Vers 27/28) Die Menschen, in Gestalt von Mann und Frau, sollen sich vermehren, nicht irgendwie, sondern indem sie, nicht anders als die Tiere, geschlechtlich miteinander verkehren. Zwar spricht Gott das nicht explizit so aus, aber, daran kann kein Zweifel bestehen, Er meint es so. Im Sexuellen macht Gott keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier. Gott hat sich in dieser Hinsicht für den Menschen nichts Eigenes ausgedacht. Der Mensch koitiert nicht anders als alle Säugetiere. Sexuell ist der Mensch auch nur ein Tier: das Menschentier.
Weil Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat, müssen logischerweise auch die menschlichen Geschlechtsorgane dem Bilde Gottes entsprechen. Denn ein Ebenbild ist immer etwas Ganzes, nichts Halbes. Und weil Gott einen Mann und eine Frau erschaffen hat, betrifft die sexuelle Ebenbildlichkeit nicht nur Penis und Skrotum des Mannes, sondern ebenso Klitoris und Vulva der Frau. Daraus folgt die irritierende, aber zwingende Erkenntnis, dass der biblische Gott, um der von Ihm gewünschten Ebenbildlichkeit gerecht zu werden, ein geschlechtliches, genauer: ein doppelgeschlechtliches Wesen sein muss. Gott ist männlich und weiblich zugleich. Der biblische Gott ist Gott und Göttin in Einem.
Die mutmaßlich männlichen Autoren der Bibel sahen das freilich anders. Sie waren zwanghaft darum bemüht, uns einen männlichen Gott, das heißt eine sexuell halbierte Gottheit zu präsentieren. Allerdings ist in der Bibel von Gottes männlicher Geschlechtlichkeit an keiner Stelle die Rede. Sie wurde schlichtweg übergangen, man könnte auch sagen: verdrängt. Der patriarchalische Gott ist auf rätselhafte Weise ›geschlechtslos-männlich‹. Aber auf keinen Fall ist Er weiblich. Er ist nicht mal ›geschlechtslos-weiblich‹. Das hat eine paradoxe Konsequenz: Der ›geschlechtslos-männliche‹ Gott hat seinen beiden menschlichen Ebenbildern Genitalien verliehen, die Er selber entbehrt. Das ist das grundlegende, nämlich sexuelle Dilemma der biblischen Ebenbildlichkeit. Gott schafft den Menschen nach seinem Bild, gestaltet ihn aber nicht grundsätzlich anders als einen Schimpansen oder Kragenbären. Wenn der Mensch sowohl ein Ebenbild Gottes als auch des Tieres ist, dann ist in logischer Konsequenz auch das Tier, vermittelt über den Menschen, ein Ebenbild Gottes. Konsequent weitergedacht, führt das dazu, dass die ganze Schöpfung ein Ebenbild Gottes ist. Schöpfer und Schöpfung würden so in eins zusammenfallen.
Doch der Gott der Bibel darf kein Tier sein. Anders als die griechischen Götter, koitiert der biblische Eine nicht. (Nur nebenbei bemerkt: Die griechischen Götter koitieren – untereinander und mit Menschen –, aber sie defäzieren nicht, obwohl sie genüsslich speisen.) Erst das Christentum wird unter dem griechischen Einfluss, den der Apostel Paulus zu verantworten hat, dem Einen Gott einen einzigen Koitus erlauben, wenn auch nur auf die transzendente Art: Der Vater im Himmel, präziser: sein Heiliger Geist, schwängert die irdische Jungfrau Maria, ohne dass sie dabei ihre Jungfernschaft verliert. Er zeugt mit ihr den Menschensohn nicht mit der Kraft eines göttlichen Gemächts, sondern nicht anders als bei der Welterschaffung: mit der Allmacht seines Geists. Wenn man so will, dann wird die Jungfrau Maria vom sprechenden Geist Gottes durch das Ohr geschwängert. Das Ohr dient seit alters in vielen Kulturen als Symbol für das weibliche Genitale. So wird die Vulva auch als das ›Ohr zwischen den Beinen der Frau‹ bezeichnet. Satan weiß sehr wohl, was er tut, wenn er sich in Gestalt der Schlange, die für den Penis steht, in Evas Ohr einschleicht, oder treffender: einschleimt. Buddha, so die Legende, wird nicht nur über das Ohr seiner Mutter gezeugt, sondern über dieses auch geboren. Kassandra, die große Seherin des griechischen Mythos, gewinnt ihre seherische Gabe, nachdem ihr eine Schlange – da haben wir wieder der Penis! – das Ohr ausleckt. Im veralteten deutschen Sprachgebrauch gibt sich die Frau dem Mann hin, indem sie ihn ›erhört‹, ihm ›Gehör schenkt‹, soll heißen: ihm ihr ›Ohr zwischen den Beinen‹ schenkt.
Gottes matriarchalische Seite
Das biblische »Mehret euch!« verweist, bei aller Dominanz des Patriarchalischen in der Bibel, auf einen matriarchalischen Ursprung der Schöpfungsgeschichte, der mit der gebärenden Weiblichkeit des göttlichen Geists bereits angedeutet wurde. Es ist typisch für matrilineare Kulturen, dass sie ihre Wertmaßstäbe aus der sexuellen Konstitution der Frau ableiten. Liebe und Sexus betrachten sie als Erfüllung des göttlichen Willens zur Fortpflanzung. Die Sexualität wird im Matriarchat als Werkzeug der Großen Göttin im Dienst des Lebens aufgefasst. Aus matriarchalischer Sicht ist der Orgasmus eine Art von Offenbarung, durch die der Mensch die göttlich-weibliche Schöpfungsekstase für ein paar Sekunden nachempfinden darf – auch der Mann!
Das biblische »Mehret euch!« zielt vor allem auf die Frau als Schöpferin neuen Lebens; das Schöpfertum des Gebärens verleiht ihr einen göttlichen Glanz. Dem Mann bleibt dieser Glanz der ›Göttlichkeit‹ versagt. Daran ändert auch seine kleine Samengabe nichts, die die Frau zu ihrem Schöpfertum benötigt, wobei zu bedenken ist, dass in den matriarchalischen Frühkulturen der Zusammenhang zwischen Koitus und Schwangerschaft noch nicht gesehen wurde. Vielmehr stellte man sich vor, dass sich die Kinder als winzige Geister in den Schoß der Mutter einnisten, gewöhnlich unter Mitwirkung des Geistes einer verstorbenen Verwandten der Schwangeren.
Was die alten Muttergottheiten betrifft, so zeichneten sie sich vor allem durch die Qualität der Doppelgeschlechtlichkeit aus. Würde man, im Stil der Antike, das Abbild einer matriarchalischen Urgottheit gestalten, so müsste es fraglos hermaphroditisch, also zweigeschlechtlich sein. In der zweigeschlechtlichen Gottheit spiegelte sich die grundsätzlich bisexuelle Natur des Menschen, ja aller Lebewesen.
In der Erschaffung von Mann und Frau spaltet die männlich-weibliche Gottheit unter dem Diktat des Patriarchats ihre Doppelgeschlechtlichkeit in zwei Geschlechter auf. Hier denkt man unweigerlich an Platons berühmte Hypothese zum Ursprung der menschlichen Sexualität, die er im Symposion durch den Komödiendichter Aristophanes (ca. 445v.Chr. – ca. 385v.Chr.) entwickeln lässt. Danach werden Mann und Frau durch den Sexualtrieb unwiderstehlich zueinander getrieben, weil sie einen Urzustand wiederherzustellen trachten, in welchem das Männliche und das Weibliche noch eins waren. Mann und Frau, so erzählt der Mythos, gingen aus einem idealen mannweiblichen Urwesen hervor, an dem alles doppelt war: Es hatte vier Arme, vier Beine, zwei Gesichter und auch doppelte Geschlechtsorgane, sowohl Penis/Skrotum als auch Klitoris/Vagina. Doch Zeus, dem Göttervater, war dieses Wesen, das man sich als ein glückliches vorstellen muss, suspekt. Denn glücklich waren nicht mal die Götter. Und so ließ Zeus dieses menschliche Urwesen aus purem Neid zerteilen. Seitdem verspüren beide Hälften das unbezwingbare Verlangen, wieder eins zu werden. In der geschlechtlichen Vereinigung, wenn sie denn glückt, dürfen die beiden Halbwesen für kurze Zeit wieder eins sein. Damit ist die Sexualität der Urtrieb des menschlichen Daseins, wie ihn auch Sigmund Freud (1856–1939), in Anlehnung an Platon (ca. 427v.Chr. – 348/347v.Chr.), verstanden hat. Platons Mythos nimmt die moderne, von Freud begründete Erkenntnis vorweg, dass wir als Männer auch das Weibliche, und als Frauen auch das Männliche in uns tragen. Wenn wir als Mann eine Frau begehren, so begehren wir auch das Männliche in ihr, das wiederum mit dem Weiblichen in uns korrespondiert. Und umgekehrt.
Der hermaphroditische Gott
Wenn wir uns die schöpferische Gottheit des ersten Bibel-Kapitels als ein doppelgeschlechtliches Wesen vorstellen – die Bibel zwingt uns dazu –, so drängt sich die Nähe zum antiken griechischen Mythos auf, die ohnehin durch die erwähnte platonische Vorstellung eines doppelgeschlechtlichen Urwesens gegeben ist. Dass für die streng patriarchalische Bibel ein hermaphroditisches Gottesbild inakzeptabel ist, bedarf keiner Erklärung. Auch das Patriarchat im klassischen Griechenland hatte mit der Figur des doppelgeschlechtlichen Hermaphroditos, dieser von Hermes und Aphrodite gezeugten Gottheit, ein Problem. So zeigen die überlieferten Darstellungen fast immer einen patriarchalisch zugerichteten, man könnte auch sagen: entschärften Hermaphroditen. Seine Körperformen sind auffallend weiblich, einschließlich weiblicher Brüste, doch es fehlt ihm ein weibliches Genitale bei stets vorhandenem Penis. Die patriarchalisch geprägte Ästhetik des klassischen Griechenlands sah in den weiblichen Geschlechtsteilen ohnehin nur etwas Fehlendes – voran das Fehlen ästhetischer Reize. Die Götter, so dachte man, hätten das Genitale der Frau ästhetisch nicht nur vernachlässigt, sondern bewusst hässlich gestaltet. So fiel es, nebenbei bemerkt, den stark päderastisch ausgerichteten Griechen leicht, den Anus des Knaben ›edler‹ zu finden als die Vulva der Frau.
Da die Männer der griechischen Antike an der Vulva nicht sonderlich interessiert waren, schon gar nicht in ästhetischer Hinsicht, lag es nahe, sie bei künstlerischen Darstellungen des Hermaphroditos gleich ganz wegzulassen. Gezeigt wurde kein Mann-Frau-Wesen, sondern nur ein Mann mit weiblichen Körperformen. Im Grunde stellt die ganze antike griechische Plastik den Versuch dar, die Problematik der menschlichen Bisexualität irgendwie zu bewältigen und dabei den sexuellen Idealen eines päderastischen und auch sonst homosexuell orientierten Patriarchats gerecht zu werden.
Dieses klassische griechische Problem ist auch im biblischen Genesis-Mythos unterschwellig zu spüren. Dieser steht dem griechischen Mythos ohnehin näher, als man gemeinhin denkt. Die hermaphroditische Gottheit des ersten Bibel-Kapitels erschafft durch das Wort ihr Ebenbild in Gestalt des Mannes und der Frau. Damit wäre eigentlich alles gut, zumindest aus matriarchalischer Sicht. Aber nicht aus patriarchalischer. Und weil dem so ist, schiebt die Bibel sofort eine zweite Geschichte von der Menschenerschaffung hinterher, ohne die erste vollständig zu tilgen. Diese ist als matriarchalisches Fragment, das man leicht überliest, erhalten geblieben.
Adam, der erste Sohn und Geliebte Gottes
In der zweiten, breit erzählten, uns allen vertrauten Geschichte von Adam und Eva erscheint die Gottheit endlich als personifizierter Mann: als Patriarchengott. Dabei fällt auf, dass die christliche Ikonografie diesen Gott nicht als viriles Mannsbild zeichnet, sondern als weißhaarigen Opa – auch das ein Versuch, Gott zwar als männlich zu inthronisieren, ihn aber gleichzeitig zu entsexualisieren. (Aus ähnlichen Gründen wird man beizeiten auch den Heiligen Josef, den Ziehvater Jesu, zum alten, etwas vertrottelten Mann degradieren. Schließlich soll niemand auf die Idee kommen, Josef könne womöglich doch Jesus’ leiblicher Vater sein.)
Der Gott der zweiten Geschichte erschafft nicht mehr zwei gleichwertige erste Menschen durch das Wort, wie die erste Geschichte mitteilt, sondern nur noch einen einzigen. Und den per Hand. Als Ebenbild dieses nunmehr ausschließlich als männlich vorgestellten Gottes muss der erste Mensch logischerweise auch ein Mann sein. Auf die gleiche handwerkliche Weise auch eine Frau zu schaffen, unterlässt der männliche Gott, denn sie würde ja nicht der Ebenbildlichkeit genügen.
Dass sich Adam ohne Frau nicht fortpflanzen kann, scheint Gott fürs Erste nicht zu interessieren. Dieser Umstand verleiht der zweiten Schöpfungsgeschichte von Anbeginn an eine latente homosexuelle Note. Gott schafft sich in der Art eines Bildhauers eine lebendige Kopie seiner selbst: Adam, wenn man so will, ist das Abbild Gottes als junger Mann. Und dieses narzisstische Ebenbild seiner selbst will er offensichtlich ganz für sich alleine haben. Uns drängt sich der Gedanke auf, dass Gott sich dieses Ebenbild schafft, um sich auf die antike griechische Art narzisstisch in es zu verlieben. Er bläst ihm durch die Nase den ›lebendigen Odem‹ ein. Man könnte auch sagen: Gott gibt Adam einen Nasenkuss. Dieser ist alles andere als harmlos, stellt er doch die orientalische Form des Liebeskusses dar.
(Nicht umsonst hat die Nase von allen Organen des menschlichen Körpers die größte Affinität zu den Genitalien, ja sie ist, wie Wilhelm Fließ (1858–1928), ein langjähriger Freund Sigmund Freuds, entdeckt hat, ein verkapptes Sexualorgan, versehen mit ›Genitalstellen‹ von kavernösem Bau, die bei sexueller Erregung anschwellen, im Prinzip nicht anders als Penis und Klitoris. Von daher muss man nicht weiter erklären, was aus psychoanalytischer Sicht mit Gottes ›Blasen‹ von Adams ›Nase‹ gemeint ist.)
Die zarte homoerotische Spannung zwischen dem alten männlichen Gott und seinem jungen menschlichen Ebenbild hat Michelangelo in seiner berühmten Darstellung der Erschaffung Adams genial ins Bild gesetzt: in den zärtlich sich berührenden Zeigefingern. Finger haben per se einen starken erotischen Reiz: weil auch der Finger, nicht anders als die Nase, den Penis symbolisiert, nicht zuletzt in unseren Träumen. In der Berührung oder Fast-Berührung der beiden Finger hat Michelangelo nichts Geringeres als den Urreiz des Sexuellen dargestellt, zumal da Adams laszives Daliegen und sein auf dem Schenkel ruhender knabenhafter Penis auf subtile Weise mit dem Spiel der Zeigefinger korrespondieren.
Adam erscheint hier als Gottes erster Sohn – und als sein Geliebter. Jesus Christus, Gottes zweiter Sohn, wird in der christlichen Fortschreibung des alttestamentarischen Mythos als ›zweiter Adam‹ die konkrete Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott aufs Neue bezeugen. Jesus’ Geschlechtsteile sind, wie bei Adam auch, wie selbstverständlich darin eingeschlossen. Jesus’ Penis hat die christliche Ikonografie, zumindest bei der Darstellung des göttlichen Kindes, nie verleugnet, im Gegenteil, sie hat ihn geradezu genüsslich ins Bild gesetzt. Der Penis eines Knaben, egal, ob göttlich oder nicht, bewahrt durch alle Zeiten und Kulturen seine Unanstößigkeit. Hingegen gibt es kaum Darstellungen des Gekreuzigten mit entblößtem Geschlecht. Dabei weiß man, dass die Römer ihre Opfer nackt ans Kreuz geschlagen haben. Mir ist nur Michelangelos berühmtes Kruzifix in der Sakristei der Kirche Santo Spirito in Florenz bekannt. Freilich hat auch hier der Künstler den Penis des Gekreuzigten so zierlich gestaltet, dass er wie der eines Knaben erscheint und somit ebenfalls keinen Anstoß erregt. Selbst noch am Kreuz soll Jesus Christus die ›kindliche Gottheit‹ bleiben.
Doch zurück zu Adam. Dieser steht, aus gewässertem Ackerstaub geformt, mitsamt seinem Penis nackt und allein in der Welt: ein getreues Abbild seines Schöpfers. Er gleicht dem Herrn so sehr, dass, wie die jüdische Sage weiß, selbst die Engel ihn zuerst mit Gott verwechseln und in Ehrfurcht vor ihm erstarren. Adam ist »das Blut vom Blute des Ewigen«, wie es in den alten Sagen der Juden heißt. Seine Gestalt reicht gottgleich von der Erde bis zum Himmel. Erst später wird Adam von Gott zum Winzling eingeschrumpft, damit die Verwirrung der Engel ein Ende hat – und Gott nicht fürchten muss, dass ihm sein menschliches Ebenbild den göttlichen Rang streitig macht.
Adams tierischer Sexus
Adam weiß erst mal nicht, was er mit sich – und seiner Geschlechtlichkeit – anfangen soll. Auch darin ist er Gott gleich, dessen Männlichkeit ja auch eines weiblichen Pendants, einer Göttin, entbehrt. Doch Adam wurde von Gott als sexuelles Wesen, als Menschentier geschaffen, und so ist von Anbeginn ein sexuelles Begehren in ihm. Er spürt, eben weil ihn Gott nicht als Kind, sondern als jungen Mann erschaffen hat, das Verlangen, sich zu paaren – nicht anders als die Tiere auch. Es kann gut sein, dass ihm erst durch den Anblick der kopulierenden Tiere der Sinn seines Begehrens klar wird. Auch bei den Nachfahren Adams, also uns, funktioniert das Kopulieren ja nicht ›von selbst‹, sondern bedarf der gesellschaftlich vermittelten Anschauung. Die Tiere koitieren von Natur aus; dem Menschen muss man zeigen, wie’s geht, weil ihm mittlerweile der Instinkt dafür fehlt. Adam lernt es von den Tieren; es gibt ja sonst niemanden, von dem er es lernen könnte.
Unter dem Druck seiner Libido versucht Adam zuerst auf eigene Faust, eine Geschlechtspartnerin zu finden. Was liegt näher, als unter den Säugetieren danach zu suchen. Doch unter diesen »ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre«. (Genesis, Kap. 2, Vers 20) Die alten Sagen der Juden bemühen an diesem heiklen Punkt nicht den diffusen Begriff der »Gehilfin«, sondern sie teilen unverhohlen mit, dass Adam seinen Sexualtrieb an Säugetier-Weibchen zu befriedigen sucht: Er war »zuerst zu allen Tieren eingegangen […]; sein Gemüt wurde jedoch nicht eher ruhig, als bis er Eva fand und zu ihr einging.« (Die Sagen der Juden, S.67) Mit »eingehen« ist in der Luther’schen Übersetzung ›koitieren‹ gemeint. Adam, so erzählt die Sage weiter, hatte nach seinen unbefriedigenden Versuchen in Sodomie gegenüber Gott zu murren begonnen: »O Herr der Welt! Alle Geschöpfe, die du in deiner Welt schufst, sind zu Paaren erschaffen worden; nur ich habe kein zweites Wesen, das zu mir gehörte.« (Die Sagen der Juden, S.67)
Über Adams erste Frau, also jene der ersten Menschenerschaffung, schweigt sich die Bibel aus; es ist, als wäre sie nie erschaffen worden. Ihr Name wird an keiner Stelle erwähnt. Dennoch wissen wir aus den Quellen der uralten jüdischen Sagen, dass ihr Name Lilith war, was soviel wie ›die Nächtliche‹ bedeutet. Sie passte, zumindest im Verständnis der patriarchalischen Bibel, überhaupt nicht zu Adam. Als starke, eigensinnige und eigenständige ›Urfrau und Urmutter‹ entstammte sie den altorientalischen Matriarchaten und fand, als gleichwertige Partnerin Adams, Eingang in die erste Schöpfungsgeschichte. Lilith war zu sehr sie selbst, als dass sie sich Adam unterworfen hätte, wie es die patriarchalische Bibel von der Frau verlangt. Sie legte Wert darauf, Adam auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Schließlich war sie von Gott auf die gleiche Art wie Adam erschaffen worden. »Bist doch nur meinesgleichen, beide sind wir von der Erde genommen«, wird sie Adam im Streit entgegenschleudern. Lilith fordert im Sexuellen – und auch sonst – die Gleichheit ein, jene vollkommene Gleichheit der Geschlechter, wie sie von der weiblich-männlichen Gottheit des Matriarchats repräsentiert wurde.
Die widerspenstige Lilith wird, wie zur Strafe, von den patriarchalisch geprägten Bibelautoren klammheimlich in die jüdische Sagenwelt verbannt, um in der Bibel, und bei den Lesern derselben, keinen Glaubensschaden anzurichten. Zum bösen weiblichen Dämon umgedeutet, verkörpert sie fortan die dunkle, rätselhafte, dem Mann Angst einflößende Seite der Frau. In der Kabbala, der jüdischen Mystik, genießt Lilith immerhin eine Art von negativer Verehrung als ›Königin des Bösen‹‹, als die sie im jüdischen Volksglauben bis heute ihr düsteres Dasein fristet. Mit Adam hatte Lilith immer nur Streit, bis sie ihn verließ und »davonflog in die Lüfte«. Nur einmal, so erzählt die Sage, kehrte Lilith zu Adam zurück: während jener 130 Jahre nach dem Sündenfall, in denen sich Adam seiner zweiten Frau Eva sexuell verweigert hat. Mit ihrem Unterleib aus »eitel Feuer und Flamme« suchte ihn Lilith eines Nachts heim, legte sich zu ihm »und gebar von ihm Teufel, Geister und Dämonen ohne Zahl. Wen diese befielen, der wurde geplagt und getötet«. (Die Sagen der Juden, S.86)
Aus all dem ergibt sich eine bedeutende Diskrepanz zwischen Mann und Frau hinsichtlich unserer biblischen Stammeltern: Der Mann wird allein durch Adam verkörpert, die Frau durch Eva und Lilith zugleich.
Eva, die Adamsfrau
Gott zieht also die Lehre aus dem Desaster mit Adams erster Frau und formt die zweite aus Adams Rippe. Aber wieso aus einer Rippe?, so fragt man sich. Vielleicht, weil Adam auf eine Rippe gut verzichten kann, wo er doch zwölf Paar davon hat. Da kommt es auf eine mehr oder weniger nicht an. In den alten jüdischen Sagen finden wir den Hinweis, dass Gott überlegte, welches »Glied« des Adam er nehmen sollte. Wichtig war ihm, die Frau aus einem »keuschen Glied« zu bauen, »aus einem Glied, das auch zur Stunde, da der Mensch nackend dasteht, zugedeckt ist«. Und weiter ist zu lesen: »Und bei jedem Glied, das der Herr dem Weibe formte, sprach er zu ihr: Sei ein frommes Weib, sei ein züchtiges Weib!« (Die Sagen der Juden, S.68) Was er damit sagen will, und der werdenden Eva buchstäblich einbläut, ist klar: Sei bloß nicht wie Lilith!
(An dieser Stelle sei gefragt, wieso Gott auf den Gedanken verfällt, der Gefährtin Adams, von der er Zucht und Frömmigkeit erwartet, ein so reizintensives, ausschließlich der weiblichen Lust dienendes Glied wie die Klitoris, dieses Unikum der menschlichen Anatomie, zum Geschenk zu machen. Im Sinne des Patriarchats hätte es ausgereicht, wenn der patriarchalische Gott die Frau mit einer weitgehend gefühllosen Geschlechtsöffnung ausgestattet hätte, mit jenem ›Loch der Löcher‹, von dem so mancher Mann gern ein wenig abschätzig spricht. Die um die Klitoris zentrierte Lust der Frau ist noch heute in 28 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Südostasiens mit ihren neurotisch-patriarchalischen Gesellschaften ein Grund, den heranwachsenden Mädchen die Klitorisspitze – nicht selten mitsamt den Schamlippen – abzuschneiden, wobei ein Viertel der Mädchen an den unmittelbaren oder langfristigen Folgen des Eingriffs stirbt.)
Bleibt weiterhin die Frage: Wieso die Rippe?
In menschlichen Träumen ist es zuweilen so, dass mit dem konkreten Trauminhalt nur vertuscht werden soll, was uns der Traum eigentlich sagen will. Das kann so weit gehen, dass der Traum das genaue Gegenteil von dem erzählt, was er tatsächlich meint; er zensiert sich selber auf Weisung des Über-Ichs. Oft ist es die tabuisierte Sexualität, die in vermeintlich asexuellen Traumszenen verhandelt wird. Wenn die Genesis, wie alle großen Mythen, ein tiefgründiger Menschheitstraum ist, so spricht einiges dafür, dass mit dem »keuschen Glied« Adams (= Rippe), aus dem Eva gebaut wird, das genaue Gegenteil gemeint ist: Adams ›unkeusches Glied‹, soll heißen: sein Penis. Allein schon durch ihre phallische Gestalt eignet sich die Rippe in idealer Weise als Symbol für das männliche Glied. Die Rippe Adams stünde demnach für seinen vom mythischen Über-Ich zensierten Penis.
Hätte Gott dem Adam anstelle der Rippe sein bestes Stück entfernt, um daraus die Eva zu bauen, dann bräuchte der penislose Adam logischerweise keine Eva mehr. Dieser Widerspruch ließe sich auf die triviale Weise lösen: Adam hatte ursprünglich zwei Penisse. So abwegig wäre das nicht, wie wir im nächsten Kapitel am Beispiel der Spinnenmännchen sehen werden, bei denen einige Arten tatsächlich zwei Penisse besitzen. Aus einem der beiden Penisse Adams hätte Gott die Eva gebaut. Doch diese Konstruktion wäre weder elegant, noch überzeugend, eben weil wir Männer keine Spinnenmännchen sind.
Wie lösen wir das Problem? Nun, wir lösen es auf elegante und überzeugende Weise: Gott nahm von Adam nicht die Rippe, er nahm auch nicht den Penis, und schon gar nicht einen von ursprünglich zweien, sondern er nahm vom Penis nur den Knochen. Und mit einem Schlag ist die zweite biblische Geschichte von der Menschenerschaffung in sich logisch: Uns Männern fehlt keine Rippe, uns fehlt der Penisknochen!
Diese aufs Erste ziemlich gewagt anmutende These wird von der biologischen Evolution eindrucksvoll bestätigt: Alle Primaten, ausgenommen Homo sapiens, besitzen einen Penisknochen. Man findet ihn auch bei Hunden, Katzen, Bären, und anderen Säugetierarten. Unsere Hypothese ist auf einmal nicht mehr gewagt, sondern geradezu nahe liegend. Mit ihr bringen wir die archaische Genesis in Übereinstimmung mit der modernen Evolutionsbiologie. Letztere teilt uns mit, dass der so genannte Schwellkörper im menschlichen Penis nichts anderes ist als der weiche Überrest des einstigen Penisknochens. Oder umgekehrt: Der Penisknochen war die ursprüngliche knöchrige Form des heutigen Penis-Schwellkörpers.
Was die bedauernswerte Eva betrifft, so stellt ihre Erschaffung aus Adams Penisknochen von allen Varianten patriarchalischer Frauenerschaffungs-Mythen zweifellos die patriarchalischste dar. Den Bibelautoren wäre sie gewiss die liebste Variante gewesen. Doch in einem heiligen Buch spricht man nicht offen vom Penis, diesem ›unkeuschen Glied‹, schon gar nicht im Zusammenhang mit Gott. Und so behalf man sich mit der »keuschen«, aber immerhin phallisch geformten Rippe, um die Abstammung der Frau vom Mann mythologisch zu begründen.
Dass Adam, als er aus der Narkose erwacht, in die ihn Gott zum Zweck der Penisknochenentnahme versetzt hat, von seiner zweiten Frau begeistert ist, versteht sich, nach dem Debakel mit Lilith, von selbst. Freudig ruft er aus: »Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; man wird sie Männin [hebräisch Ischa] heißen, darum dass sie vom Manne [hebräisch Isch] genommen ist.« (Genesis, Kap. 2, Vers 23) Hier kommt ein unterschwelliges Inzest-Motiv zum Tragen: Adam wird mit seinem eigenen »Bein und Fleisch« Sex haben.
Die »Männin«, die bezeichnenderweise erst nach dem Sündenfall den Namen Eva (›Leben Schenkende‹) verliehen bekommt – und zwar von Adam, nicht von Gott! –, hat mit dem Penisknochen, aus dem sie gemacht ist, das Patriarchat, das in vielem ein ›Penisarchat‹ ist, buchstäblich verinnerlicht. »In einer männerrechtlichen Gesellschaft«, so schreibt der Sexualforscher Ernest Borneman (1915–1995), »orientiert sich die Frau an dem Mann und lernt seine sexuellen Attribute auch im eigenen Geschlecht zu schätzen.« Deshalb müssen wir uns die »Männin« als eine sehr männliche (phallische) Frau vorstellen.
Nun kann nichts mehr schiefgehen, denkt Adam. An die Stelle Liliths, einer selbstbewussten Frau, tritt eine »Männin«, eine Halbfrau: Adams weiblicher Abklatsch. Die vertuschende Art, mit der später der Sündenfall erzählt wird, legt den Verdacht nahe, dass auch hier eine latente Homosexualität im Spiel ist, wie wir sie im Verhältnis zwischen Gott und Adam zu spüren meinten. Was, von Satan eingefädelt, unter dem Baum der Erkenntnis geschieht, ist eh klar: Adam »erkennt« seine »Männin«, er »geht in sie ein«, soll heißen, er hat Sex mit ihr. Wenn ein Mann mit einer »Männin«, also einem Mann mit weiblichen Attributen, sexuell verkehrt, dann kann eigentlich nur ein Akt gemeint sein, bei dem die Vagina keine Rolle spielt.
Und in der Tat: Das »Erkennen« unterm Baum der Erkenntnis war ein Sexualakt, von dem die »Männin«, wie wir wissen, nicht schwanger wurde. Das gibt schon deshalb zu denken, weil sich ausnahmslos alle mythischen Geschlechtsakte dadurch auszeichnen, dass sie Nachwuchs zur Folge haben. Andernfalls bräuchte sie der Mythos nicht zu erzählen. Denn mit mythischen Geschlechtsakten, vornehmlich solchen zwischen Göttern und Sterblichen, soll nichts anderes als die Genealogie von Stämmen und Völkern – oder hier der ganzen Menschheit –begründet werden. Nur so funktioniert das patriarchalische Stammbaum-Denken.
Und so entsteht ein begründeter Verdacht, den zu äußern freilich nicht leicht fällt: Adam hat seine »Männin« unter dem Baum der Erkenntnis wie einen Mann penetriert. Dies dürfte auch der Grund sein, wieso Adam danach mit seiner »Männin« während 130 Jahren nicht mehr sexuell verkehrt. Das behauptet zumindest die jüdische Sage. Nach unserer Deutung ist Adams Askese die Sühne für den analsexuellen Sündenfall. Freilich hat Adam, der ein Alter von 930 Jahren erreichen wird, noch immer genügend Zeit, um Eva ›normal‹ zu begatten und so die Gattung auf den Weg zu bringen. Doch deren Weg ist nur von kurzer Dauer. Gott wird die Menschheit, ihrer sittlichen Verderbtheit wegen, in der Sintflut ertränken. Diese Verderbtheit hat in Adam ihren Ursprung. Von ihm spannt sich ein direkter Bogen zu Sodom und Gomorra (Genesis, Kap. 18/19). Zwar teilt die Bibel nicht eindeutig mit, welche »sehr schweren« Sünden in beiden Städten begangen wurden, doch es gibt allen Grund zu der Annahme, dass es jene ›Sexual-Sünden‹ waren, die Adam mit der Unschuld des ersten Menschen in die Welt gesetzt hat: Zoophilie, Analverkehr und Inzest. Letzteren begeht Adam insofern, als Eva für ihn zweite Frau und erste Tochter zugleich ist: sein eigen Fleisch und Blut. Notgedrungen war die ganze biblische Urfamilie inzestuös. Anders hätte die Menschheit auch nicht aus ihr hervorgehen können!
Diese drei biblischen Urformen ›perversen‹ Geschlechtsverkehrs sind im Laufe der Jahrhunderte als ›Sodomie‹ bezeichnet worden. Letztlich hat Gott selbst sie zu verantworten. Bei der Erschaffung seines menschlichen Ebenbilds ist der Allmächtige grandios gescheitert, nicht zuletzt im Hinblick auf dessen Sexualität. Den Menschen, nicht anders als den Tieren, einfach nur zu sagen: »Seid fruchtbar und mehret euch«, geht an der polymorphen ›Perversität‹ des menschlichen Sexus vorbei.
Zweites Kapitel
Die biologische Penis-Genese
Dass dem Menschenmann als einzigem unter den Primatenmännern der Penisknochen (Baculum) fehlt, lässt nicht nur Adams ›Rippe‹ in einem neuen Deutungslicht erscheinen, sondern gibt auch den Evolutionsforschern ernsthaft zu denken. Was ist der Vorteil eines knochenlosen Penis?, so fragen sie sich. Das fragen auch wir uns. Erstmal keiner, denkt der stets um seine Erektionsfähigkeit besorgte Menschenmann. Hingegen liegt der Vorteil eines Penisknochens buchstäblich auf der Hand: Mit einem Knochen im Penis hätte der Mann ein Sexualproblem weniger. Er müsste in kritischer Koitussituation nicht um den Erhalt seiner fragilen Erektion fürchten. Viele Männer bräuchten keine Potenzmittel mehr zu nehmen, um ihren Penis wenigstens leidlich hochzukriegen. Die Männer hätten, egal wie impotent sie sich fühlten, ständig einen Ständer – selbst noch im Sarg.
Doch die Evolution gehorcht einer anderen Logik: Wenn alle Männer, auch die impotenten, eine knochenharte Dauererektion vorzuweisen hätten, wäre Potenz kein Vorteil mehr bei der Partnerfindung, sondern ein allgemeines und permanentes Faktum der männlichen Sexualkonstitution. Bei den anderen Primaten spielt die Erektion als Imponierobjekt und Potenzbeweis keine Rolle, da der Penis ohnehin sehr klein ist und das Wenige auch noch vom Fellkleid größtenteils verdeckt wird. So muss man bei einem Gorilla-Mann, der durch seine stattliche Größe und offensichtliche Kraft imponiert, schon sehr genau hinschauen, um seinen kleinen, gerade mal drei Zentimeter großen Penis zu entdecken. Ohnehin ist es bei den Gorillas so, dass der überschaubare Familienverband von etwa zehn Individuen vom Silberrücken-Männchen dominiert wird, der keine Konkurrenten zu fürchten hat. Es gibt für ihn somit auch keinen Grund, mit einem möglichst großen Penis bei den Weibchen Eindruck zu machen; dafür reichen Statur und Körperkraft aus.
Bei den Schimpansen, unseren nächsten Tier-Verwandten, sieht es allerdings schon wieder anders aus: Es gibt in den relativ großen Horden massive Konkurrenz unter den Männchen um die Gunst der Weibchen. Und so haben Schimpansen auch einen relativ großen Penis von durchschnittlich acht Zentimetern. Noch imposanter aber sind ihre Hoden: Während diese beim Gorilla jeweils nur etwa dreißig Gramm wiegen, sind es bei dominanten Schimpansen-Männchen bis zu 120 Gramm! Auch bei den eng mit den Schimpansen verwandten Bonobos – früher auch Zwerg-Schimpansen genannt – haben die Männchen stattliche Hoden, obwohl sie in Matriarchaten leben und die sexuelle Konkurrenz zwischen den Männchen deshalb keine so große Rolle spielt. Soziale Konflikte werden bei den Bonobos nur selten auf aggressive Weise ausgetragen. Sex dient ihnen als eher beiläufiger sozialer Kitt und nicht, wie bei den Schimpansen, als Grund für Konkurrenz und Streit hinsichtlich der Begattungshierarchie in der Horde. Mit einem besonders großen Skrotum beeindruckt ein Schimpansen-Männchen nicht nur die Weibchen, sondern ebenso die Rivalen im Affen-Patriarchat. Hingegen muss ein Bonobo-Männchen mit seinem Geschlechtsorgan nur die Weibchen im Affen-Matriarchat auf sich aufmerksam machen.
Beim Menschen ist es nun so, dass zum schwach behaarten Körper ein auffallend großer Penis hinzukommt – bei ziemlich bescheidenen Hoden von gerade mal zwanzig Gramm Gewicht. Das fehlende Fell lässt den erigierten Penis noch größer erscheinen, als er eh schon ist, was, nebenbei bemerkt, wohl auch ein Motiv für männliche Intimrasur sein dürfte. Zudem rückt der aufrechte Gang den imposant aufgerichteten Phallus erst recht ins Blickfeld begattungswilliger Frauen, während das Skrotum als Imponierorgan nur eine untergeordnete Rolle zu spielen scheint. Von den meisten Frauen wird es ohnehin kaum eines Blicks gewürdigt.
Relativ zur Körpergröße hat der Mensch den größten Penis unter den Säugetieren. Nicht einmal der Blauwal, mit bis zu dreißig Metern Länge das größte Säugetier der Erde, kann es mit seinem etwa zwei Meter langen Penis in dieser Hinsicht mit dem Menschen aufnehmen. Es scheint, als solle den Menschenfrauen der Penis des Mannes buchstäblich ins Auge springen. Bewegte sich der Mensch, wie die übrigen Primaten, nackt auf allen Vieren fort, würde ein großer Penis nur stören. Entsprechend liefe ein Gorilla mit erigiertem Zwanzig-Zentimeter-Penis ständig Gefahr, sich mit diesem im Urwaldgestrüpp zu verheddern und dabei Verletzungen davonzutragen.
Von dem bekannten Evolutions-Forscher Richard Dawkins stammt die Hypothese, dass die männlichen Vorfahren von Homo sapiens den Penisknochen im Lauf der Evolution eingebüßt hätten, weil der knochenlose Penis den Frauen ermöglicht habe, an der Erektionsfähigkeit die sexuelle und sonstige Gesundheit der um ihre Gunst werbenden Männer abzulesen. Denn Erektionsstörungen sind bei einem jungen Mann zweifellos als bedeutsames Krankheitssymptom zu werten. Welche Frau will schon einen Mann, der keinen hoch kriegt! Nun könnte man einwenden, dass so ein Erektionstest auch für Schimpansen- oder Gorilla-Weibchen von Interesse sein könnte. Doch dafür fehlt diesen Primaten die Intelligenz, die nötig ist, um von guter Erektion auf gute Gesundheit zu schließen. Zudem kann man davon ausgehen, dass Menschenaffen-Männchen ohnehin keine Erektionsprobleme kennen; diese sind eine Folge der Kulturentwicklung beim Menschen, die höchstwahrscheinlich erst mit dem Patriarchat in Erscheinung getreten sind.
Der große und knochenlose Penis beim Menschen ist also letztlich eine indirekte Folge des großen Menschen-Gehirns und der damit verbundenen hohen Intelligenz – in diesem Fall jener der Frauen. Evolutionsgeschichtlich ist also die Intelligenz der Frauen daran schuld, dass die Männer ohne Unterstützung eines Penisknochens erigieren müssen.
Die Menschenfrauen, die sich auf einen Mann mitsamt seinem Penis einlassen, können auch aus anatomischen Gründen froh sein, dass der Penisknochen fehlt. Dadurch ist die Gefahr von Koitusverletzungen stark vermindert, während sie zum Beispiel ziemlich groß ist, wenn eine Frau sich in perverser Anwandlung von einem Hund bespringen lässt »und durch plötzliches Herausreißen des Hundepenis der Penisknochen Einrisse am After oder in der Scheide bewirkt«. (Ernest Borneman: Lexikon der Liebe, S.747) So können die Frauen der Evolution gegenüber nur dankbar sein, dass der Penis des Mannes so ist, wie er ist. Nicht nur, dass er einen Knochen haben könnte, nein, dieser könnte auch noch mit Widerhaken versehen sein, wie das zum Beispiel beim Katzenpenis der Fall ist.
Wer freilich als Mann glaubt, sein knochenloser Penis könne nicht brechen, der irrt. Ein Penisbruch, hervorgerufen durch ungeschickte, allzu heftige oder bewusst gewalttätige Penetration, passiert schneller, als man denkt. Zu Bruch geht dabei der Schwellkörper, also das, was vom einstigen Penisknochen übriggeblieben ist. Dabei können im schlimmsten Fall sogar schwere Blutungen im Penis auftreten, verbunden mit Urin-Infiltration, falls die Harnröhre mit verletzt wird. Von daher ist dem Mann zu raten, auch bei stürmischer Penetration nicht gänzlich die Kontrolle über sich und seinen Penis zu verlieren, zumal wenn er sexuell noch unerfahren ist und vielleicht sogar meint, volltrunken vögeln zu müssen. Und damit haben wir eine elegante, wenn auch triviale Überleitung zu den Vögeln.
Das Überraschende gleich vorneweg: Vögel vögeln nicht. Das gilt zumindest solange, wie mit dem Begriff ›Vögeln‹ eine penetrierende Kopulation gemeint ist. Denn zur Penetration fehlt den Vogel-Männchen schlichtweg der Penis. Das gilt zumindest für die allermeisten Vogelarten. Nur bei wenigen Vogelgruppen, etwa den Enten oder Gänsen, besitzen die Männchen ein bescheidenes ›Begattungsglied‹. Wenn wir also unser menschliches Koitieren als »Vögeln‹ bezeichnen, meinen wir eigentlich ein ›Gänseln‹ oder ›Enteln‹. Gleichwohl ist ›Vögeln‹ als volkstümlich-derbe Bezeichnung für den Koitus schon seit dem Mittelalter gebräuchlich: Mit vogelen war zwar ursprünglich ›Vögel fangen‹ gemeint, doch hatte es von Anbeginn auch die Bedeutung von ›begatten (beim Vogel)‹, um schließlich auch als Ausdruck für die menschliche Begattung verwendet zu werden.
Tiere, die sich tagsüber die meiste Zeit in der Luft befinden, müssen möglichst leicht sein. Und da die Natur die Fortpflanzung problemlos auch ohne Penis hinkriegt, hat sie dieses entbehrliche Fortpflanzungsgerät bei den Vögeln einfach weggelassen – aus Gewichtsgründen. Das Vogelweibchen wird also vom Männchen gar nicht penetriert, wie man meinen könnte, wenn man den Spatzen beim ›Vögeln zuschaut, sondern beide pressen nur ihre ›Kloaken‹ aneinander. Eine Kloake ist eine Art Sammelbecken, in welchem die Ausfuhrorgane für Kot und Urin, ebenso die Absonderungen der Geschlechtsorgane zusammenlaufen – eine Art organische Senkgrube. Im mittleren Teil der Kloake befinden sich beim Vogelmännchen seitlich von der Harnleitermündung die Ausgänge zweier Samenleiter. Das Weibchen hat an der entsprechenden Stelle die Scheidenöffnung. Das Männchen lässt bei der Kopulation sein Sperma einfach von seiner Kloake in die des Weibchens fließen, von wo es dann in die Scheide gelangt. Da die Vögel ohnehin nur ein- oder zweimal im Jahr ›vögeln‹, spricht eigentlich nichts gegen diesen so einfachen wie praktischen ›Kloakensex‹. Für den Menschen möchte man sich Geschlechtsverkehr durch Aneinanderpressen von Kloaken lieber nicht vorstellen, vor allem wegen der damit verbundenen Hygieneprobleme. Die Lust auf oralen Sex wäre einem auch verleidet.
Der Luxus zweier Penisse
Die Kloake haben die Vögel von ihren evolutionsgeschichtlichen Vorläufern, den Reptilien, übernommen. Die Kriechtiere ›vögeln‹ also wie die Vögel. Da bei ihnen das Körpergewicht keine Rolle spielt, kommen die männlichen Tiere sogar in den Genuss eines winzigen, zur Ausstülpung fähigen Penis in ihrer Kloake. Mit diesem übertragen sie den Samen in die Kloake des Weibchens, ohne dass eine Penetration, die diesen Namen verdient, stattfinden muss. Während männliche Schildkröten und Krokodile nur einen einzigen solchen Ausstülpungspenis besitzen, haben männliche Echsen und Schlangen gleich deren zwei. Man spricht von zwei Hemipenissen. Bei der Begattung stülpt das männliche Tier beide Halb-Penisse aus, führt jedoch nur einen von ihnen in die Kloake des Weibchens ein, und zwar jenen, der dem Scheideneingang am nächsten liegt. Die paarigen Penisse sind vertrackte Gebilde aus Falten, Wülsten, Spitzen und Zacken, die dazu dienen, das männliche Begattungsorgan in der weiblichen Kloake regelrecht zu verankern. Nach der Begattung werden die Hemipenisse zurückgezogen und dabei wieder eingestülpt. Es gibt allerdings auch einige Echsenarten, unter ihnen zum Beispiel die Brückenechse, bei denen die Männchen, in der Art der Vögel, ohne Penis auskommen. Bei der Begattung pressen sie in Vogelmanier ihre Kloake auf die des Echsenweibchens.
Beim Stichwort ›zwei Penisse‹ drängt sich dem Menschenmann natürlich sofort die Frage auf, ob der Besitz solch eines dualen Begattungsapparats nicht auch für ihn von Vorteil wäre. In Gedanken sieht er sich in wilder Doppelpenetration mit zwei Frauen, wie immer diese anatomisch zu bewerkstelligen, kräftemäßig zu bewältigen und seelisch zu verarbeiten wäre. Von diesem Gedanken kommt der Mann aber schnell wieder ab, wohl wissend, dass es schwierig genug ist, den einen Penis, den er hat, optimal, das heißt zur Zufriedenheit des Sexualpartners, zum Einsatz zu bringen. Ein Ausstülpmechanismus wäre gewiss praktisch, doch fehlte ihm die bezaubernde Eleganz einer langsam sich entfaltenden Erektion, deren Loblied in einem der folgenden Kapitel noch gesungen wird.
Bei einer besonders faszinierenden Tiergruppe, jener der Spinnen, gehört der Besitz zweier Penisse nicht nur zur Sexual-, sondern weit mehr noch zur Überlebensstrategie des Männchens. Denn das Männchen ist bei den meisten Arten wesentlich kleiner als das Weibchen. Der krasse Unterschied in der Körpergröße wäre nicht weiter tragisch, wenn die Weibchen nicht die fatale Neigung verspürten, nach vollzogenem Geschlechtsakt den Partner aufzufressen. Das kommt daher, dass bei ihnen der Beutetrieb nicht immer scharf vom Begattungstrieb getrennt ist. Koitierend zu sterben, womöglich im Moment des Orgasmus, ist freilich nicht die schlechteste aller denkbaren Todesarten. Zudem ist sie im Dienst der Arterhaltung gar nicht so abwegig, wie sie aufs Erste erscheinen mag. Wegen der raschen und großen Produktion von Eiern haben Spinnenweibchen einen sehr hohen Eiweißbedarf, den sie auf diese praktische und billige Weise decken. Das Männchen hat mit der Abgabe des Samens ohnehin seine biologische Pflicht, sich fortzupflanzen, erfüllt. Hier bestätigt sich auf eindringliche Weise ein grundlegendes Gesetz der Natur: Ihr Interesse gilt vorrangig der Art und nicht dem Individuum.
Das Penispaar der Spinnenmännchen ist evolutionsgeschichtlich nichts weiter als das zum Begattungsorgan umfunktionierte vorderste Beinpaar (Pedipalpen). Vor der Begattung befüllt das Männchen diese beiden ›Bein-Penisse‹ mit Sperma, das aus dem vorderen Teil der Bauchseite austritt. Zu diesem Zweck spinnt das Männchen ein kleines ›Sperma-Netz‹; auf dieses setzt es einen Tropfen Samenflüssigkeit ab und packt das Befruchtungspaket mit beiden ›Begattungsbeinen‹. Damit ist das Männchen begattungsbereit. Diese Vorbereitung auf den Koitus kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen – ein langes, autoerotisches Vorspiel des Männchens, wenn man so will. Wenn das Männchen sich schließlich einem Weibchen nähert, das Samen-Geschenkpaket vor sich hertragend, richtet es sich immer wieder hoch auf, erigiert gewissermaßen mit seinem ganzen Körper, und winkt der Auserwählten mit seinem geladenen ›Doppelpenis‹ zu. Das geht so lange, bis sich beide Tiere Kopf an Kopf gegenüberstehen. Falls das kleine Männchen Glück hat, und das vergleichsweise riesige Weibchen durch das winkende ›Penispaar‹ in Paarungsstimmung gekommen ist, kann es wagen, das Weibchen mit dem Mut des Begehrens anzuspringen, rasch seine beiden mit Samen beladenen Taster an der Geschlechtsöffnung des Weibchens zu positionieren und das Samenpaket eiligst in diese hineinzustopfen. Das ordinäre, vor allem im süddeutschen Raum gebräuchliche Wort ›stopfen‹ für koitieren bringt zumindest beim Spinnensex die Sache auf den Punkt.
Sie hat ihn zum Fressen gern
Bei einigen Spinnenarten benutzt das Männchen nur einen der beiden ›Tasterpenisse‹, der an speziellen Fortsätzen der weiblichen Geschlechtsöffnung einrastet. Meistens ist damit das Schicksal des Männchens besiegelt. Im Moment des Einrastens rastet das Weibchen buchstäblich aus; es schlägt, einem Tötungsreflex gehorchend, seine mächtigen Klauen in den Hinterleib des kopulierenden Männchens, falls dieses nicht flink genug ist, sich von seinem feststeckenden Penis loszureißen, diesen im Körper des Weibchens zurücklassend, um mit seinem anderen, heil gebliebenen Penis das Weite zu suchen. Falls ihm das gelingt, erbringt das Männchen den Beweis, dass es zumindest bei weiblichem Sexualkannibalismus nicht das Schlechteste ist, zwei Penisse zu haben. Falls das Männchen nicht entkommt und den tödlichen Biss erhält, ist damit die Samenübertragung nicht unterbunden. Der Penis des Toten führt sein Werk selbständig zu Ende. Ist dies geschehen, wird das Männchen, inklusive Penis, vom begatteten Weibchen verspeist. Erst verzehrt er sich nach ihr, dann wird er von ihr verzehrt. In sich stimmiger kann ein Liebesakt, zumindest aus weiblicher Perspektive, kaum sein.
Bei der Wespenspinne ist die Sache mit dem Sex ähnlich vertrackt, doch hat hier das Männchen eine reelle Chance, den Geschlechtsakt zu überleben. Das Weibchen ist nämlich nicht darauf fixiert, sich nur mit einem einzigen Männchen zu paaren. Es ist polygam, oder präziser ausgedrückt: polyandrisch. Das heißt, es will sich möglichst mit mehreren Männchen paaren und erst später entscheiden, welches Samenpaket es für die Befruchtung der Eier verwendet. Die Biologen sprechen in so einem Fall von ›kryptischer Weibchenwahl‹. Allerdings setzt die weibliche Spinnen-Anatomie der Polygamie Grenzen: Die Weibchen haben ›nur‹ zwei Geschlechtsöffnungen und können sich deshalb nur von zwei verschiedenen Partnern pro Paarungszeit begatten lassen. Anders als die Weibchen, sind die Männchen jedoch auf Monogamie geprägt, wenngleich auch sie im Besitz zweier Begattungsorgane sind. »In ihrem Interesse liegt es«, so meint die Verhaltensforscherin Jutta Schneider, »ein jungfräuliches Weibchen zu finden, mit ihm zu kopulieren und es dann zu monopolisieren.« Zu diesem Zweck verstopft das Männchen nach der Begattung die Geschlechtsöffnung des Weibchens mit der Spitze seines ›Taster-Penis‹– eine seltene Form der sexuellen Selbstverstümmelung. Jutta Schneider spricht von »Ein-Schuss-Genitalien«. Der Verlust der Penisspitze als Genitalpfropf lohnt sich für das Männchen insofern, als es dadurch sicherstellt, dass nach ihm kein Nebenbuhler in die von ihm besamte Geschlechtsöffnung des Weibchens eindringt und ebenfalls seinen Samen dort ablegt. Schließlich hat das Männchen ja noch einen zweiten Penis und kann damit ein weiteres Weibchen begatten und verpfropfen – vorausgesetzt, er kommt bei der ersten Kopulation mit dem Leben davon. Die flinksten Männchen haben so die Chance, zweimal im Leben zum ›Schuss‹ zu kommen, was ja ganz im Sinne der Evolution ist.
Auch bei den Walzenspinnen verläuft die Kopulation auf bemerkenswerte Weise: Das Männchen, das bei dieser Ordnung der Spinnentiere ausnahmsweise nur wenig kleiner ist als das Weibchen, fällt seine Geschlechtspartnerin regelrecht an und umklammert sie, wobei das Weibchen wie hypnotisiert in Bewegungslosigkeit verharrt. Danach wird es vom Männchen an einen sicheren Ort geschleppt und dort auf den Rücken gedreht. Mit Hilfe seiner Mundwerkzeuge weitet das Männchen die Geschlechtsöffnung des ›ohnmächtigen‹ Weibchens, setzt einen Samentropfen auf ihm ab und stopft ihn mit den Mundwerkzeugen hinein. Danach verschließt es die Ränder der weiblichen Geschlechtsöffnung, indem es diese zusammenkneift, und macht sich flink aus dem Staub, bevor das Weibchen aus seiner Sexualstarre erwacht. Auch beim Menschen gibt es Männchen, die am liebsten mit schlafenden oder sich schlafend stellenden Frauen koitieren – eine narzisstische Vorliebe, die dem Fetischismus zuzuordnen ist, genauer: dem Antifetischismus der Kinephobie (= Bewegungsangst).