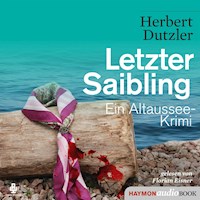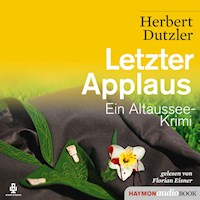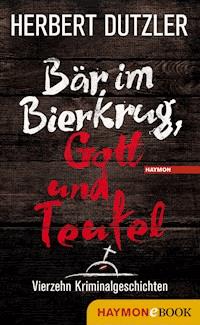19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Willkommen in den wilden 70ern: Smoke on the Water in Dauerschleife Zwischen Vinylplatten und dem ersten Rausch Sigi ist 16, seiner Meinung nach also quasi erwachsen, jedenfalls viel zu alt für Kinderkram. Rauchen ist angesagt, an den Geschmack von Bier gewöhnt man sich schnell; schließlich muss man die Freunde beeindrucken. Das beim Sommerjob hart verdiente Geld investiert er in einen Plattenspieler, um in seinem Zimmer die Rock-Nummern von den Rolling Stones, Deep Purple und Pink Floyd auf volle Lautstärke zu drehen. Damit versucht er auch die zunehmend angespannte Stimmung zu Hause zu übertönen, denn die Beziehung seiner Eltern gerät immer mehr ins Wanken. Als etwas passiert, was das Fass zum Überlaufen bringt, reicht es Sigis Mutter – sie zieht aus und nimmt seine Schwester Uschi mit. Vom Klassensprecher zum Herzensbrecher Und Sigi? Der bleibt, denn sein eigenes Leben ist turbulent genug: Nachdem er die Latein-Wiederholungsprüfung gerade so besteht, wird er überraschend zum Klassensprecher gewählt und zeigt sein schriftstellerisches Talent beim Verfassen von Texten für die kritische Schülerzeitung Pulp. Auch so manches Mädchen verdreht ihm den Kopf: Er schickt Briefe nach Deutschland an seine Sommerliebe Wiebke, im Tanzkurs nähert er sich Rita an, die er schon lange toll findet – aber werden seine Avancen von Erfolg gekrönt sein? Ein Nostalgieroman zum Abtauchen und Verlieben Wir begleiten Sigi, erleben sein Aufwachsen im Österreich der 1970er-Jahre hautnah, fast so, als wären wir selbst mittendrin. Mit viel Gefühl, Spannungsmomenten und feinem Humor schickt Herbert Dutzler seinen Protagonisten auf einen turbulenten Weg ins Erwachsenwerden, wo er sich zwischen ersten großen Gefühlen, rebellischer Rockmusik und den kleinen wie großen Dramen des Familienlebens zurechtfinden muss. Ein Buch, das die Stimmung und das Lebensgefühl einer ganzen Generation lebendig werden lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sigi ist sechzehn – und dieser Sommer bringt alles durcheinander: Die Eltern entfremden sich, ein Autounfall verändert das Familiengefüge, die Schwester zieht mit der Mutter aus, und plötzlich ist da viel zu viel Veränderung für jemanden, der selbst noch nicht weiß, wohin mit sich.
Während sich Sigi zwischen Klassensprecherrolle, Sommerjob und Tanzkurs behaupten muss, flüchtet er sich immer wieder in die Musik. Der Plattenspieler unter der Dachschräge wird zum stillen Vertrauten, wenn das Leben draußen zu laut wird. Da ist Wiebke, das Mädchen aus Deutschland, das sein Herz schneller schlagen lässt. Und Rita, mit der er nicht nur über Schulpolitik diskutiert.
Herbert Dutzler erzählt mitreißend von einem Jugendlichen, der sich selbst kennenlernt – in einer Welt, die gerade aus den Fugen gerät. Ein Roman über das Aufwachsen in den 70er-Jahren, über Verluste, neue Gefühle und das leise Reifen einer eigenen Stimme.
Inhalt
1 Im Möbelwagen zum Decamerone
2 Russisches Ei und Toast Hawaii
3 Ein Kuss, ein Brief und klasse Schuhe
4 Der Klassensprecher
5 Die Susi vom Kirchenwirt
6 Von Prüfungen und Überprüfungen
7 Ginny Come Lately
8 Ovid, Handke und die Schülerzeitung
9 Die Vögel und die Socken des Kaisers
10 Schlecht recherchiert
11 Damenwahl
12 Danksagung
1 Im Möbelwagen zumDecamerone
Ein letzter großer Brocken wartete noch auf die Aufarbeitung, und das war die Diasammlung seiner Mutter. Er erinnerte sich noch genau, zu ihrem 40. Geburtstag im Jahr 1972 hatte sie von ihren Eltern eine neue Kamera und einen Diaprojektor geschenkt bekommen, weil sie die Dias ihrer Eltern immer gerne angesehen und bewundert hatte. Die waren nämlich häufig auf Reisen, und jedes Jahr wurde die Familie Niedermayr nach Neustadt eingeladen, um bei den Großeltern einem Diavortrag beizuwohnen. Seine Familie war dabei gespalten gewesen: Er selbst hatte großes Interesse an Reisen und fremden Ländern gehabt, genau wie seine Mutter. Der Rest der Familie, sein Vater und seine Schwester Uschi, hatte sich gelangweilt, sein Vater war bei den Diavorführungen sogar regelmäßig eingeschlafen. Obwohl es bei den Neustädter Großeltern kein Bier, sondern höchstens einmal einen Eierlikör gegeben hatte.
Als er klein gewesen war, hatte immer sein Vater fotografiert. Nicht, ohne häufig darauf hinzuweisen, dass die komplizierte Technik eines Fotoapparates nichts für Frauen wäre. Seine Fotos waren aber nie besonders gelungen ausgefallen, und so hatte die Mutter die Aufgabe der Familienchronistin übernommen – mit wesentlich mehr Engagement und Präzision als der Vater. Ihre Fotos waren fast immer technisch einwandfrei und zeigten gut gewählte Motive.
Ab 1972 also hatte seine Mutter das Familienleben peinlich genau in Form von Dias dokumentiert, und seine Frau hatte sich schon öfter darüber beschwert, dass die riesigen Diakästen so viel Platz beanspruchten. So hatte er sich entschlossen, zu digitalisieren, was interessant war, und den Rest schweren Herzens wegzuwerfen. Seine Mutter hatte es sich nicht einmal nehmen lassen, ihn zu seinem ersten Ferienjob im Sommer 1974 zu begleiten, um vor dem Eingang der Firma ein Foto von ihm zu schießen. Als er es in das Digitalisierungsgerät schob, sah er sich selbst vor sich, mit gut 16 Jahren und etwas peinlich berührtem Gesicht. Die dicken Brillen waren noch keinen Kontaktlinsen gewichen, und sein Übergewicht war deutlich sichtbar, obwohl er sich immer bemüht hatte, den Bauch einzuziehen, wenn er fotografiert wurde. Den Ferienjob hatte er mit einem mulmigen Gefühl angetreten, weil er nicht genau gewusst hatte, was ihn erwartete, und ob er den Ansprüchen gerecht werden würde. Mama hatte auch nicht davor zurückgescheut, bis in den Hinterhof der Firma vorzudringen, um ihn, zur Belustigung der Lagerarbeiter, vor einem der Möbellaster zu fotografieren. Das hatte einen schlechten Start bedeutet – wer von seiner Mama zur Arbeit gebracht wurde, dem war der Spott sicher. Jetzt aber fand er es interessant, noch einmal einen der Möbelwagen auf einem Foto zu sehen, in denen er in diesem Sommer viele Stunden verbracht hatte.
Zu seinem Glück hatte seine Mutter nicht mitbekommen, wie es im Lager der Möbelfirma zuging, sonst hätte sie ihn wohl sofort von dort weggeholt. Respekt gegenüber Frauen war dort unbekannt gewesen, die Lagerarbeiter hatten einander mit zotigen Witzen unterhalten, ungeniert derbe Kommentare zu den Frauen abgegeben, die im Lager auftauchten, und Musik aus der untersten, frauenfeindlichsten Schublade zu ihren Lieblingssongs erkoren.
Ich hab’s mir ausgerechnet. Wenn wir uns die Arbeit gut einteilen, müssen wir pro Stunde ungefähr drei Meter machen. Dann sind wir genau Freitag um drei fertig, und dann ist für diese Woche Schluss mit der Schufterei. „Langsam!“, sage ich zu Hassan. „Wir sind zu schnell. Es ist erst zehn Minuten vor elf, und wir haben schon fast unsere drei Meter.“ „Drei Meter?“, fragt Hassan und stützt sich auf den Stiel seiner Schaufel. Der Schweiß läuft ihm nicht nur über das Gesicht, sondern über den ganzen, stark behaarten Oberkörper. Er sieht aus wie geölt. Ich wahrscheinlich auch. Für diesen Job hätten wir uns Handtücher mitnehmen sollen. Ich erkläre ihm meine Theorie. „Du lieber kratzen“, sagt Hassan. „Rechnen nix gut!“
Es ist nämlich so, dass wir zwei, Hassan und ich, die Schienenritzen auskratzen müssen. Zur Laderampe der Möbelfirma führt ein Gleis, sodass auch Eisenbahnwaggons beladen werden können. Ich hab allerdings noch nie einen Waggon gesehen, der auf diesem Gleis steht. Obwohl ich auf dem Schulweg zweimal täglich bei der Fabrik vorbeikomme, bei der ich jetzt einen Ferienjob habe.
Auf jeden Fall ist gleich neben dem Gleis auch noch ein Sägewerk, in dem die Bretter für die Möbel zugeschnitten werden. Und deshalb sind die Schienenritzen voll mit Baumrinde, Sägespänen und Dreck. Und den müssen Hassan und ich jetzt mit einem speziell für diesen Zweck hergestellten Werkzeug herauskratzen. Bis gestern war auch noch der Günther, mein Freund, mit dabei, aber der muss heute irgendwo anders helfen, Stoffballen zu schlichten. Da hat er es schön, denn in der Werkshalle ist es sogar bei diesen Temperaturen angenehm kühl. Dem Günther verdanke ich diesen Job, denn sein Vater ist gut bekannt mit dem Besitzer der Möbelfirma, sie sind zusammen im Lions-club, und der Vater vom Günther ist Rechtsanwalt und hat auch beruflich mit der Möbelfirma zu tun.
Inzwischen habe ich Günthers Eltern recht gut kennengelernt, und das sind ganz andere Leute wie meine Eltern. Sie sind sehr elegant, vor allem Günthers Mutter, haben einen Haufen Geld, ein tolles Haus mit Swimming-Pool und zwei teure Autos. Eigentlich wollte ich ja Koch werden, aber wenn ich mir den klapprigen Renault 4 vom Koch beim Kirchenwirt anschaue und dann den Mercedes vom Günther seinem Vater, dann überlege ich, ob ich nicht vielleicht doch Rechtsanwalt werden soll anstatt Koch. Obwohl ich nach wie vor sehr gerne koche. Dieses Hobby hat mir zwar eine ganze Menge Freude, aber auch Ärger bereitet, weil viele denken, dass ein Mann, der Kuchen und Kekse bäckt und Schnitzel brät, kein richtiger Mann ist. Früher hat das auch mein Papa gedacht, aber der hat sich beruhigt. In der Schule gibt es immer noch ein paar Stänkerer, die mich fragen, ob ich mir bald Zöpfchen flechten werde oder wann ich jetzt einen BH brauche. Dabei haben die keine Ahnung, dass auch im Fernsehen ein Mann kocht. Da war noch nie eine Frau zu sehen.
Den Dreck schieben wir zu Haufen zusammen, die der Ali dann mit dem Traktor abholt. Der Ali ist kein Türke, wie der Name vermuten ließe, denn er heißt in Wirklichkeit Alfred. Er ist sowas wie mein Chef, das heißt, er sagt mir jeden Tag in der Früh, was ich zu tun habe. Ansonsten ist er kein wirklicher Chef, und alle machen sich über ihn lustig. Er ist ein kleiner, dunkelhaariger Mann, der immer etwas gebückt herumläuft und einen blauen Kittel trägt, so wie fast alle Lagerarbeiter in unserer Firma. Für mich hat es keinen blauen Kittel mehr gegeben, aber ich hätte sowieso keinen anziehen wollen.
„Wieso“, frage ich den Hassan, als ich wieder einmal ein bisschen verschnaufen muss und mich auf den Stiel meines Werkzeugs lehne, „bist du eigentlich da? Und nicht bei deiner Frau und deinem Kind in Izmir?“ Hassan hat mir nämlich heute in der Jausenpause Fotos von seiner Familie gezeigt. Sie waren sehr dunkel. Die Frau ist sehr hübsch und hat schwarze Haare, genau wie das Mädchen auf dem Foto. Die Augen sind auch dunkel, aber man hat nicht erkennen können, ob es schlechte Fotos waren oder ob die beiden wirklich so aussehen. Auf jeden Fall haben sie auf allen Fotos ein bisschen traurig dreingeschaut. „Ich arbeiten hier, dann kaufen Taxi. Nix Arbeit in Izmir.“ „Taxi?“, frage ich. „Du willst Taxifahrer werden?“ Hassan hört auf, in der Schienenritze zu kratzen, stützt sich ebenfalls auf den Werkzeugstiel und schnauft. Dann nickt er und erklärt mir, dass in Izmir Taxifahrer dringend gebraucht würden, weil es viel zu wenige Busse gibt.
„Ja!“, lacht Hassan. „Taxi fahren sehr gut.“ Er erzählt, dass es in seiner Heimat so warm ist, dass man das ganze Jahr über mit offenen Fenstern fährt und dabei lässig die linke Hand mit der Zigarette aus dem Fenster hängen lässt. „Du Lust auf türkisch Zigarette?“, fragt er dann. Ich schüttle den Kopf. Hassan geht zum Traktor, wo er sein Hemd auf den Fahrersitz geworfen hat. Da stecken die Zigaretten drin. Er kann sogar während des Schienenauskratzens rauchen, mit Inhalieren und Rausblasen. Die Zigarette hat er dann fast quer im Mundwinkel hängen. Das schaffe ich nicht. Ich muss immer eine Pause machen, wenn ich eine rauche. Außerdem muss ich sparen, denn mehr als fünf oder sechs Tschick am Tag kann ich mir nicht leisten, obwohl ich nur Hobby rauche. Der Günther und sein Vater, die rauchen Marlboro, die kosten fast doppelt so viel. Der Herbert, mein anderer bester Freund, kauft sich die billigsten filterlosen Zigaretten, die es gibt, und raucht sie mit einem Plastikspitz. Die heißen Austria 3. Aber der Herbert ist sowieso ein ziemlich spezieller Mensch, den man lange kennen muss, wenn man ihn mögen will.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man tausende Kilometer von seiner Familie entfernt irgendwo arbeitet und seine Frau und sein Kind überhaupt nie sieht, höchstens einmal im Jahr im Urlaub. Wozu hat man dann eine Familie? Aber anscheinend ist es bei den Gastarbeitern so, dass es nur wenig oder überhaupt keine Möglichkeit gibt, zu Hause Geld zu verdienen. Und deswegen kommen sie zu uns. Der Hassan ist ein netter Kerl, mit dem man gut auskommt. Nicht so wie der Jakov, der kommt aus Jugoslawien. Der erzählt uns in der Pause ständig, dass die Kroaten gezwungen werden, unter Tito zu leben, und dass Kroatien ein freier, unabhängiger Staat werden muss. Und außerdem ist er ein Hitler-Verehrer, keine Ahnung, wie das alles zusammengeht.
Aber auch eine Familie wie meine, die nicht weit entfernt ist und die man jeden Tag sieht, kann ein Problem sein. Mit meiner Familie kann man nämlich nicht vernünftig reden. Höchstens mit meiner Schwester, mit der Uschi. Meistens sind wir uns einig, was die Rückständigkeit unserer Eltern betrifft. Ich darf nämlich sehr wenig, was andere in meinem Alter schon dürfen, zum Beispiel darf ich zu Hause nicht rauchen und auch kein Bier trinken, obwohl ich schon 16 bin. Und die Uschi darf natürlich noch weniger.
Sie ist jetzt 14 und ärgert sich sehr darüber, dass sie auch am Wochenende nicht länger als bis sechs Uhr am Abend fortgehen darf. Alle anderen dürfen bis zehn, sagt sie. Uschi hat schon einen Busen und braucht einen Büstenhalter. Da ist sie mächtig stolz darauf und gibt fürchterlich an. Das führt auch öfter zu Streit mit Mama, denn Uschi sagt, sie ist jetzt eine Frau und kann sich auch die Fingernägel und die Augen anmalen, genauso wie die Stars auf den Postern in ihrem Zimmer. Momentan hängen da Uschi Glas und Romy Schneider, denn Uschi ist ein totaler Fan von Filmstars. Und von billiger Popmusik, deswegen hängen da auch ABBA und die Rubettes. Obwohl sie auf ihrer Klarinette fast nur klassische Musik spielt. Außerdem ist Uschi eine Musterschülerin, obwohl es gar nicht danach ausgesehen hat, als sie noch in der Volksschule war.
Mama ist der Meinung, dass eine 14-Jährige noch ein Kind ist und sich auf keinen Fall aufreizend kleiden und anmalen soll, weil sich dann die Männer an sie heranmachen. Und darüber, wie lang oder wie kurz ein Rock sein soll, streiten sie sich auch dauernd. Meiner Meinung nach sind die Beine von der Uschi aber eh so dünn, dass von verführerischer Erotik keine Rede sein kann. Das ist bei der Rita, einer aus unserer Klasse, schon ganz etwas anderes. Da schaue ich gerne hin, wenn sie einen Minirock anhat. Aber jedenfalls ist die Uschi die Einzige in der Familie, die mich einigermaßen versteht.
Papa redet überhaupt nicht mehr viel. Wenn er zu Hause ist, steht er meistens mit einer Bierflasche in der Hand in seiner Werkstatt und schraubt am VW Käfer herum. Mama ärgert sich furchtbar darüber, erstens über das viele Trinken und zweitens darüber, dass sie fast nie das Auto benützen kann, weil es meistens kaputt ist oder gerade repariert wird. Wegen der Bierflasche hat er nur eine Hand zum Arbeiten frei, und da dauern die Reparaturen halt ein bisschen länger.
Mama hätte gern ein neues Auto, und sie meint, das könnten wir uns jetzt auch leicht leisten, weil sie ja ganztägig arbeitet. In der Apotheke, wo sie vor fünf oder sechs Jahren angefangen hat, weil dem Herrn Apotheker seine Frau davongelaufen ist, die bis dahin seine Gehilfin in der Apotheke war. Wegen dem Herrn Apotheker gibt es auch häufig Streit, weil Papa erstens überhaupt nicht einsieht, dass Mama arbeiten geht, weil er die Familie ja schließlich auch allein ernähren kann und der Herr im Haus ist. Das betont er oft. Zweitens, weil er Mama verdächtigt, ein Verhältnis mit dem Herrn Apotheker zu haben. Hinweise darauf sind, seiner Meinung nach, dass sie schon zweimal mit dem gleichen Autobus zu einer Oper nach Linz ins Landestheater gefahren sind, und dass der Apotheker Mama ja nur eingestellt hat, weil ihm seine eigene Frau abhandengekommen ist. Mama streitet alles ab, aber ich habe schon einmal, natürlich nur zufällig, gesehen, wie der Herr Apotheker meine Mama umarmt und geküsst hat. Gut, ich habe nur den Apotheker schmatzen gehört, direkt gesehen habe ich nur die Umarmung. Davon habe ich Papa natürlich nichts erzählt.
„Warum du Arbeit in Ferien?“, fragt Hassan in einer weiteren Pause. Ich schaue auf meine Uhr. Es ist zehn vor zwölf. Wir sollten erst gar nicht mehr anfangen, vor der Mittagspause. „Weil ich mir eine Stereoanlage kaufen will. Möglichst mit Plattenspieler.“ „Du hast keine Radio?“, fragt Hassan. „Doch“, antworte ich. „Aber der taugt nichts. Ich will in Stereo hören, verstehst du? Ich brauch etwas Lauteres, und eine bessere Tonqualität!“
Beim Günther haben wir uns schon öfters die Platten seiner Schwester angehört. Die hat nämlich eine tolle Stereoanlage mit Plattenspieler in ihrem Zimmer, und weil sie jetzt meistens in Wien auf der Uni ist, können wir uns ihre Platten ausborgen. Solang sie nicht merkt, dass wir sie gespielt haben, weil da kann sie sehr unangenehm werden. Vor allem dann, wenn Kratzer drauf sind. Deswegen lege ich die Platten auf, denn ich bin sehr sorgfältig, und der Günther ist eher schusselig und kennt sich auch mit dem Plattenspieler nicht so gut aus wie ich. Wenn niemand zu Hause war beim Günther, da haben wir auch schon „Smoke on the Water“ mit voller Lautstärke gehört. Wenn dir das in die Birne fährt, dann weißt du, was Musik ist.
Hassan will wissen, ob mir die Ö3-Hitparade gefällt. Ich zische nur verächtlich. „Das ist was für Babys, wie meine Schwester. Kennst du Led Zeppelin? Oder Deep Purple? Da ist nämlich ordentlich was los, wenn du die Kopfhörer aufhast und dir das durch den Schädel zischen lässt!“ Ich muss vor Hassan ein wenig angeben. In Wirklichkeit gibt’s bei mir zu Hause eben noch gar kein Stereo, sondern nur den alten hölzernen Radiokasten von meinem Opa, den ich geerbt habe, als er gestorben ist, und meinen Kassettenrekorder. „Hörst du auch gern Musik?“, frage ich. Hassan nickt. „Ajda Pekkan. Schönste Frau von Türkei!“ „Aber geh!“, necke ich ihn. „Die schönste Frau der Türkei, das ist doch deine Frau!“ Hassan grinst ein bisschen verlegen. „Schon!“, sagt er. „Aber Ajda so Lippen! Ganz rot!“ Er deutet dicke Lippen vor seinem Mund an. „Und blond! Und solche Busen!“ Er legt seine Hände mit gespreizten Fingern vor seine eigene Brust, um anzudeuten, wie groß der Busen der Sängerin ist. Ich muss ebenfalls grinsen. „Und ich habe gedacht, du interessierst dich für ihre Lieder!“ Hassan errötet ein wenig und nimmt seine Harke wieder zur Hand.
„Hast du Freundin?“, fragt er atemlos, nachdem er einige Zeit eifrig drauflosgehackt hat. In diesem Moment ertönt die Sirene, die die Mittagspause ankündigt. „Erzähl ich dir am Nachmittag!“, sage ich, schmeiße mein Werkzeug hin und streife mein Hemd über. Oma kocht nämlich zu Mittag immer für mich. Und weil heute der VW ausnahmsweise einmal fährt und das Moped deswegen frei ist, habe ich es mir ausleihen können und bin im Handumdrehen zu Hause. Wenn es anspringt. Nach einigem Bocken tut es das auch, und ich knattere die drei Kilometer nach Hause.
Beim Thema Freundin, da ist der Hassan bei mir auf einen wunden Punkt gestoßen. Ich habe nämlich keine, und nicht einmal eine in Aussicht. Obwohl ich ständig verliebt bin. Angefangen hat das in der vierten Klasse, auf dem Skikurs. Da hat mich die Gerda zum Tanzen aufgefordert. Ich wollte natürlich zuerst nicht, aber der Herbert hat mich praktisch gezwungen, weil er gemeint hat, ich bin ein elender Feigling, wenn ich nicht tanze. Und ein schlechter Freund noch dazu, weil er gefürchtet hat, die Gerda wird sich an ihn wenden, wenn ich nein sage.
Die Gerda, die war fast so rund wie ich, und das hat dazu geführt, dass ich mich vor ihr nicht geschämt und sie schon nach dem ersten Tanz für das begehrenswerteste Wesen auf dem Planeten gehalten habe. Es hat sich aber aus den Tänzen auf dem Skikurs überhaupt nichts Weiterführendes entwickelt, wir haben uns in der Schule dann nur mehr verlegen angelacht. Sie hat zu Boden geschaut und ist rot geworden, wenn wir uns zufällig begegnet sind, und mit der Zeit ist es dann so gekommen, dass ich sie einfach übersehen habe und sie wieder eine von vielen geworden ist, die man gar nicht wahrnimmt. So ist das eben mit der Liebe.
Ich habe mich dann mit Uschi Glas über Wasser gehalten, die in den lustigen Filmen dabei ist, wo den doofen Lehrern von den Schülern unglaublich komische Streiche gespielt werden. Bis dann der nächste Skikurs kam und Christa mich geküsst hat. Ich habe gar nicht recht gewusst, wie mir geschieht, aber plötzlich waren da beim Spazierengehen vier Pärchen unterwegs, und alle haben küssen müssen, und die anderen durften dabei zuschauen. Ich hab zuerst gar nicht gewusst, wie das geht, mit Zunge und so, aber ich habe schnell gelernt, und von da an war das Küssen eines meiner liebsten Hobbies. Ich habe es leider aber nur selten ausüben können, denn Christa habe ich insgesamt nur sechsmal geküsst, und das auch nur, weil wir uns nach dem Skikurs noch zweimal zum Spazierengehen getroffen haben. Da haben wir aber leider nicht recht gewusst, was wir miteinander reden sollen, und so ist auch diese Liebe irgendwie erloschen.
Seither habe ich nur zweimal geküsst. Mit Zunge. Einmal war ich auf einer Party eingeladen, was selten genug vorkommt, und da haben wir dieses Spiel gespielt, wo man ein Soletti von zwei Seiten anknabbert. Die rothaarige Marie-Luise aus der Handelsakademie hat mich dabei geküsst, ich habe mich sofort in sie verliebt und sie nach der Party nie mehr wiedergesehen. Und die Letzte war die Rita aus meiner Klasse, bei unserer Schulschlussfeier der sechsten Klasse im Juli. Da war sie aber schon völlig betrunken und hat mehrere geküsst, das zählt also nicht wirklich. Ich war auch betrunken, aber nicht so sehr, dass ich mich an Ritas Zunge nicht mehr erinnern könnte. Vielleicht kann man am Schulanfang wieder da anknüpfen, wo wir im Juli aufgehört haben. Falls sich Rita an die Küsserei überhaupt erinnert.
Das Moped gibt knapp vor unserem Haus ein paar laute, heisere Huster von sich und stirbt ab. Ich schiebe den restlichen Weg. Wahrscheinlich ist wieder einmal der Vergaser verstopft, überlege ich seufzend. Das bedeutet kürzere Mittagspause, weil ich den Vergaser noch putzen muss, bevor ich wieder losfahren kann. „Was gibt’s, Oma?“, frage ich, gleich, nachdem ich ihre Wohnungstür im ersten Stock aufgestoßen habe. „Ich hab eh schon gewartet“, sagt sie, mit einem leisen Vorwurf in der Stimme. „Einen Leberbunkel.“ „Oh! Wunderbar!“, sage ich und rücke meinen Sessel an den Tisch. „Spät bist dran!“, sagt Oma und stellt die Rein mit dem Leberbunkel auf den Tisch. „Das Moped ist abgestorben“, rechtfertige ich mich. „Ich hab das letzte Stück schieben müssen.“ „Wär eh besser, wenn’st mit dem Radl fährst“, sagt Oma und schneidet in den Leberbunkel. „Weil ein bissl Bewegung, das tät dir grad gut!“ Ihr Blick richtet sich auf meinen nicht unerheblichen Bauch. „Ist schon gut, Oma. Im Herbst, hab ich mir fix vorgenommen, da nehm ich ab!“ „Wie willst denn das machen, wenn dir das Essen so schmeckt?“, fragt sie und legt mir ein dickes Stück Leberbunkel auf den Teller. „Wirst schon sehen!“, sage ich und hole mir ein paar Braterdäpfel und Sauerkraut aus der Rein.
Wie man einen Leberbunkel macht, hat mir Oma schon beigebracht. Sie ist nämlich eine geniale Köchin, vor allem, wenn es darum geht, aus billigen Zutaten hervorragende Speisen zu zaubern. Das war früher auch nötig, weil es ja, wie Oma immer sagt, nichts gab, vor allem kein Geld. Ein Leberbunkel besteht hauptsächlich aus Schweinsleber und fettem Schweinefleisch. Beides faschiert man im Fleischwolf, und dann kommen noch Knödelbrot, Zwiebeln und Gewürze dazu. Das Ganze wird in ein Schweinsnetz eingewickelt und gebacken, also eigentlich eine einfache Geschichte. Und viele Leute werden davon satt.
Das mit dem Abnehmen ist mir wirklich ernst, denn wenn ich so weitermache, dann habe ich bei den Mädchen keine Chance, die meisten wollen eher athletische Männer. Gut, die Rita, die ist selber ein wenig füllig, aber eben nicht so wie ich. Und auf die habe ich ein Auge geworfen. Oder auch zwei. Sie kommt mir sogar vor dem Einschlafen immer in Gedanken unter, da stelle ich mir dann vor, wie sie sich an mich kuschelt und ich sie in den Arm nehme. Einen Plan habe ich auch schon: Ich werde im nächsten Schuljahr einfach auf das Abendessen verzichten und statt der üblichen Bretteljause nur ein Fruchtjoghurt zu mir nehmen. Weil, laut der Zeitschrift, die Mama immer kauft, hat die Bretteljause 500 Kalorien, ein Fruchtjoghurt aber nur 150. Da würde ich dann 350 Kalorien pro Tag sparen, und über 10 000 im Monat. Wenn ich das ein paar Monate durchhalte, dann wird das schon klappen mit der Normalfigur. Auf die fehlen mir nämlich laut Tabelle genau zwölf Kilo. Vielleicht wachse ich sogar noch ein wenig, dann muss ich natürlich weniger abnehmen.
„Was ist denn eigentlich mit der Uschi?“, frage ich. „Will die heute kein Essen?“ Oma seufzt. „Weißt eh, wie heikel sie ist. Und dann will sie auch noch so dünn sein wie ihre Filmstars, wie die Romy Schneider oder die Senta Berger. Die hungert sich noch zu Tode.“ „Hat sie denn gar nichts gegessen?“, frage ich nach. „Doch“, sagt Oma. „Zwei Erdäpfel mit Sauerkraut.“ „Vielleicht“, schmatze ich mit vollem Mund, „mach ich ihr fürs Wochenende einen Kuchen. Morgen bin ich eh schon um drei fertig mit der Arbeit. Da geht sich’s sicher aus.“ Meinen Kuchen kann Uschi nämlich nicht widerstehen, Filmstarfigur hin oder her.
Am Freitag um zehn stehe ich schon wieder seit drei Stunden in der brütenden Hitze bei den Geleisen und kratze Dreck aus den Schienen, als der Ali auf uns zuwatschelt. „Sigi“, schnauft er, „du kommst jetzt mit mir mit. Du musst helfen, Möbel aufladen. Am Montag fahrst mit dem Wieser in die Steiermark. Den Wagen laden wir heute schon, ihr fahrt um vier Uhr früh weg.“ „Und was ist mit Schiene?“, fragt Hassan. „Ich schick dir den Jakov heraus“, sagt Ali, dreht sich um und watschelt wieder zur Laderampe hinüber, wo der Wagen 11 samt seinem Anhänger schon mit offenen Türen eingeparkt hat. „Scheiß Jakov!“, brummt Hassan und nimmt seine Harke zur Hand. Die beiden verstehen sich nicht gut, weil Jakov nur den Katholizismus gelten lässt und einen Hass auf die Mohammedaner hat, ich weiß auch nicht, warum. Dabei nimmt es der Hassan gar nicht so genau mit seiner Religion, der isst auch gerne Leberkäsesemmeln, und beten hab ich ihn noch nie gesehen. Das würde auch unser Chef, der Herr Lehdorfer, nicht so gerne sehen, wenn sich der Hassan während der Arbeitszeit auf seinen Teppich kniet, um zu beten. Das mit dem Beten und dem Teppich hab ich aus einem Film im Fernsehen. Fünfmal täglich müssen die das machen, und zuerst noch dazu herausfinden, in welche Richtung Mekka liegt. Dorthin muss der Teppich nämlich ausgerichtet sein, auf den man sich beim Beten kniet. Ich knie überhaupt nicht gerne, und deswegen gehe ich auch nicht in die Kirche. Und wenn ich muss, dann knie ich mich nicht hin. Da kann Mama noch so böse schauen.
Ich bin erleichtert, dass das Schienenausputzen ein Ende hat, werfe meine Harke hin, wische mir mit dem Ärmel über die Stirn und folge dem Ali. Der Günther hat mir ja versprochen, dass ich als Beifahrer im Lastwagen mitfahren darf, und darauf habe ich mich schon die längste Zeit gefreut. Weil, erstens gibt es da viele Überstunden, wenn wir schon um vier in der Früh losfahren. Ich krieg dann mindestens zwölf Stunden bezahlt, aber sechs davon sitz ich nur im Lastwagen, schaue bei der Windschutzscheibe hinaus, trinke Cola und rauche. Das ist, so denke ich mir, eine angenehme Arbeit. Für den Fahrer natürlich nicht, weil normalerweise fahren sie zu zweit und lösen sich beim Fahren ab. Der 11er-Wagen, mit dem ich am Montag nach Graz fahren soll, ist einer von den älteren, der hat noch keine Servolenkung. Da ist das Fahren ein echter Kraftakt, vor allem auf kurvenreichen Straßen, und die Fahrer kommen ordentlich ins Schwitzen.
Ich folge dem Ali in sein winziges Büro, das eher wie eine Abstellkammer aussieht. Verstaubte Kartons stapeln sich in Metallregalen. Auf seinem abgewetzten Schreibtisch liegen unordentlich eine ganze Menge Formulare herum, und der Radiorekorder plärrt. Ali hört immer sehr laut Musik. Entweder, weil er schwerhörig ist, oder weil er seine Lieder draußen im Lager auch noch hören möchte. Und seine Lieder, die sind so abgründig, dass sie nicht einmal im Radio gespielt werden. Deshalb hat er immer Kassetten eingelegt, die aber meistens ziemlich jaulen, weil der Radiorekorder schon ziemlich verstaubt ist und deswegen das Kassettendeck unregelmäßig läuft.
„Kennst das?“, grinst Ali und zeigt auf sein Gerät. Es läuft gerade ein Lied, in dem zwei Sänger behaupten, sie wären Schleifer aus Paris. Ihr Akzent ist aber eher tirolerisch, kommt mir vor. „Ritzipi, Ritzipa, Ritzibumm!“, singt der Ali den Refrain mit. „Was …“, beginne ich, aber der Ali unterbricht mich mit erhobenem Zeigefinger. „Wart! Hör zu!“, ermahnt er mich. „Neulich hab ich mal eine von hinten geschliffen, und die hat mir auf den Schleifstein gepfiffen“, singt er mit. „Geschissen!“, grinst Ali. „Verstehst? Von hinten!“ Er steht auf und zeigt mir pantomimisch, was die Sänger gemeint haben. Ich verschränke die Arme. „Ich bin eher für die Stones“, sage ich. „Die haben bessere Texte!“ „Ja, ja!“, sagt Ali. „Ihr Studierten wisst ja immer alles besser! Aber ich bin mir sicher, dass du noch nie eine von hinten geschliffen hast!“ Er beginnt, in seinen Papieren zu stöbern, während ich auf Anweisungen warte. Inzwischen singt das Tiroler Duo von einem Hahn, der 50-mal am Tag auf der Henne sitzt. Ali summt leise mit. „Also“, sagt er schließlich und fischt ein paar zusammengetackerte Zettel aus seinem Stapel. „Du fährst mit dem Wieser. Nach Graz. Dann noch nach Leibnitz und nach Judenburg. Nimm dir was zum Übernachten mit, das geht sich an einem Tag nicht aus. Am Dienstagnachmittag sagen wir euch dann, wie es weitergeht diese Woche. Dem Wieser und dir.“ Ich nicke und mache mich davon, während Ali auch beim nächsten Lied mitsingt. „Wenn es juckt, juckt, juckt“, singen die Tiroler.
„Boden hinein!“, brummt der Wieser anstatt einer Begrüßung, als ich auf die Laderampe hinaustrete. Die Möbel werden im LKW nämlich auf zwei Ebenen eingeladen, und die sind durch ein breites Brett getrennt, das man Boden nennt. Zuerst kommt der Boden hinein, dann ein Sofa oder ein Bett obendrauf, und danach wird darunter eingeladen. Und so geht das immer weiter, bis der Wagen voll ist. Zum Glück weiß ich schon, wie man so einen Boden anpackt. Man legt ihn sich auf den Rücken und muss ihn dann, im Wageninneren, aufrichten, sodass man ihn auf die dafür vorgesehenen Schienen legen kann. Wenn ein Ferialpraktikant das zum ersten Mal macht, erklärt man es ihm natürlich nicht, er stellt sich ungeschickt an und schafft es nicht. Damit ist man dann eine Lachnummer für alle Fahrer und Lagerarbeiter, die sich bei so einer Gelegenheit gerne hinter dem LKW versammeln, in dem sich der Neuling schwitzend abplagt.
Ich bin aber schließlich nicht blöd und habe nach dieser Tortur einem anderen Fahrer genau zugeschaut, wie er es macht. „Hopp!“, sagt der Wieser, und wir wuchten ein schweres grünes Sofa auf die obere Ebene im Wagen.
Am Montag überhöre ich fast den Wecker, ich bin noch tief in meinen Träumen versunken, und das Läuten dringt nur langsam zu mir durch. Ich richte mich schlaftrunken auf, stelle fest, dass draußen gerade erst die Morgendämmerung angebrochen ist, und fahre in Hose und Hemd. Dann schneide ich mir schnell noch ein Stück von dem Marmorkuchen ab, den ich am Samstag gebacken habe. Er ist leider schon ein wenig trocken, schmeckt mir aber trotzdem. Ich schnappe mir meine Tasche, in die ich schon gestern Sachen zum Übernachten, eine Literflasche Cola und zwei Zwiebelbrote eingepackt habe. Ich brauch ja nicht viel, weil wegen einer Übernachtung muss ich nicht extra was zum Umziehen einpacken. Die Unterhose wechsle ich sowieso nur zweimal in der Woche. Zahnbürste und Zahnpasta genügen also. Die Zwiebelbrote, das gebe ich zu, sind kulinarisch gesehen für einen angehenden Koch im Grunde nicht vertretbar, weil die Zwiebeln nach einem Tag im Brot einen ganz eigenartigen Geruch und ein Aroma annehmen, das nicht jeder mag. Ich aber schon.
Papa hat ja eigentlich gemeint, dass ich nach der fünften Klasse Gymnasium mit der Schule aufhöre und endlich in die Lehre zum Kirchenwirt gehe, damit ich ihm nicht mehr länger auf der Tasche liege und zu Hause Kostgeld zahle. Denn dann, hat er gehofft, hört auch Mama wieder zu arbeiten auf, und er ist wieder der Herr im Haus, und es ist alles in Ordnung. Da hat er sich aber gründlich getäuscht, denn Mama hat sich gesagt, jetzt sind die Kinder aus dem Gröbsten heraußen und der Sigi kann ohnehin schon besser kochen als ich. Sogar die Uschi hat sie schon so weit abgerichtet, dass sie mit der Waschmaschine zurechtkommt und auch im Garten Wäsche aufhängen kann. Also hat sie beschlossen, Vollzeit zu arbeiten. Und ich hab mich darauf versteift, dass ich zuerst die Matura mache und mit 18 nach Wien gehe und bei einem Fernsehkoch in die Lehre gehe, weil ich dann schon selbständig bin und eine echte Karriere in der Küche hinlegen kann. Papa hat zwar zuerst nicht kapiert, warum ich die Matura haben will, wenn ich dann doch erst wieder eine Lehre mache, aber er hat letztendlich nachgeben müssen, weil mich auch Mama unterstützt hat. „Beim Kirchenwirt“, hat sie gesagt, „da gibt’s nur fette Schnitzel und ein flachsiges Gulasch, da kann der Siegfried nichts mehr lernen. Und wenn wir ihn unterstützen, dann darf er vielleicht auch einmal im Fernsehen kochen.“ Damit war die Debatte beendet und mein Plan beschlossene Sache.
Ich will aber nicht nur ins Fernsehen, ich will auf ein Kreuzfahrtschiff und die Welt kennenlernen. Vorzugsweise nach Florida, weil da starten die Mondraketen der NASA, und so einen Start will ich unbedingt einmal miterleben. Obwohl jetzt gar keine Mondraketen mehr starten, aber ich bin mir sicher, bis ich ausgelernt habe und auf einem Schiff bin, fliegen wir zum Mars. Momentan bauen die Amerikaner gerade ein Space-Shuttle, das ist so eine Art Flugzeug, das ins Weltall fliegen und dann ganz normal auf einem Flughafen landen kann. Darauf bin ich schon sehr gespannt.
Mama sagt übrigens immer Siegfried zu mir, alle anderen sagen „Sigi“, aber das kommt Mama nicht über die Lippen. Deswegen heißt sie selbst auch Edeltraud und die Uschi Ursula. Papa heißt leider Adolf, was ihm wegen dem Hitler sehr peinlich ist, und er hätte es lieber, wenn Mama ihn wie alle anderen „Adi“ nennen würde, aber da beißt er auf Granit.
Der Wieser steht schon beim 11er-Wagen, als ich ankomme. „Den Hänger müssen wir noch dranhängen“, sagt er. „Du gehst nach hinten und nimmst die Deichsel.“ Was eine Deichsel ist, das weiß ich gerade noch, aber warum ich nach hinten gehen soll und was mit der Deichsel zu tun ist, wird mir natürlich nicht erklärt.
Der LKW kommt immer näher, der Wieser hängt sich aus dem Fenster und schreit: „Geht’s?“ Ich sehe selbst, dass es nicht geht. Die Anhängerkupplung des LKW ist mehr als 20 Zentimeter vom Ring meiner Deichsel entfernt. Ich zerre wie wild daran herum, aber sie bewegt sich keinen Millimeter. „Halt!“, schreie ich schließlich. „Es passt nicht!“ Der LKW zischt laut, die Bremslichter leuchten auf und er kommt Zentimeter vor dem Zusammenstoß zum Stehen. „Kruzifix!“, schimpft der Wieser, als er aus dem Führerhaus springt. „Du musst natürlich zuerst die Bremse lösen, du Depp!“ Er greift nach einem Hebel mit einem Griff daran, so ähnlich wie ein Bremshebel beim Fahrrad. Er drückt den Griff, der Hebel löst sich, es zischt. Jetzt lässt sich die Deichsel, wenn auch mühsam, bewegen. Der Wieser geht wieder nach vorne. Ich spare mir die Bemerkung, dass er mir das vorher hätte zeigen können, sowas kommt nämlich in dieser Firma nicht so gut an. Vor allem, wenn es von einem Ferialpraktikanten kommt.
Leider muss der Wieser noch einmal fluchen und aussteigen, nachdem er gefragt hat, ob ich den Strom und die Bremsleitung angeschlossen habe. Das habe ich natürlich nicht getan, weil ich auch nicht wusste, dass das notwendig ist. Sicherheitshalber gehe ich mit nach hinten und schau dem Wieser zu. Diesmal erklärt er mir sogar, wie es geht, während er es macht. Wahrscheinlich hat er endlich eingesehen, dass ich null Komma nichts von LKWs verstehe. Bevor wir losfahren, macht der Wieser noch seinen Hosenschlitz auf und uriniert gegen den Reifen seines eigenen LKW, was mich einigermaßen erstaunt. Mir ist beigebracht worden, dass man sich gut vor den Blicken anderer verbirgt, wenn man sich denn schon einmal außerhalb des Klosetts erleichtern muss. Der Wieser grunzt zufrieden, als er seinen Hosenschlitz wieder schließt. „So!“, sagt er. „Jetzt fahren wir!“ Unter dem Reifen hat sich eine nicht unerhebliche Pfütze gebildet.
Die Fahrt nach Graz wird lang dauern. Dahin gibt es nämlich keine Autobahn, nur ein ganz kleines Stück am Anfang. „Der 11er“, sagt der Wieser, „der hat nur 120 PS.“ Deshalb brauchen wir selbst auf der Autobahn ein paar Kilometer, bis wir auf 80 km/h sind. Schon nach 20 Kilometern geht’s auf die Bundesstraße, und dass man da nicht überholen kann, spielt für uns keine Rolle. Ganz im Gegenteil, der Wieser muss oft abbremsen, weil uns jemand bei Gegenverkehr überholt. Bei jedem Bremsmanöver flucht er ausgiebig, und schon beim Pyhrnpass ist meine Colaflasche leer, weil mir so fad ist, dass ich dauernd trinken muss. Die Passstraße kenn ich schon von unseren Urlauben in Caorle. Der LKW zuckelt noch viel langsamer die Steigung hinauf als der Bus, mit dem wir immer nach Italien fahren. Dann muss ich natürlich auch aufs Klo, aber ich halte es so lange zurück, wie es geht. Durch die große Windschutzscheibe brennt die Sonne herein, sodass ich ins Schwitzen gerate, ohne dass ich mich überhaupt bewege. Fast ein bisschen wehmütig denke ich an den Hassan, der weiter Schienen auskratzt, weil der kann sich wenigstens hie und da eine Pause im Schatten gönnen.
Irgendwann muss ich den Wieser dann doch bitten, dass er wegen dem Klogehen stehen bleibt, aber es ist gar nicht so leicht, mit dem langen Lastzug einen passenden Parkplatz zu finden. Als es schließlich so weit ist, habe ich auch keine Zeit mehr, eine verborgene Stelle zum Pieseln zu finden, und stelle mich, wie der Wieser in der Früh, zum Hinterreifen.
Als wir endlich in Graz ankommen, werde ich Zeuge eines unerwarteten Schauspiels. Der Wieser muss nämlich den Anhänger von der Straße aus im rechten Winkel in eine Einfahrt schieben, damit wir an die Laderampe herankommen. Das dauert, und es braucht zwei Helfer aus dem Grazer Lager, die sich passend positionieren und ihm Kommandos zurufen, damit das klappt. Wenn der Wieser nicht vorher schon wie ein Schwein geschwitzt hätte, dann wäre es jedenfalls jetzt so weit. Ich komme mir ein bisschen unnötig vor und bin froh, als endlich der Anhänger und das Zugfahrzeug mit offenen Türen an der Laderampe stehen, denn nun könnte es ans Ausladen gehen.
Könnte, denn der Wieser muss sich zuerst hinsetzen und mit der Belegschaft des Grazer Lagers Bier trinken. Ich bleibe beim Cola. „Darfst noch kein Bier trinken, was?“, fragt einer der Grazer. Wastl nennen sie ihn. „Schon“, sage ich. „Aber ich hab gerade keinen Gusto.“ Dafür zünde ich mir, dass die beiden auch merken, dass ich erwachsen bin, eine Hobby an. Der Aufenthaltsraum hier ist sowieso schon voller kaltem Rauch und der Aschenbecher auf dem Tisch quillt über.
Nach ein paar Bier geht es dann ans Ausladen, und als wir fertig sind, ist es schon Abend. Wir gehen mit den zwei vom Lager in Graz gleich nebenan ins Gasthaus, und ich frage mich schön langsam, wo wir heute Nacht schlafen werden. Weil sich alle einen Bauernschmaus bestellen, mache ich das auch. „Müssen wir uns nicht noch ein Zimmer suchen?“, frage ich während des Essens. Der Wieser deutet nur mit dem Zeigefinger zur Decke und schmatzt weiter. Offenbar werden in diesem Gasthaus auch Zimmer vermietet. Vier Bier hat der Wieser nun schon getrunken, seit wir in Graz angekommen sind. Zum Bauernschmaus habe ich mir auch eines bestellt, damit ich nicht unangenehm auffalle.
Das Zimmer, das uns von einer mürrischen alten Frau zugeteilt wird, ist schäbig. Zwei metallene Bettgestelle in einem ansonsten kahlen Raum, auf einem kleinen Tischchen ein Radio, das offenbar einmal durchgebrannt ist, weil ein Teil des Gehäuses schwarz von Ruß ist. „Gehst noch mit ins Kino?“, fragt der Wieser. Dass wir beide verschwitzt sind und wahrscheinlich ziemlich stinken, ist anscheinend egal. Ich nicke zustimmend. Wann komme ich schon einmal ins Kino? Normalerweise höchstens bei dem faden Film-club von der Schule in Seeklausen, wo sie so Filme spielen, bei denen man einschläft, wenn man nicht gerade eine Freundin bei sich hat, an der man ein bisschen herumdrücken kann. Und so eine habe ich leider nie.
Gut, dass Mama nicht hier ist, denn die mag das gar nicht, wenn man in verschwitzter Kleidung herumrennt. Wenn Papa aus der Werkstatt kommt, schimpft sie jedes Mal, wenn er sich einfach an den Küchentisch setzt, ohne sich zu waschen oder die Arbeitskleidung auszuziehen. Meistens rülpst er dann auch noch, und die ganze Küche stinkt nach schalem Bier. Das ist oft der Zeitpunkt, wo Mama wütend ihr Geschirrtuch hinschmeißt und die Küchentür lautstark hinter sich zuwirft. Papa sagt dann immer „Ich weiß gar nicht, was sie hat!“, aber Uschi und ich, wir wissen es schon. Deswegen passe ich zu Hause auf, dass ich nicht stinkend zum Essen komme, weil dann glaubt Mama, ich werde wie Papa, und dann fängt sie manchmal zu weinen an, und das ist mir peinlich.
Dass ich werde wie Papa, das sagt sie fast immer, wenn sie sich über mich ärgert. Das ist meistens wegen der Zigaretten, oder wenn sie riecht, dass ich Bier getrunken habe. „Dass du mir nicht auch so ein Säufer wirst“, sagt sie dann, „den nichts interessiert, außer seiner Werkstatt und seinem Bier. Und mit dem man rein gar nichts anfangen kann, nicht einmal einen gemütlichen Sonntagsausflug mit der Familie!“
Das ist auch so ein Thema, das ständig zu Streit führt. Mama will einfach nicht einsehen, dass Papa keine Ausflüge mit der Familie macht. Seine einzigen Ausflüge sind die an den Fischweiher, zum Fischen, oder auf den Fußballplatz. Und daran nimmt wiederum die Familie nicht teil. Mittlerweile haben auch Uschi und ich kein Interesse an Familienausflügen mehr, aber Mama fragt Papa trotzdem immer wieder, am Wochenende, ob wir nicht einmal nach Seeklausen fahren können, um einen Spaziergang an der Seepromenade zu machen und dann auf eine Torte und einen Kaffee in eine Konditorei zu gehen. Papa grunzt dazu nur und holt sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Jedes Wochenende geht das so, und keiner gibt nach. Mich würde es ja nicht wundern, wenn Mama dann einmal mit dem Herrn Apotheker nach Seeklausen fährt, denn der möchte sicher mit ihr spazieren gehen, der alte Lustmolch.
Über dem Eingang des Kinos prangt in großen Lettern der Titel des Films: „Decamerone“. Das sagt mir gar nichts, und ich wundere mich schon, dass der Wieser einen italienischen Film sehen möchte, bis ich im Foyer ein paar Standfotos aus dem Film sehe, auf denen hauptsächlich nackte Frauen zu sehen sind, an den kritischen Stellen nur notdürftig verhüllt. Auf ein paar Fotos ist auch einfach über dem Busen ein schwarzer Balken hingedruckt. So ein Film ist das also. Ein bisschen überrascht bin ich schon, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich so etwas sehen darf oder überhaupt will, aber bevor ich noch viel zum Denken komme, sitze ich schon in einem muffigen Polstersessel und sehe die Wochenschau. In einem Bericht heißt es, dass Südafrika jetzt aufrüstet, weil die Nachbarländer Mozambique und Angola keine Kolonien mehr sind und von den Schwarzen regiert werden. „Die sind eh viel zu deppert zum Regieren“, kommentiert der Wieser abfällig. Dann gibt es noch einen Bericht darüber, dass die Speisewagen in den österreichischen Zügen so einen schlechten Ruf haben, dass man überlegt, dort zur Belebung des Geschäfts Freibier auszuschenken. „Lauter Depperte!“, kommentiert wiederum der Wieser. „Wer fährt schon in einem Speisewagen? Bei den Autobahnraststätten, da täten wir ein Freibier brauchen!“ Ich verzichte auf einen Kommentar.
Gott sei Dank habe ich meine Hobby mit, und so kann ich mich wenigstens mit den Zigaretten darüber hinwegretten, dass mich der Film einerseits peinlich berührt, andererseits aber auch aufregt, weil sehr viele nackte Frauen darin zu sehen sind, was für mich natürlich etwas völlig Neues ist, weil ich überhaupt noch nie einen Film mit Nackten gesehen habe. Wesentliche Informationen darüber, wie das mit dem Sex genau funktioniert, kann ich dem Film allerdings nicht entnehmen, da die entscheidenden Handlungen immer nur angedeutet werden. Der Wieser muss sehr viel lachen. Außerdem sagt er dauernd „Ich scheiß mich an!“.
Im Bett kann ich dann lange nicht einschlafen, weil mir die aufregenden Szenen noch lange im Kopf herumgeistern. Wahrscheinlich, so denke ich mir, geht der Wieser nur auswärts in solche Filme, weil er sich daheim nicht traut. Da könnte ihn ja jemand erkennen und das seiner Frau erzählen, die sicher nicht begeistert darüber wäre, dass sich der Wieser andere nackte Frauen anschaut.