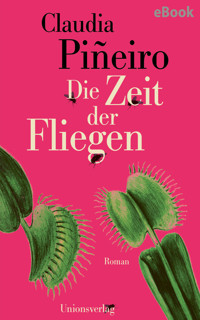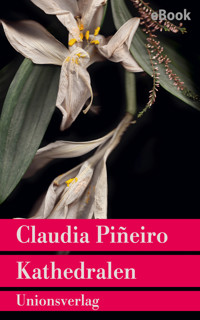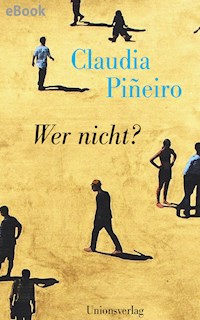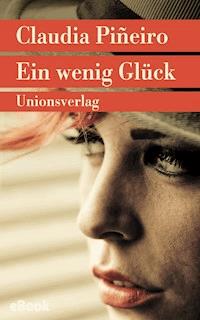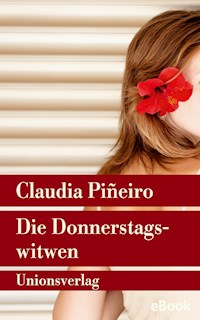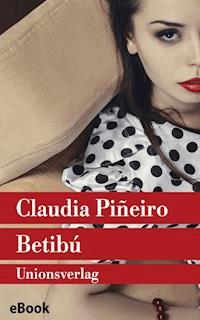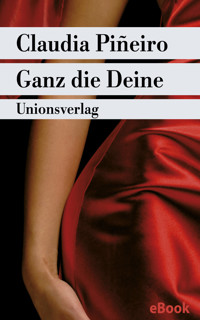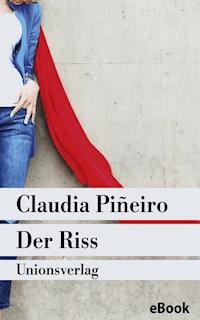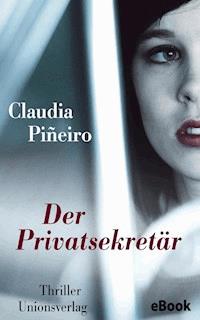
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Román Sabaté wundert sich über seinen rasanten Aufstieg in der aufstrebenden neuen Partei Pragma. Als persönlicher Assistent des charismatischen Parteichefs steht er im Zentrum der ausgeklügelten Kampagne, die unter Einsatz von Desinformation, Halbwahrheit und manipulierten Emotionen versucht, ihren Chef an die Macht zu bringen. Als er erkennt, welches Spiel mit ihm und dem Land getrieben wird, versucht er, sich und die junge Journalistin Valentina Sureda aus dem Netz der Lügen zu befreien – und löst damit ein politisches Erdbeben aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
In der aufstrebenden Partei Pragma steht Román Sabaté als persönlicher Assistent des charismatischen Parteichefs im Zentrum einer ausgeklügelten Wahlkampagne. Als er erkennt, welches Spiel mit ihm und dem Land getrieben wird, will er sich und die Journalistin Valentina Sureda aus dem Lügennetz befreien – und löst damit ein politisches Erdbeben aus.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Claudia Piñeiro (*1960) ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Argentiniens. Nach dem Wirtschaftsstudium arbeitete sie als Journalistin, Dramatikerin und Regisseurin. Sie erhielt den Premio Clarín, den LiBeraturpreis und den Premio Hammett und war für den International Booker Prize nominiert.
Zur Webseite von Claudia Piñeiro.
Peter Kultzen (*1962) studierte Romanistik und Germanistik in München, Salamanca, Madrid und Berlin. Er lebt als freier Lektor und Übersetzer spanisch- und portugiesischsprachiger Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Peter Kultzen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Claudia Piñeiro
Der Privatsekretär
Thriller
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2017 im Verlag Alfaguara, Buenos Aires.
Originaltitel: Las Maldiciones
© by Claudia Piñeiro
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
www.schavelzongraham.com
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Luke Braswell (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31014-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 03:11h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER PRIVATSEKRETÄR
1 – Jeder Mensch schleppt einen Fluch mit sich herum …2 – Man kann aus allen möglichen Gründen bei der …3 – Román Sabaté lernte ich vor ungefähr fünf Jahren …4 – Valentina Sureda5 – Auf der Straße wird es hell«, sagt sich …6 – Als ich Pragma-Mitglied geworden war, hätte ich eigentlich …7 – Der Wecker klingelt zum dritten Mal. Erneut zurückstellen …8 – Joaquín hat seine Milch getrunken und ist irgendwann …9 – Fernando Rovira kommt zu früh, fast zwanzig Minuten …10 – Der Alsina-Fluch (Projektskizze)11 – Adolfo macht sich Sorgen, auch wenn er versucht …12 – Beim Gemüsestand und im Lebensmittelgeschäft war sie schon …13 – Während der Arbeit an meinem Buch über den …14 – Sebastián Petit ist jetzt schon vierundzwanzig Stunden wach …15 – Kurz nachdem mein erstes Jahr bei Pragma vorbei …16 – Wo ist Román?, fragt China sich schon zum …17 – Der Tag bricht an. Licht dringt durchs Rollo18 – Die Pressekonferenz fängt in wenigen Minuten an …19 – Auf den sandigen Straßen von Cariló war an …20 – Der Alsina-Fluch (Projektskizze)21 – Gleich nachdem China Ricardo Alfonsín und danach auch …22 – Der Alsina-Fluch (Projektskizze)23 – Nach Roviras ungewöhnlicher Anfrage verlebte ich mehrere ziemlich …24 – Wir einigten uns darauf, dass es am besten …25 – Mal abgesehen von einem Schlüpfer ihrer ehemaligen Freundin …26 – Stimme Roviras: »Also bis gleich, wir brauchen nicht …27 – Fernando Roviras großer Fehler war es, Joaquín mir …28 – Endlich macht Román sich daran, China und Adolfo …29 – Mit dem Rest des Whiskys, den er sich …30 – Hätte er mich umbringen sollen? Aber wann …31 – Der Alsina-Fluch (Projektskizze)32 – China setzt sich auf den Beifahrersitz, neben Sebastián …33 – Als Rovira und Vargas gerade vor dem Möbelgeschäft …34 – Facebook-Seite von Fernando Mario Rovira35 – Irene hat den offenen Brief gelesen, den ihr …36 – Vor einer knappen Stunde haben sie über die …Mehr über dieses Buch
Über Claudia Piñeiro
Claudia Piñeiro: Lesen als Revanche
Claudia Piñeiro: »Frauen und Männer lesen unterschiedlich«
Über Peter Kultzen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Claudia Piñeiro
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Argentinien
Für Ricardo,dieser Roman ganz besonders
»Erdosain blickte eine Sekunde in das rhombenförmige Gesicht des anderen, dann sagte er spöttisch lächelnd: ›Wissen Sie, dass Sie Lenin ähnlich sehen?‹Und ehe der Astrologe antworten konnte, ging er fort.«
ROBERTO ARLT, Die sieben Irren
»Ja … aber Lenin wusste, wohin er ging.«
ROBERTO ARLT, Die Flammenwerfer
»Es gibt also keinen Grund, die Wirksamkeit gewisser magischer Praktiken in Zweifel zu ziehen. Gleichzeitig sieht man aber, dass die Wirksamkeit der Magie den Glauben an die Magie impliziert und dass dieser sich unter drei ergänzenden Aspekten darstellen lässt: zunächst der Glaube des Zauberers an die Wirksamkeit seiner Techniken; dann der des Kranken, den jener pflegt, oder des Opfers, das er verfolgt, an die Macht des Zauberers selbst; schließlich das Vertrauen und die Forderungen der öffentlichen Meinung.«
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Der Zauberer und seine Magie, Strukturale Anthropologie I
1
Jeder Mensch schleppt einen Fluch mit sich herum. Manche bemühen sich ihr Leben lang, diesen Fluch abzuschütteln. Im Glauben, sie seien stark genug, um ihn auszutricksen, führen sie bis zum bitteren Ende einen unsinnigen, aussichtslosen Kampf. Andere versuchen es gar nicht erst und fügen sich in ihr Schicksal. Hin und wieder werfen sie einen Blick über die Schulter, um zu überprüfen, dass die Last auf ihrem Rücken nicht verrutscht ist, davon abgesehen, schenken sie ihr so gut wie keine Aufmerksamkeit. Und dann gibt es noch die Glückspilze, die nichts von dem Fluch merken, der auf ihnen liegt. Leute wie Román Sabaté. Er ist ahnungslos und somit gleichsam unberührbar.
Trotzdem ist Román heute schwindlig, und er hat starke Magenschmerzen. Auf die Idee, dass die Schmerzen etwas mit einem Fluch zu tun haben könnten, kommt er aber nicht. Für ihn ist der Ort, an dem er sich befindet, schuld daran. Er sieht sich um, schnüffelt. Nein, an der Müdigkeit und Anspannung kann es nicht liegen, ebenso wenig an seiner Schuld. Und auch nicht an seiner Angst. Die Bar des Retiro-Bahnhofs, wo er auf den Bus wartet, ist ein grauenhafter Ort. Ein passenderer Ausdruck fällt ihm nicht ein. Dafür weiß er jedoch genau, wer ständig alles »grauenhaft« findet. Oder zumindest fand. Warum muss ihm dieses Wort ausgerechnet jetzt einfallen? Er sagt und sagte doch sonst nie »grauenhaft«, trotzdem drängt sich ihm der Ausdruck in diesem Moment geradezu auf: »Grauenhaft.« Das grelle Neonlicht reizt seine übermüdeten Augen. Dann die über den grauen Boden verteilten wackligen Rohrstühle, deren verdreckte Schaumstofffüllung durch die Risse in dem roten Kunstleder quillt. Und schließlich diese Mischung aus Essensgerüchen und den Ausdünstungen eines scharfen Putzmittels aus der Toilette, kaum auszuhalten. In der Ecke ist knapp unter der Decke ein – im Gegensatz zum restlichen Mobiliar – hochmoderner Fernsehapparat angebracht. Gerade laufen die Nachrichten, der Ton ist allerdings ausgestellt. Wahrscheinlich haben die Betreiber der Bar ihn zur letzten Fußballweltmeisterschaft angeschafft, sagt sich Román. Wo er selbst damals die meisten Spiele sah, weiß er noch genau, auf einem riesigen 60-Zoll-LED-High-Definition-Bildschirm, fast wie im Kino, umgeben von einer Unmenge Sushi – was ihm aber noch nie geschmeckt hat – und dem gesamten Team. »Team«, auch so ein Wort, das er am liebsten nie mehr verwenden würde.
Er nimmt die Flasche und gießt in beide Gläser Sodalimonade. Früher war er öfter in solchen Bars, an solchen Bahnhöfen, aber das ist lange her. Er ist noch jung, nicht mal dreißig, fünf oder sechs Jahre sind für ihn deshalb viel. Plötzlich wird ihm klar, wie lange er schon bloß noch mit dem Flugzeug oder – falls die Strecke kurz war oder es keinen passenden Flug gab – mit dem Auto gereist ist, beziehungsweise mit dem Schiff, wenn er wieder einmal nach Montevideo oder Colonia musste, um Geld auf gewisse Konten einzuzahlen oder abzuheben. Manchmal war er sogar im Hubschrauber unterwegs. Aber im Bus nie, nie wieder. Das heißt, doch, damals in Cariló, aber auch daran möchte er jetzt nicht denken. Außerdem war das so nicht geplant gewesen – er war mit dem Auto hingefahren und hatte eigentlich auch mit dem Auto zurückfahren sollen. Aber früher, da waren solche Bars an solchen Orten die Regel. Etwa wenn er mit seinen Freunden verreiste, als er zum ersten Mal nach Buenos Aires fuhr, und ebenso, als er noch regelmäßig seine Eltern in Santa Fe besuchte. Oder als er einmal überstürzt nach Mendoza aufbrach, auf der Suche nach Carolina, seiner damaligen Freundin, von der er immer noch ab und zu träumt – dann sieht er sie mit einem riesigen Neun-Monate-Bauch vor sich. Er war also schon oft an solchen Orten, jedoch nie mit einem todmüden dreijährigen Kind. Einem Kind, das den kleinen Arm auf die Tischplatte aus Kunststoff gelegt hat und den Kopf darauf und so vor sich hindämmert. Einem Kind, das sich bereitwillig in alles fügt und für nichts von alldem verantwortlich ist.
Ob es richtig war, nicht einmal China zu sagen, wohin er unterwegs ist und aus welchem Grund? Seit er in dieser Bar sitzt, fragt er sich das immer wieder. Vielleicht sollte er es ihr doch sagen. Zeit genug wäre noch. Er braucht sie. Er holt sein Mobiltelefon hervor, sucht ihren Namen auf der Kontaktliste, betrachtet ihr Foto, zögert. Nach einer Weile sagt er sich, dass es unvernünftig, ja, der reine Wahnsinn wäre, sie jetzt anzurufen, sosehr es ihn auch dazu drängt. Gleich darauf entnimmt er seinem Telefon Chip und Akku. Ob das reicht, weiß er nicht, aber so hat man es ihm damals beigebracht – so könne man seiner Spur nicht folgen, hieß es. Das war eine der Verhaltensvorschriften. Bis jetzt hat er sie noch nie anwenden müssen, aber nachdem sie ihm das extra für solche Fälle erklärt haben, wird es wohl funktionieren.
Der Kellner kommt mit der Rechnung. Román kann sich nicht daran erinnern, darum gebeten zu haben, doch der Kellner hält sie ihm hin, bis er irgendwann den Arm senkt, den Zettel unter die halb leere Limonadeflasche schiebt und mit Blick auf den Fernseher sagt: »Die lügen doch alle, einer wie der andere.«
Román schaut auf – wie erwartet ist in Großaufnahme Fernando Roviras Gesicht zu sehen. Das konnte gar nicht anders sein. Nicht weil Rovira der einzige Lügner ist oder niemand diese Bezeichnung so verdient wie er. Rovira nutzt vielmehr in der letzten Zeit jede Gelegenheit, um in den Nachrichten zu erscheinen, auch außerhalb der Hauptsendezeit. Außerdem verkörpert Fernando Rovira gewissermaßen Románs Schicksal. Auch ohne Ton weiß Román genau, was Rovira in diesem Augenblick sagt, dafür braucht er nicht einmal den Lauftext am unteren Bildrand zu verfolgen: »Rovira bekräftigt, dass die Teilung der Provinz Buenos Aires noch vor den nächsten Wahlen durchgeführt werden soll.« Román kann an Roviras Verhalten gleich mehrere Dinge ablesen. Erstens: Inzwischen scheint es Wichtigeres zu geben als die Aufklärung des Mordes an Roviras Frau Lucrecia Bonara – bis vor wenigen Monaten kam Rovira jedes Mal sofort darauf zu sprechen, wenn man ihm ein Mikrofon vor den Mund hielt. Zweitens: Das Einzige, was Rovira jetzt wirklich am Herzen liegt, ist die Teilung der Provinz und der Gouverneursposten in der von ihm bevorzugten Hälfte. Drittens, und das ist für Román das Wichtigste: Offensichtlich weiß Rovira weder, dass Román sich von ihm abgesetzt hat, noch, wie er das getan hat. Das Interview nähert sich seinem Ende, und Román Sabaté fragt sich, ob wenigstens der Journalist sich zu einem früheren Zeitpunkt nach dem Mord erkundigt hat, dem Stand der Ermittlungen und ob es mittlerweile irgendwelche brauchbaren Hypothesen oder ernst zu nehmenden Tatverdächtigen gibt. Oder ist dieser Mord auch für die Medien nach einem Jahr kein Thema mehr, dem man mehrere Minuten Sendezeit zugesteht, weil sich längst andere Dinge in den Vordergrund gedrängt haben? Die Teilung der Provinz Buenos Aires, zum Beispiel.
Der Kellner sagt noch einmal: »Das sind doch lauter Lügner, einer wie der andere.«
Und als wollte er seine Behauptung untermauern, zieht er die Fernbedienung aus der Tasche, hält sie in Richtung Fernsehapparat und stellt den Ton laut. Das Interview ist ans Ende gelangt, Rovira verabschiedet sich mit den Worten: »Unser Ziel heißt nicht: die Provinz Buenos Aires nachhaltig machen. Wir wollen zwei nachhaltige Provinzen und keinen unregierbaren Moloch. Vielen Dank.«
»Schwätzer …«, sagt der Kellner.
»Papa?« Joaquín, der mit dem Rücken zum Bildschirm am Tisch sitzt, hebt den Kopf und sieht Román verwirrt an. Offensichtlich ist er noch nicht ganz wach.
»›Nachhaltig‹, was soll denn das für ein Scheiß sein, he?«, sagt der Kellner.
»Wüsste ich auch gern …« Román legt das Geld auf den Tisch und steht auf. »Komm«, sagt er zu Joaquín, »gleich fährt unser Bus.«
Statt vom Stuhl zu klettern, streckt der Kleine die Arme aus, damit Román ihn hochhebt. Román setzt zuerst den Rucksack auf. Er hat nur wenig Kleidung eingepackt, dazu ein paar Bücher, den Umschlag mit dem Foto und einen Stapel Papiere – beim Aufbrechen wollte er sie schon vernichten, zuletzt hat er sie für alle Fälle aber doch mitgenommen. So ist die Ladung ziemlich schwer. Außerdem pikst ihn der Ladekran eines Lastwagens in den Rücken – das einzige Spielzeug von Joaquín, das sie dabeihaben. Das Auto ist aus Holz, vor einiger Zeit haben sie es gemeinsam zusammengebastelt und angemalt. Als Román zu Joaquín sagte, er könne nur eine Sache auf ihren »kleinen Ausflug« mitnehmen, hat dieser zu Románs Freude auf den Laster gedeutet. Erst als Román das Gefühl hat, dass das Gewicht gleichmäßig zu beiden Seiten seiner Wirbelsäule verteilt ist, lächelt er Joaquín an, der immer noch mit ausgebreiteten Armen wartet, hebt ihn vom Stuhl und sagt: »Los gehts, mein Augenstern!«
Sie verlassen die Bar. Die grauenhafte Bar. Hinter ihnen erscheint wieder Fernando Rovira auf dem Bildschirm. Ohne sich darum zu kümmern, geht Román mit Joaquín im Arm zu dem Fahrsteig, den man ihm am Kartenschalter genannt hat. Joaquín wird wahrscheinlich schon wieder schlafen, wenn sie dort ankommen. Román stellt sich in der nur von den Scheinwerfern der einfahrenden Busse erhellten Dunkelheit ans Ende der kurzen Warteschlange, die Tickets und ihre Ausweise in der Jeanstasche. Er fragt sich plötzlich, ob er wohl beim Einstieg in den Fernbus einen Nachweis vorlegen muss, der ihn berechtigt, mit diesem Kleinkind in seinem Arm auf Reisen zu gehen. Warum hat er nicht vorher daran gedacht? Wenn der Bus in ein paar Minuten eintrifft und er versucht, zusammen mit Joaquín einzusteigen, wird es sich zeigen.
Klappt es nicht, kann er das Ganze vergessen. Nur weil er diese eine Sache nicht bedacht hat, geht womöglich alles schief.
Oder auch nicht. Er vertraut auf sein Glück.
Ja, doch, er vertraut auf sein Glück.
Und sonst muss er die Karten eben neu mischen und noch einmal ausgeben.
Für ihn wäre es nicht das erste Mal.
2
Man kann aus allen möglichen Gründen bei der Politik landen. Völlig zu Recht, oder nicht ganz so. Oder auch aus Versehen, aus Nachlässigkeit, weil man nicht Nein sagen kann. Weil man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Oder zur falschen Zeit am falschen. Weil man von irgendwas leben muss – das war für mich ein berechtigter Grund, damals, vor fünf Jahren. Das bisschen Geld, das ich bei der Ankunft in Buenos Aires besaß, hätte bestenfalls gereicht, um zwei, drei Monate gerade so durchzukommen.
Ich begriff allerdings schnell, dass es viel zu viele Leute gibt, die, bald besser, bald schlechter, von der Politik leben. »Sag mal, du sitzt jetzt doch an der Quelle, kannst du nicht dafür sorgen, dass das Finanzamt bei mir nicht so genau hinschaut?«, war mit das Erste, worum mich jemand bat, kaum dass ich angefangen hatte, für eine Partei zu arbeiten. Derlei Bitten würde ich ab sofort ständig zu hören bekommen, auch das war mir sofort klar. Wie ich das machen sollte und was für mich dabei herausspringen würde, wusste ich allerdings nicht. Eine neue Welt. Und alles bloß, weil ich einmal, ohne mir viel zu denken, meinen Zimmergenossen Sebastián Petit zu einem Vorstellungsgespräch begleitet hatte. So landete ich bei der Politik. Beziehungsweise bei den Politikern. Mit Politik im eigentlichen Sinn habe ich, ehrlich gesagt, bis jetzt kaum etwas zu tun gehabt.
Das Vorstellungsgespräch fand in den Räumen von Pragma statt, einer wenige Jahre zuvor von Fernando Rovira gegründeten Partei. Rovira war im Norden des Großraums Buenos Aires als Bauunternehmer tätig. Durch Grundstücksspekulation, die Errichtung mehrerer Gated Communities und die eine oder andere Finanztransaktion hatte er in kurzer Zeit ein gewaltiges Vermögen angehäuft und eines Tages beschlossen, eine eigene Bürgerbewegung zu gründen, »weil ich genug habe von der Art und Weise, wie bei uns Politik gemacht wird. Wer hierzulande etwas für den Fortschritt tun will, bekommt nichts als Knüppel zwischen die Beine geworfen.« Die Wahlen um den Gouverneursposten gewann er mit Riesenabstand zu seinen Mitbewerbern, denen das fehlte, was Rovira im Übermaß besaß: Charisma. Durch den Erfolg angelockt, schlossen sich ihm alle möglichen Unternehmer, Politiker kleinerer Gruppierungen, Medienleute und weitere einflussreiche Akteure an und halfen ihm, jeder auf seine Weise, bei der Gründung von Pragma, der Partei mit dem Wahlspruch: »Damit es wieder aufwärtsgeht – packen wir es an!« Sebastián glaubte fest daran, dass mit Fernando Rovira ein echter Wandel möglich wäre. Hatte Rovira etwa nicht jedes Mal Erfolg gehabt, sowohl bei privaten wie öffentlichen Unternehmungen? Typen wie er waren Ausnahmegestalten unter den Politikern – Rovira hatte sich früher nie politisch engagiert, hing keiner besonderen Ideologie an und ließ sich weder einem der großen Konzerne noch einer der einflussreichen Familien des Landes zuordnen. Stattdessen umgab er sich mit den besten und fähigsten Mitarbeitern und Beratern.
Sebastián bewunderte ihn, während ich gerade einmal sein Gesicht aus dem Fernsehen kannte. Mein Freund studierte Politikwissenschaften und war mit der dazugehörigen Theorie bestens vertraut, worauf er sich eine Menge einbildete. Trotzdem hatte seine Begeisterung angesichts des Vorstellungsgesprächs offensichtlich mehr mit seinen Gefühlen als seinem Verstand zu tun. So kam es mir jedenfalls vor. Den ganzen Abend schwärmte er von der grandiosen Chance, bei einer politischen Gruppierung mitzuarbeiten, die auf »Exzellenz« setze. Das Wort »Exzellenz« konnte er nicht oft genug wiederholen, was mir ein wenig auf die Nerven ging. Auch weil er so tat, als sei »Exzellenz« der Schlüssel zu jeder Art von Erfolg. Wenn er das Wort aussprach, kniff er leicht die Augen zusammen und tippte zu jeder Silbe mit dem Zeigefinger in die Luft, als dirigierte er ein unsichtbares Orchester: »Ex-zel-lenz.« Während er in unserem Zimmer hin und her ging, lag ich auf dem Bett und hörte ihm zu. Er redete pausenlos auf mich ein und fuchtelte dazu wie besessen mit den Händen.
Ich kannte Sebastián von einem Ferienaufenthalt in Mendoza, der einige Zeit zurücklag. Wir waren damals beide allein unterwegs und hatten gemeinsam mehrere Tage in einer Berghütte bei Uspallata verbracht. Ursprünglich hatte ich mich wegen Carolina auf die Reise gemacht, meiner damaligen Freundin, an die ich mich heute noch sehr genau erinnere, nicht weil ich so verliebt gewesen wäre, sondern weil vieles von dem, was mir in den letzten Jahren passiert ist, mich auf die Worte verwies, die seinerzeit das Ende unserer Beziehung herbeigeführt hatten: »Ich weiß nicht, ob ich jemals Vater werden will.« Carolina hatte mich daraufhin verlassen, und ich war ihr hinterhergereist. Ich fand, dass sie übertrieb, dass sie unsere eher scherzhafte Unterhaltung über das Thema Kinder zu ernst genommen hatte. Ich redete mir ein, in Wirklichkeit habe sie nur deshalb so heftig reagiert, damit wir uns anschließend einmal mehr würden aussöhnen können – wie in den Romanen, die sie so liebte. Und ich war mir sicher, dass nach einer gründlichen Aussprache alles weitergehen würde wie bisher. Als ich sie in Mendoza bei ihren Großeltern aufgestöbert hatte, küssten und umarmten wir uns, doch schon bald fing sie wieder mit dem Thema an, diesmal noch hartnäckiger. Ich wusste nicht, wie ich das Missverständnis – falls es sich tatsächlich um eines handelte – aufklären sollte. Unsere Beziehung wollte ich keinesfalls beenden, und trotzdem sah ich mich außerstande, etwas anderes zu sagen als beim Mal davor. Also versuchte ich, das Thema zu wechseln, küsste sie wieder und wieder, aber Carolina ließ sich nicht beirren. Doch was ihre Kinderwünsche anging, konnte ich ihr nichts vormachen, sosehr ich es gewollt hätte. Im Augenblick war eine Vaterschaft für mich kein Thema, wir waren beide kaum älter als zwanzig, keiner meiner Freunde hatte in dieser Hinsicht irgendwelche Pläne. Alles, was wir damals wollten, war ausgehen und uns betrinken, studieren, manche hatten schon angefangen zu arbeiten, wir träumten davon, bald von zu Hause auszuziehen, in der Welt herumzureisen, schöne Mädchen kennenzulernen, uns zu verlieben. Aber ein Kind in die Welt setzen? Jetzt doch nicht, auf keinen Fall. Carolina dagegen sehr wohl. Und so stellte sie mich an jenem Nachmittag in Mendoza vor die Wahl – für sie war es ausgeschlossen, eine Beziehung mit jemandem fortzusetzen, »der mich dazu verdammt, niemals Kinder zu bekommen«. Aber tat ich das? Waren wir nicht selbst fast noch Kinder?
Was mich anging, stimmte das, nicht so jedoch im Fall von Carolina. Also trennte sie sich von mir.
Da es offenkundig keine Aussicht auf Versöhnung mehr gab, ich aber nicht schon einen Tag nach meiner Abreise wieder zu Hause erscheinen wollte, beschloss ich, noch eine Weile in der Gegend zu bleiben. Ich ging zum Bahnhof, wählte einen der nächsten abfahrenden Busse aus und fuhr nach Uspallata. Sebastián war schon seit zwei oder drei Tagen dort. Auch er war allein unterwegs, wie er sagte, brauchte er nach einem Jahr intensiven Studiums und harter Arbeit ein wenig Ruhe und Zeit für sich selbst. Erst viel später erfuhr ich, dass Sebastián vor dem Aufbruch nach Uspallata eine ziemliche Weile sehr deprimiert gewesen war und sein Ausflug dazu beitragen sollte, einen Zustand zu überwinden, den er niemals beim Namen nannte. Außerdem hatte er nur wenige Freunde, weil er die Menschen in seiner Umgebung durch seine unmäßige Energie oder seine finstere Verschlossenheit rasch ermüdete. In Uspallata wussten wir voneinander bloß, was man eben von jemandem weiß, den man gerade erst in einer Berghütte kennengelernt hat. Allerdings verführt einen eine solch ungewohnte Nähe leicht zu dem Glauben, jemanden besser zu kennen, als es tatsächlich der Fall ist. Trotzdem wäre es wahrscheinlich hierbei geblieben, und wir hätten uns mit den Worten verabschiedet »Bis dann«, »Ich schreib dir«, »Ich ruf mal an«, ohne dem jemals Taten folgen zu lassen, hätte ich nicht, kurz bevor wir endgültig auseinandergingen, erwähnt, dass ich mich mit dem Gedanken trug, womöglich nach Buenos Aires zu ziehen. Das war eher laut gedacht, doch Sebastián bot mir sofort einen Platz in dem Pensionszimmer an, in dem er wohnte, seit er bei seinen Eltern ausgezogen war und sein erstes Gehalt bekommen hatte. Und er drängte mich, rasch zu entscheiden.
»Ich habe noch andere Interessenten, also lass dir die Gelegenheit nicht entgehen«, mahnte er mich unentwegt. Er schrieb mir sogar die Adresse und alles, was dazugehörte, genau auf, um die Ernsthaftigkeit seines Angebots zu unterstreichen. Außerdem wäre es für uns beide von Vorteil, die Kosten zu teilen, fügte er hinzu, und nachdem wir uns schon hier in dieser Berghütte fast wie Brüder verstanden hätten, könne das doch auch in Buenos Aires funktionieren. Aber warum auch in Buenos Aires?, hätte ich mich fragen sollen. Stattdessen teilten wir beiden, die eigentlich so gut wie nichts miteinander verband, uns schon bald darauf einen Raum, der um einiges kleiner war als die Berghütte in Uspallata, und das nicht nur für eine begrenzte Zeit.
Bei uns zu Hause wurde normalerweise kaum über Politik gesprochen, mit einer Ausnahme: Wenn mein Onkel Adolfo, der ältere Bruder meines Vaters, zu Besuch kam, war von nichts anderem die Rede. Adolfo war zweimal Abgeordneter der Radikalen Bürgerunion im Rat seiner Heimatstadt San Nicolás gewesen.
»Demokratisch gewählt«, wie er gerne betonte. »Aus meiner politischen Karriere ist nur deshalb nichts geworden, weil ich mich zu früh habe scheiden lassen, und in unserer Partei können Geschiedene bekanntlich keine Karriere machen. Deshalb halten die anderen ihre Ehe auch um jeden Preis aufrecht, selbst wenn es die reinste Hölle ist.« Auch seine Ehe war die Hölle gewesen, wie mein Onkel unermüdlich wiederholte. »Ich hatte die Wahl: Entweder ich ruiniere mein Leben oder meine politische Karriere. Aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die imstande sind, jeden Tag mit einem Fluch zu beginnen und mit einem Fluch zu beenden. Doch genau das war meine Ehe – ein einziger, endloser Fluch.« Also hatte er sich scheiden lassen. »Strategisch gesehen ein Fehler, zumindest was meine politische Zukunft anging. Aber meiner Gesundheit hat es gutgetan. Bei den Peronisten ist es anders, wenn die von ihrer Frau rausgeworfen oder im Fernsehen beschimpft und zur Sau gemacht werden, ist das egal. Wir Radikalen dagegen können uns so was nicht erlauben, das heißt, wir können auch tun, was wir wollen, aber es muss unbedingt geheim bleiben. Und scheiden lassen geht bei uns gar nicht.« So richtig in Fahrt geriet Adolfo jedoch, wenn die Rede auf Parteigenossen kam, die in seinen Augen längst nicht so fähig waren wie er und trotzdem herausragende Posten besetzten. »Sieh dir den an. Ich habs bloß bis zum Stadtrat gebracht, aber dieser Idiot da ist inzwischen fast ganz oben angelangt …«
»Lass gut sein, Adolfo«, sagte mein Vater dann jedes Mal, und wenig später waren beide damit beschäftigt, ein altes Möbelstück auf Hochglanz zu polieren.
Beide betrieben Möbelgeschäfte, mein Großvater war Tischler gewesen und hatte ihnen das Handwerk beigebracht. Mein Onkel war in San Nicolás geblieben, während mein Vater in Santa Fe, der Heimatstadt meiner Mutter, ein Geschäft aufgemacht hatte. Im Lauf der Jahre waren sie dazu übergegangen, fast nur mehr mit Möbeln aus anderer Fabrikation zu handeln, selbst stellten sie bloß noch Stücke her, die ihnen besonders gut gefielen. Und so ging die Schreinertradition der Familie mit ihrer Generation zu Ende. Adolfo hatte keine Kinder, und obwohl ich über Grundkenntnisse der Möbelherstellung verfügte und manchmal sogar zum Zeitvertreib etwas Einfaches baute, hätte ich mir nicht vorstellen können, das Geschäft meines Vaters eines Tages zu übernehmen. Auch meine Mutter stellte sich für mich nichts dergleichen vor, im Gegenteil. Sie war die große Träumerin der Familie und wünschte sich für ihren einzigen Sohn all das, was sie selbst nie hatte verwirklichen können. Zumindest bis zu jenem Vorfall auf der Bundesstraße von Santa Fe nach Paraná – seitdem wirkte sie stets ein wenig ängstlich und zurückhaltend.
Ich glaube, mehr als all die Geschichten von politischen Manövern und Betrügereien genoss mein Vater die feste Stimme und den begeisterten Tonfall unerschütterlicher Selbstgewissheit, mit dem Adolfo sie wiedergab. Zudem war dieser Bruder seit dem Tod meines Großvaters – als er starb, waren die beiden gerade einmal acht beziehungsweise fünfzehn Jahre alt – wie ein Vater für ihn gewesen. Nur eine Woche nach der Beerdigung hatte Adolfo das Geschäft der Familie übernommen und seitdem für ihren Lebensunterhalt gesorgt. Für meinen Vater war er der vergötterte Ersatzvater und Superheld, auch jetzt noch, wo beide längst erwachsen waren und ihr eigenes Leben führten. Weshalb er ihm auch bei seinen Besuchen – jedes Jahr kam Adolfo zwei oder drei Mal zu uns nach Santa Fe – seine gesamte Zeit und Aufmerksamkeit widmete. Und der größte Teil dieser Besuche bestand darin, dass wir ihm dabei zuhörten, wie er über Politik sprach. Auch meine Mutter mochte ihn sehr – wer hätte ihn nicht gemocht? –, allerdings war sie ihm nicht so bedingungslos ergeben wie mein Vater. Und so hatte sie entdeckt, dass Adolfo die meisten seiner politischen Weisheiten und Sentenzen einfach von weit bedeutenderen Mitgliedern der Radikalen Bürgerunion übernommen hatte. Der Großteil stammte von Raúl Alfonsín, dem mein Onkel angeblich bei dem Attentat in San Nicolás im Jahr 1991 das Leben gerettet hatte, indem er sich über ihn warf, kaum dass der erste Schuss zu hören war. Als er wieder mal Äußerungen dieses ersten argentinischen Präsidenten nach dem Ende der Militärdiktatur ungeniert als seine eigenen ausgab, wies meine Mutter Adolfo darauf hin, worauf dieser ungerührt erwiderte: »Tja, das hat er von mir, den Satz habe ich mal auf einem Parteitag gesagt, und er hat ihn übernommen. Da bin ich natürlich stolz drauf, klar, und ich gehe doch jetzt nicht hin und sage: Hallo, das stammt aber von mir.«
So war mein Onkel Adolfo für mich also der Urheber so bekannter Äußerungen Alfonsíns wie: »Auf die Ideen kommt es an, wer sie umsetzt, ist nicht so wichtig«, »Die Freiheit haben wir jetzt, was wir brauchen, ist Gleichheit«, »Wenn Politik bloß das Mögliche erreichen will, gibt sie sich selbst auf«, »Unsere Schulden werden wir nicht damit bezahlen, dass das Volk hungert«, ja sogar »Demokratie heißt satt machen, erziehen, heilen«.
Ich hörte bei diesen Unterhaltungen aufmerksam zu, verstand aber bestenfalls zum Teil, wovon die Rede war. Neben den erwähnten, vor allem von Alfonsín übernommenen Äußerungen, prägten sich mir vor allem einzelne Begriffe ein, die immer wieder vorkamen – Komitee, Gleichheit, Freiheit, Volkssouveränität, Sozialdemokratie, Mitstreiter. Was ich dagegen nie hörte, war der Ausdruck »Exzellenz«, das könnte ich schwören.
»Du siehst ja, was dabei rausgekommen ist«, lautete Sebastiáns Kommentar, als ich mich lange danach – wir waren bereits seit einiger Zeit Pragma-Mitglieder – bei einer Diskussion beklagte, allmählich hätte ich genug von seinem ewigen Gerede, man müsse »pragmatisch« sein, um anschließend von meinem Onkel Adolfo und seinen so ganz andersartigen Äußerungen zu erzählen. Sebastián ist übrigens der Einzige bei Pragma, dem gegenüber ich jemals von der Existenz dieses Verwandten gesprochen habe. In Anwesenheit von Fernando Rovira wäre mir das niemals eingefallen. Als gehörten Adolfo Sabaté und Pragma zwei völlig verschiedenen Welten an, die, zum Wohle aller, möglichst nicht in Berührung kommen sollten. Zumindest solange es sich irgendwie vermeiden ließ.
Obwohl mir Sebastiáns »Exzellenz«-Schwärmerei an dem Abend vor dem Vorstellungsgespräch auf die Nerven gegangen war, beneidete ich ihn um seine Begeisterung. Vielleicht ließ ich mich auch deshalb darauf ein, ihn zu begleiten. Seit ich von Santa Fe nach Buenos Aires gezogen war, hatte ich mich eigentlich für nichts wirklich erwärmen können, nicht einmal für eine Frau. Die Geschichte mit Carolina hatte ich noch längst nicht verdaut – konnte man wirklich nur mit einer Frau zusammen sein, wenn man auch Kinder mit ihr haben wollte? So bald würde ich mich jedenfalls nicht wieder verlieben.
»Weißt du was? Warum kommst du nicht mit?«, sagte Sebastián.
»Wohin?«
»Zu dem Vorstellungsgespräch morgen, bei Pragma.«
»Möchtest du das denn?«
»Ich finde, du solltest dich auch bewerben. Die Ausschreibung ist total weit gefasst, irgendwas von dem, was du kannst, passt bestimmt dazu.«
Ich überlegte einen Moment, ob der letzte Satz von Sebastián eine bloße Tatsachenbeschreibung oder ironisch gemeint war, aber bevor ich antworten konnte, setzte er nach: »Komm, du hast nichts zu verlieren.«
»Da hast du recht«, sagte ich, und wir legten uns endlich schlafen.
Als wir am nächsten Morgen pünktlich um acht bei der angegebenen Adresse eintrafen, warteten vor uns schon an die hundert Personen.
»Ein Vorstellungsgespräch, um Mitglied bei einer Partei zu werden? Die Dinge haben sich wirklich vollkommen verändert. Wie ist das passiert, Román, und wann? Wo war ich da?«, sagte mein Onkel, als ich ihm ein paar Wochen später davon berichtete. Obwohl ich bei Pragma, wie gesagt, nie von ihm erzählte, wollte er von mir natürlich alles über Pragma wissen. Er hatte durch meinen Vater erfahren, dass ich dort arbeitete. Das, was ihn meiner Vermutung nach am meisten irritieren würde, ließ ich möglichst weg. Dazu gehörte auch, wie das Vorstellungsgespräch verlaufen war. Die Männer und Frauen, die sich eingefunden hatten, waren fast alle in unserem Alter und gaben sich positiv, selbstsicher, ja fast kämpferisch.
»Puh, das wird nicht so einfach«, seufzte Sebastián. Allzu große Sorgen schien er sich trotzdem nicht zu machen, er war sich viel zu sicher, dass er eine der zehn ausgeschriebenen Stellen bekommen würde. »Wenn es nur eine oder zwei wären, wäre es was anderes, aber bei zehn Stellen muss einfach eine für mich dabei sein, diese Leute sind schließlich nicht blind.«
Er hatte vergeblich versucht, mir eins seiner Jacketts aufzudrängen. Auf ein weißes Hemd ließ ich mich aber ein. Ich zog es zu der einzigen Jeans an, die ich besaß und die ich zum Glück gerade erst hatte reinigen lassen. Und dazu ein paar Mokassins von Sebastián, die mir allerdings eine Nummer zu klein waren. An die Blase an der Ferse erinnere ich mich bis heute. Ich selbst hätte nur mit einem Paar ausgelatschter Sandalen oder nicht weniger abgetragener Bastschuhe aufwarten können, abgesehen von meinen Joggingschuhen, die Sebastián aber völlig unpassend fand: »Hier gehts nicht darum, wer am schnellsten läuft, hier ist Teamarbeit angesagt.«
Er selbst zog sich eine graue Hose, ein blaues Jackett und ein weiß-blau gestreiftes Hemd an, dazu feine Schuhe mit Schnürsenkeln. Außerdem steckte er eine sorgfältig gefaltete Krawatte ein.
»Ob ich die anziehe, entscheide ich erst kurz vorher, wenn ich die Lage überblicke. In manchen Firmen trägt kein Mensch irgendwas um den Hals, und dann fällst du mit Krawatte natürlich total aus der Rolle«, belehrte er mich, während wir in der Bar gleich neben der Pension noch schnell einen Kaffee tranken.
Der erst vor Kurzem eingeweihte Sitz von Roviras Partei befand sich in einem sanierten und in dem dunkelvioletten Farbton, der damals sehr in Mode war, gestrichenen Gebäude, das auf den ersten Blick an ein schickes Boutique-Hotel erinnerte. Die Warteschlange zog sich den gegenüberliegenden Bürgersteig entlang. Vor dem Eintreten musste man also zunächst noch die Straße überqueren. Wahrscheinlich soll der Eingang nicht verstellt werden, sagte ich mir – die beiden riesigen Pflanzkübel zu beiden Seiten sowie mehrere teure Motorräder, die ebenfalls dort abgestellt waren, ließen ohnehin nicht viel Platz frei. Allmählich beschlich mich aber das Gefühl, mich auf einer Art Laufsteg fortzubewegen, abgesehen davon, dass ich den Eindruck hatte, ab und zu bewege sich die Gardine eines der Fenster im ersten Stock, als wollte uns jemand beobachten. Mehrere junge Leute, die bereits zum »Team« gehörten, verteilten Formulare, die wir während des Wartens schon einmal ausfüllen sollten. Ich bot Sebastián meinen Rücken als Schreibunterlage an, anschließend würde ich seinen benutzen, aber er fand das keine gute Idee.
»Die achten auf alles. Aus allem, was du tust oder nicht tust, ziehen die ihre Schlüsse. Und wir gehören doch wohl nicht zu den Leuten, die sich anderen freiwillig als Schreibpult zur Verfügung stellen, oder?«
Ich sah ihn erstaunt an und musste daran denken, wie oft ich genau das mit meinen Freunden in Santa Fe gemacht hatte. Doch bevor ich etwas hätte erwidern können, wechselte Sebastián das Thema.
»Eine Krawatte wäre wirklich total fehl am Platz gewesen, siehst du?« Er deutete unauffällig auf die übrigen wartenden Männer, die fast alle, scheinbar locker und ungezwungen, bloß in Hemd und Hose erschienen waren, auch wenn es sich eindeutig um teure Markenprodukte handelte. Zusätzlich zu dem Formular bekamen wir Kugelschreiber mit dem Logo von Pragma sowie dem eingeprägten handschriftlichen Namenszug Fernando Roviras darauf ausgehändigt. Weder bei dem Punkt »Abgeschlossenes Universitätsstudium oder andere abgeschlossene Ausbildungen« noch »Derzeitiges Universitätsstudium oder andere laufende Ausbildungen« hätte ich etwas eintragen können. Bestenfalls hätte ich einen der Studiengänge anführen können, die ich nie abgeschlossen hatte und wohl auch nie abschließen würde. Zuletzt beschloss ich jedoch, mir die Mühe zu sparen, schließlich war ich aus reinem Zufall hier gelandet, eigentlich nur um Sebastián einen Gefallen zu tun. Fast wie zum Spaß trug ich dafür unter dem Punkt »Andere Fähigkeiten und Kenntnisse« ein: Möbelschreiner, Chauffeur, Fitnesstrainer. Und übergab mein Formular anschließend als Erster von allen, die in der Warteschlange standen.
Wir hatten angenommen, dass wir anschließend persönlich befragt würden, aber so war es nicht. Worüber Sebastián sehr enttäuscht war – wie er zugab, hatte er sich eine ganze Woche lang vorbereitet, um eine »exzellente« Präsentation parat zu haben, die er jederzeit auf Abruf hätte abspulen können. Ich hatte in der Tat mitbekommen, wie er Nacht um Nacht irgendwelche Grafiken zusammenstellte, mit Leuchtstift Textstellen markierte, ganze Sätze aufsagte oder plötzlich fluchend vom Stuhl aufsprang, weil wieder einmal die Internetverbindung unterbrochen war. Dass der ganze Aufwand nur der Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch bei Pragma diente, hatte ich allerdings nicht geahnt.
»Die hätten mich anschließend sofort eingestellt, echt«, jammerte er.
Das Einzige, was nach Abgabe der Formulare passierte, war, dass wir im Erdgeschoss des Gebäudes ein Frühstück serviert bekamen, woraufhin man uns für unser Erscheinen und das Interesse daran, Teil des Pragma-Teams zu werden, dankte und abschließend mitteilte, dass die zehn ausgewählten Kandidaten telefonisch benachrichtigt würden, damit sie so schnell wie möglich mit der Arbeit beginnen könnten. Sebastián spazierte aufgeregt wie ein kleiner Junge in Disneyland in dem Empfangsraum umher und lächelte sehnsüchtig vor sich hin – zum letzten Mal hatte ich ihn so selig lächeln sehen, nachdem wir in Uspallata gemeinsam eine Flasche Malbec geleert hatten, dessen Preis die Grenzen meines Budgets weit überstieg. Und obwohl es ihm versagt blieb, seinen grandiosen Monolog zur Aufführung zu bringen, nutzte er jede Gelegenheit, um mit einem der Mitglieder des Pragma-Teams ins Gespräch zu kommen, wobei er tat, als wäre er bereits einer der Ihren.
Als wenige Tage später der Anruf erfolgte und es hieß, ich solle mich am nächsten Tag in der Pragma-Zentrale einfinden, war Sebastián sichtlich geschockt. Ich war ans Telefon gegangen, und Sebastián machte mir anschließend Vorwürfe, weil ich nicht gefragt hatte, ob er auch zu den Auserwählten gehörte.
»Vielleicht rufen sie jeden einzeln an und haben nicht gemerkt, dass wir beide dieselbe Telefonnummer haben«, sagte ich und schaffte es, ihn damit vorläufig zu beruhigen.
»Du hast recht, bestimmt rufen sie gleich noch mal an«, erklärte er versöhnlich.
Aber wir warteten vergeblich, dass das Telefon noch einmal klingelte. Woraufhin ich einen Sebastián kennenlernte, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Seine Gesichtszüge verhärteten sich, er fing an, hektisch mit den Fingern auf dem Tisch zu trommeln, sprang irgendwann auf, lief mit gesenktem Blick im Zimmer hin und her und fing irgendwann an, wütende Flüche auszustoßen. Bis er plötzlich mit der Faust an die Tür schlug, dass ich erschrocken zusammenfuhr.
»Was hast du denn in dieses Scheißformular eingetragen? Aus irgendeinem Grund müssen sie dich schließlich genommen haben«, sagte er später in derselben Nacht, in der keiner von uns in den Schlaf fand. Die Empörung war ihm deutlich anzuhören.
»Keine Ahnung, Sebastián«, sagte ich.
Er starrte mich an, als überlegte er, wo in meinem Gesicht er den ersten Fausthieb platzieren solle.
»Wenn du willst, gehe ich morgen einfach nicht hin, für mich ist das schließlich …«, sagte ich in dem Versuch, zu verhindern, dass die Sache ein schlimmes Ende nahm.
Aber er fiel mir ins Wort: »Natürlich gehst du morgen hin, und dann strengst du dich mehr an als alle anderen, machst dich überall beliebt und sorgst dafür, dass sie mich auch einstellen, ganz egal, wie und warum.«
Jeder andere hätte in diesem Augenblick geantwortet, jetzt sei es aber genug mit seinen Chefallüren. Doch obwohl es sich tatsächlich so angehört hatte, als würde er mir Befehle erteilen, war mir sehr wohl klar, dass er mich in Wirklichkeit verzweifelt um Hilfe gebeten hatte.
Für Sebastián war das mit Pragma mehr als irgendein Job, was er auch sogleich bestätigte: »Dir ist hoffentlich klar, dass das für mich total wichtig ist, oder?«
»Natürlich ist mir das klar. Und keine Sorge, ich besorg dir einen Job bei Pragma«, versprach ich.
Und so war es dann auch.
3
Román Sabaté lernte ich vor ungefähr fünf Jahren kennen, kurz nachdem er nach Buenos Aires gezogen war. Ich wusste damals allerdings weder, um wen es sich handelte, noch, woher er kam. Wir waren uns einfach ein paar Mal im Rahmen meiner Arbeit als Live-Reporterin für TvNoticias über den Weg gelaufen: vor dem Haus von Fernando Rovira, der damals schon nicht mehr Bürgermeister von San Isidro war; vor der Pragma-Zentrale im schicken Stadtteil Palermo; in den Büroräumen von Arturo Sylvestre, dem Strategen und Kommunikationschef von Pragma, in Puerto Madero, dem in ein Luxusquartier umgewandelten ehemaligen Hafenbezirk von Buenos Aires; außerdem an verschiedenen Orten, die Rovira regelmäßig aufsuchte, also eine Reihe feiner Restaurants, ein Fitnessstudio, Büros von Anhängern und Gegnern – ob jemand Ersteren oder Letzteren zuzurechnen war, konnte sich rasch ändern. Als Live-Reporterin hatte ich stets dort zu sein, wo Rovira und seine Leute sich aufhielten. Román war zu der Zeit, die mir heute schon so weit zurückzuliegen scheint, für mich bloß einer aus dem Team Roviras, offensichtlich jedoch ein festes Mitglied. Dass ich ihn, schüchtern, wie er war, und sich stets im Hintergrund haltend, überhaupt wahrnahm, hatte eigentlich nur einen Grund – er sah besser aus als alle seine Mitstreiter, sein Chef eingeschlossen, und das obwohl für viele Argentinierinnen kein anderer Politiker so sexy war wie der attraktive Mittvierziger Fernando Rovira. Beide hatten einen dunklen Teint und leuchtend grüne Augen und waren über einen Meter neunzig groß. »Gut aussehen« und »sexy sein« ist für mich aber nicht das Gleiche – um gut auszusehen, braucht man nicht mächtig zu sein, sexy ist man ohne Macht und Einfluss dagegen nicht.
Besser lernte ich Román dann vor ungefähr drei Jahren kennen, als ich die Arbeit an einem Buch für Salvatierra Editores begann, ein mit angeblich spanischem Kapital gegründeter Verlag, der erst wenige Monate davor seine Zelte in Argentinien aufgeschlagen hatte, um »absatzträchtige Projekte« auf den Weg zu bringen. Den Kontakt hatte Iván mir verschafft, mein Exfreund, der mich ab und zu auf einen Kaffee einlud, als wollte er sich überzeugen, dass ich mir noch nicht das Leben genommen hatte und das auch nicht tun würde, nachdem er mich wegen meiner besten Freundin verlassen hatte. Er sagte, ich solle mich unbedingt dort melden, die Leute von Salvatierra seien sehr aufgeschlossen für Projekte aller Art, darüber entschieden würde allerdings stets durch ein »Editionskomitee«. Das allerdings dämpfte meine Begeisterung, schließlich hatte ich schon öfter Verlagen Projekte angeboten, und wenn ich es daraufhin mit einem »Editionskomitee« zu tun bekommen hatte, hatte das meistens daran gelegen, dass sich niemand persönlich für eine Ablehnung verantwortlich erklären wollte. Ich stellte mich trotzdem dort vor und traf zu meiner Überraschung auf einen alten Bekannten, Eladio Cantón, einen Journalisten und Kritiker, den ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. In den Neunzigern war Cantón der Star des Feuilletons gewesen, bis er einmal das Buch eines Sohns des Zeitungseigentümers verrissen hatte, was ihn nicht nur seinen Posten gekostet, sondern es ihm auch unmöglich gemacht hatte, bei irgendeiner anderen wichtigen Zeitung unterzukommen.
»Was hätte ich tun sollen, China? Das Buch war wirklich der letzte Dreck. Und dazu der Titel, Ich und der Mount Everest – Die geilste Besteigung der Welt … Ich wollte das Buch auch nicht besprechen, aber der Typ hat nicht lockergelassen, also musste ich die Sache übernehmen, ich konnte schließlich keinen meiner Kollegen aufs Schafott schicken.«
Eladio Cantón, der damals nicht nachgegeben hatte und dafür mehrere Jahre lang keinen festen Job mehr finden konnte, hatte also inzwischen seine Lektion gelernt und arbeitete jetzt an vorderster Front für einen Verlag, der sich das unbedingte Geschäftemachen auf die Fahnen geschrieben hatte.
»Das hier ist einfach was anderes, bei uns arbeiten alle total professionell, ich brauche niemandem was vorzumachen, und auch wenn ein Buch von einem Freund des Verlegers stammt oder von jemandem, dem er einen Gefallen schuldet, brauche ich es nicht in den Himmel zu jubeln, auch wenn es der letzte Schrott ist. Wir beschränken uns darauf, halbwegs ordentlich geschriebene Texte zu verlegen, und solange sie interessant sind, brauchen es keine literarischen Wunderwerke zu sein. Unsere Autoren müssen nicht unbedingt den Nobelpreis gewinnen. Hauptsache, die Leute haben Lust, unsere Bücher zu lesen. Und wenn es Sachbücher sind, umso besser. Die Belletristik ist sowieso bloß noch ein Schatten ihrer selbst. Lauter Zeug, das nichts taugt, schlecht geschrieben, die reinste Nabelschau. Bei Sachbüchern hast du ein klares Thema, da wissen die Leser, woran sie sind. Wenn sie das Buch in der Buchhandlung sehen, und das Thema gefällt ihnen, gut, und wenn nicht, dann nehmen sie eben etwas anderes. Da wird niemandem etwas vorgegaukelt. Also, bring mir ein Buch über ein Thema, das die Leute interessiert, dann werden wir schnell einig.«
Ich wunderte mich, Eladio Cantón so reden zu hören, er, der früher mit anderen erbittert und unermüdlich darüber stritt, was gute Literatur sei und was nicht.
»Du hast mich eben nicht verstanden, China, wir verlegen hier keine Literatur, wir verlegen Bücher. Wenn du willst, gehen wir mal zusammen einen Kaffee trinken, und dann sprechen wir in aller Ruhe über Literatur. Oder gehörst du zu den Leuten, die bloß noch Tee trinken? Aber was solls, bring mir einfach ein spannendes Buch. Damit machst du mich glücklich.«
Und im dritten Anlauf – die ersten beiden Vorschläge hatten ihn nicht überzeugt – hatte ich tatsächlich ein Projekt im Gepäck, das ihn glücklich machte: Der Alsina-Fluch.
»Das taugt erst mal nur als Arbeitstitel«, sagte er, markierte aber sogleich mit gelbem Leuchtstift das Wort Fluch. »Fluch zieht immer«, erklärte er.
Auf die dazugehörige Geschichte war ich bei einem Auftrag in La Plata gestoßen. Seitdem ging mir die Sache nicht mehr aus dem Kopf. Vorläufig hatte ich bloß das Thema – die historisch belegte Tatsache, dass es noch niemand geschafft hatte, argentinischer Präsident zu werden, wenn er davor das Amt des Gouverneurs der Provinz Buenos Aires bekleidet hatte. Und dazu zwei, drei Sätze, mehr nicht. Aber der Rest würde sich schon einfinden. Cantón bat mich um ein vorläufiges Inhaltsverzeichnis sowie Kurzbeschreibungen der einzelnen Kapitel. Mehrere davon sollten sich der gründlichen Erforschung der Geschichte dieses Fluchs widmen, der »la Tolosana« genannten Hexe, die angeblich seine Urheberin war, und den von seinen Auswirkungen betroffenen Amtsinhabern. Dazu sollten Interviews mit ehemaligen Gouverneuren und anderen einflussreichen Politikern kommen wie auch mehrere Kapitel über die im Lauf der Jahre gemachten Vorschläge zur Teilung der Provinz. Wenigstens ein Drittel des Buches sollte sich mit Fernando Rovira und seinen hartnäckigen Bestrebungen beschäftigen, diese Teilung endlich und nach seinen Vorstellungen durchzusetzen, ein Vorhaben, dessen Verwirklichung inzwischen immer wahrscheinlicher schien. Ohne über eine belastbare Grundlage für meine These zu verfügen – am wichtigsten war mir in diesem Augenblick, mit Cantón zu einem Vertragsabschluss zu kommen –, behauptete ich, Roviras Teilungsvorhaben sei weniger technischen, demografischen, institutionellen, wirtschaftlichen oder politischen Gründen geschuldet als seiner Furcht vor dem berühmten Fluch der Tolosana. Und genau da biss Cantón an, dies schien ihm eindeutig das verführerischste Element.
»Verwünschungen, abergläubische Vorstellungen, Mythen, Hexen, Magie, Politiker, auf denen ein Fluch lastet, nichts funktioniert so gut wie dieser ganze Hokuspokus, China«, erklärte er begeistert. Und unversehens seine frühere Belesenheit zur Schau stellend, legte er mir Claude Lévi-Strauss’ Aufsatz »Der Zauberer und seine Magie« ans Herz, ein Hinweis, für den ich ihm womöglich nie genug gedankt habe.
Da Fernando Rovira also eine der Hauptfiguren des Buches werden sollte, versuchte ich als Erstes, Gesprächstermine mit ihm zu organisieren. Er ließ mich wissen, dass er sich durch meine Anfrage geschmeichelt fühle, aber zeitlich so eingeschränkt sei, dass er sich außerstande sehe, meinem Wunsch nachzukommen. Als Ersatz empfahl er mir seinen Mitarbeiter Román Sabaté, der berechtigt sei, mir in allen ihn betreffenden Punkten Auskunft zu geben. Die ideale Lösung war das nicht – irgendwann würde ich trotz allem mit Rovira persönlich sprechen müssen –, aber bis dahin war es nicht schlecht, sich mit einem so gut aussehenden jungen Mann unterhalten zu können. Bei den Begegnungen mit Román versuchte ich, über mein Projekt hinaus so viel Persönliches wie möglich über seinen Chef herauszufinden. Um die Theorie zu untermauern, dass die Verbissenheit, mit der Rovira sein Provinzteilungsvorhaben verfolgte, sich weniger rationalen Gründen als dem Alsina-Fluch verdankte, war ich auf Elemente aus seiner Familiengeschichte angewiesen, irgendwelche Ereignisse aus seiner Kindheit, seiner fernen Vergangenheit, die er im Dunkeln hielt. Weder in alten Interviews noch in sonstigen Aufzeichnungen aus Presse, Funk und Fernsehen ließ sich etwas über seine ersten Lebensjahre, geschweige denn seine Eltern finden. Als ich mich, dadurch misstrauisch geworden, an die Erstellung einer Liste von »Politikern mit der Öffentlichkeit nicht zumutbaren Eltern« machte, wurde mir aber bald klar, dass Rovira in dieser Hinsicht kein Einzelfall war. Wie ich mir eingestehen musste, war auch meine eigene Familiengeschichte hochempfindliches Material.
So ergiebig, auch in den Augen Eladio Cantóns, mein Thema war, war ich doch überzeugt, dass die Leser noch etwas anderes wollten – das, was sie immer wollen: dass ihnen jemand die Geschichte erzählt, die sie sich erhoffen. Eine zwingende, spannende Geschichte, die sie nicht loslässt. Wenn mir das gelänge, wäre das Buch wirklich gut. Wenn nicht, wäre es bloß Mittelmaß, eines der vielen Sachbücher, die zunächst abzugehen scheinen wie eine Rakete, um zuletzt doch nicht über die erste Auflage hinauszukommen. Ich beharrte also darauf, dass ich wenigstens zwei oder drei Mal persönlich mit Rovira sprechen müsse. Was mir dieser zu meiner Überraschung schließlich nicht mehr verwehrte, ja, er teilte mir sogar mit, er empfinde Stolz darüber, »dass jemand so viel Interesse für mich aufbringt«. Sosehr Eitelkeit eine unverzichtbare Eigenschaft ist, wenn man es als Politiker zu etwas bringen will, war in Roviras Fall meiner Ansicht nach ausschlaggebend, dass er offensichtlich den Eindruck hatte, auf diese Weise könne er mich auf seine Seite ziehen, mich seinem »Team« einverleiben und die Kontrolle darüber erlangen, was ich über ihn und sein Vorzeigeprojekt schreiben würde. Glaubte er wirklich, dass ich mich auf so ein Spiel einlassen würde? Dass ich nichts veröffentlichen würde, was ihm nicht behagte? Womöglich setzte er auch auf eine weniger direkte Strategie: nicht offen sagen, was er dachte, nicht von vornherein zensieren, sondern sich darauf verlassen, dass die Tatsache, dass er sich mir öffnete, sich auf mein Gewissen auswirken und mich dazu bringen würde, dies selbst zu tun, wenn es um bestimmte Dinge ging, die sein Leben und sein Projekt betrafen. Dinge, von denen ich vorläufig nichts wusste, die jedoch zweifellos irgendwann auftauchen würden. Wie es schließlich immer geschieht. Anders gesagt, er würde eine Verbindung aufbauen, an der er selbst nicht wirklich beteiligt war, ich dagegen schon, eine manipulative Strategie, wie sie Rovira – wie vielen anderen Politikern – mit größter Selbstverständlichkeit von der Hand ging. Der Einsatz Román Sabatés war im Rahmen dieser Strategie ein besonders geschickter Schachzug. Oder wäre es gewesen, wenn die Dinge sich nicht zuletzt in ihr Gegenteil verkehrt hätten.
Bei meinen Treffen mit Román – zunächst einmal pro Monat, später öfter, zuletzt wann immer wir Lust hatten und unter egal welchem Vorwand – erfuhr ich jedoch viel mehr über ihn selbst als über Rovira. Nicht nur, weil wir uns dabei, wenngleich zurückhaltend, auch über uns unterhielten. Vielmehr konnte ich beobachten, wie Román sich bewegte, Telefongespräche annahm, sich mit Rovira unterhielt, anderen dessen Mitteilungen weitergab, errötete, log, wenn er Fragen beantworten sollte, zu denen er auf Anweisung Roviras nichts preisgeben durfte, für uns beide in der Küche seines Chefs kochte und dabei so selbstverständlich mit allem hantierte, als wäre er bei sich zu Hause, oder im Garten mit Roviras Sohn spielte.