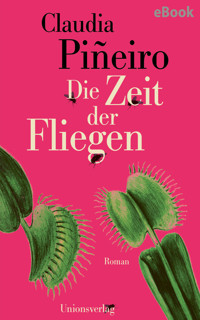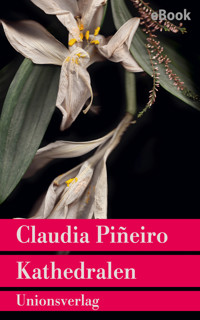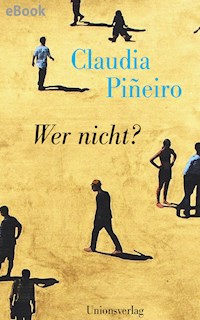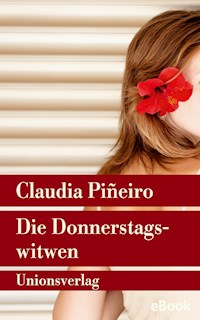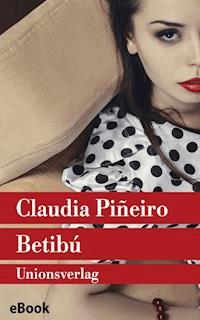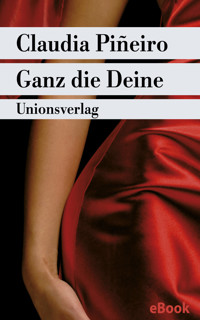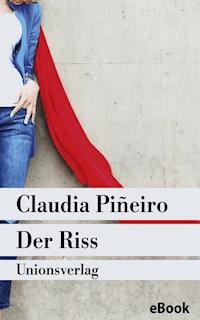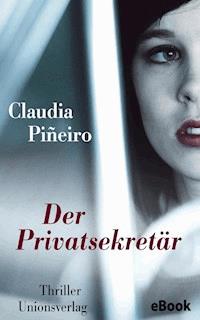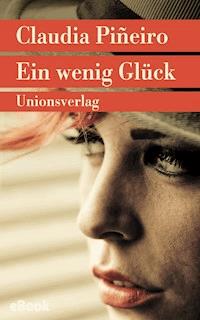
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Bahnübergang, eine heruntergelassene Schranke, ein blinkendes rotes Licht und kein Zug. Drei, fünf, acht Minuten … und kein Zug. Mary Lohan hat ihren sechsjährigen Sohn, Federico, und Juan, seinen Schulfreund, im Auto. Sie wollen ins Kino. Ihr Auto ist das dritte in der Warteschlange. Der erste Wagen umfährt die Schranke und überquert die Gleise, der zweite ebenso. Die Kinder singen vergnügt, der Filmbeginn rückt näher, und kein Zug ist in Sicht. Also los, auch sie wird es wagen. Die Schranke ist schon lange ein Ärgernis. Ob ein Zug überhaupt kommt, ist ungewiss. Zwanzig Jahre nach der Katastrophe kehrt Mary zurück in die Vergangenheit, aus der sie geflohen ist. Zwischen herbeigesehnten Begegnungen und erschütternden Enthüllungen begreift sie endlich, dass ihre Rückkehr vielleicht so etwas wie ein wenig Glück bedeutet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Mary Lohan kehrt zurück in die Vergangenheit, aus der sie geflohen ist. Zwischen herbeigesehnten Begegnungen und erschütternden Enthüllungen versteht sie, dass das Leben weder reines Schicksal noch purer Zufall ist und dass ihre Rückkehr vielleicht so etwas wie ein wenig Glück bedeutet.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Claudia Piñeiro (*1960) ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Argentiniens. Nach dem Wirtschaftsstudium arbeitete sie als Journalistin, Dramatikerin und Regisseurin. Sie erhielt den Premio Clarín, den LiBeraturpreis und den Premio Hammett und war für den International Booker Prize nominiert.
Zur Webseite von Claudia Piñeiro.
Stefanie Gerhold (*1967) übersetzt Literatur aus dem Spanischen, u. a. Manuel Vázquez Montalbán sowie die Werkausgabe von Max Aub. 1999 erhielt sie den Übersetzerpreis der Spanischen Botschaft in der Kategorie junge Übersetzer.
Zur Webseite von Stefanie Gerhold.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Claudia Piñeiro
Ein wenig Glück
Roman
Aus dem Spanischen von Stefanie Gerhold
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Una suerte pequeña bei Alfaguara Argentina, Buenos Aires.
Originaltitel: Una suerte pequeña (2015)
© by Claudia Piñeiro 2015
c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria, S.L.
www.schavelzongraham.com
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Valentin Casarsa/iStock
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30942-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.05.2024, 18:07h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
EIN WENIG GLÜCK
Logbuch mit Unterbrechungen: ZurückkommenDie Schranke war unten. Zwei Autos standen schon …Ich hätte Nein sagen sollen, dass es nicht …Ich verstaue den Rucksack mit den Unterlagen des …Die Schranke war unten. Sie bremste, vor ihnen …Der Pilot kündigt den Landeanflug an, die Kabinenbeleuchtung …Die Wohnung, in der man mich untergebracht hat …Die Schranke war unten. Sie bremste, vor ihnen …Als Mr Galván mich dreißig Minuten nach seinem …Die Schranke war unten. Sie bremste, vor ihnen …Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe …Ich sitze in dem Büro, das das College …Die Freundlichkeit von FremdenWarumMariano und ich haben sehr jung geheiratet …Alle mochten Federico – vielleicht ist das ja …In dem Jahr, als Juan starb, war Federico …Die Vorstellung begann um halb sechs, der Film …Die Schranke war unten. Vor uns standen schon …An diesem Abend wartete ich, bis Federico eingeschlafen …Federico nahm nicht an der Aufführung am Tag …Sobald Mariano wach wäre, würde ich ihn bitten …Ich ging an die frische Luft, ohne ein …Ohne einen genauen Plan zu haben, fuhr ich …In der ersten Zeit spielte sich mein Leben …Als ich den Text fertig geschrieben habe …BostonIch bin nach Boston zurückgekehrt, in das Haus …Die Evaluierung des St. Peter’s College liegt nicht …Vier Tage vor Mr Galváns geplanter Anreise erhalte …Mein Sohn kommtAm Tag vor seiner Ankunft bekomme ich eine …Ich halte auf dem Flughafen nach dem offiziellen …Mehr über dieses Buch
Über Claudia Piñeiro
Claudia Piñeiro: Lesen als Revanche
Claudia Piñeiro: »Frauen und Männer lesen unterschiedlich«
Über Stefanie Gerhold
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Claudia Piñeiro
Zum Thema Argentinien
Zum Thema Kindheit
Zum Thema Frau
Für Ricardo, der zwar nicht Robert ist, aber Robertsein könnte.
Für Paloma Halac, die mich darauf gebracht hat, woher Mary Lohan kommt. Und noch auf einiges mehr.
Für meine Kinder Ramiro, Tomás und Lucía. Die mein großes Glück sind.
»Akuter Schmerz. Er wird chronisch werden. Chronisch bedeutet, dass er ohne Ende, aber vielleicht nicht ohne Unterlass sein wird. Es kann auch bedeuten, dass du daran nicht stirbst. Du wirst nicht frei davon, aber du stirbst nicht daran. Du wirst ihn nicht jede Minute spüren, aber du wirst nicht viele Tage ohne ihn zubringen. Und du wirst einige Tricks lernen, um ihn zu betäuben oder zu vertreiben, ohne dabei am Ende das zu zerstören, wofür du diesen Schmerz auf dich genommen hast.«
Alice Munro, »Die Kinder bleiben hier«
Logbuch mit Unterbrechungen: Zurückkommen
Die Schranke war unten. Zwei Autos standen schon da. Die Signalglocke unterbrach die Nachmittagsstille. Ein rotes Licht blinkte über dem Schild »Bahnübergang«. Die heruntergelassene Schranke, das Bimmeln und das rote Licht kündigten einen Zug an. Aber es kam kein Zug. Zwei, fünf, acht Minuten, kein Zug weit und breit. Das erste Auto umkurvte die Schranke und fuhr rüber. Das zweite Auto rückte auf.
Ich hätte Nein sagen sollen, dass es nicht geht, dass ich nicht wegkann. Irgendwas sagen, egal was. Aber das habe ich nicht getan. Immer wieder habe ich mir die Gründe aufgezählt, warum ich mich, anstatt Nein zu sagen, am Ende doch bereit erklärt habe. Der Abgrund zieht uns an. Manchmal ohne dass wir es merken. Wie ein Magnet. Dann treten wir an den Rand, blicken in die Tiefe – und könnten springen. Ich bin so jemand. Ich könnte vortreten, mich in die Tiefe stürzen, in die Leere, ins Nichts fallen lassen, nur um – endlich – frei zu sein. Obwohl diese Freiheit zu nichts gut ist, weil danach nichts kommt. Eine Freiheit nur für den Moment des Fallens.
Es fällt mir schwer, Nein zu sagen, aber womöglich habe ich mich nicht nur deshalb bereit erklärt. Womöglich habe ich auch deshalb zugesagt, weil ich es im Grunde wollte. In meinem tiefsten Inneren, in das ich selbst nicht hineinblicken kann, wollte ich es. Vielleicht habe ich sogar die ganze Zeit darauf gewartet. Der Abgrund in mir. Neunzehn Jahre. Fast zwanzig. Die ganzen Jahre habe ich darauf gewartet, dass etwas, jemand, eine unwiderstehliche Kraft, ein unausweichlicher Umstand mich zwingen würde, zurückzukehren. Denn die Entscheidung selbst treffen, das hätte ich nicht gekonnt. Das Schicksal oder der Zufall ja, ich nicht. Zurückkehren. Aber nicht nur in mein Land zurückkehren, nach Argentinien, nicht nur in die Stadt, in der ich gelebt habe, Temperley, sondern auch ins St. Peter’s College. Als würde ich ins Innere einer Matroschka vordringen, zu der darin verborgenen kleinen Welt: in ein englisches College im Süden von Buenos Aires, das ich gleichermaßen geliebt und gehasst habe.
Das St. Peter’s College. Noch immer kostet es mich Überwindung, den Namen auszusprechen, selbst in Gedanken. Ich weiß, dass der, um den es geht, nicht mehr dort sein wird. Aber dafür vielleicht jemand, den ich kenne oder der mich kennt. Oder ihn. Der uns kannte, als ich noch dort gelebt habe. Ein wenig beruhigt es mich, dass ich dank einiger Eingriffe anders aussehe als damals. Ich werde mich unerkannt bewegen können. Vor ein paar Jahren traf ich zufällig Carla Zabala – eine Mutter aus der Schule, die damals zu meinem Freundeskreis gehörte –, und sie erkannte mich nicht wieder. Wir waren in einem großen Bekleidungshaus und standen, jede in einer anderen Schlange, an den Kassen an. Sie sprach mich in miserablem Englisch an und fragte etwas über den Preis des Kleidungsstücks, das sie über dem Arm trug. Mir verschlug es die Sprache, ich brachte kein Wort heraus. Carla wartete kurz ab, wurde aber nicht stutzig, dann stellte sie ihre Frage der Frau hinter mir. Damit hatte ich die Bestätigung für etwas, was ich schon wusste: Ich war nicht mehr die Frau, die ich einmal gewesen war. Die Frau, die in Boston in einem Bekleidungshaus an der Kasse anstand, war eine andere als die, die in Temperley gelebt hatte, sie kannte das St. Peter’s College nicht, keine Carla Zabala noch sonst wer würde sie erkennen. Einfach, weil sie das nicht mehr war.
Wenn ich mich auf Fotos von damals suche, erkenne ich mich selbst nicht wieder. Ich habe nur drei Fotos behalten, drei Fotos von ihm, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Keines von Mariano. Ich sehe sie mir fast nie an, irgendwann habe ich es mir abgewöhnt. Robert bat mich darum, er sagte, wenn ich mir immer wieder die Fotos ansehen würde, würde ich nie darüber hinwegkommen. Womit er recht hatte. Eine Weile tat ich es noch heimlich. Aber als ich eines Abends schlafen ging, fiel mir auf, dass ich mir den ganzen Tag die Fotos nicht angesehen hatte. Zwei weitere Tage vergingen. Eine Woche, ein Monat. Irgendwann dachte ich nicht mehr an die Fotos. Trotzdem habe ich sie aufbewahrt. Heute, während das Flugzeug mich an den Ort zurückbringt, den ich damals verlassen habe, habe ich vier Fotos dabei: die drei und eines mit Robert und mir vor unserem Haus. Aber ich sehe sie mir auch jetzt nicht an. Ich habe sie einfach mitgenommen, ich weiß noch nicht einmal, warum.
Ich bin nicht mehr blond wie die Mehrzahl der Frauen, die ihre Kinder aufs St. Peter’s schickten. Seit einiger Zeit trage ich meine Haare rötlich, fast rot. Ich habe zehn Kilo abgenommen, vielleicht noch mehr. Dick war ich nie, aber nach meinem Weggehen – eigentlich war es eine Flucht – wurde ich mager, durchscheinend, und ich habe die Kilos nie wieder aufgeholt. Ich kleide mich nicht mehr so wie die Frauen von dort, wie wir alle uns damals kleideten; ich kehre als typische Amerikanerin zurück, als eine Frau aus Boston. An kühlen Tagen trage ich einen Hut, was in Temperley undenkbar ist. Selbst meine frühere Stimme wird unter dem Klang der anderen Sprache verborgen bleiben. Solange ich mich in der Gefahrenzone aufhalte, werde ich sorgfältig auf meine Aussprache achten. Außerdem ist meine Stimme heiser geworden, zum ersten Mal bemerkte ich meine Heiserkeit an dem Tag, als ich das Land verließ. »Traumatisch bedingte Dysphonie«, diagnostizierte der Arzt, den ich ein paar Wochen später in Boston aufsuchte. Mit den Jahren wurde daraus eine chronische Dysphonie, denn mehrere Stunden am Tag unterrichten geht auf die Stimmbänder. Selbst meine Augen sind nicht mehr dieselben. Und nicht allein deshalb, weil sie andere Dinge gesehen haben, andere Welten. Auch nicht, weil sie den Ort, an den ich heute zurückkehre, nie wiedergesehen haben. All das würde man ihnen nicht anmerken. Und falls doch irgendetwas davon sie verändert haben sollte, hätten nur ich und vielleicht Robert es bemerkt, eine gewisse Traurigkeit, der matter gewordene Glanz und dass sie nicht mehr so flink von einem Ding zum nächsten huschen. Etwas anderes ist es, wohin man schaut, wenn man im Gespräch nach einem Wort sucht. Ich zum Beispiel richte den Blick zur Zimmerdecke, lasse ihn dort ruhen, bis ich das Wort gefunden habe. Robert hat geradeaus geschaut, wo das passende Wort schon irgendwo in der Ferne für ihn bereitlag; meine Mutter – heute weiß ich das – schloss die Lider. Und er? Wie ist es bei ihm? Ich weiß es nicht mehr. Aber um so subtile Veränderungen, die bestenfalls sehr aufmerksamen Beobachtern auffallen, geht es mir gar nicht. Ich meine äußerliche Veränderungen, die jeder auf den ersten Blick bemerkt. Als mein Augenarzt mir farbige Kontaktlinsen vorschlug, sagte ich sofort Ja. Robert war entgeistert. Aber solange es mir nicht schadete, hätte er mir niemals etwas ausgeredet. Wenn ich braune Augen wollte, sollte ich sie seinetwegen haben. Robert. Er liebte meine blauen Augen. Ich nicht mehr. »Braun sieht bestimmt sehr gut aus«, sagte er, auch wenn er eigentlich anderer Meinung war. Dass ich Robert begegnet bin, war meine Rettung. Ich weiß nicht, wo ich ohne ihn gelandet wäre. Als ich mich schon aufgeben wollte, war er auf einmal da und nahm mich mit nach Boston.
In Boston arbeite ich als Spanischlehrerin. Soll ich in der ersten Person oder in der dritten Person schreiben? Warum muss ich mich für eine Erzählperspektive entscheiden? Solche und ähnliche Fragen stellen mir meine Schüler, sobald sie die ersten Schwierigkeiten überwunden haben und »echte Texte« schreiben wollen. Jedes Jahr aufs Neue stellen sie mir solche Fragen. Es sind formale Fragen, die ich auch so beantworte – ich unterrichte schließlich Grammatik, nicht Literatur –, und trotzdem beschäftigen sie mich. Die Schüler lernen bei mir eine Fremdsprache, es geht nicht darum, dass sie auf Spanisch einen Roman oder eine Erzählung schreiben sollen. Dafür haben sie ihre Muttersprache, man soll in der Sprache schreiben, in der man denkt und träumt. In der Sprache, in der man schweigt. Aber auch wenn solche Fragen über den Lernstoff hinausgehen, finde ich die Antworten, die ich meinen Schülern gebe, manchmal selbst zu theoretisch: »Die grammatische Person (erste, zweite, dritte Person) wird durch das Personalpronomen ausgedrückt. Das Personalpronomen sorgt für die deiktische Zuordnung, die notwendig ist für die Definition des Sprechakts, also um die Rolle des Senders, des Empfängers und gegebenenfalls einer dritten deiktischen Instanz festzulegen.« Sprechakt, Sender, Empfänger, deiktische Instanz – Bullshit, würde Robert sagen. Ich kann die Definition auswendig, meine Schüler müssen sie aus dem Kopf aufsagen. By heart, sagt man auf Englisch. Was alles andere als eine wörtliche Übersetzung ist. Kopf versus Herz. An manchen Tagen habe ich Erbarmen mit meinen Schülern und gebe ihnen eine freundlichere Antwort: »Die erste Person ist generell die, die spricht – ich und wir. Die zweite Person ist die, zu der gesprochen wird oder die zuhört – du und ihr. Die dritte Person ist die, über die gesprochen wird – er, sie, es und das Sie des Plurals.« Doch während ich jetzt hier am Flughafen sitze und warte, frage auch ich mich angesichts des weißen Blatts vor mir, ob ich meine Geschichte in der ersten oder in der dritten Person Singular schreiben soll. Als »ich« oder als »sie«. Ich probiere beides aus. Die dritte Person rückt mich weg, sorgt für Abstand. Die erste lockt mich an den Rand des Abgrunds – ›Spring doch!‹ Die dritte erlaubt es mir, mich verborgen zu halten, nicht an den Rand zu treten, nicht in die Tiefe zu schauen, selbst beim Erzählen nicht. Aber versteckt habe ich mich schon die ganze Zeit, mit dem Ergebnis, dass ich nie ein Wort über diesen Tag und über die Tage und Jahre danach habe schreiben können. Darum zwinge ich mich, diesen Text – dieses Logbuch meiner Rückreise – in der ersten Person zu schreiben. Nur so lässt sich der Schmerz erzählen. Der Schmerz, der Bruch, die Flucht – danach war die Welt in tausend Stücke zersprungen, die sich nie mehr würden zusammenfügen lassen –, der Blick zurück aus der Ferne, das Verlassensein, das Aufgeben, die Narben – all das lässt sich nur in der ersten Person erzählen.
Ich sitze in New York am Flughafen – dank Robert lernte ich wieder, in einen Zug zu steigen, und konnte die Zugfahrt von Boston nach New York sogar genießen (»du kommst entspannt an und steigst ins Flugzeug«) – und warte, dass mein Flug aufgerufen wird. Meinen kleinen Koffer mit dem Nötigsten für ein bis zwei Wochen habe ich aufgegeben. Ich schreibe in der ersten Person. Ich schreibe für mich in der ersten Person. Ich schreibe an mich. Die erste Seite überschreibe ich mit »Logbuch«, nicht mit »Tagebuch«. Um Tagebuch zu schreiben, muss man überzeugt sein, dass das eigene Leben es wert ist, erzählt zu werden, und das bin ich nicht. Dass dieses Leben, so hart es gewesen sein mag oder immer noch ist, es wert sein soll, Tag für Tag und mit allen Einzelheiten aufgeschrieben zu werden, und das ausschließlich aus meiner Sicht, dazu fehlt mir die Überzeugung.
Die Fotos habe ich im Handgepäck. Alle vier Fotos. Die drei Aufnahmen von früher, das von Robert zuoberst; falls ich während des Flugs etwas aus dem Rucksack holen will und dabei auf die Fotos stoße. Dann sehe ich lieber zuerst Robert, auch wenn er mich jetzt, da er tot ist, nicht mehr so wie all die Jahre beschützen kann. Zuerst das Foto von Robert, dann die von ihm. In dem Rucksack, in dem die Fotos sind, stecken auch die Unterlagen des Garlic Institute, der amerikanischen Eliteschule, für die ich arbeite. Dank Robert habe ich dort bald nach meiner Flucht eine Anstellung als Spanischlehrerin gefunden. Und im Auftrag des Garlic Institute reise ich jetzt ohne Zwischenlandung und in der Businessclass zu einer anderen Schule, zum St. Peter’s College.
Und in meine Vergangenheit.
Ich verstaue den Rucksack mit den Unterlagen des Garlic Institute und den vier Fotos in der Gepäckablage über den Sitzen. Es gibt ausreichend Platz, als Reisender der Businessclass braucht man seine Taschen nicht auf Kosten anderer in zu kleine Fächer zu quetschen. Dafür bezahlt man. Ich hole ein paar Sachen aus der Aktentasche, bevor ich sie unter den Vordersitz schiebe. Das Buch, das ich gerade lese, das zum Logbuch umfunktionierte Notizbuch, einen Stift, ein Päckchen Taschentücher, das alles stecke ich in die Tasche vor mir zu den Zeitschriften und Sicherheitshinweisen der Fluglinie. Ich bin unentschlossen, ob ich gleich eine Tablette nehmen soll, mit der ich mindestens sechs Stunden schlafen werde, oder ob ich den Start abwarten, zum Abendessen Wein trinken und mich darauf verlassen soll, dass der Alkohol mich müde macht. Seit Robert nicht mehr lebt, trinke ich kaum noch Alkohol, ein Glas Wein wird da seine Wirkung nicht verfehlen. Oder auch zwei Gläser, oder drei, in der Businessclass ist der Passagier König. Ich lehne den Begrüßungssekt, den die Stewardess mir anbietet, dankend ab, die Kohlensäure kribbelt in der Nase, und ich bekomme Kopfschmerzen davon.
Gleich werden wir starten. Es sind nur noch wenige Sitze frei. Auch der neben mir. Wenn ich Glück habe, bleibt er frei. Womit ich noch lange kein Glückspilz wäre, anders als meine Mutter immer behauptet hat. Ich habe überhaupt nicht viel Glück. Dass ich vor zwanzig Jahren Robert getroffen habe, war eher eine Ausnahme. Eigentlich war es auch weniger Glück als eine letzte Chance, die das Schicksal mir zugespielt hat, es ging um Leben oder Tod. Anders gesagt, dass ich Robert kennenlernte, war einfach ein glücklicher Zufall. So wie jetzt: Eine Frau mit einem Baby steigt ein – und geht an mir vorbei. Danach ein Mann. Und noch einer. Dann aber führt die Stewardess eine ältere Dame zu dem Platz neben mir. Die Frau wirkt unbeholfen. Sie entschuldigt sich mehrmals, bevor sie sich an mir vorbeizwängt und ihren Platz am Fenster einnimmt. Als wäre sie an irgendetwas schuld. Dann erzählt sie mir, dass sie zum vierten Mal mit dem Flugzeug reist und zum ersten Mal in der Businessclass. Man habe sie in die Businessclass gesetzt, weil in der Touristenklasse kein Platz mehr frei gewesen sei, ihr Sohn habe für sie die Reise gebucht, damit sie ihren Enkel kennenlernen könne. Zur Hochzeit sei sie auch hingereist, allein, hin und zurück. Ihre Familie, erklärt sie, bestehe aus ihm und ihr, niemandem sonst. »Und jetzt noch mein Enkel.« Über eine Schwiegertochter fällt kein Wort. Beim Hinflug sei alles problemlos gewesen, aber heute hätte man sie fast nicht mitgenommen, erzählt sie, ohne in irgendeiner Weise verstimmt zu sein, als würde sie von einer Laune des Schicksals sprechen, gegen die aufzubegehren sie nicht das Recht hätte. Sie hätten sie auf die Warteliste gesetzt, zum Gate geschickt und gesagt, man werde sie – wenn alles gut gehe – aufrufen, bevor das Boarding beginne, und am Ende hätten die Angestellten der Fluglinie ihr dann einen Platz in der Businessclass gegeben. »Wir machen Ihnen ein Upgrade.« So hat man vermutlich zu ihr gesagt, sie bekommt den Wortlaut nicht mehr zusammen und schließt auf der Suche nach dem Ausdruck ein wenig die Augen – genau wie meine Mutter. »Irgend so ein englisches Wort.« Bestimmt haben sie Upgrade gesagt, aber ich will sie nicht belehren und mich über diese Frau stellen, die, anstatt sich über das Upgrade zu freuen, offensichtlich das Gefühl hat, am falschen Platz zu sein – die vielen Knöpfe, mit denen sie nichts anfangen kann, und dann fragt die Stewardess sie schon wieder, ob sie nicht doch einen Sekt möchte. In der Touristenklasse hätte sie sich bestimmt wohler gefühlt, dort wäre sie eine unter vielen gewesen, niemand hätte sich um sie gekümmert und ihr ständig etwas angeboten. Die Frau hätte lieber in der Touristenklasse gesessen, auch wenn sie dort nicht die Beine hätte ausstrecken können und mit geschwollenen Knöcheln an ihrem Reiseziel angekommen wäre, auch wenn das Essen dort nicht so gut gewesen wäre, auch wenn ein hinter ihr sitzendes Kind gegen die Rückenlehne getrampelt hätte oder ihr Kopfhörer als einziger im ganzen Flugzeug defekt gewesen wäre. Solche Lästigkeiten sind ihr vertraut, damit kann sie umgehen, letztlich machen sie ihr nichts aus. Lästig sind ihr dagegen all die unbekannten Dinge, mit denen sie es hier zu tun bekommt.
Manchmal kann ein Upgrade einen also geradezu belasten. So war es auch für mich, als ich zu Mariano nach Temperley zog. Ich hatte mein Leben lang in einer Dreizimmerwohnung in Caballito gewohnt. Dort gab es ein kleines Wohn-Ess-Zimmer, mein Zimmer und das Zimmer meiner Eltern. Und einen kleinen Balkon, auf dem meine Mutter Pflanzen hatte, die jedoch ständig vertrockneten, weil sie das Gießen vergaß. So saß mein Vater eben zwischen verdorrten Pflanzen und las, während ich die Morgensonne genoss. Als meine Eltern starben, fiel die Mietwohnung an ihre Besitzer zurück. Ich wohnte gern in der Stadt, hier hatte man alles, was man brauchte, in der Nähe und viele öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung. Aber Mariano hatte von Geburt an in Temperley gelebt, im Haus seiner Großeltern, das später das Haus seiner Eltern wurde, ein Landhaus im englischen Stil mit Garten und einem kleinen Swimmingpool, der auf einer Seite von der mit einer Kletterrose bewachsenen Gartenmauer begrenzt wurde. Von dem Haus waren es bloß fünf Minuten bis zur Klinik seines Vaters, deren Geschäftsführer er war – und vielleicht noch immer ist. Als wir nach unserer Heirat zusammenziehen wollten, wollte Mariano unbedingt ein Haus, das genauso schön war wie das seiner Eltern und von dem er es genauso nah zur Arbeit hatte. Und er fand eines. Eines Tages führte er mich hin, um es mir zu zeigen. Weil es eine Überraschung sein sollte, nahm er mein Halstuch und verband mir damit die Augen. »Willst du Blindekuh mit mir spielen?«, fragte ich. Aber er ließ mich ins Auto steigen, fuhr um ein paar Straßenecken und hielt an. Da wollte ich mir die Augenbinde abnehmen, doch er wollte sich die Überraschung nicht nehmen lassen. Also half er mir beim Aussteigen, führte mich ein paar Schritte am Arm und ließ mich dann stehen. Ich hörte, wie er mit einem Schlüssel ein Tor aufschloss. Wir gingen weiter, es schien ein gepflasterter Weg zu sein. Irgendwann machten wir halt. Endlich knotete er das Tuch auf.
Ich öffnete die Augen, vor mir stand genau so ein Haus wie das seiner Eltern, nur viel größer, in besserem Zustand, mit einem gepflegteren Garten und mehr Bäumen; und genau so eine Kletterrose wie an der Gartenmauer seiner Eltern – nur üppiger – wuchs zwischen zwei Fenstern an der Fassade hoch. »Es gehört uns«, sagte er. Mich befielen Freude und Beklemmung zugleich. Als würde das Haus – das auch meines sein würde – im nächsten Augenblick auf mich stürzen und mich unter seinem Schutt begraben. Mariano stellte mich vor vollendete Tatsachen. Er hatte ausgesucht, was er für uns beide für richtig befunden hatte, er hatte für uns entschieden. Das heißt, eigentlich für sich. Trotzdem empfand ich es zunächst wie ein unverdientes Geschenk und war ihm dankbar dafür.
»Er liebt dich wirklich«, sagte meine Mutter, »du bist ein Glückspilz, du weißt ja gar nicht, wie glücklich du dich schätzen kannst, dass du ein eigenes Haus hast und nicht auf ewig zur Miete wohnen musst.«
Mein Vater sagte nichts. Damals schob ich mein Unbehagen darauf, dass es mir ganz allgemein schwerfiel, von anderen etwas anzunehmen und überhaupt Dinge zu genießen. Dinge wie dieses Haus, in dem Mariano und ich unsere Liebe leben und glücklich sein und eine Familie gründen würden. Eben das, wovon alle Mädchen träumten. Nur ich nicht. Wovon ich träumte, wusste ich nicht. Stattdessen übernahm ich einfach die Träume der anderen. Ganz verkehrt konnte das nicht sein, und was wollte ich schließlich auch sonst vom Leben?
»Du bist ein Glückspilz«, sagte meine Mutter erneut.
Um nicht widersprechen zu müssen, stimmte ich ihr zu. Und ein wenig Glück habe ich ja auch wirklich. Zum Beispiel hatte ich gerade Glück, dass die Frau mit dem Baby an mir vorbeigegangen ist.
Bevor das Flugzeug abhebt, suche ich noch schnell auf Google Maps die Adresse unseres damaligen Hauses. Ich will herausfinden, wie weit es von der Wohnung entfernt ist, in der man mich für die Zeit meines Aufenthalts im St. Peter’s untergebracht hat. »In der Nähe des Bahnhofs«, steht in der E-Mail, in der man mir Fotos der Wohnung und die genaue Adresse geschickt hat. Als wäre das ein Vorteil. Ich sehe die Stewardess schon den Gang entlangkommen, gleich wird sie mich auffordern, das Handy auszuschalten, trotzdem fahre ich noch rasch mit dem Finger die Routen nach, wie ich von der Wohnung zur Schule gehen kann, ohne an dem Haus vorbeizukommen, in dem wir zehn Jahre zusammengewohnt haben. Die besten und schlimmsten zehn Jahre meines Lebens. Man kann das Haus tatsächlich umgehen, wenn man den richtigen Weg nimmt.
Die Stewardess bleibt neben mir stehen, und ich schalte das Handy aus. Gleich wird das Flugzeug starten. Die alte Frau neben mir, die mit dem Upgrade, umklammert das Kreuz an ihrer Halskette, mit der anderen Hand hält sie, ohne mich um Erlaubnis gefragt zu haben, meinen Arm fest; sie hat die Augen geschlossen und betet.
Auch ich mache die Augen zu. Und denke nicht an Mariano und nicht an das Haus und nicht an Robert. Ich denke an ihn und daran, welche Wege er wohl geht, Tag für Tag.
Die Schranke war unten. Sie bremste, vor ihnen standen schon zwei Autos. Die Signalglocke unterbrach die Nachmittagsstille. Ein rotes Licht blinkte über dem Schild »Bahnübergang«. Die heruntergelassene Schranke, das Bimmeln und das rote Licht kündigten einen Zug an. Es musste ein Zug kommen. Aber es kam kein Zug. Zwei, fünf, acht Minuten, kein Zug weit und breit. Das erste Auto umkurvte die Schranke und fuhr rüber. Das zweite Auto rückte auf. Sie wartete ab, schloss nicht auf. Stattdessen fragte sie sich, warum der Fahrer nicht rüberfuhr, so wie der vor ihm. Und sie hatte sich die Frage noch nicht zu Ende gestellt, da setzte sich das Auto in Bewegung, fuhr ein Stück vor, halb an der Schranke vorbei, und blieb wieder stehen. Ohne Genaueres sehen zu können, nahm sie an, dass der Fahrer zur einen Seite blickte und zur anderen, um sich zu vergewissern, dass weit und breit kein Zug kam.
Der Pilot kündigt den Landeanflug an, die Kabinenbeleuchtung wird eingeschaltet, und die Stewardessen vergewissern sich, dass alles an seinem Platz ist, die Rückenlehnen aufrecht, die Tische hochgeklappt. Ich höre, wie das Fahrwerk herausgelassen wird, gleich werden unter den Flügeln die Räder erscheinen und eingefahren werden. Von meinem Platz aus kann ich sie nicht sehen, aber ich suche mit den Augen die Stewardess, und ihre Ruhe bestätigt mir, dass die Räder da sind. Ich verfolge diesen Vorgang jedes Mal sehr aufmerksam, seit Robert mir in einer Fernsehserie von Steven Spielberg eine Szene gezeigt hat, in der ein Kampfjet nicht landen kann, weil er ein Rad verloren hat. In dieser lebensbedrohlichen Lage zeichnet ein Besatzungsmitglied das fehlende Rad einfach, und sie sind gerettet. Den echten Schauspielern – Kevin Costner ist der Pilot – kommt in dieser Szene die magische Hand der Animation zu Hilfe, die das rettende Rad herbeizaubert. Als könnte man mit einer Zeichnung die Realität verändern.
Das Flugzeug rumpelt über die Landebahn. Die Passagiere klatschen. Warum eigentlich? Bei keinem meiner Flüge in den letzten Jahren haben die Passagiere geklatscht. Der Pilot bremst, das Flugzeug kommt zum Stehen. Ich bin wieder in Argentinien. Nach zwanzig Jahren. Noch befindet sich zwischen meinen Füßen und dem Boden, auf den ich zurückgekehrt bin, ein Abstand, noch stehen meine Füße nur auf dem Boden des Flugzeugs. Wann genau kehrt man zurück? Wann betritt man heimischen Boden? Wann kann man sagen, man ist angekommen?
Ich habe es eilig aufzustehen, wenn auch nicht so eilig wie andere, die schon vor dem Erlöschen des Anschnallzeichens aufgestanden sind. Ich hole meinen Rucksack aus der Gepäckablage und biete der Frau neben mir meine Hilfe an. Die zeigt sich zunächst erfreut, sagt dann aber etwas verschämt, dass sie lieber sitzen bleibt, bis alle ausgestiegen sind. Dass die Passagiere der Business-Klasse immer zuerst aussteigen, scheint sie nicht zu wissen, oder es ist ihr egal. Vielleicht denkt sie auch, ich wäre sehr in Eile, und möchte mich nicht aufhalten. Eile, das habe ich mir seit Langem abgewöhnt. Wozu soll ich es noch eilig haben? Mit welchem Ziel? Es ist eher umgekehrt, seit ich damals geflohen bin, kann nichts und niemand mehr mich drängen. Robert fand sich bald damit ab, dass es mir einerlei war, wie lange sich ein Gespräch hinzog oder ob man auf jemanden warten musste. Slow down, das war auch seine Maxime. Bevor ich aussteige, sehe ich noch einmal zu der Frau. Sie weicht meinem Blick aus. Ich glaube, am liebsten würde sie so lange sitzen bleiben, bis niemand mehr da ist. Oder überhaupt sitzen bleiben und mit demselben Flugzeug wieder zu ihrem Sohn zurückfliegen. Aber das geht nicht. Manche Dinge lassen sich nun mal nicht rückgängig machen, ganz egal, wie man sich dazu verhält, ungeschehen machen kann man sie nicht.
Ich verabschiede mich von der Crew und steige aus, gehe durch den Rüssel, stelle mich am Einreiseschalter an, zeige meinen Ausweis vor, meinen Daumen, mein Gesicht für das Foto, dann stelle ich mich ans Gepäckband und warte auf meinen Koffer. Alles mit einer Getriebenheit, die ich an mir nicht kenne. Vielleicht wäre ich – wie die alte Frau – am liebsten im Flugzeug sitzen geblieben, damit es mich dorthin zurückbringt, wo ich herkomme, doch weil ich weiß, dass das nicht geht, habe ich beschlossen, alles schnellstmöglich hinter mich zu bringen, um nach dieser Prüfung in mein jetziges Leben zurückzukehren. In das Leben, das ich mir nach meiner Flucht in Boston aufgebaut habe. Der Abgrund, der einen anzieht und zugleich abstößt. Wie wenn wir früher, als Kinder, Fangen spielten – kaum hatten wir jemanden erwischt, stürmten wir kreischend in die entgegengesetzte Richtung davon. Ich betrete argentinischen Boden und will gleichzeitig wieder weg. So schnell wie möglich, am liebsten sofort. Obwohl das Spiel noch gar nicht begonnen hat, weil ich noch immer nicht richtig in Argentinien bin. So kommt es mir jedenfalls vor – weder als ich durch den Rüssel ging, noch als ich am Einreiseschalter anstand, hatte ich das Gefühl, wirklich hier zu sein, und so ist es auch jetzt noch, als ich mich im Terminal unter die Leute mische. Kann ein so steriler und unpersönlicher Ort wie ein Flughafen heimischer Boden sein? Was unterscheidet den Boden im Flughafen Ezeiza in Buenos Aires von dem im Flughafen Logan in Boston oder dem im JFK-Airport in New York? Alle sind mit ähnlichen Fliesen ausgelegt, nüchtern, austauschbar.
Ich bringe mich am Gepäckband in Position, damit ich meinen Koffer gleich in Empfang nehmen kann. Von Weitem sehe ich die Frau, die neben mir gesessen hat. Sie scheint Ausschau nach mir zu halten. Eindeutig. Endlich hat sie mich entdeckt und kommt näher. Einen Meter von mir entfernt bleibt sie stehen. Sie sucht nicht das Gespräch mit mir. Sie will nur in meiner Nähe sein. Die Gewissheit haben, dass, wenn ich an diesem Gepäckband stehe, auch ihr Koffer hier ankommen wird. So braucht sie niemanden mehr zu fragen. Offensichtlich fühlt sie sich in meiner Nähe sicher. Das rührt mich, und gleichzeitig erschreckt es mich. Jemanden umsorgen, streicheln, ins Bett bringen, aufmerksam sein für alles, was er braucht, das war für mich einst selbstverständlich. Doch dazu lasse ich es schon lange nicht mehr kommen. Noch nicht einmal ein Haustier kommt seitdem für mich infrage – Robert hätte so gern einen Hund gehabt. Und all das nur, um nie wieder Verantwortung für ein Lebewesen übernehmen zu müssen. Robert war in dem Sinn nicht von mir abhängig, im Gegenteil, er sorgte für mich, er half mir, in den Schlaf zu finden, kümmerte sich darum, dass es mir gut ging. Und er gefiel sich in der Rolle. Das Einzige, was ich ihm dafür geben konnte, war, dass ich seine Zuwendung annahm. Aber vielleicht war das schon viel für die Frau, der Robert Jahre davor auf einem Flughafen vom Boden aufgeholfen hatte. Darum ist es auch für mich so merkwürdig, auf einmal zu spüren, dass jemand – jetzt, hier, auf diesem Flughafen – Schutz bei mir sucht. Es erschreckt mich, vor allem aber gefällt es mir, als würde diese zarte Regung auf einmal aus einem langen Schlaf erwachen. Ein wiedererwachtes Gefühl: dass man einander braucht, einander unverzichtbar ist. Ein Gefühl aus einer früheren Zeit, das ich so lange nicht an mich herangelassen habe, und doch ist es mir wohlvertraut. Nachdem ich weggegangen war, musste ich lernen zu akzeptieren, dass er irgendwann nicht mehr von mir abhängig sein würde. Er würde sein Leben leben, so wie ich meines, denn irgendwann würde er begreifen, dass ich nicht mehr zurückkehren würde. Sein Schmerz, den ich nur ahne, nicht kenne, belastet mich bis heute mehr als mein eigener. Mein eigener steigt hin und wieder auf, aber er ist sanfter geworden; erst wenn ich mir seinen Schmerz in den Sinn rufe, erinnere ich mich wieder, wie stark meiner anfangs war.