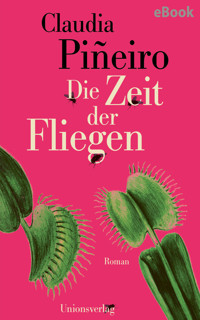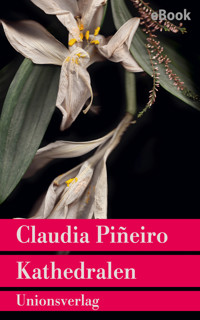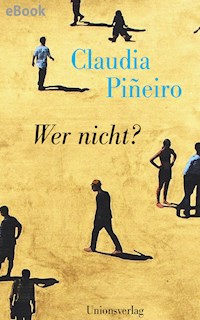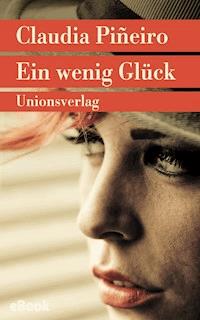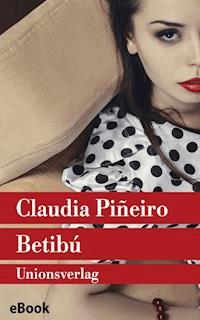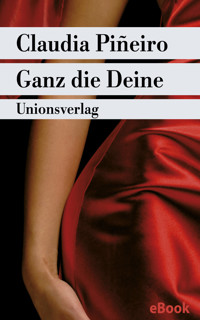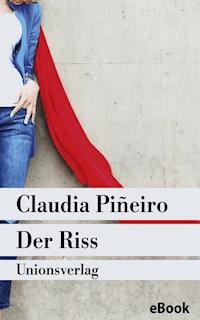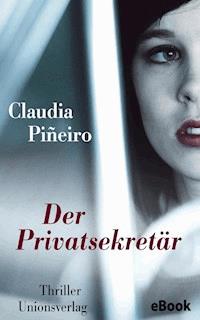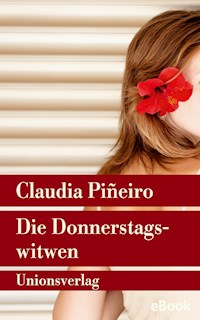
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vor den Stadttoren von Buenos Aires lebt hinter hohen Sicherheitszäunen eine wohlhabende Gemeinschaft. Unter der Oberfläche jedoch schwelen Konflikte, die auch vor den Siedlungszäunen nicht haltmachen: Untreue, Alkoholsucht und Ehezwist. Zudem bekommt selbst die privilegierte Gated Community die Wirtschaftskrise mit aller Wucht zu spüren. Anstatt die Ärmel hochzukrempeln, gehen drei Familienväter einen eigenwilligen Weg, um ihren Lieben den hohen Lebensstandard zu sichern. Dann werden ihre Leichen am Grund des Swimmingpools gefunden. Die Donnerstagswitwen ist das Porträt einer Gemeinschaft, die über ihre Verhältnisse lebt und tödliche Geheimnisse zu verbergen hat. Der preisgekrönte Bestseller ist bereits in vierzehn Sprachen erschienen und wurde von Marcelo Piñeyro fürs Kino verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Drei Familienväter gehen einen eigenwilligen Weg, um ihren Lieben den hohen Lebensstandard zu sichern. Dann werden ihre Leichen am Grund des Swimmingpools gefunden … Das Porträt einer Gemeinschaft, die über ihre Verhältnisse lebt und tödliche Geheimnisse zu verbergen hat.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Claudia Piñeiro (*1960) ist der Shootingstar der argentinischen Literatur. Nach dem Wirtschaftsstudium arbeitete sie als Journalistin, schrieb Theaterstücke und führte Regie fürs Fernsehen. 2005 erhielt sie den Premio Clarín; 2010 wurde sie mit dem LiBeraturpreis ausgezeichnet.
Zur Webseite von Claudia Piñeiro.
Peter Kultzen (*1962) studierte Romanistik und Germanistik in München, Salamanca, Madrid und Berlin. Er lebt als freier Lektor und Übersetzer spanisch- und portugiesischsprachiger Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Peter Kultzen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Claudia Piñeiro
Die Donnerstagswitwen
Roman
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel Las viudas de los jueves bei Alfaguara Argentina, Buenos Aires.
Dieses Werk wurde im Rahmen des »Sur«-Programms des Außenministeriums der Republik Argentinien zur Förderung von Übersetzungen verlegt.
Originaltitel: Las viudas de los jueves (Buenos Aires, 2005)
© by Claudia Piñeiro 2005
Vermittelt durch die Literarische Agentur Mertin, Inh. Nicole Witt
© by Unionsverlag, Zürich 2021
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: alexey_ds (istockphoto.com)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30271-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 22.06.2021, 18:51h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE DONNERSTAGSWITWEN
1 – Ich machte den Kühlschrank auf und starrte eine …
2 – Virginia sagte immer, das Haus der Scaglias sei …
3 – Altos de la Cascada heißt die Siedlung …
4 – Wir sind Ende der Achtzigerjahre nach La Cascada …
5 – Ich erinnere mich noch, als wäre es heute …
6 – Das Auto hielt an der Schranke. Ernesto ließ …
7 – Einige Monate nachdem die Scaglias eingezogen waren …
8 – Die ersten Jahre in La Cascada verbrachte Virginia …
9 – Romina war schon unterwegs zur Schule. Sie wurde …
10 – Eines schönen Sommertages bot der Spielplatz von Altos …
11 – Romina und Juani lernen sich auf dem Spielplatz …
12 – Am Ausgang von Loch eins stehen und den …
13 – Als ich zum ersten Mal aufgefordert wurde …
14 – Carmen Insúa trug die Namen in die Spielerliste …
15 – 1998 war das Jahr der vielen seltsamen Selbstmorde …
16 – Als es schon niemand mehr für möglich gehalten …
17 – Es war schon elf Uhr, aber Carmen lag …
18 – Vor dem Aufschlag hob Tano den Blick …
19 – Die Urovichs entstammen einer der Gründerfamilien von Altos …
20 – Hundertmal rufen sie, sie solle zum Essen kommen …
21 – Kurz nach ihrem Umzug nach Altos de la …
22 – Jedes Jahr am 8. Dezember – dem Tag …
23 – Er stellte die letzte Kiste voller Unterlagen in …
24 – Im Herbst wird das Bermudagras gelb. Es vertrocknet …
25 – Eines Abends kommen Romina und Juani zum Spielplatz …
26 – Sie fuhren mit zwei Autos. Lala hatte vorgeschlagen …
27 – Der Tag, an dem Carla Masotta in mein …
28 – Schließlich trennten sich die Insúas. Carmen Insúa war …
29 – »Ich nehm keine Drogen, was redest du da …
30 – Tano sah seine E-Mails durch. Eine Einladung zu …
31 – Die erste formelle Einladung der Llambías an die …
32 – Romina weiß nicht, was Ernesto beruflich macht …
33 – Das Thema der streunenden, herrenlosen Hunde kam Anfang …
34 – Wie jeden Samstag stand Gustavo um halb zehn …
35 – Mavi und Ronie werden vor den Disziplinarausschuss bestellt …
36 – Eines Donnerstags – an einem der Donnerstage …
37 – Romina fühlt sich in La Cascada fremd …
38 – Nacheinander brachten sie auf dem Weg zu Loch …
39 – Ernesto möchte, dass Romina Jura studiert. Gleich nächstes …
40 – Mitte 2001 verkündeten die Urovichs offiziell, dass sie …
41 – Lala sah sich im Zimmer um. Da waren …
42 – Seit dem letzten Treffen mit Alfredo Insúa und …
43 – Nach seinem Sturz auf der Treppe musste Ronie …
44 – Als Ronie aus dem Krankenhaus entlassen wurde …
45 – Es war ein sonniger Tag. Der Frühling zeigte …
46 – Wir kamen gegen Mittag nach Hause. Juani war …
47 – Eine Woche nach der Beerdigung bestellen Ronie und …
48 – Ich sah meinen Mann und meinen Sohn an …
Mehr über dieses Buch
Claudia Piñeiro: »Der Mörder ist noch unter uns«
Über Claudia Piñeiro
Claudia Piñeiro: Lesen als Revanche
Claudia Piñeiro: »Frauen und Männer lesen unterschiedlich«
Über Peter Kultzen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Claudia Piñeiro
Zum Thema Argentinien
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Für Gabriel und meine Kinder
»Wir schreiben jene idyllische Periode, als die breite Masse der amerikanischen Mittelklasse noch die Blindenschule besuchte.«
Tennessee Williams, »Die Glasmenagerie«
»Ohne Personal gibt es keine Tragödie, höchstens ein schäbiges bürgerliches Trauerspiel. Während du deine eigene Tasse abwäschst und die Aschenbecher auskippst, verlieren die Leidenschaften an Kraft.«
Manuel Puig, »Unter einem Sternenzelt«
1
Ich machte den Kühlschrank auf und starrte eine Weile geistesabwesend vor mich hin, die Hand auf dem Türgriff, vor dem kalten Licht, das die Fächer beleuchtete. Bis das Warnsignal ertönte, das darauf hinweist, dass zu viel Kälte entweicht, wenn die Türe zu lange offen ist – da fiel mir wieder ein, weshalb ich zum Kühlschrank gegangen war. Ich suchte nach etwas zu essen. Ich gab ein paar Reste vom Vortag auf einen Teller, erwärmte das Ganze in der Mikrowelle und trug den Teller anschließend zum Tisch. Eine Tischdecke legte ich nicht auf, nur einen von den Untersetzern, die ich vor ein paar Jahren aus Brasilien mitgebracht hatte, als wir drei zum letzten Mal zusammen Urlaub gemacht hatten. Die ganze Familie. Ich setzte mich ans Fenster, normalerweise war das nicht mein Platz bei Tisch, aber wenn ich allein war, sah ich beim Essen gern in den Garten hinaus. Ronie aß an diesem Abend – an dem Abend, um den es hier geht – bei Tano Scaglia. Wie jeden Donnerstag. Auch wenn dies kein gewöhnlicher Donnerstag war. Ein Donnerstag im September 2001. Der 27. September 2001. Ebendieser Donnerstag. Wir waren immer noch ganz eingeschüchtert vom Anschlag auf die Twin Towers und öffneten alle Briefe nur mit Gummihandschuhen aus Angst vor diesem weißen Pulver. Juani war weggegangen. Wohin und mit wem, hatte ich nicht gefragt. Juani mochte es nicht, wenn ich ihn so was fragte. Ich wusste es aber sowieso. Wenigstens bildete ich mir das ein.
Ich benutzte so wenig Geschirr wie möglich. Schon seit ein paar Jahren hatte ich mich damit abgefunden, dass wir uns keine Vollzeithaushaltshilfe mehr leisten konnten, inzwischen kam bloß noch zweimal pro Woche eine Frau, die die gröbsten Arbeiten erledigte. Seither benutzte ich also kaum noch Geschirr, wie ich mir auch angewöhnt hatte, meine Kleidung möglichst nicht zu zerknittern und nur selten das Bett neu zu beziehen. Nicht, weil ich die damit verbundene Arbeit als anstrengend empfunden hätte, aber wenn ich Geschirr spülte, Betten machte oder bügelte, musste ich daran denken, was ich früher gehabt hatte, jetzt aber nicht mehr hatte.
Ich wollte rausgehen, ein bisschen an die frische Luft, aber ich hatte Angst, Juani zu begegnen, der dann wieder denken würde, ich spionierte ihm nach. Es war heiß, eine helle, sternklare Nacht. Ich hatte keine Lust, mich hinzulegen, um mich dann schlaflos im Bett hin und her zu wälzen und mir den Kopf wegen irgendwelcher Immobiliengeschäfte zu zerbrechen, die einfach nicht zustande kommen wollten. Alles, was ich an Abschlüssen in die Wege leitete, schien damals unweigerlich zu platzen, bevor ich meine Provision kassieren konnte. Die neueste Wirtschaftskrise dauerte jetzt schon mehrere Monate, manche schafften es besser, so zu tun, als beträfe es sie nicht, aber letztlich hatte sich das Leben für alle auf die eine oder andere Weise verändert. Oder es würde sich noch verändern. Auf der Suche nach einer Zigarette ging ich in mein Zimmer, Juani hin oder her, ich wollte jetzt einfach rausgehen, und beim Spazierengehen rauche ich nun mal gerne. Als ich am Zimmer unseres Sohnes vorbeikam, wäre ich fast hineingegangen – vielleicht fand ich ja dort eine Zigarette. Aber ich wusste, dass das nicht stimmte, es wäre nur ein Vorwand gewesen, um mich ein wenig umzusehen, und das hatte ich schon am Morgen getan, als ich sein Bett gemacht und aufgeräumt hatte – da hatte ich auch nicht gefunden, wonach ich gesucht hatte. Ich ging also weiter, auf meinem Nachttisch lag eine unangebrochene Schachtel, ich machte sie auf, nahm eine Zigarette heraus, zündete sie an und ging die Treppe hinunter zur Haustür. Da kam Ronie herein, und ich gab mein Vorhaben auf. In dieser Nacht kam alles anders. Ronie steuerte geradewegs die Bar an. »Na, so was, so früh …«, sagte ich, am Fuß der Treppe stehend. »Ja«, sagte er und ging mit einem Glas und der Whiskyflasche die Treppe hinauf. Ich blieb noch einen Moment stehen, dann folgte ich ihm. In unserem Schlafzimmer war er nicht. Im Bad auch nicht. Er war draußen auf der Dachterrasse, wo er sich zum Trinken auf einem Liegestuhl niedergelassen hatte. Ich holte mir einen Stuhl, setzte mich neben ihn und wartete; dabei sah ich in dieselbe Richtung wie er und sagte kein Wort. Ich hoffte, er werde mir etwas erzählen. Egal was, es brauchte nicht lustig zu sein, ja, es brauchte nicht einmal allzu viel Sinn zu ergeben, er sollte bloß etwas sagen, er sollte bei dem minimalen Wortaustausch, in den sich unsere Gespräche im Lauf der Zeit verwandelt hatten, einfach nur seinen Part übernehmen. So wollte es unsere unausgesprochene Übereinkunft: eine Handvoll vorgefertigter Sätze, die sich aneinanderreihten, Wörter, die das Schweigen ausfüllten, damit keiner von uns etwas über dieses Schweigen zu sagen brauchte. Leere Wörter, Worthülsen. Wenn ich mich darüber beklagte, erwiderte Ronie jedes Mal, wir sprächen deshalb so wenig, weil wir so viel Zeit zusammen verbrächten, was solle es schon zu erzählen geben, wenn man den größten Teil des Tages beieinanderhocke. So war es tatsächlich, seit Ronie vor sechs Jahren seinen Job verloren hatte. Und bis auf ein paar Projekte, aus denen dann zuletzt doch nie etwas geworden war, hatte er auch keine andere Arbeit mehr gefunden. Die Erkenntnis, dass wir uns so wenig zu sagen hatten, bedrückte mich weniger, als festzustellen, dass ich das erst merkte, als sich das Schweigen bereits bei uns zu Hause festgesetzt hatte – wie ein entfernter Verwandter, der sich irgendwann eingeschlichen hat und den man daraufhin unmöglich einfach weiterschicken kann. Auch musste ich feststellen, dass ich keinerlei Schmerz dabei empfand – vielleicht, weil der Schmerz sich ebenso unbemerkt festgesetzt hatte wie das Schweigen. »Ich hole mir ein Glas«, sagte ich. »Bring Eis mit, Virginia«, rief Ronie mir hinterher.
Ich ging in die Küche. Während ich den Eiskübel füllte, überlegte ich, was der Grund für Ronies frühe Rückkehr sein könnte. Am wahrscheinlichsten schien mir, dass er mit jemandem in Streit geraten war. Bestimmt mit Tano oder mit Gustavo. Mit Martín Urovich nicht. Martín stritt schon lange mit niemandem mehr, nicht einmal mit sich selbst. Als ich wieder auf die Terrasse kam, fragte ich Ronie rundheraus danach, ich wollte es nicht erst am nächsten Tag beim Tennisspielen erzählt bekommen, von der Frau von jemand anderem. Seit Ronie arbeitslos war, war er voll versteckter Ressentiments, die im unpassendsten Moment an die Oberfläche kamen. Schon seit Längerem war bei meinem Mann kein Verlass mehr auf den Mechanismus, der verhindert, dass man in Gesellschaft anderer Menschen Dinge sagt, die man besser nicht sagen würde. »Nein, ich habe mit niemandem gestritten.« – »Und warum bist du dann so früh zurück? Donnerstags kommst du doch sonst nie vor drei Uhr heim.« – »Heute eben schon«, sagte er. Und das war alles, was er sagte, und auch mich ließ er nicht mehr zu Wort kommen: Er stand auf und schob den Liegestuhl näher ans Geländer, so, dass er mir fast den Rücken zukehrte. Aber nicht, um mich zu kränken, es war vielmehr, als suchte er nach dem besten Platz, um ein Schauspiel zu verfolgen. Unser Haus liegt dem der Scaglias schräg gegenüber, in einer Diagonalen, durch zwei oder vielleicht drei Häuser getrennt; aber da unser Haus höher ist – und trotz der Pappeln der Iturrias, die teilweise die Sicht verdecken –, konnte man von dort, wo wir waren, die Dächer, den Garten und fast den ganzen Swimmingpool überblicken. Ronie sah zum Pool. Die Lichter waren aus, und eigentlich war nicht viel zu erkennen. Die Formen schon, der Umriss des Beckens; man konnte auch erahnen, dass das Wasser sich bewegte und wechselnde Schatten auf die türkisblauen Kacheln warf.
Ich stand auf und stellte mich hinter Ronies Liegestuhl. Die nächtliche Stille wurde noch verstärkt durch die Pappeln der Iturrias, die sich ab und zu im warmen Wind bewegten, was sich anhörte, als regnete es inmitten der sternklaren Nacht. Ich wusste nicht, ob ich gehen oder bei Ronie bleiben sollte, jedenfalls hatte er, von seiner Teilnahmslosigkeit abgesehen, nicht zu erkennen gegeben, dass ich verschwinden sollte, was für unsere Verhältnisse eine ganze Menge war. Ich betrachtete ihn von hinten, über die Lehne hinweg. Er rutschte immer wieder nervös auf dem Stuhl hin und her, offensichtlich fand er die passende Stellung nicht. Später wurde mir klar, dass er nicht nervös war, sondern Angst hatte, aber das wusste ich damals nicht. Wie hätte ich auch darauf kommen sollen – Ronie hatte nie vor irgendetwas Angst. Nicht einmal vor dem, was mir Angst machte, vor der Angst, die vor ein paar Monaten zum ersten Mal aufgetaucht war und mir seither keine Ruhe ließ. Diese Angst war schuld daran, dass ich vor dem Kühlschrank stehen blieb und vergaß, was ich eigentlich wollte. Sie begleitete mich die ganze Zeit, auch wenn ich so tat, als wäre nichts, und lachte oder irgendwelches Zeug erzählte, Tennis spielte oder Dokumente unterschrieb. Diese Angst war es auch, die mich an diesem Abend – scheinbar gleichmütig und unbeeindruckt von der Distanz, die Ronie wieder einmal zwischen uns aufgebaut hatte – sagen ließ: »Juani ist weggegangen.« – »Mit wem?« – »Das habe ich nicht gefragt.« – »Wann kommt er wieder?« – »Weiß ich nicht. Er hatte die Rollerskates an.« Wieder wurde es still, dann sagte ich: »Auf dem Anrufbeantworter war eine Nachricht von Romina, sie hat gesagt, sie wartet auf ihn, wegen ihrer Runde. Ob Runde irgend so ein Geheimwort von den beiden ist?« – »Runde heißt Runde, Virginia.« – »Dann brauche ich mir also keine Sorgen zu machen?« – »Nein.« – »Dann ist er also bei ihr?« – »Er ist bestimmt bei ihr.« – »Ja, bestimmt ist er bei ihr.« Und wieder schwiegen wir.
Danach fielen, glaube ich, noch ein paar Worte, welche genau, weiß ich nicht mehr. Floskeln, die ein Teil unserer Abmachung waren. Ronie goss sich noch einen Whisky ein, ich hielt ihm das Eis hin. Er nahm sich eine Handvoll, und ein paar Eiswürfel fielen auf den Boden und glitten bis an den Rand der Terrasse. Ronie sah ihnen hinterher, einen Moment lang schien er das Haus gegenüber vergessen zu haben. Er sah zu den Eiswürfeln, und ich sah ihn an. Vielleicht hätten wir einfach so weitergemacht, abwechselnd hierhin, dann dahin gesehen, aber da gingen beim Swimmingpool der Scaglias die Lichter an, und durch den Pappelregen hindurch waren Stimmen zu hören. Tanos Lachen. Musik, eine Art trauriger, zeitgenössischer Jazz. »Diana Krall?«, fragte ich, aber Ronie antwortete nicht. Er wirkte wieder angespannt, stand auf, trat die Eiswürfel zur Seite, setzte sich hin, führte die geballten Fäuste zum Mund, biss die Zähne zusammen. Ich wusste, dass er mir etwas verschwieg, eben deshalb hielt er so krampfhaft den Mund geschlossen, es sollte bloß nichts hinausdringen. Es musste mit dem zu tun haben, was ihn die ganze Zeit beschäftigte. Irgendein Streit, Eifersucht, eine Beleidigung, die er nicht vergessen konnte. Eine als Witz getarnte Kränkung; darin ist Tano besonders gut, sagte ich mir. Ronie stand erneut auf und trat ans Geländer, um besser sehen zu können. Er trank sein Glas aus. Rechts und links von ihm waren Pappeln, er sah hinüber und verdeckte mir die Sicht. Dafür hörte ich, dass jemand ins Wasser sprang, das Geräusch konnte nur vom Pool der Scaglias stammen. »Wer war das?«, fragte ich. Keine Antwort. Wer auch immer da ins Wasser gesprungen war, mir war es jetzt egal. Gar nicht egal war mir dagegen dieses Schweigen, das mich jedes Mal auflaufen ließ wie eine Wand. Ich hatte genug von meinen nutzlosen Versuchen und ging nach unten. Böse war ich nicht, aber Ronie war offensichtlich ganz woanders, nicht bei mir, sondern dort drüben, auf der anderen Seite der Straße, bei seinen Freunden am Swimmingpool der Scaglias. Als ich die erste Treppenstufe betrat, verstummte die Jazzmusik, mittendrin brach sie ab.
Ich ging hinunter in die Küche und spülte das Glas ab, länger als nötig; dabei füllte sich mein Kopf bis zum Rand mit Gedanken, mehr, als eigentlich hineinpassten. Ich dachte an Juani, nicht an Ronie. Obwohl ich das gar nicht wollte, obwohl ich mich mit anderen Sachen ablenken wollte. So, wie manche Leute anfangen, Schäfchen zu zählen, wenn sie einschlafen wollen, führte ich mir diverse ausstehende Immobiliengeschäfte vor Augen, überlegte, wem ich am besten das Haus von den Gómez Pardos zeigen sollte, wie ich es hinbekäme, dass die Canettis einen Kredit erhielten, um den geplanten Kauf tätigen zu können, und erinnerte mich daran, dass ich vergessen hatte, mir von den Abrevayas die Kaution aushändigen zu lassen. Und dann dachte ich wieder an Juani, an Ronie nicht. Umso deutlicher und eindrücklicher sah ich Juani vor mir. Ich trocknete das Glas ab und stellte es ins Regal, nahm es aber gleich wieder heraus und füllte es mit Wasser – heute Nacht brauchte ich etwas zum Einschlafen. Etwas, was mich wie einen Stein ins Bett fallen ließ. Im Apothekerschränkchen musste es noch etwas Derartiges geben. Zum Glück kam ich nicht mehr dazu, etwas einzunehmen, denn in diesem Augenblick hörte ich hastige Schritte auf der Treppe und gleich darauf einen Schrei und ein trockenes hartes Aufschlagen auf den Holzboden. Ich stürzte aus der Küche und sah meinen Mann vor mir, mit einem offenen Bruch, aus einem Bein ragte ein blutverschmierter Knochen heraus. Mir wurde übel, um mich herum begann sich alles zu drehen, aber ich durfte die Kontrolle nicht verlieren, außer mir war niemand da, und ich musste mich um Ronie kümmern. Umso dankbarer war ich, dass ich nichts eingenommen hatte, denn ich musste die blutende Stelle abbinden, ich wusste aber gar nicht, wie man das macht, man wickelt irgendwas ganz fest drum herum, notfalls einen alten Lappen oder besser eine saubere Serviette, damit es aufhört zu bluten, und dann ruft man den Krankenwagen; nein, bis der kommt, dauert es viel zu lange, besser gleich ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Juani legte ich einen Zettel hin: »Papa und ich sind kurz weg, kommen gleich wieder. Wenn was ist, ruf mich auf dem Handy an. Alles o.k. Bei dir hoffentlich auch. Küsschen, Mama.«
Ronie schrie vor Schmerzen, während ich ihn zum Auto schleifte, und von dem Geschrei wurde ich wach. »Virginia, bring mich zu Tano«, rief er. Ich hörte nicht auf ihn, ich nahm an, er delirierte, weil es so wehtat; ich hievte ihn, so gut ich konnte, auf den Rücksitz. »Bring mich zu Tano, verdammt noch mal!«, schrie er, und dann wurde er ohnmächtig. Vor Schmerzen, meinten die im Krankenhaus später, aber das war es nicht, nein. Ich fuhr mit Vollgas, auf Teufel komm raus, egal, ob da eine Spielstraße war oder Lärmschutzschwellen. Ich hielt nicht einmal an, als ich beim Überqueren einer Kreuzung sah, dass Juani barfuß die Seitenstraße entlangrannte, Romina hinter ihm her. Als wären sie auf der Flucht, ständig sind die beiden vor irgendetwas auf der Flucht, musste ich denken. Und die Rollerskates lassen sie einfach liegen. Immer verliert Juani seine Sachen. Aber damit durfte ich mich jetzt nicht aufhalten. Nicht in dieser Nacht. Irgendwann wachte Ronie wieder auf. Immer noch benommen sah er zum Wagenfenster hinaus und versuchte zu erkennen, wo wir waren, was ihm aber offensichtlich nicht gelang. Immerhin schrie er nicht mehr. Zwei Querstraßen bevor wir La Cascada verließen, kam uns das Auto von Teresa Scaglia entgegen. »Ist das Teresa?«, fragte Ronie. »Ja.« Ronie fasste sich an den Kopf und fing an zu weinen, zuerst wimmerte er leise, dann aber brach er in lautes Schluchzen aus. Ich sah ihn im Rückspiegel an, verzweifelt krümmte er sich auf seinem Sitz zusammen. Ich versuchte, ihn mit Worten zu beruhigen, aber das war aussichtslos. Mit der Zeit gewöhnte ich mich an sein Gejammer. Genau wie an den Schmerz, der sich unmerklich eingeschlichen hatte, und die Unterhaltungen voll leerer Worte.
Als wir beim Krankenhaus ankamen, hörte ich sein Weinen schon gar nicht mehr. Dennoch weinte er. »Warum weinen Sie denn so?«, fragte der diensthabende Arzt. »Tut es dermaßen weh?« – »Ich habe Angst«, erwiderte Ronie.
2
Virginia sagte immer, das Haus der Scaglias sei zwar nicht das schönste von Altos de la Cascada, trotzdem sei es immer das erste, das ihren Kunden auffalle. Und wenn jemand eine Ahnung davon hatte, welches die attraktivsten Häuser in unserer Siedlung waren, dann sie – sie arbeitete als Immobilienmaklerin. Auf jeden Fall war Tano Scaglias Haus eins der größten Häuser hier, was natürlich schon etwas ausmachte. Viele von uns waren ein bisschen neidisch darauf, auch wenn keiner es zugeben wollte. Das Mauerwerk bestand aus Planziegeln, das Dach war mit schwarzem Schiefer gedeckt und ruhte auf weiß gestrichenen Balken. Das Haus hatte zwei Stockwerke, sechs Schlafzimmer, acht Bäder beziehungsweise Toiletten, abgesehen von dem Waschraum für die Bediensteten. Es war in zwei, drei Designzeitschriften vorgestellt worden, der Architekt, der es entworfen hatte, hatte gute Beziehungen. Im Obergeschoss gab es einen Filmvorführraum und neben der Küche ein großes Esszimmer mit Rattanmöbeln und einem eleganten Tisch aus Holz und auf Rost getrimmtem Edelstahl. Der Swimmingpool lag direkt vor dem Wohnzimmer. Saß man in den sandfarbenen Sesseln und sah durch das Fenster, das sich über die gesamte Fläche der Wand erstreckte, hatte man das Gefühl, an Deck eines Kreuzfahrtschiffes zu sitzen; außerdem setzte sich der Holzboden auf der anderen Seite des Fensters bis an den Beckenrand fort.
Im Garten hatte jeder Strauch seinen Platz, je nach Farbe, Höhe, Dichte und Beweglichkeit des Blattwerks. »Das ist sozusagen meine Visitenkarte«, sagte Teresa. Kurz nachdem sie nach La Cascada gezogen waren, hatte sie ihre grafologischen Forschungen beendet und eine Ausbildung in Gartenbau begonnen, und obwohl sie gar nicht zu arbeiten brauchte, schien sie ständig auf der Suche nach neuer Kundschaft, als ginge es für sie vor allem darum, andere von ihren Fähigkeiten zu überzeugen, und weniger um einen weiteren Garten, dessen Gestaltung sie übernehmen sollte. In ihrem eigenen Garten gab es weder welke noch kränkelnde Pflanzen, wie dort ohnehin nichts dem Zufall überlassen blieb; dass dort, wo der Wind die Samen hingetragen hatte, irgendetwas von selbst hervorspross, war nicht vorgesehen, und Schnecken oder Ameisen suchte man natürlich auch vergeblich. Der Rasen war ein makelloser, gleichmäßig tiefgrüner Teppich. Das Ende des Gartens wurde von einer Linie markiert, an der die Farbe des Rasens schlagartig wechselte: Jenseits davon befand sich der Golfplatz, genau genommen Loch siebzehn. Die Sicht vom Haus aus wurde auf der linken Seite von dem zu Loch siebzehn gehörenden Sandbunker und auf der rechten von einem kleinen künstlichen Teich abgerundet.
Teresa betrat das Haus direkt von der Garage aus. Einen Schlüssel brauchte sie nicht, bei uns in Altos de la Cascada schließt niemand sein Haus ab. Sie sagt, sie habe sich gewundert, dass nicht wie sonst das laute Lachen ihres Mannes und seiner Freunde zu hören war. Unserer Freunde. Vom Alkohol beflügeltes Lachen. Aber sie war froh, dass sie nicht hineinzugehen brauchte, um die Gäste zu begrüßen, sie hätte sowieso nur die altbekannten, immer gleichen Witze zu hören bekommen, was sie, müde, wie sie war, nur schwer ertragen hätte, sagte sie. Wie jeden Donnerstag hatten sich die Männer getroffen, um zusammen zu Abend zu essen und Karten zu spielen; die Frauen kamen derweil ihrer Verpflichtung nach, gemeinsam ins Kino zu gehen, so hatte es sich seit Langem eingespielt. Alle bis auf Virginia, die sich uns schon seit geraumer Zeit nicht mehr anschloss und dafür alle möglichen Ausreden anführte, die ihr niemand so richtig abnahm. Vielmehr sahen wir in ihren wirtschaftlichen Schwierigkeiten den wahren Grund dafür, dass sie nicht mitkam. Die Kinder der Scaglias waren an diesem Abend auch nicht zu Hause; Matías schlief bei den Floríns, und Sofía übernachtete bei den Großeltern mütterlicherseits, obwohl sie überhaupt keine Lust dazu gehabt hatte, aber ihr Vater hatte es so entschieden. Das Hausmädchen hatte Ausgang – Tano persönlich hatte verfügt, dass sie immer am Donnerstag ihren freien Abend nahm, damit er und seine Freunde ganz ungestört waren.
Als Teresa die Treppe ins obere Stockwerk hinaufstieg, fürchtete sie schon, die Männer könnten es wieder einmal mit dem Trinken übertrieben haben und würden nun ausgerechnet im Filmzimmer ihren Rausch ausschlafen. Aber da waren sie nicht, und auf dem Weg von dort bis zu ihrem Schlafzimmer konnten sie ihr nicht mehr in die Quere kommen, so viel war sicher. Das Haus wirkte ohnehin wie ausgestorben. Sorgen machte sie sich deshalb nicht, komisch fand sie es aber doch: Bei ihrer Ankunft hatte sie an den Autos von Gustavo Masotta und Martín Urovich vorbeimanövrieren müssen; falls die Kumpane ihres Mannes sich nicht zu Fuß davongemacht hatten, mussten sie also trotz allem irgendwo in der Nähe sein. Sie ging auf den Balkon. In der Dunkelheit glaubte sie, am Beckenrand mehrere Handtücher zu erkennen. Die Nacht war angenehm mild, obwohl es erst Ende September war; doch fürs Schwimmen spielte das Wetter ohnehin keine große Rolle mehr, seit Tano die Beckenheizung hatte einbauen lassen. Bestimmt haben sie sich zum Abschluss ihres Besäufnisses ins Wasser gestürzt und sind jetzt dabei, sich in der Laube wieder anzuziehen, dachte Teresa. Und damit hatte sie genug über die Sache nachgedacht, fand sie, zog ihr Nachthemd über und schlüpfte ins Bett.
Als sie um vier Uhr morgens aufwachte, war sie immer noch allein. Die linke Bettseite neben ihr war unberührt. Sie ging auf die andere Hausseite und sah durchs Fenster, dass die Autos noch dort parkten. Im Haus war es immer noch ruhig. Sie ging nach unten, durchquerte das Wohnzimmer und stellte fest, dass das, was sie vom Balkon aus gesehen hatte, nicht nur Handtücher, sondern auch T-Shirts waren. Die Lichter am Swimmingpool waren allerdings aus, und es war auch sonst kaum etwas zu erkennen. Im Esszimmer war alles wie immer an solchen Abenden: der Tisch voll offener Flaschen, die Aschenbecher quollen über von Zigarrenstummeln, dazwischen ein Haufen durcheinanderliegender Karten, als hätten Tano und seine Freunde gerade eine Partie zu Ende gespielt. Sie ging zur Gartenlaube. Im Umkleideraum lag Männerkleidung auf der Bank, auf dem Boden eine zusammengeknüllte Unterhose, und in der Dusche hing an dem Knauf, an dem man das Wasser aufdrehte, ein einsamer Strumpf. Nur Tano hatte seine Sachen am einen Ende der Bank sorgfältig zusammengelegt; davor standen seine Schuhe. Spazieren gegangen sind sie also nicht, dachte Teresa. Sie ging zum Swimmingpool. Auf dem Weg dorthin wollte sie das Licht einschalten, aber zumindest in diesem Abschnitt ging es nicht an. Ob die Sicherung durchgebrannt ist?, überlegte sie. Erst später erfuhr sie, dass nicht die Sicherung der Grund war, sondern die Vorsicherung. Das Wasser lag ruhig da. Sie fasste die Handtücher an, sie waren trocken, höchstens ein wenig feucht vom Tau, sie waren also nicht benutzt worden. Was sie stutzig machte, waren die drei leeren Sektgläser, die in Reih und Glied am Beckenrand standen. Dass die Männer hier etwas getrunken hatten, war nichts Besonderes, das machten sie, wo immer sie Lust hatten, aber diese Gläser gehörten zum Hochzeitsgeschirr, das ihnen Tanos Vater geschenkt hatte, und es wurde normalerweise nur zu besonderen Anlässen benutzt, Tano selbst wollte es so. Teresa bückte sich, um die Gläser einzusammeln, bevor sie einem morgendlichen Windstoß, einer Katze oder einem Frosch zum Opfer fielen – andere Gefahren sind hier in La Cascada weitgehend auszuschließen. Dachten wir wenigstens.
Als sie nach den Gläsern griff, warf Teresa nur einen kurzen Blick auf die reglose Wasseroberfläche. Zwei der Gläser stießen beim Hochheben aneinander, das Klirren ließ Teresa zusammenfahren. Sie sah sich die Gläser genau an, stellte aber erleichtert fest, dass nirgendwo ein Sprung zu entdecken war. Dann kehrte sie zum Haus zurück. Sie bewegte sich langsam und vorsichtig, die Gläser sollten nicht noch einmal aneinanderstoßen; was sie nicht wusste und was wir alle erst am nächsten Morgen erfahren sollten: Am Grund des lauwarmen Wassers, auf dem Boden des Schwimmbeckens, lagen die leblosen Körper ihres Mannes und zweier seiner Freunde.
3
Altos de la Cascada heißt die Siedlung, in der wir wohnen. Wir alle. Zuerst zogen Ronie und Virginia hier raus, fast zur selben Zeit wie die Urovichs; ein paar Jahre später Tano und seine Familie; als einer der Letzten kam dann Gustavo Masotta. Früher oder später wurden wir also zu Nachbarn. Altos de la Cascada ist eine Privatsiedlung, ringsherum zieht sich ein Drahtzaun, verborgen hinter allen möglichen Sträuchern. Genau genommen heißt die Siedlung Altos de la Cascada Country Club. Die meisten von uns sagen aber einfach nur La Cascada, andere ziehen die Abkürzung Los Altos vor. Hier gibt es einen Golfplatz, Tennisplätze, ein großes Schwimmbad und zwei Klubhäuser. Und private Security. Tagsüber sind es fünfzehn, nachts zweiundzwanzig Wachmänner. Ein gut zweihundert Hektar großes geschütztes Gebiet, zu dem man nur mit Genehmigung Zutritt erhält.
Es gibt drei Möglichkeiten, in die Siedlung zu gelangen: Für die Bewohner der Siedlung gibt es eine Durchfahrt mit Schlagbaum, wo man bloß die persönliche Magnetkarte an ein Lesegerät zu halten braucht. Für Besucher, die eine Genehmigung vorweisen können, existiert ein Seiteneingang, ebenfalls mit einer Sperre: Hier müssen sie die Nummer von ihrem Personalausweis, Führerschein oder etwas Vergleichbarem angeben. Schließlich gibt es noch ein Drehkreuz, wo Lieferanten, Hausangestellte, Gärtner, Maler, Maurer und sonstige Handwerker, die in der Siedlung zu tun haben, ihren Ausweis und ihre Taschen und sonstigen Gepäckstücke vorzeigen müssen.
Entlang dem Zaun sind im Abstand von fünfzig Metern Überwachungskameras angebracht, die sich in einem Hundertachtzig-Grad-Winkel hin und her bewegen. Die ersten Kameras beschrieben noch einen ganzen Kreis, aber sie wurden schon bald durch die jetzigen ersetzt, weil sie die Privatsphäre der Bewohner der an den Zaun grenzenden Häuser störten.
Die Häuser sind durch »lebende Zäune« voneinander getrennt, mit anderen Worten: durch Hecken. Aber nicht irgendwelche. Liguster oder violette Trompetensträucher, wie sie überall an Bahngleisen wachsen, sind völlig aus der Mode. Und exakt gerade geschnitten werden die Hecken heutzutage auch nicht mehr so oft – es geht nicht darum, eine undurchdringliche grüne Wand zu errichten. Sorgfältig rund schneidet man sie aber ebenso wenig. Heute lässt man sie einfach draufloswachsen, stutzt nur noch hier und da – es soll natürlich wirken, obwohl selbstverständlich alles genau durchdacht ist. Von Weitem soll es aussehen, als wären die Pflanzen wie von allein an dieser Stelle aus dem Boden gewachsen, niemand soll daran erinnert werden, dass sie eigentlich die Grenze zweier benachbarter Grundstücke markieren. Drahtzäune oder Eisengitter sind verboten, gemauerte Abgrenzungen erst recht. Abgesehen natürlich von dem zwei Meter hohen Drahtzaun, der die Siedlung umgibt. Dafür ist die Verwaltung zuständig. Der Zaun wird allerdings schon bald durch eine Mauer ersetzt, die den neuen Sicherheitsvorschriften entspricht. Die Gärten von Häusern, die unmittelbar an den Golfplatz grenzen, dürfen nicht einmal durch »lebende Zäune« abgetrennt werden; der Übergang wird durch die Verwendung verschiedener Rasensorten sichtbar gemacht, was von weiter weg jedoch nicht zu bemerken ist – man glaubt, alles sei einheitlich grün und gleichzeitig Privat- und Allgemeinbesitz.
Die Straßen sind nach Vögeln benannt: Schwalben-, Drossel-, Amselstraße. Sie sind anders angeordnet als normalerweise üblich, viele sind Sackgassen mit einem von Büschen eingefriedeten Wendekreis am Ende. Die Häuser an diesen Sackgassen sind besonders begehrt, weil dort weniger Autos vorbeikommen, wer würde nicht gerne so ruhig wohnen? Wäre dies keine geschützte Privatsiedlung, würden sich einem, vor allem nachts, in solch einer Straße die Nackenhaare aufstellen – man hätte Angst, in einen Hinterhalt zu geraten, überfallen zu werden. Aber nicht in La Cascada, hier ist so etwas unmöglich, hier kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit und überall völlig unbesorgt zu Fuß unterwegs sein, passieren kann einem hier nichts.
Bürgersteige gibt es nicht. Die Leute bewegen sich im Auto vorwärts, auf Motorrädern, Quads, Fahrrädern, Golfbuggys, Elektrorollern oder Rollerskates. Und wer zu Fuß geht, geht auf der Straße. Bei jemandem, der ohne Sportausrüstung zu Fuß unterwegs ist, kann es sich eigentlich nur um eine Haushaltshilfe oder einen Gärtner handeln. Gärtner heißen bei uns in Altos de la Cascada auch parquistas – was bestimmt daher kommt, dass kein Grundstück hier kleiner als eintausendfünfhundert Quadratmeter ist, wodurch jeder Garten automatisch zu einem Park wird.
Wer nach oben sieht, wird nirgendwo eine Leitung entdecken, weder für Strom noch für Telefon oder Fernsehen. Natürlich gibt es für all das Leitungen, bloß verlaufen die unterirdisch und damit unsichtbar – den Bewohnern von Los Altos soll schließlich nichts die Freude am Betrachten ihrer Umgebung trüben. Die Leitungen verlaufen in einem Kabelschacht parallel zu den Abwasserkanälen, beides unter der Erde verborgen.
Auch den Anblick von Wassertanks braucht man hier nicht zu ertragen, sie stehen versteckt hinter dünnen Sichtschutzwänden. Für die Wäsche gilt das Gleiche: Das Baubüro der Siedlung muss nicht nur dem Grundriss eines geplanten Hauses zustimmen, es legt auch von vornherein fest, wo die künftigen Bewohner die Wäsche zum Trocknen aufzuhängen haben; sollten diese später stattdessen einen Ort dafür benutzen, der von den umstehenden Häusern eingesehen werden kann, führt das zu einer kostenpflichtigen Anzeige.
Jedes Haus ist anders, man versucht, den Eindruck zu vermeiden, das eigene Heim könne einem anderen gleichen, selbst wenn das tatsächlich der Fall ist. Was wiederum gar nicht anders sein kann, schließlich sind beim Bau bestimmte ästhetische Prinzipien zu beachten. Entweder, weil die Bauordnung es vorschreibt oder sonst eben die Mode. Jeder von uns möchte, dass sein Haus das schönste von allen ist. Oder das größte. Oder das solideste. Die Bauordnung sieht jedoch vor, dass die Siedlung in verschiedene Bereiche eingeteilt ist, in denen jeweils nur ein Haustyp errichtet werden darf; danach hat sich die äußere Erscheinung dann zu richten. So gibt es einen Bereich, in dem weiße Häuser vorgeschrieben sind. Und einen, wo nur Ziegelhäuser stehen. Und einen, wo alle Dächer mit Schiefer gedeckt sein müssen. Man ist bei der Wahl des Haustyps also an den jeweiligen Bereich gebunden. Aus der Vogelperspektive präsentiert sich der Country Club als Ansammlung von drei Flecken: einem roten, einem weißen und einem schwarzen.
Im Ziegelsektor befinden sich die »Schlafhäuser«, Apartmentblocks, wo die Klubmitglieder wohnen, die nur übers Wochenende herkommen und deshalb kein ganzes Haus unterhalten möchten. Von Weitem könnte man die »Schlafhäuser« für drei riesige Villen halten, in Wirklichkeit bestehen sie jedoch aus vielen kleinen Wohnungen, in die die drei wuchtigen Gebäude unterteilt sind und denen ein sorgfältig gepflegter Garten angegliedert ist.
Und noch eine Besonderheit dieser Siedlung gibt es, vielleicht die auffälligste: die Gerüche. Diese Gerüche verändern sich je nach Jahreszeit. Im September duftet alles nach Jasmin – was keine dichterische Schwärmerei, sondern eine reine Tatsachenbeschreibung ist. In jedem Garten von La Cascada gibt es mindestens einen Jasminstrauch, der im Frühling blüht. Dreihundert Häuser mit dreihundert Gärten, in denen dreihundert Jasminsträucher wachsen, alles zusammengedrängt auf einer Fläche von zweihundert Hektar, umgeben von Maschendraht und bewacht von einer Spezialfirma, das hört sich nicht unbedingt besonders poetisch an. Doch im Frühjahr ist die Luft hier von einem schweren, süßen Duft erfüllt. Wer das nicht gewohnt ist, dem kann das schon ein bisschen zu viel werden. Andere werden geradezu süchtig danach, und wenn sie während dieser Zeit die Siedlung verlassen müssen, sehnen sie sich bereits beim Wegfahren danach, bald wieder da zu sein, um erneut den süßen Geruch der Jasminblüten einatmen zu können. Als ob das nicht auch anderswo möglich wäre. Die Luft in Altos de la Cascada ist während dieser Zeit schwer, man kann sie förmlich mit Händen greifen, wer hier wohnt, dem gefällt das, genau wie das Summen der Bienen in der Umgebung der blühenden Jasminsträucher. Und auch wenn sich, wie schon gesagt, die Düfte je nach Jahreszeit verändern, bleibt das Grundgefühl immer dasselbe: Wie herrlich ist es doch, hier durchzuatmen! Im Sommer riecht es in La Cascada nach frisch gemähtem und gesprengtem Rasen, allerdings auch nach dem Chlor der Swimmingpools. Der Sommer ist außerdem die Jahreszeit der Geräusche: Platscher, das Geschrei spielender Kinder, laut sägende Zikaden, Vögel, die sich über die Hitze beschweren, Musik, die sich durch ein angelehntes Fenster nach draußen stiehlt, jemand, der einsam vor sich hin trommelt. Vergitterte Fenster – in La Cascada gibt es so etwas nicht. Hier brauchen wir keine Gitter. Moskitonetze allerdings schon, wer lässt sich schon gerne von Insekten belästigen. Im Herbst riecht es nach frisch gesägten Ästen, die aber niemals liegen bleiben und anfangen zu verfaulen, dafür gibt es Männer in grünen Overalls mit dem Logo von Altos de la Cascada, die, sobald es stark geregnet oder gestürmt hat, zur Stelle sind, um abgefallene Blätter und Äste aufzusammeln. Die Spuren eines Sturms sind meistens schon verschwunden, bevor wir gefrühstückt haben und zur Arbeit, zur Schule oder zum Morgenspaziergang aufbrechen. Wir merken bloß, dass der Boden feucht ist oder dass es nach nasser Erde riecht. Manchmal sind wir nicht einmal sicher, ob das Gewitter, von dem wir in der Nacht aufgewacht sind, tatsächlich stattgefunden hat oder bloß ein Traum war. Und im Winter dann der Geruch nach Holz, das im Kamin verbrennt. Ein rauchiger Eukalyptusgeruch, der privateste, intimste aller Gerüche – der Geruch des eigenen Hauses. Die Bestandteile, aus denen er sich außerdem zusammensetzt, kennen nur wir selbst.
Wer so wie wir nach Altos de la Cascada zieht, behauptet, es gehe ihm darum, »im Grünen« zu sein, um ein gesundes Leben, Sport, Sicherheit. Hinter diesem Vorwand verstecken wir uns, auch vor uns selbst, um nicht eingestehen zu müssen, weshalb wir in Wirklichkeit hergekommen sind. Und irgendwann wissen wir es dann selbst nicht mehr – mit dem Einzug in La Cascada setzt ein geheimnisvoller Prozess des Vergessens ein. Von der Vergangenheit bleibt da nur noch die letzte Woche, der letzte Monat, das letzte Jahr, »als wir beim Country-Club-Turnier gewonnen haben«. Freunde, die uns ein Leben lang begleitet haben, Orte, ohne die man unmöglich auszukommen glaubte, Verwandte, Erinnerungen, Fehler, die wir begangen haben, all das löst sich irgendwann in nichts auf. Als könnte man in einem bestimmten Alter einfach die beschriebenen Seiten aus seinem Tagebuch herausreißen und mit den Aufzeichnungen noch einmal von vorne anfangen.
4
Wir sind Ende der Achtzigerjahre nach La Cascada gezogen. Gerade hatten wir einen neuen Präsidenten bekommen. Eigentlich wäre es erst im Dezember jenes Jahres so weit gewesen, aber die enorme Inflation und die vielen Plünderungen von Supermärkten hatten dafür gesorgt, dass der vorherige Präsident seinen Platz vor Ablauf der Amtszeit frei machte. Von einer Abwanderung in die geschützten Wohnviertel am Rand des Großraums von Buenos Aires war damals noch nichts zu bemerken. Nur wenige wohnten dauerhaft in Altos de la Cascada oder einem ähnlichen geschützten Viertel beziehungsweise Country, wie man auch sagt. Ronie und ich gehörten also zu den Ersten, die den Mut hatten, die Stadtwohnung im Zentrum endgültig aufzugeben und mit der Familie hier rauszuziehen. Ronie war anfangs unsicher. Die viele Fahrerei, sagte er. Aber ich ließ nicht locker, ich war überzeugt, dass es unser Leben verändern würde – zum Besseren natürlich –, dass wir einen Schnitt machen und die Stadt hinter uns lassen sollten. Schließlich hat Ronie eingewilligt.
Wir verkauften ein Wochenendhaus, das wir von Ronies Familie geerbt hatten, eins der wenigen Dinge aus dem Erbe, die wir noch zu Geld machen konnten. Dafür kauften wir das Haus der Antieris. Das Geschäft war eine »runde Sache«, wie ich so etwas gern bezeichne. Und dabei zeigte sich zum ersten Mal, dass mir das mit dem Häuserkaufen und -verkaufen Spaß machte, es lag mir offenbar im Blut. Obwohl ich damals natürlich noch nicht so viel von der Sache verstand wie heute. Antieri hatte sich zwei Monate zuvor das Leben genommen. Die Witwe wollte um jeden Preis aus dem Haus ausziehen, in dem sich ihr Mann, der Vater ihrer vier Töchter, eine Kugel in den Kopf gejagt hatte. Im Wohnzimmer. Ein eher kleines Wohnzimmer mit integriertem Esszimmer. Fast alle Häuser aus der Anfangszeit von Altos de la Cascada und ähnlichen »Countrys« hatten kleine Wohnzimmer. Damals, also in den Fünziger-, Sechziger- und auch noch Siebzigerjahren, hatte man keine Häuser, die vom Zentrum so weit entfernt waren, wenn man ein Leben in Gesellschaft führen und Leute bei sich empfangen wollte. Dass es einmal so etwas wie die Panamericana-Schnellstraße geben würde, wie wir sie heute kennen, tadellos asphaltiert und vierspurig, hätte man damals nicht zu träumen gewagt. Wenn man zu der Zeit Freunde oder Verwandte hierher einlud, hatte das etwas von einem Abenteuer – »ein Tag auf dem Lande« –, man genoss den Garten, die Sportanlagen, ging zusammen mit den Gästen reiten oder Golf spielen. Die Zeit, in der man seine teuren ausländischen Teppiche oder Sitzgruppen aus den elegantesten Möbelgeschäften von Buenos Aires zur Schau stellte, sollte erst ein paar Jahre später beginnen. Wir zogen irgendwann dazwischen hierher, es waren nicht mehr die Sechzigerjahre, die Neunziger waren allerdings auch noch nicht angebrochen, obschon sie uns unbestreitbar viel näher waren, und das nicht nur in zeitlicher Hinsicht. Wir ließen eine Zwischenwand herausreißen und vergrößerten auf diese Weise das Wohnzimmer um mehrere Quadratmeter, die Fläche des vormaligen Arbeitszimmers, das wir, da waren wir uns sicher, nicht brauchen würden.
Das mit Antieri passierte an einem Sonntagmittag. Die Schreie seiner Frau waren bis zum Golfplatz zu hören. Das Haus ist fast gegenüber von Loch vier, und Paco Pérez Ayerra, der damals Vereinspräsident war, erzählt immer wieder, wie ihm sein long drive danebenging, weil die Schreie genau in dem Augenblick einsetzten, als sein Schläger auf den Ball traf. Antieri war beim Militär gewesen, Heer oder Marine, etwas in der Art. Niemand wusste das so genau. Jedenfalls hatte er Uniform getragen. Viel Kontakt mit ihren Nachbarn hatten die Antieris nicht, sie machten keinen Sport, und auf Feste gingen sie auch nicht. Ihre Töchter schon, aber selten. Die Eltern jedoch hatten eigentlich mit niemandem Umgang. Sie kamen am Wochenende und schlossen sich in ihrem Haus ein. Zuletzt war er auch über die Woche dort geblieben, allein, mit heruntergelassenen Rollläden, angeblich damit beschäftigt, seine Waffensammlung zu reinigen. Er sprach mit niemandem. Deshalb braucht man, finde ich, auch nicht über die Gründe zu spekulieren, und erst recht nicht würde ich dem schon bald die Runde machenden Gerücht allzu viel Glauben schenken, nach dem Antieri gedroht hatte, er werde sich eine Kugel in den Kopf jagen, falls die Wahlen – die von 1989 – mit einem bestimmten Ergebnis ausgingen. Ein bekannter Schauspieler hatte in der Tat damit gedroht und danach auch Ernst gemacht, alle Medien haben damals darüber berichtet; aber im Fall Antieris hat jemand einfach beide Geschichten miteinander verknüpft, und schon war das Gerücht in der Welt.
Als ich das Haus zum ersten Mal sah, fiel mir vor allem Antieris Arbeitszimmer auf – das wir dann ja dem Wohnzimmer zuschlugen. Dort war alles so sauber und aufgeräumt, es war fast ein wenig zum Fürchten. An allen Wänden standen volle Bücherregale. Die Buchrücken – aus grünem oder bordeauxrotem Leder – waren in tadellosem Zustand. Außerdem gab es zwei Glasschränke, in denen Antieri seine Waffen aufbewahrte, die unterschiedlichsten Modelle und Kaliber, allesamt auf Hochglanz poliert. Juani, der damals gerade fünf Jahre alt war, zog ein Buch aus einem Regal, ließ es zu Boden fallen und trat darauf. Der Buchrücken schien leicht eingedrückt. Ronie zog Juani am Haarschopf aus dem Zimmer, um ihn unter vier Augen zur Rede zu stellen. Er kochte vor Wut. Ich versuchte, den Abdruck von Juanis Schuh auf dem Buch wegzuwischen. Dann wollte ich es wieder ins Regal stellen – es war seltsam leicht, und da sah ich es mir genauer an: Es war hohl! Zwischen den Buchdeckeln befand sich nicht ein einziges Blatt Papier, es war nur eine leere Schachtel. Auf dem Rücken stand Faust. Ich stellte das Buch an seinen Platz zurück. Zwischen Das Leben ein Traum von Calderón de la Barca und Dostojewskis Schuld und Sühne – lauter leere Bände. Rechts davon standen noch zwei, drei klassische Titel, dann ging es wieder von vorne los: Das Leben ein Traum, Goethes Faust, Schuld und Sühne, alles in fein geschwungenen goldenen Lettern. Und so auch in allen übrigen Regalen.
Das Haus bekamen wir fast geschenkt. Andere Interessenten hatten ihr Angebot zurückgezogen, als sie erfahren hatten, dass sich dort jemand erschossen hatte. Die Witwe sagte nichts davon, der Makler ebenso wenig. Aber alle anderen sprachen davon, und zuletzt drang es immer bis zu den möglichen Käufern durch. Mir machte es, ganz ehrlich, nichts aus; ich bin nicht abergläubisch. Das Beste war, dass der Witwe, als es ans Unterschreiben der Verträge ging, noch irgendwelche Unterlagen fehlten, sodass sie schließlich für die gesamten Notarkosten und sonstigen Gebühren aufkommen musste, unser Anteil miteingeschlossen. Darüber hinaus verdiente ich sogar noch zweihundert Pesos, indem ich Rita Mansilla die hohlen Bücher verkaufte; die Witwe wollte sie nicht mitnehmen, und im Keller hätten sie bloß Staub angesetzt.
Das Haus kostete so schließlich gerade einmal fünfzehntausend Dollar mehr, als uns das Wochenendhaus eingebracht hatte; zudem stand es auf einem zweitausend Quadratmeter großen Grundstück, hatte zweihundertfünfzig Quadratmeter Wohnfläche, drei Luxusbäder, Dienstbotenzimmer. Hell war es auch – wenn die Rollläden nicht gerade unten waren. Bevor wir einzogen, ließen wir alle Räume frisch weißen, damit es noch heller wirkte – ein alter Maklertrick aus Buenos Aires. Später wurde mir klar, dass derlei in La Cascada überflüssig ist: Hier scheint die Sonne unbehindert durch die Fenster, weil keine benachbarten, geschweige denn angrenzende Gebäude im Weg sind. Nur auf vereinzelten Grundstücken stehen die Bäume so dicht, dass es dort übermäßig schattig wird, bei uns war und ist das jedoch nicht der Fall.
Das war das erste Immobiliengeschäft, das ich in meinem Leben abgeschlossen hatte – ein großer Erfolg. Von da an wuchs meine Begeisterung für diese Tätigkeit stetig. Es hatte etwas von einem Spiel. Sobald ich mitbekam, dass jemand knapp bei Kasse war, ein Paar vorhatte, sich zu trennen, oder ein arbeitsloser Ehemann einen Job im Ausland gefunden hatte und folglich ein Umzug bevorstand – manche verließen das Land auch, ohne anderswo Arbeit gefunden zu haben, weil sie genug davon hatten, sich ohne festes Einkommen mit den Betriebskosten für Schwimmbad und Golfplatz herumzuschlagen –, in all diesen Fällen also begann ich meinerseits zu überlegen, wer Interesse an dem frei werdenden Haus haben könnte, und setzte mich dann mit dem Betreffenden in Verbindung.
So kam es, dass ich zwei Jahre später den Scaglias ihr künftiges Haus verkaufte. Wenige Tage davor hatte der neue Wirtschaftsminister, der bis dahin Außenminister gewesen war, das Amt angetreten, für das er eigentlich von Anfang an vorgesehen war. Kaum vereidigt, sorgte er dafür, dass der Kongress dem berühmten Konvertibilitätsgesetz zustimmte, das die Parität von Dollar und Peso verfügte – seither konnten wir uns im Glauben wiegen, dass wir wieder über unbegrenzte Kaufkraft verfügten, was Orten wie Altos de la Cascada einen massenhaften Zuzug bescherte.
Manche Dinge, allerdings längst nicht so viele, wie man meinen könnte, verändern den Lauf unseres Lebens grundlegend. Eins davon war zweifellos der Verkauf dieser Immobilie an die Scaglias im März 1991.
5
Ich erinnere mich noch, als wäre es heute gewesen. Ein Paar braune Schuhe aus Krokoleder, das war das Erste, was von ihr zu sehen war, als sie aus dem Auto stieg. Als Teresa Scaglia den Fuß dann aufsetzte, bohrte sich ihr Stiftabsatz in den weichen Boden des Grundstücks, das ich ihnen verkaufen wollte. Ich merkte, wie unangenehm ihr das war, und versuchte, den Vorfall herunterzuspielen. »Das geht allen Frauen aus der Stadt so, wenn sie hier rauskommen«, sagte ich. »Es ist natürlich nicht so schön, auf hohe Absätze verzichten zu müssen. Ich weiß, wovon ich rede, das können Sie mir glauben. Aber man muss sich eben entscheiden: Absätze oder das hier …«, erklärte ich und deutete theatralisch auf die Bäume und die Parklandschaft um uns herum.
Tano hatte von allem nichts mitbekommen, glaube ich zumindest. Er hatte sich schon ein ziemliches Stück vom Auto entfernt. Aber nicht, weil er es eilig hatte – das heißt, eilig hatte er es schon, aber nicht aus Zeitmangel; er konnte es einfach nicht erwarten, es drängte ihn so sehr. Er ging also ungerührt voraus, während ich stehen blieb und auf Teresa wartete. Kaum zu glauben, dass diese Frau sich später mit Gartenarbeit beschäftigen sollte. Als sie nach Altos de la Cascada kam, wusste sie nur, dass sie Pflanzen mochte. Teresa zog den Absatz aus der Erde und versuchte, ihn am Gras abzuwischen; dabei sank sie jedoch unweigerlich mit dem anderen Absatz im Boden ein. Es war zwecklos: Der frisch gesäuberte erste Absatz würde wiederum einsinken, der andere ohnehin schmutzig aus der Erde hervorgezogen werden, und auch dieser würde wieder schmutzig werden, so viel Mühe sie sich auch geben würde, ihn sauber zu halten. Aber wenn ich ihr das erklärt hätte, statt ihr die Möglichkeit zu geben, selbst zu lernen, wie man am besten auf diesem Gelände zurechtkommt, hätte ich mich genauso ungeduldig und respektlos verhalten wie ihr davonstürmender Ehemann. Nicht, dass ich übermäßig ruhig und gelassen gewesen wäre: Mithilfe der Provision, die ich für den Verkauf dieses Grundstücks einstreichen würde, könnte ich mehrere schon seit Längerem anstehende Umbau- und Renovierungsmaßnahmen in unserem eigenen Haus in Auftrag geben. Ich überlegte, wofür sie sich wohl entscheiden werde – als ich zum ersten Mal nach La Cascada gekommen und auch gleich mit dem Absatz eingesunken war, hatte ich einfach die Schuhe ausgezogen und war barfuß beziehungsweise in Seidenpantys weitergegangen. Damals waren wir noch jung, und Ronie lachte darüber; wir lachten beide. Aber Teresa und ich sind ganz verschieden. Wir alle sind hier ganz verschieden, auch wenn manche meinen – aber da täuschen sie sich –, an einem solchen Ort würden wir Frauen mit der Zeit einander immer ähnlicher. »Country-Frauen«, nennen sie das. Aber das sind bloß Klischees und Vorurteile. Natürlich erleben wir Vergleichbares, passieren uns ähnliche Dinge. Beziehungsweise passieren uns bestimmte Dinge eben nicht, und darin gleichen wir uns. Uns allen fällt es zum Beispiel anfangs schwer, bestimmte Gewohnheiten aufzugeben. Aber letztlich heißt es eben: Schuhe mit hohen Absätzen, Seidenstrümpfe, lange, schwere Vorhänge, die über den Boden schleifen – für all das ist hier kein Platz. Sosehr dies anderswo für Eleganz und einen anspruchsvollen Lebensstil steht, in Altos de la Cascada bedeutet es nur eine Belastung wegen des erhöhten Reinigungsaufwands.