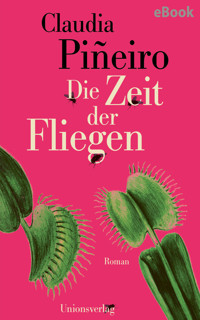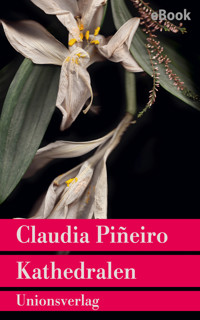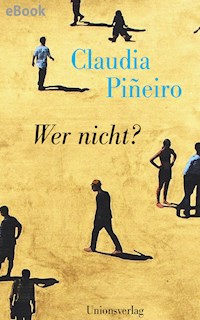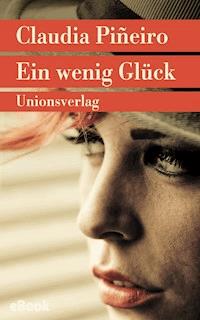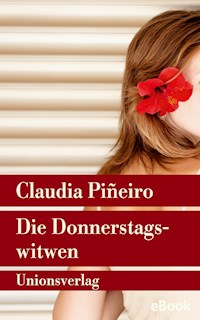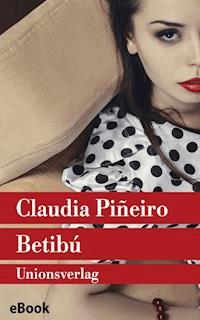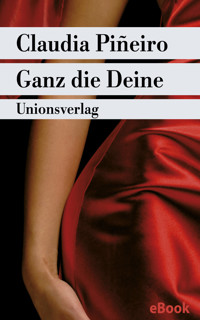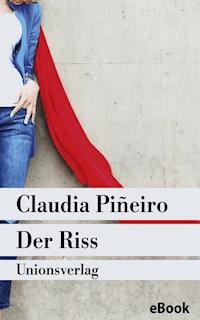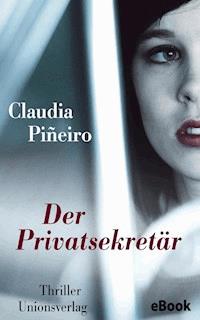7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jede glaubt, sie habe sich für die andere geopfert. Nun kommt die Stunde der Wahrheit. Die Tochter wird tot aufgefunden, erhängt im Glockenturm der Kirche. Doch Elena, die Mutter, kann oder will nicht glauben, dass Rita sich das Leben genommen hat. Für die alte Dame gibt es nur eine Möglichkeit, hinter das Geheimnis um Ritas Tod zu kommen: Sie muss mit einer Frau sprechen, der sie und ihre Tochter vor zwanzig Jahren geholfen haben. Dafür muss Elena ins Stadtzentrum fahren – ein schwieriges und riskantes Unterfangen für jemanden, der an Parkinson in fortgeschrittenem Stadium leidet. Wenn die Wirkung ihres Medikaments endet, wird sie wieder in bewegungsloser Starre versinken. Am Ende muss Elena eine Wahrheit erfahren, mit der sie nicht gerechnet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Rita wird tot aufgefunden, erhängt im Glockenturm der Kirche. Doch Elena, die Mutter, kann oder will nicht an Selbstmord glauben. Trotz ihrer schweren Parkinson-Erkrankung begibt sie sich auf die Suche nach dem Geheimnis um Ritas Tod – und muss sich am Ende einer Wahrheit stellen, mit der sie nicht gerechnet hat.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Claudia Piñeiro (*1960) ist eine der erfolgreichsten Autorinnen Argentiniens. Nach dem Wirtschaftsstudium arbeitete sie als Journalistin, Dramatikerin und Regisseurin. Sie erhielt den Premio Clarín, den LiBeraturpreis und den Premio Hammett und war für den International Booker Prize nominiert.
Zur Webseite von Claudia Piñeiro.
Peter Kultzen (*1962) studierte Romanistik und Germanistik in München, Salamanca, Madrid und Berlin. Er lebt als freier Lektor und Übersetzer spanisch- und portugiesischsprachiger Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Peter Kultzen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Claudia Piñeiro
Elena weiß Bescheid
Roman
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel Elena sabe bei Alfaguara Argentina, Buenos Aires.
Dieses Werk wurde im Rahmen des »Sur«-Programms zur Förderung von Übersetzungen des Außenministeriums der Republik Argentinien verlegt.
Originaltitel: Elena sabe (2007)
© by Claudia Piñeiro 2007
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hart Creations
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30272-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 15:29h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ELENA WEISS BESCHEID
Morgen — (Zweite Tablette)1 – Also los, den rechten Fuß heben, nur ein …2 – Rita starb an einem regnerischen Nachmittag. Auf dem …3 – Elena nähert sich dem Bahnhof. Bloß fünf Querstraßen …4 – Als man Rita fand, hing sie im Glockenturm …5 – Sie sitzt auf der Bahnhofsbank und wartet …6 – Es dauerte eine Weile, bis der Leichnam freigegeben …7 – Endlich sitzt Elena in dem Zug, der sie …8 – Kaum jemand sprach so ungern über die Sache …Mittag — (Dritte Tablette)1 – Der Zug erreicht Plaza Constitución. Elena wartet …2 – Inspektor Avellaneda gehört auch zu denen, die nichts …3 – Elena beschließt, ein Taxi zu nehmen. Im Bewusstsein …4 – »Setzen Sie auch die beiden Frauen von der …5 – Also gut, Elena beschließt, die Einnahme ihres Medikaments …6 – Auch Mimí wäre außerstande gewesen, Rita zu töten …7 – Wie Elena gesagt hat, biegt das Taxi in …Nachmittag — (Vierte Tablette)1 – Elena hat Isabel vor zwanzig Jahren kennengelernt …2 – Sie hebt den Arm über ihren gebeugten Kopf …3 – Zwei Tage bevor sie sich im Glockenturm erhängte …4 – Elena nimmt die nächste Tablette und wartet …Mehr über dieses Buch
Über Claudia Piñeiro
Claudia Piñeiro: Lesen als Revanche
Claudia Piñeiro: »Frauen und Männer lesen unterschiedlich«
Über Peter Kultzen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Claudia Piñeiro
Zum Thema Argentinien
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Frau
Zum Thema Spannung
Für meine Mutter
»Jetzt erkenne er sie, die zu ihren Lebzeiten neben ihm von ihm zwar geliebt, aber niemals erkannt worden sei. Zusammen sei der Mensch mit einem geliebten andern endlich erst, wenn der betreffende tot, tatsächlich in ihm ist.«
Thomas Bernhard, Verstörung
»Es ist auch ein Betonbau nichts anderes als ein Kartenhaus. Es muss nur der entsprechende Windstoß kommen.«
Thomas Bernhard, Entblößungen
Morgen
(Zweite Tablette)
1
Also los, den rechten Fuß heben, nur ein paar Zentimeter, nach vorne bewegen, ein kleines oder großes Stück weit, gerade so, dass er sich am linken vorbeischiebt, und dann wieder aufsetzen. Das ist alles, denkt Elena. Aber sie denkt, und ihr Gehirn befiehlt: Bewegen!, und trotzdem tut sich nichts. Der rechte Fuß rührt sich nicht. Erhebt sich nicht. Bewegt sich nicht nach vorne. Setzt nicht wieder auf. Rührt sich nicht, erhebt sich nicht, bewegt sich nicht nach vorne, setzt nicht wieder auf. Nur das. Aber es tut sich nichts. Da setzt Elena sich hin und wartet. Zu Hause in der Küche. Um zehn fährt der Zug in die Stadt, den muss sie nehmen; der nächste, der um elf, nützt ihr nichts; um neun hat sie ihre Tablette genommen, denkt sie, und sie weiß, dass sie deshalb den um zehn nehmen muss; sobald es dem Medikament gelingt, ihren Körper dazu zu bringen, den Befehlen ihres Gehirns zu gehorchen. Gleich. Nicht den um elf, bis dahin hat sich die Wirkung des Medikaments so sehr abgeschwächt, dass sie nicht mehr vorhanden ist, dann steht sie wieder da wie jetzt, aber ohne die Hoffnung auf die Wirkung des Levodopa.
Levodopa, so heißt das Zeug, das sich durch ihren Körper bewegen muss, sobald sich die Tablette aufgelöst hat; den Namen kennt sie schon länger. Levodopa. So hat man es ihr gesagt, und sie hat es sich damals auf einen Zettel geschrieben, weil sie wusste, dass sie die Schrift des Arztes nicht würde entziffern können. Dass sich das Levodopa durch ihren Körper bewegen muss, das weiß sie. Darauf wartet sie, während sie zu Hause in der Küche sitzt. Im Moment kann sie nichts tun außer warten. Im Geist geht sie die Straßen durch. Sagt sich die Namen vor. Einmal vorwärts und einmal rückwärts. Lupo, Moreno, 25 de Mayo, Mitre, Roca. Roca, Mitre, 25 de Mayo, Moreno, Lupo. Levodopa. Bis zum Bahnhof sind es nur fünf Querstraßen, gar nicht so viel, denkt sie und sagt die Namen auf und wartet immer noch. Fünf. Straßen, die sie zwar noch nicht mit ihren schleppenden Schritten hinter sich bringen kann, aber sich leise ihre Namen vorsagen, das kann sie.
Heute will sie niemandem begegnen. Niemand soll sie fragen, wie es ihr geht, und niemand soll ihr nachträglich sein Beileid wegen des Todes ihrer Tochter aussprechen. Tag für Tag erscheint jemand, der nicht zur Totenwache oder zum Begräbnis kommen konnte. Oder den Mut dazu nicht fand. Oder nicht aufbringen wollte. Wenn jemand so stirbt wie Rita, haben alle das Gefühl, sie müssten an der Beerdigung teilnehmen. Deshalb ist zehn keine gute Uhrzeit, denkt sie, denn auf dem Weg zum Bahnhof muss sie an der Bank vorbei, und heute werden die Renten ausbezahlt, da begegnet sie bestimmt einem ihrer Nachbarn. Mehreren Nachbarn. Die Bank öffnet zwar erst um zehn, und da fährt ihr Zug gerade in den Bahnhof ein, und sie tritt, die Fahrkarte in der Hand, an die Bahnsteigkante, um einzusteigen, aber trotzdem, Elena weiß Bescheid, die Rentner sind schon vorher da und stehen an, als hätten sie Angst, dass das Geld nur für die reicht, die zuerst kommen. Um sich die Bank zu ersparen, müsste sie einen Umweg machen, zuerst bis zur Parallelstraße gehen, aber ihr Parkinson würde einen hohen Preis dafür verlangen. Parkinson, so heißt das. Elena weiß schon seit Längerem, dass sie die Herrschaft über einige Teile ihres Körpers verloren hat, über die Füße zum Beispiel. Da hat er das Sagen. Oder sie. Sie überlegt, ob man bei Parkinson er oder sie sagen soll, der Name klingt zwar männlich, aber eine Krankheit ist es trotzdem, und Krankheiten sind weiblich, die Krankheit. Wie die Katastrophe. Oder die Strafe. Da beschließt sie, ihn »sie« zu nennen, denn beim Gedanken daran denkt sie »Scheißkrankheit«. Und Scheiße ist auch weiblich, es heißt die Scheiße, nicht der. Verzeihen Sie den Ausdruck, sagt sie. Also »sie«.
Doktor Benegas hat es ihr mehrmals erklärt, aber ganz verstanden hat sie es immer noch nicht. Was sie hat, versteht sie, schließlich steckt es in ihrem Körper. Aber manche Wörter, die der Arzt benutzt, versteht sie nicht. Beim ersten Mal war Rita dabei. Rita, die jetzt tot ist. Er sagte, Parkinson ist ein Degenerationsprozess der Nervenzellen. Dieses Wort gefiel ihnen beiden nicht. Degeneration. Weder ihr noch ihrer Tochter. Doktor Benegas hat das bestimmt gemerkt, denn er hat sofort versucht, es ihnen zu erklären. Er hat gesagt, eine Erkrankung des zentralen Nervensystems, die einen Teil der Nervenzellen dazu bringt, zu degenerieren, sie verändert sie, verwandelt sie, modifiziert sie in der Weise, dass sie kein Dopamin mehr produzieren. Damals erfuhr Elena, dass, wenn ihr Gehirn befiehlt: Bewegen!, dieser Befehl nur dann ihre Füße erreicht, wenn das Dopamin ihn überbringt. Wie ein Laufbursche, dachte sie damals. Dann ist der Parkinson also »sie« und das Dopamin der Laufbursche. Und das Gehirn hat dabei nichts zu melden, denkt sie, schließlich hören ihre Füße nicht darauf. Wie ein vom Thron gestürzter König, der nicht merkt, dass er nicht mehr regiert. Wie der Kaiser ohne Kleider aus der Geschichte, die sie Rita erzählte, als Rita klein war. König ohne Thron, Kaiser ohne Kleider. An seiner Stelle ist jetzt »sie«, nicht Elena, sondern ihre Krankheit, und dazu der Laufbursche und der König ohne Thron. Elena sagt sich die Namen vor, so wie sie sich vorher die Namen der Straßen bis zum Bahnhof vorgesagt hat; diese Namen leisten ihr beim Warten Gesellschaft. Vorwärts und rückwärts. Kaiser ohne Kleider gefällt ihr nicht, denn ein Kaiser ohne Kleider ist nackt. Lieber König ohne Thron. Sie wartet, wiederholt, bildet Paare: »sie« und der Laufbursche, der Laufbursche und der König, der König und »sie«. Sie versucht es wieder, aber die Füße reagieren immer noch nicht, sie stellen sich nicht bloß taub, sie sind taub. Taube Füße. Elena würde sie am liebsten anschreien: Bewegt euch endlich! Scheißfüße!, würde sie sogar schreien, bewegt euch endlich, ihr Scheißfüße! Aber sie weiß, dass das nichts nützen würde, auch ihre Stimme würden ihre Füße nicht hören. Deshalb schreit sie nicht, sondern wartet. Sagt sich Wörter vor. Straßennamen, Könige, wieder Straßennamen. Sie nimmt neue Wörter in ihr Gebet auf: Dopamin, Levodopa. Sie ahnt, dass das Dopa von Dopamin und das Dopa von Levodopa miteinander zu tun haben, sicher ist sie aber nicht, sie sagt die Wörter immer wieder, spielt damit, auch wenn ihre Zunge sich verhaspelt, sie wartet, egal, Hauptsache, die Zeit vergeht, Hauptsache, die Tablette löst sich auf, bewegt sich durch ihren Körper, bis zu ihren Füßen, und die merken endlich, dass sie losmarschieren sollen.
Sie ist nervös, und das ist nicht gut, denn wenn sie nervös ist, dauert es länger, bis das Medikament wirkt. Aber sie kann nichts dagegen machen. Heute setzt sie alles auf eine Karte, sie muss herausfinden, wer ihre Tochter getötet hat, muss mit dem einzigen Menschen auf der Welt sprechen, den sie vielleicht dazu bewegen kann, ihr zu helfen. Das ist dieser Mensch ihr schuldig, wegen einer lange zurückliegenden, fast vergessenen Geschichte. Diese Schuld wird sie einfordern, auch wenn Rita, wäre sie hier, dagegen wäre, das Leben ist doch kein Tauschhandel, Mama, manche Dinge macht man einfach, bloß so, weil Gott es will. Einfach wird es bestimmt nicht, aber sie wird es versuchen.
Die Frau, zu der sie will, heißt Isabel. Ob sie sich noch an Elena erinnert, weiß Elena nicht. Wohl kaum. An Rita schon, sie schickt ihr jedes Jahr zu Silvester eine Postkarte. Vielleicht weiß sie gar nicht, dass Rita tot ist. Wenn es ihr niemand gesagt hat, wenn sie die Todesanzeige, es blieb die einzige, nicht gelesen hat, die zwei Tage nach der Beerdigung erschien – im Namen der kirchlichen Schule, an der Rita arbeitete: Leitung und Lehrerschaft, Schüler und Eltern begleiten Elena in diesem Moment voller …
Wenn Elena es an diesem Tag nicht bis zu ihr schafft, wird die Frau, zu der sie heute will, bestimmt im Dezember einer Toten eine Karte schicken, auf der sie ihr frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht. An Rita erinnert sie sich, aber an sie, an Elena, denkt Elena, bestimmt nicht. Und falls doch, würde sie sie nicht wiedererkennen, wenn sie so vornübergebeugt bei ihr erschiene, mit diesem Körper, der viel älter wirkt, als sie eigentlich ist. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, ihr klarzumachen, wer sie ist und warum sie gekommen ist. Wenn sie es überhaupt schaffen wird. Sie wird ihr von Rita erzählen. Von ihrem Tod. Wie auch immer, sie wird ihr sagen, wie wenig sie von all dem versteht, was die anderen ihr erzählt haben.
Elena weiß, wo sie Isabel finden kann, aber nicht, wie sie es bis dorthin schaffen soll. Dorthin, wo sie selbst sie vor zwanzig Jahren gebracht hat, zusammen mit Rita. Wenn sie Glück hat, wenn Isabel nicht umgezogen ist, wenn sie, anders als ihre Tochter, nicht gestorben ist, wird sie sie dort antreffen, in einem alten Haus im Stadtteil Belgrano, ein Haus mit einer schweren bronzebeschlagenen Holztür gleich neben einer Arztpraxis. Wie die Straße heißt, weiß sie nicht mehr. Wenn sie sich stattdessen daran erinnerte, was ihre Tochter sie damals gefragt hat – Mama, kennst du eine Calle del Soldado de la Independencia? –, dann wüsste sie jetzt Bescheid. Bald wird sie es wissen, denn woran sie sich sehr wohl erinnert, ist, dass es eine oder zwei Querstraßen von der Avenida war, die zwischen Retiro und General Paz an der Stadtgrenze entlangführt, in der Nähe eines kleinen Platzes und einer Eisenbahnlinie. Den Zug sahen sie nicht, sie hörten bloß, wie er vorbeifuhr, und Rita fragte, welche Linie ist das?, aber Isabel antwortete nicht, weil sie weinte.
Um herauszufinden, wie sie – fast zwanzig Jahre danach – ein zweites Mal dorthin gelangen konnte, war Elena zu dem Taxiunternehmen bei ihr um die Ecke gegangen, da, wo früher die Bäckerei war, in der Elena, seit sie, frisch verheiratet, in dieses Viertel gezogen war, immer das Brot für die Familie gekauft hatte, bis es mit dem Brot vorbei war und die Taxis kamen. Der Fahrer wusste es nicht, ich bin neu hier, sagte er zur Entschuldigung und fragte den Besitzer. Er wiederholte, was Elena gesagt hatte: die Avenida, die zwischen Retiro und General Paz an der Stadtgrenze entlangführt, in der Nähe einer Eisenbahnstrecke. Und der Besitzer antwortete: Libertador, und Elena: Genau, Libertador, so hieß die Straße, jetzt, wo er es sagte, fiel es ihr wieder ein, und sie müsse nach Belgrano, und dort zu einem kleinen Platz. Olleros, sagte ein anderer Fahrer, der gerade von einer Tour zurückgekehrt war. Hm, da bin ich mir nicht so sicher, sagte Elena. Olleros, sagte der Fahrer noch einmal selbstgewiss. Aber an den Namen der Straße erinnerte sie sich nicht, dafür an die Holztür und die Bronzebeschläge, an Isabel und ihren Ehemann, an ihren Ehemann nur wenig. Sollen wir Sie hinfahren?, fragten die Männer, und Elena lehnte ab, das sei sehr weit, und sehr teuer, sie werde mit der Bahn fahren, und falls sie unterwegs nicht mehr könne und ihr Körper keine Lust auf die U-Bahn habe, könne sie immer noch in Constitución ein Taxi nehmen. Wir machen es billiger für Sie, bot der Besitzer an. Nein, danke, antwortete sie. Sie können später bezahlen, er ließ nicht locker. Nein, mit der Bahn, sagte Elena, ich habe nicht gern Schulden, und sie ließ sich auf nichts mehr ein. Da in der Nähe gibt es aber keine U-Bahn, Señora, von Carranza sind es ungefähr zehn Querstraßen, sagten die Männer, wenn Sie ein Taxi nehmen, müssen Sie aufpassen, dass die Sie nicht bloß spazieren fahren, sagen Sie dem Fahrer, er soll immer geradeaus durch die Avenida Nueve de Julio bis Libertador fahren, und von da weiter geradeaus bis Olleros. Nein, verbesserte der Fahrer, der Bescheid wusste, Libertador geht doch über in Figueroa Alcorta. Bevor Sie zum Planetarium kommen, müssen Sie aufpassen, da muss er links fahren, bis zum Spanierdenkmal, und dann wieder durch Libertador. Oder bei der Pferderennbahn in Palermo, mischte sich der Besitzer ein, aber lassen Sie sich bloß nicht spazieren fahren, sollen wir Sie nicht doch hinbringen? Elena sagte nichts mehr und ging, diese Frage hatte sie schon beantwortet, zweimal das Gleiche zu sagen war zu anstrengend für sie.
Constitución, Nueve de Julio, Libertador, Figueroa Alcorta, Planetarium, Spanierdenkmal, Libertador, Olleros, eine Holztür, Bronzebeschläge, eine Tür, Olleros, Libertador, Nueve de Julio, Constitución. Vorwärts, rückwärts. An welcher Stelle sie die Pferderennbahn in ihr Gebet aufnehmen soll, weiß sie nicht mehr. Sie wartet, denkt nach, zählt noch einmal die Straßen. Die fünf bis zum Bahnhof und die anderen, die sie nicht kennt oder nicht erinnert. Bis zur Straße, wo sie eine Schuld einfordern will, die ihr zusteht, wie sie meint – weil sie ihr einfach zustehen muss. Ein König ohne Krone. Sie versucht, den rechten Fuß zu heben, und der Fuß fühlt sich auf einmal angesprochen und erhebt sich. Es kann also losgehen.
Sie stützt sich mit je einer Handfläche auf ihre Oberschenkel, legt die Füße aneinander und schiebt sie nach vorne, bis ihre Beine an den Knien einen Neunzig-Grad-Winkel bilden, dann legt sie die rechte Hand über die linke Schulter und die linke Hand über die rechte Schulter, fängt an, mit dem Oberkörper vor- und zurückzuschaukeln, bis sie genug Schwung hat und aufstehen kann. Das lässt Doktor Benegas sie jedes Mal machen, wenn er zur Untersuchung kommt. Sie weiß, dass sie auf andere Art und Weise einfacher aufstehen könnte, aber sie versucht es immer wieder, beim nächsten Besuch soll der Arzt merken, dass sie trainiert hat. Sie will Doktor Benegas Eindruck machen, zeigen, dass es geht, trotz allem, was er bei der letzten Untersuchung, zwei Wochen bevor Rita tot aufgefunden wurde, gesagt hat. Vor dem Stuhl stehend, aus dem sie sich gerade erhoben hat, hebt sie den rechten Fuß, bloß ein paar Zentimeter, bewegt ihn vorwärts, gerade so weit am linken Fuß vorbei, dass man es als Schritt betrachten kann, dann setzt sie ihn ab. Jetzt ist der linke Fuß an der Reihe, er muss das Gleiche tun, genau das Gleiche. Sich erheben. Vorwärtsbewegen. Aufsetzen. Sich erheben, vorwärtsbewegen, aufsetzen.
Darum geht es. Bloß darum. Loslaufen, damit sie den Zug um zehn nehmen kann.
2
Rita starb an einem regnerischen Nachmittag. Auf dem Regal in ihrem Zimmer stand ein Seehund aus Glas, der rosaviolett anlief, wenn die Luftfeuchtigkeit sich der Hundertprozentmarke näherte, worauf es draußen unweigerlich zu schütten anfing. Am Tag ihres Todes hatte der Seehund diese Farbe. Rita hatte den Hund in Mar del Plata gekauft, wohin sie, wie alle zwei Jahre, in den Sommerferien gefahren waren. Alle zwei Jahre – in jedem Jahr mit gerader Endzahl – fuhren sie im Sommer weg, bis Elenas Krankheit diese Ausflüge in entwürdigende Unternehmungen verwandelte. In Jahren mit ungerader Endzahl blieben sie zu Hause und verwendeten das zurückgelegte Geld, um die Wände streichen zu lassen oder für unaufschiebbare Reparaturarbeiten, etwa wenn ein kaputtes Abflussrohr ausgewechselt werden musste oder die Sickergrube des Abortes zu erneuern war, weil sämtliche Würmer, die dafür gesorgt hatten, dass die Erdwände der alten Grube belüftet wurden, durch das Waschmittel zugrunde gegangen waren. Manchmal war auch eine neue Matratze fällig. Im letzten ungeraden Jahr mussten sie hinten im Hof fast die Hälfte der Fliesen austauschen, ein Baum – der gar nicht ihnen gehörte – hatte sie mit seinen Wurzeln gelockert, ein Paradiesbaum, der auf der anderen Seite der Mauer zum Nachbargrundstück stand und sich voller Tücke auf unterirdischem Weg bei ihnen breitgemacht hatte.
Sie hatten eine Zweizimmerwohnung in der Calle Colón gemietet, eine Querstraße, bevor es zu dem Hügel hinaufgeht, der auf der anderen Seite zum Meer hinabsteigt. Rita bezog das Schlafzimmer und Elena das Wohn- und Esszimmer: »Mama, du stehst immer so früh auf, da schläfst du besser neben der Küche, dann störst du mich nicht.«
Wie in jedem geraden Jahr hatte Rita die Anzeigen in der Zeitung angestrichen, in denen Ferienwohnungen angeboten wurden, die ihrem Budget entsprachen, und anschließend diejenige ausgewählt, deren Besitzer am wenigsten weit entfernt von ihnen wohnten. Auf diese Weise brauchten sie nicht so weit zu fahren, um zu bezahlen und sich den Schlüssel geben zu lassen. Was solls, ist doch eine wie die andere, für die Ferien ist es egal, ob ein Teller mehr oder weniger im Schrank steht. Und wie das Sofa bezogen ist, spielt auch keine Rolle.
Den Besuch bei den Vermietern erledigten sie gemeinsam. Obwohl sie die Wohnung in jedem Fall genommen hätten, ließen sie sich zuerst Fotos zeigen, Fotos, die nur sehr eingeschränkt der Wirklichkeit entsprachen, wie sich herausstellte, der Dreck war darauf nicht zu erkennen. Aber das machte nichts, Elena putzte gern, solange ihr Körper mitspielte. Es beruhigte sie, wundersamerweise nahmen dabei sogar ihre Rückenschmerzen ab. Ein Nachmittag, und die Ferienwohnung hatte ihre eigentliche Gestalt wiedergewonnen und blitzte.
An den Strand gingen sie nicht. Zu viele Leute, zu heiß. Rita hatte keine Lust, den Sonnenschirm zu schleppen, und ohne Schattengarantie wagte Elena es nicht, sich der Sonne auszusetzen. Der Tapetenwechsel tat ihnen trotzdem gut. Sie schliefen länger als sonst, zum Frühstück gab es ofenwarme Croissants, und sie kochten viel frischen Fisch. Wenn sich die Sonne nachmittags hinter den Appartementhochhäusern versteckte, brachen sie zu ihrem Spaziergang entlang der Rambla auf. Von Süden nach Norden gingen sie auf der Meerseite, und auf dem Rückweg von Norden nach Süden entlang der Avenida.
Dabei stritten sie. Immer, jeden Nachmittag. Wegen allem Möglichen. Der Anlass war egal, wichtig war nur die Form, die sie gewählt hatten, um sich auszutauschen: der Streit, ein Streit, der weit über das jeweils infrage stehende Thema hinausging. Er kaschierte eine Auseinandersetzung, die sich in ihrem Inneren abspielte, wo im Verborgenen jede ihre eigene Richtung einschlagen konnte. Jedes Wort bei diesem Streit kam wie ein Peitschenhieb, zuerst schlug die eine zu, dann die andere. Hieb um Hieb. Die Worte dienten ihnen als glühende Eisen, die sich der Gegnerin ins Fleisch brannten. Keine ließ sich den Schmerz anmerken, sie beschränkten sich darauf, Schläge auszuteilen. Bis eine der beiden, für gewöhnlich Rita, vom Kampf abließ – mehr aus Angst vor den eigenen Worten als vor dem selbst empfundenen oder zugefügten Schmerz – und zuletzt leise fluchend zwei Meter vor der anderen herlief.
Den gläsernen Seehund hatte sie damals am ersten Ferientag in einem Geschäft entdeckt, wo auch Halsketten aus Schneckenhäusern, Aschenbecher, mit Einlegearbeiten aus kleinen Muscheln verzierte Schmuckkästchen, Korkenzieher, deren erigierte Metallspirale die Anatomie eines Kindes, Pfarrers oder Gauchos an einer Stelle schmückte, die weder Elena noch Rita anzusehen wagten, und ähnliche Souvenirs verkauft wurden.
Rita blieb vor dem Schaufenster stehen, klopfte mit dem frisch gefeilten Nagel ihres Zeigefingers an die Scheibe und sagte zu Elena: »Den kauf ich mir, bevor wir zurückfahren.« Wetter-Seehund: blau – Sonne, rosa – Regen, stand in mit einem blauen Kugelschreiber geschriebenen Großbuchstaben auf dem Schild, das von innen ans Fenster geklebt war.
Elena hielt nichts von der Idee. »Vergeude dein mühsam verdientes Geld nicht für solch einen Quatsch.«
»Ich mache mir aber eine Freude damit, Mama.«
»Da gibt es schönere Sachen, nicht so was Mickriges.«
»Von mickrig musst du gerade reden.«
»Stimmt, mickrig ist schon dein Freund von der Bank.«
»Ich habe wenigstens jemanden, der mich lieb hat.«
»Wenn es dich glücklich macht, meine Liebe.«
»Mit dir werde ich jedenfalls wohl kaum je glücklich werden, Mama«, erwiderte Rita, im Glauben, Elena damit fürs Erste den entscheidenden Schlag verpasst zu haben, worauf sie sich mit betont ausgreifenden Schritten zwei Meter von ihr absetzte.
In ihrem Windschatten folgte Elena dem von der Tochter vorgegebenen Weg, darauf bedacht, den von dieser festgelegten Abstand beizubehalten, und schon nach wenigen Schritten holte sie zum Gegenschlag aus.
»Mit deinem miesen Charakter wirst du nie glücklich werden.«
»Woher habe ich den nur, Mama?«
»Schlaues Kind«, gab Elena zurück, und damit hatte es sich erst einmal ausgeredet.
Beim Hotel Provincial angekommen, machten sie kehrt und liefen zurück Richtung Süden. So ging es an allen restlichen Tagen. Spaziergang, Peitschenknallen, Abstand, und zuletzt Schweigen. Die Worte änderten sich, der Auslöser ihres Streits, aber der Ton, die Melodie, der Ablauf blieben immer gleich. Vom Seehund war nicht mehr die Rede.
Allerdings lachte Elena, als sie eines Nachmittags wieder an dem Souvenirgeschäft vorbeikamen, und sagte: »Bring doch Pater Juan den Korkenzieher mit dem Priester mit, wie wärs?«
Was ihre Tochter gar nicht witzig fand: »Du Ferkel, Mama.«
Bevor die zwei Ferienwochen um waren, kaufte Rita sich, genau wie angekündigt, den Wetter-Seehund. Sie bezahlte bar. Seit sie in der Schule fest angestellt worden war und ihr Gehalt auf ein Konto überwiesen bekam, hatte sie auch eine Kreditkarte, aber die ließ sie immer zu Hause, aus Angst, sie könne gestohlen werden. Sie sagte, sie sollten ihr den Seehund bitte mit viel Papier einwickeln, damit ihm auf der Heimfahrt nichts passiere. Statt Papier nahmen die Leute aus dem Laden ein Stück von dieser Plastikfolie mit kleinen Luftpolstern, die Rita später eins nach dem anderen platzen ließ. Im Bus bekam der Seehund einen Ehrenplatz, er durfte auf ihrem Schoß sitzen.
Elena hat ihn aufbewahrt, sie bewahrt alle Sachen von Rita auf. Sie hat alles zusammen in eine Pappkiste getan, die ein Nachbar ihr geschenkt hat, die Kiste von einem Fernseher mit 29-Zoll-Bildschirm. Der Nachbar wollte sie vor die Tür stellen, zum Müll, und Elena fragte ihn, ob sie sie nehmen könne. »Für Ritas Sachen«, sagte sie, und der Nachbar gab ihr wortlos die Kiste, es war, als würde er ihr sein Beileid ausdrücken. Er half ihr sogar, sie in die Wohnung zu tragen.
Dorthinein tat Elena alles, bis auf die Kleider; die Kleider nicht, das konnte sie nicht, die rochen immer noch nach ihr, nach ihrer Tochter. Kleidung riecht immer so, wie der Tote gerochen hat, als er noch am Leben war, da weiß Elena Bescheid. Man kann die Kleider noch so oft waschen, egal mit welchem Waschmittel, es bleibt dieser Geruch, der nicht von einem bestimmten Parfum kommt, oder von einem Deodorant, oder von dem Waschmittel, mit dem die Kleidung gereinigt wurde, als es noch jemanden gab, der sie schmutzig machte. Es ist nicht der Geruch des Hauses oder der Familie, denn Elenas Kleidung riecht anders. Es ist der Geruch des Toten, als er noch lebte. Ritas Geruch. Ihn zu riechen, ohne gleich danach ihre Tochter vor sich zu haben, das wäre zu viel für sie gewesen. Mit der Kleidung ihres Mannes war es ihr genauso ergangen, aber damals wusste sie nicht, dass es noch viel stärker wehtut, wenn es sich um den Geruch eines Kindes handelt.
Die Kleidung also nicht einpacken. Der Kirche wollte sie sie auch nicht überlassen, nicht dass eines Tages Ritas grüner Pullover um die Ecke bog, am Körper von jemand anderem. Sie schichtete die Kleider im Hof zu einem ordentlichen Stapel auf und verbrannte sie. Sie brauchte vier Streichhölzer, um das Feuer in Gang zu bringen. Zuerst ging ein Paar Nylonstrümpfe in Flammen auf, sie schmolzen und verwandelten sich in synthetische Lava. Dann griff das Feuer nach und nach auf den Rest über. Aus der Asche tauchten das Drahtgeflecht eines Mieders auf, einige Druckknöpfe, Reißverschlüsse. Sie gab das Ganze in einen Abfallsack und stellte ihn vor die Tür, für die Müllabfuhr.
Die Kleidung kam also nicht in die Kiste von dem Nachbarn. Die Schuhe schon, auch ein Paar ungetragene, geruchlose Wollhandschuhe, dazu alte Fotos, Ritas Telefonbuch, ihre Dokumente, bis auf den Personalausweis, den sie den Leuten von der Bestattungsfirma hatte aushändigen müssen, damit sie die Formalitäten erledigen konnten, ihr Terminkalender, ihre Bankauszüge, eine halb fertige Strickarbeit, das Foto aus der Lokalzeitung, auf dem man sie und ihre Lehrerkollegen auf dem Schulhof sieht, an dem Tag, als die neuen Klassenräume der Sekundarstufe eingeweiht wurden, die Bibel mit der Widmung von Pater Juan – Möge Gottes Wort dich geleiten, wie es deinen Vater geleitet hat –, die Lesebrille, die Tabletten für die Schilddrüse, ein Heiligenbildchen von San Expedito, das ihr die Frau vom Schulsekretariat geschenkt hatte, als sich die Entscheidung über Elenas Rente in die Länge zog, die Geburtsanzeige aus der Zeitung von Isabels Tochter. Isabel und Marcos Mansilla freuen sich, die Geburt ihrer Tochter María Julieta bekannt zu geben, Ciudad de Buenos Aires, am 20. März 1982.