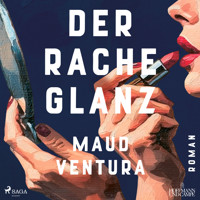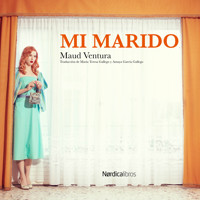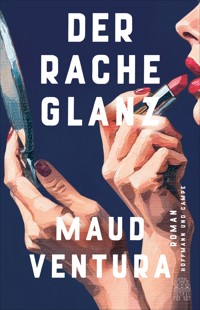
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie muss berühmt werden – dafür ist sie zu allem bereit Cléo weiß schon früh, dass sie den fürchterlich durchschnittlichen Verhältnissen, in denen sie aufwächst, entkommen will. Spätestens als sie bei einer banalen Modenschau von einer Mitschülerin ausgestochen wird, reift in ihr die Erkenntnis, dass sie sich rächen muss. Ihre Vendetta heißt: Berühmt werden. Als Popsängerin. Unerbittlich arbeitet Cléo jahrelang an ihrem Timbre, ihren Lyrics, ihrem Charisma, überhaupt an ihrer Außenwirkung bis ins winzigste Detail. Immer obsessiver verfolgt sie ihr einziges Ziel, geht dabei immer strenger mit sich selbst ins Gericht. Und während sie dem Weltruhm näher kommt, steigt der Preis dafür ins Unermessliche. Der Rache Glanz ist ein mitreißender, messerscharfer Roman über unsere dem blendenden Glanz des schönen Bilds verfallene Zeit und Maud Ventura eine der aufregendsten französischen Autorinnen ihrer Generation. »Jede Seite ein Peitschenhieb.« Libération »Herrlich bissig - beeindruckend!« Le Telegramme »Ein Volltreffer.« People
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Maud Ventura
Der Rache Glanz
Roman
Michaela Meßner
Für Mein Mann
Il est heureux, malheureux comme nous
Il cherche ce qu’il voudrait comme nous
Mais quelque chose l’emporte au-dessus
de tout
Celui qui chante
Michel Berger, »Celui qui chante« (1980)
Berühmt zu sein ist mein Leben. Ich wusste, dass ich es werden würde, ich habe alles dafür getan. Ob ich auf einen derartigen Erfolg vorbereitet war? Aber sicher! Ich bin immer der Meinung gewesen, dass mich keine Existenz erwartete, sondern ein Schicksal. Mein Weg würde außergewöhnlich sein, meine Karriere alle Normen sprengen.
Wenn man sich die Frage stellt, was eine Berühmtheit ausmacht, denkt man an Pailletten, Glamour, Reichtum, treu ergebene Fans, an Prestige und Anerkennung. Dabei müsste man auch das ständige Überlegenheitsgefühl erwähnen, den Personenkult, den Geldrausch, die endlosen Kommentare, die Eitelkeit, die Heuchelei, die Straffreiheit. Berühmtsein ist eine harte Droge, ein wildes Monster. Und ich habe es mir mit aller Wut geholt, mit Zähnen und Klauen.
Der enorme Ruhm hat die Bestie in mir befreit, erbarmungslos und grausam. Ich kann es auch gleich offen sagen: Ich habe mir die Hände schmutzig gemacht. Auf meinem Level haben alle Leichen im Keller. Wer das Gegenteil behauptet, lügt. Der Ruhm ist eine Kriegsbeute – niemand ist je bereit, ihm den Rücken zu kehren.
Mit zweiunddreißig throne ich hoch oben auf einem Schloss, das ich nur mit meinen Songs errichtet habe. Ich glaube nicht an das Glück. Ich glaube nicht an Vitamin B, an ein Netz einflussreicher Freunde. Ich glaube nicht an die gläserne Decke. Meinen Erfolg verdanke ich einzig und allein meinem Talent, meinem Charakter – und der Meritokratie. Wäre ich also am Abend meiner letzten Preisverleihung aufrichtig gewesen, hätte ich mich in meiner langen Rede nur bei einer Person bedankt: bei mir selbst.
Drei Wochen auf einer einsamen Insel mitten im Pazifischen Ozean. Ohne Wasser und Strom, ohne jeden Kontakt zur Außenwelt. Genau diese Art von Fantasie kann man sich als Celebrity einfach kaufen. Wenn man alles hat, muss man bei der Wahl des Sommerurlaubs schon ein bisschen Einfallsreichtum beweisen.
Gestern habe ich zehn Stunden in einem Privatjet gesessen. Wir landeten in der Nähe von Tahiti oder den Fidschi-Inseln, vielleicht war es auch Hawaii. Ich stieg in ein anderes Flugzeug um, und dann in ein Wasserflugzeug. Eine Stunde später tauchte die Insel auf: ein in den unendlichen Weiten verlorenes Atoll.
Wasser, so weit das Auge reicht, weißer Sand, prächtige Lagunen, ich spaziere durch eine Postkartenidylle. Schwärme von Seevögeln legen am Strand einen Zwischenstopp ein, die Natur ist üppig, man ahnt, dass es hier oft heftig gießt, die Regenwasserzisterne ist voll. Kokospalmen, Bananenstauden, Orangenbäume, verhungern werde ich hier nicht. Den Blick in die Ferne gerichtet, suche ich den Horizont nach Land, nach einem Ankerpunkt ab. Es gibt keinen.
In den nächsten drei Wochen wird mein einziger Unterschlupf eine Hütte am Strand sein. Sie ist bezaubernd, auf Pfeilern errichtet, hat eine Terrasse mit Blick auf den Ozean. Die hohe, schräge Holzkonstruktion stützt ein Dach, das mit den geflochtenen Blättern tropischer Pflanzen gedeckt wurde. Darin nur ein spärlich möblierter Raum: ein einfaches Bett, eine Kommode, ein Tisch, zwei Stühle. Die Vorräte befinden sich in einem Schrank: Reis, Obst, getrockneter Fisch, Wurzelknollen, Konservendosen, hundert Liter Mineralwasser. Ich öffne die Schubladen, um meine Inventur zu vollenden, breite die magere Beute auf dem Boden aus: ein Kocher, zwei Gasflaschen, Schwimmflossen, eine Tauchermaske, eine Taschenlampe, eine Machete, eine Streichholzschachtel, eine Fliegenklatsche, ein Wasserfilter, eine Angelschnur, ein Globus, eine Bibel. Kahle Wände, keinerlei Dekoration, keine Uhr, kein Spiegel. Ziemlich rustikal für einen 500000-Dollar-Urlaub. Aber das ist ja kein Geheimnis: je teurer, desto weniger WLAN. Ich zahle einen hohen Preis, um mitten im Nirgendwo zu sein, unerreichbar für Blicke, Handys und die Kameraobjektive der Paparazzi – und die unablässige Inanspruchnahme durch meine Crew. Dieses Jahr mache ich mir das schönste Geschenk überhaupt: Sie können mir alle mal den Buckel runterrutschen.
Vor sechs Monaten erfuhr ich zum ersten Mal von dieser Insel. An dem Abend hatte ich einen mit Spannung erwarteten Auftritt auf dem Fest nach der Preisverleihung, bei der ich wieder einmal groß abgeräumt und eine Dankesrede nach der anderen gehalten hatte. Kurz zuvor hatte ich, Trophäe in der Hand, viermal meinem Publikum gedankt, mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen. Das ist das Erste, was man lernen muss: auf Befehl zu weinen. Man weiß ja, wie der Hase läuft. Man muss so tun, als sei man gerührt und aufgeregt, im Triumph bescheiden bleiben, allen weismachen, dass man seine Musik nur für die Fans macht, sich bei den Teams im Hintergrund bedanken und dabei eine lange Liste von Namen aufzählen, die niemandem irgendetwas sagen.
Natalie Holmes steht bei der After-Show-Party an der Bar, einen Champagnerkelch in der Hand. Ich habe sie schon über ein Jahr nicht mehr gesehen, ein Jahr, in dem viel los war: Trennung, Verrat, Medienrummel, Dramen, triumphaler Release des dritten Albums. Natalie Holmes und ich hatten früher eine Handvoll gemeinsamer Freunde, aber diese Freunde wurden zu Feinden, daher könnte ich drauf wetten, dass sie so tun wird, als hätte sie mich nicht gesehen, den Blick auf ihre Jimmy-Choo-Pumps gesenkt. Wette verloren. Sie kommt mit einem breiten Lächeln auf mich zu. Es ist schon verrückt, wie schnell der Erfolg alte Feindschaften ins Land des Vergessens schickt. Meine neue Assistentin flüstert mir den Titel des letzten Films ins Ohr, in dem sie eine Rolle hatte, den Namen des Regisseurs, das Premierendatum. Ich bin ja gerne bereit, Konversation zu treiben, aber ein Minimum an Fakten muss man mir schon geben.
Natalie beglückwünscht mich als Erstes zu meinem Album (als Einstieg nicht sehr originell) und zu den vier Awards, die ich heute Abend kassiert habe (wie platt), dann gesteht sie mir, dass sie oft an unsere Gespräche bei John Cutler in Los Angeles denken muss (ich habe nicht die geringste Erinnerung daran). Ihre Robe schneidet ihr deutlich in die Arme – und ich mag ja Bustierkleider, aber sie schmeicheln nicht jedermann (was hat ihr Stylist da nur verbrochen?). Ich beiße die Zähne zusammen, um nicht zu gähnen, und wäre gern überall, nur nicht hier bei dieser Plauderei mit einer abgeschmackten Schauspielerin. Ich will mich gerade freundlich verabschieden, als das Gespräch eine unerwartete Wendung nimmt. Natalie Holmes legt mir vertraulich eine Hand aufs Handgelenk und fängt an, mir von ihrem letzten Urlaub zu erzählen.
»Eigentlich war es kein richtiger Urlaub, eher ein Experiment«, murmelt sie.
»Inwiefern?«
»Ich darf nicht mehr darüber verraten, aber ich schwöre dir, es hat mein Leben verändert.«
»Tatsächlich?«
»Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mich so umhauen würde … Ich kann dir die Nummer geben, wenn du magst.«
»Ja, warum nicht.«
»Aber ich garantiere für nichts. Das läuft nur über Mundpropaganda, es gibt extrem wenige Plätze. Ich habe gehört, Selena Gomez wartet schon seit Monaten auf ihre Chance.«
Wenn ich Natalie Holmes glauben darf, gibt sich die ganze Elite von Hollywood an diesem Ort, der »top secret« und »hochexklusiv« ist, die Klinke in die Hand. Das ist natürlich genau das, was man mir erzählen muss, damit ich unbedingt auch dabei sein will. Keine Mega-Yacht, keine Villa auf den Bahamas, kein Schloss in der Toskana, aber drei Wochen auf einer Privatinsel im Pazifik. »Ein Abenteuer à la Robinson Crusoe«, »ein spirituelles Retreat«, »ein Ende-der-Welt-Erlebnis«, »ein so abgeschiedener Ort, dass nichts anderes mehr existiert«. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Natalie Holmes den Sommer ohne Klimaanlage und Harpunenfischen verbringt, aber warum nicht? »Genau da hatte Christopher Nolan die Idee für seinen Film Interstellar«; »Taylor Swift stellt einmal im Jahr ihre Koffer dort ab, lädt ihren Akku wieder auf und findet Inspiration für neue Songs«; »Die Insel hat angeblich mal Francis Scott Fitzgerald gehört, er soll dort die ersten Kapitel von The Great Gatsby geschrieben haben.« Ich wage das zu bezweifeln, meines Wissens ist der amerikanische Autor nie reich geworden, aber Natalie Holmes weiß, mit welchen Argumenten man mich ködern kann, Fitzgerald ist mein Lieblingsschriftsteller.
Mit einem Funkeln in den Augen und einem bedeutungsschwangeren Lächeln fügt sie hinzu: »Die Eingeweihten nennen sie die Insel der Meisterwerke … Es wird sich bestimmt rumsprechen, aber momentan ist der Ort noch geschützt, das muss man doch ausnutzen. Es ist absolut zauberhaft dort.«
»Was du nicht sagst.«
Ich fühle mich tief getroffen. Gestern bin ich Selena und Taylor begegnet, wieso haben sie mir nichts davon erzählt? Und außerdem, warum weiß eine Schauspielerin wie Natalie Holmes, die weder meine Aura noch meinen Einfluss hat, vor mir darüber Bescheid? Als sie sich verabschiedet, nimmt sie mir übrigens noch das Versprechen ab, es nicht weiterzusagen. Sie hat eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet, hart wie Stahlbeton. Sollte ich das Glück haben hinzufahren, würde man mir auch eine vorlegen. Der Ort wird geheim gehalten, es gibt keinerlei Informationen im Internet, ein knallhartes Auswahlverfahren. Der Reiz des Mysteriums.
Eines Abends, ich bin ziemlich kaputt, gebe ich einem plötzlichen Impuls nach und wähle die Nummer. Ich stecke gerade mitten in der Werbekampagne für mein drittes Album und wurde den ganzen Tag nur von Dumpfbacken belagert, von denen keine in der Lage war, meine Anweisungen korrekt auszuführen. Die Leute um mich herum sind alle entweder inkompetent oder faul, und die Woche endet in einem Klima der Angst. Musik wirkt sich ja angeblich positiv aufs Gemüt aus – dass ich nicht lache! Durch die Schnelligkeit und den Druck werde ich unausstehlich. Als ich wieder alleine in meinem Hotelzimmer in Las Vegas bin, betrachte ich mich im Spiegel, während ich warte, dass jemand rangeht, vergebens. Auf einem rätselhaften Anrufbeantworter, der einen Bibelvers zitiert, hinterlasse ich eine Nachricht.
Feiner Sand, türkisblaues Wasser, absolute Stille. Ich schwimme eine ganze Weile langsam vor mich hin, erst Brust, dann Rücken. Ich denke an die Strömungen, die mich ins offene Meer hinausziehen könnten, an die Tiefenwellen beim Korallenriff, an Fische, deren Rückendornen ein tödliches Gift enthalten. Der Thrill ist Teil des Vergnügens.
Nach meinem Bad knote ich unter der Außendusche, einer spartanischen Installation hinter der Hütte, meinen Badeanzug auf. Das von der Sonne erwärmte Regenwasser ist lauwarm, die Seife schäumt im Kontakt mit meiner Haut, ich seufze glückselig. Endlich einmal kein Paparazzo, der sich hinter einem Felsen versteckt, um meine Brüste zu fotografieren, ich muss nicht einmal den Bauch einziehen.
Den restlichen Tag baue ich an einer Sandburg. Wie damals am Strand der Île d’Oléron, als ich noch ein Kind war, häufe ich nassen Sand auf, ziehe Wassergräben, befestige meine Burg, in aller Ruhe, konzentriert, bevor ich Muscheln suchen gehe, um damit meine Türmchen zu dekorieren. Eine nutzlose, beliebige Tätigkeit, die ich nur für mich mache. Die Freude, etwas zu tun, ohne dabei brillieren zu müssen. Ist es zwei Uhr oder schon fünf? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Mechanisch lasse ich die Hand in meine Tasche gleiten und taste nach meinem Handy. Es wird einige Tage dauern, bis ich diesen Reflex werde unterdrücken können.
Einen Tag vor meiner Abreise wurde meine Tasche von einem Mann im weißen Polohemd gründlich durchsucht. Ich durfte kein Handy, keinen Computer, keinen Fotoapparat oder sonstiges elektronisches Gerät mitnehmen. Er hat auch meine Uhr konfisziert. Alles nach dem Motto: offline sein. Nicht erreichbar. Von der Bildfläche verschwinden. Keine Anrufe meiner Assistentin, kein Social Media, keine Verpflichtungen. Nichts als Ruhe und Gemütlichkeit.
Einzige Ausnahme meiner selbstgewählten Einsamkeit: ein Notfallsatellitentelefon, schwarz, mit Antenne, das in einem Schrank neben der Reiseapotheke liegt. Ich kann mir unschwer vorstellen, dass einige der Berühmtheiten, die sich diese besondere Erfahrung gönnen, nach achtundvierzig Stunden in die Knie gehen. Wahrscheinlich fragen viele, ob sie nicht doch früher nach Hause können, aus Angst vor einer bösen Spinne oder gequält von tödlicher Langeweile. Denn ich habe keinen Zweifel, dass diese drei Wochen auch eine Herausforderung sein werden. Einsamkeit ist eine andere Art von Hölle.
Doch momentan bin ich im Paradies. Seit ein paar Monaten sehne ich mich nicht mehr nach weiteren Trophäen, sondern träume davon, einmal Pause zu machen. Die Leute um mich herum sind der Ansicht, dass ich reizbar, ungeduldig und unausstehlich geworden bin. Sie haben keine Ahnung, niemand kann verstehen, was ich alles durchmache. Das einzige halbwegs stimmige Bild ist: Ich stecke in einer Waschmaschine, und das Programm läuft seit sieben Jahren.
Öffentlich würde ich es niemals zugeben, aber ich bin erschöpft. Ich war bereit, alle Schlachten zu schlagen, um berühmt zu werden, habe mir aber nicht vorstellen können, was ich alles tun müsste, um es auch zu bleiben.
Über dem Ozean geht die Sonne zum ersten Mal unter. Am Fuß meines Bettes steht mein offener Koffer, das Feuer, das ich aus Unterholz und Reisig gemacht habe, knistert am Strand. Die Gitarre auf den Knien, taste ich mich an den Anfang einer Strophe heran, neben mir liegt ein Heft bereit. Dieser paradiesische Rückzugsort wird mir bestimmt genug Material liefern, um mein viertes Album zu schreiben – ich habe mich auf eine Insel zurückgezogen, ein Schweigegelübde musste ich nicht ablegen. Nach Einbruch der Dunkelheit macht das Meer dem Himmel Platz, ich entdecke darin Tausende von unbekannten Sternenkonstellationen, deren Geometrie mir fremd ist. Ich befinde mich irgendwo in der südlichen Hemisphäre.
Die Flammen werfen sägezahnartige Schatten auf den Sand, mir läuft ein Schauder über den Rücken, und ich drehe mit den Fingerspitzen den Globus, den ich in der Hütte gefunden habe. Er stammt aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts; es sind Länder abgebildet, die inzwischen verschwunden sind, Akronyme einer anderen Zeit, ich suche Grenzen, die es noch gar nicht gab. Fahre mit dem Zeigefinger über die Breitengrade und Meridiane und versuche mich auf der Himmelskugel zu verorten. Die Insel ist höchstwahrscheinlich gar nicht eingezeichnet. Ich bin nur ein Punkt in der unendlichen Weite des Pazifiks, aber wo? Vor meinem Blick zeichnen sich die Umrisse der Staaten ab, die ersten Kontinentalküsten sind wahrscheinlich über viertausend Kilometer von hier entfernt, irgendwo in Südamerika oder Ozeanien.
Was mache ich hier? Und überhaupt, wie bin ich hier hergekommen? Mich überkommt ein Schwindel, zur Beruhigung streiche ich über die Narben auf meinen Oberschenkeln, meinem Schädel, meinen Händen, meinen Armen, meinen Knöcheln. Sie alle markieren Stationen meines Lebenswegs, in sämtlichen Etappen hin zum Ruhm.
Berühmtheit hat einen Preis, und den zahlt man jeden Tag aufs Neue.
Teil EinsDer Glaube
Ich heiße Cléo Louvent Johnson. Meine Mutter ist Französin, mein Vater Amerikaner; ich switche mit Leichtigkeit zwischen beiden Sprachen hin und her. Meine Mutter ist Statistikerin, mein Vater Ägyptologe; ich werde mit Zahlen und Hieroglyphen groß, wachse in einer Wohnung voller Bücher auf, in einer ruhigen Ecke des 14. Arrondissements von Paris. Mein Vater, der mich zärtlich Cleopatra nennt, pinnt meine Zeichnungen von Pyramiden und Sphinxen an die Magnetwand in der Küche. Samstags nimmt meine Mutter mich in die Stadtbücherei unseres Viertels mit; auf dem Rückweg machen wir einen Abstecher zu den Graureihern im Montessori-Park.
Ich bin vier Jahre alt, mein Vater erzählt mir in meinem Zimmer eine Geschichte. Die Bücher, die er kommentiert, damit wir sie verstehen, sind meine Lieblingsbücher. Als Spezialist für Ägypten und leidenschaftlicher Anhänger der Antike in jeder Form schildert er mir das Unglück, das Isis und Osiris widerfahren ist, ihren Kampf gegen Seth, aber auch die Irrfahrten des Odysseus und die Kindereien der Götter des Olymp; wenn er die Heldentaten von Ramses II., Perikles und Alexander dem Großen schildert, hänge ich gebannt an seinen Lippen. Diese Erzählungen sind für ihn ein willkommener Vorwand, einen großen Umweg über die Geschichte zu machen, und seine epischen Schilderungen sind voll von Gestalten, die außerordentliche Dinge wagen, und von wundersamen Tieren. Es ist bald Schlafenszeit, mein Vater deckt mich zu, ehe er das Licht ausschaltet, als er merkt, dass ich unruhig bin. Er will den Grund wissen, und ich gestehe ihm schließlich: »Papa, ich wäre gern so berühmt wie Céline Dion«.
Ich habe keinerlei Erinnerung daran, aber meine Eltern haben sich lange einen großen Spaß daraus gemacht, diese Anekdote, über die viel gelacht wurde, immer wieder zu erzählen. Ich ahne, dass es sie ein bisschen traurig gemacht hat und dass sie auch ein bisschen überrascht waren. Wo hat sie das bloß her?
Meine Eltern leben im Mikrokosmos ihrer Universitätsrecherchen, ihrer Publikationen, ihrer Konferenzen. Sie wissen nicht, welche Persönlichkeiten gerade in Mode sind – wenn die Idole des Jahrhunderts ihnen auf der Straße über den Weg laufen würden, sie würden sie gar nicht erkennen. Der rote Teppich, Promipaare, Hollywood, Privatjets, Boulevardblätter: für sie ein exotisches Land, in dem sie auf keinen Fall ihren Urlaub verbringen möchten.
Wenn ich meine Eltern vor dem Schultor stehen sehe, wirken sie auf mich älter als die anderen. Meine Mutter erklärt mir, ihre Schwangerschaft habe nicht neun Monate gedauert, sondern neun Jahre. Ich werde ihr einziges Kind bleiben. Sie machen kein Geheimnis daraus, dass meine Mutter Schwierigkeiten hatte, schwanger zu werden, in meinem Wikipedia-Eintrag steht, ich sei das Kind einer In-vitro-Fertilisation. Aus einem obskuren Grund lässt dieses Detail den Zauber, der meine Geburt umgibt, noch größer erscheinen: Musste sich die Wissenschaft einmischen, um ein so außergewöhnliches Wesen wie mich hervorzubringen?
Ich bin ein kleines Mädchen mit kurzen Haaren, brav, einzelgängerisch, das sich Platanenblätter in ihre Manteltaschen stopft, um ihren Puppen einen Salat zu machen. Meine Eltern hören mich in meinem Zimmer mit mir selbst reden, und es fällt ihnen auf, dass ich vor dem Spielen immer die Tür zumache.
Sie ahnen nicht, dass ihr geliebtes Kind an seinen Mittwochnachmittagen ganze Hefte mit Proben für eine Starunterschrift füllt. Als ich sieben bin, übe ich mich darin, so schnell wie möglich ganze Autogrammserien zu Papier zu bringen. Im Jahr darauf gebe ich mein erstes Interview. Die Fragen fallen mir ganz spontan ein, meine Antworten arbeite ich sorgfältig aus, auf Französisch, auf Englisch. Die Plüschtiere zu meinen Füßen – Igel, Wal, Marienkäfer und Eichhörnchen – hören mir aufmerksam zu. Meine wunderbare Menagerie ist ein aufmerksames Publikum, das beste, das ich mir erträumen kann.
Ich singe auch zusammen mit meinen Superstars, spiele ihre Musik auf dem CD-Spieler, der neben meinem Schreibtisch auf dem Boden steht. Ich kenne alle Texte auswendig, lese sie vom Booklet ab, im Schneidersitz auf dem hellblauen Teppich meines Schlafzimmers sitzend. Als ich dann ein Teenager bin, übernimmt die Website »paroles.net« mit ihren Tausenden von archivierten Songtexten. Ich werde, völlig gebannt, Stunden damit zubringen.
Wie oft habe ich schon Journalisten meinen Werdegang geschildert. Wie oft im Interview meine Vergangenheit erzählt. Wie oft an diesem gefährlichen Spiel teilgenommen, dessen Tragweite mir nicht bewusst war.
Ich habe mein Leben ein bisschen romantischer dargestellt, meine Antworten ein bisschen aufgehübscht, um genialer und beeindruckender zu wirken. Alles, was nicht in meine Legende passte, habe ich weggelassen, nicht mehr darüber gesprochen und mich nach und nach auch nicht mehr daran erinnert. Ich habe mir falsche Erinnerungen zugelegt. Auf der Suche nach einem saftigen Detail oder einer bewegenden Geschichte habe ich die Vergangenheit anderer Menschen, Bücher und Filme ausgeschlachtet, und am Ende sogar selbst vergessen, was wirklich zu mir gehörte.
Erinnerungen sind flüchtig, um sich das bewusst zu machen, muss man nur ein und dasselbe Ereignis mehrfach erzählen. Nach der dritten oder vierten Wiederholung beginnt die Vergangenheit sich neu zusammenzusetzen. Ganz allmählich ändert man die Lichtverhältnisse, lässt bestimmte Details weg, verstärkt die dramatische Wirkung, um seine Zuhörerschaft zu fesseln. Man verwandelt die Vergangenheit in Geschichte. Und je öfter wir eine Erinnerung erzählen, desto stärker nimmt sie Schaden. Es gibt Anekdoten, die ich so oft wiederholt habe, dass ich nicht mehr weiß, ob sie wahr oder falsch sind.
Es ist verlockend, sein Leben umzuschreiben, ich habe das oft getan. Es gibt sehr früh schon endlos viele Hinweise auf mein späteres Schicksal: die frühreifen Interviews vor meinen Plüschtieren, meine ungewöhnliche Mezzosopranstimme, meine Faszination für Songtexte, mein musikalisches Gehör, mein Talent fürs Klavierspiel, die Ermutigungen meines Gitarrenlehrers, meine soliden Grundlagen in Musiktheorie, meine Leidenschaft für den Chor. Es ist so viel einfacher, den Weg in umgekehrter Richtung zu gehen. Mit sieben Jahren mache ich zum ersten Mal Musik, aber davon darf man sich nicht täuschen lassen. Da, wo ich herkomme, ist das Konservatorium eine normale außerschulische Aktivität für gute Schüler. Meine Eltern haben nicht den Ehrgeiz, eine Berühmtheit aus mir zu machen, indem sie mich dazu anspornen, ein Instrument zu lernen – wir sind nicht in Los Angeles, bei uns ist Musikmachen ein bürgerlicher Reflex und keine Ermutigung, ein weltberühmter Popstar zu werden.
Mein Wunsch, Berühmtheit zu erlangen, kommt nicht von meiner Familie, sondern von meinen Schwachstellen. Mein Leben lang werde ich versuchen, von Millionen unbekannter Menschen bewundert zu werden, werde allen, die meinen Weg kreuzen, Respekt abverlangen. Dem Bäcker, der Apothekerin, meiner Lehrerin in der Grundschule, dem Nachbarn aus dem dritten Stock. Ich habe nur ein Ziel: dass alle meine Überlegenheit anerkennen.
Über die mentalen Probleme von Promis wird viel geredet. Wie viele werden zu Alkoholikern, werden suchtkrank, driften in die Depression ab, bringen sich um? Der Ruhm macht einen verrückt – und man muss verrückt sein, um berühmt sein zu wollen. Das öffentliche Leben ist ein Honigtopf, der Narzissten, Perverse und Soziopathen anzieht. Ausgeglichene Menschen haben nicht dieses Bedürfnis, wie ein Vampir anderen die Liebe auszusaugen.
Ich muss wieder an dieses kleine vierjährige Mädchen denken, das seinem Vater gesteht, wie traurig es ist, nicht berühmt zu sein. In diesem Verlangen, bewundert und bejubelt zu werden, Applaus zu bekommen, lag ein Bedürfnis, das schon immer die normalen Proportionen sprengte.
»Als ich Cléo Louvent zum ersten Mal begegnet bin, wusste ich sofort, dass sie berühmt werden würde.« In den Artikeln, die über mich geschrieben werden, findet sich immer ein ehemaliger Lehrer oder Klassenkamerad, der behauptet, mein Potenzial sei für alle offensichtlich gewesen. In Wirklichkeit hätte niemand auf mich gewettet. Ich bin ein ganz gewöhnliches Kind gewesen, schüchtern und nicht besonders hübsch.
In meinen ersten Zeugnissen stehen exzellente Noten, aber man ermuntert mich, im Mündlichen etwas aktiver zu werden. Ich verstecke mich hinter meinen guten Noten – ich verdanke sie meinem nicht enden wollenden Perfektionismus. Sobald ich in meinem Schulheft einen Fehler mache, reiße ich die Seite heraus und fange noch einmal von vorne an.
Mit acht lässt man mich eine Klasse überspringen, plötzlich sitze ich neben der schönen Juliette Marchand. Meine neue beste Freundin ist das gerade Gegenteil von mir: beliebt, eine Plaudertasche, laut. Ihre Leichtigkeit beeindruckt mich. Meine Mutter findet, sie habe eine nervtötende Neigung, sich in Szene zu setzen. Mein Vater hat die gleiche Aversion gegen Leute, die laut sind oder im Mittelpunkt stehen wollen. Wenn ich mich zu Hause wie Juliette aufführen würde, würde man mir trocken erwidern: Hör auf, dich interessant zu machen.
Juliette teilt ihre Zuneigung zwischen Lydia, Clementine und mir. Mit anderen Worten, ich gehöre zu ihren Hofdamen und fürchte in jeder Pause, nicht mehr ihre Favoritin zu sein. Als Juliette rumschwadroniert, wie wichtig es sei, einen Jungen geküsst zu haben, bevor man auf die Mittelschule geht, stehe ich hinter ihr und nicke schweigend. Sie fängt an, mich Cléou zu nennen, ich hasse das, aber auch dazu sage ich nichts.
An einem Montag im Oktober beschließt Juliette, mit mehreren Mädchen aus der Klasse eine Modenschau aufzuziehen. Die Show soll am nächsten Sonntag bei ihr stattfinden, vor ihren Eltern und ihren Freunden. Auf dem Schulhof sprechen wir die ganze Woche lang über nichts anderes. Mit zehn Jahren gibt es nichts Wichtigeres, das könnt ihr mir glauben.
Der große Tag kommt, mein Vater setzt mich bei Juliette ab, meine schönsten Kleider liegen zusammengefaltet in meinem Rucksack. Um mir meinen Platz beim Catwalk zu sichern, habe ich so getan, als besäße ich eine Schlaghose; dort angelangt tue ich so, als hätte ich sie vergessen. Im Badezimmer überrasche ich Lydia dabei, wie sie sagt, ich sei eine dreckige kleine Lügnerin: Diese Schlaghose gebe es gar nicht. Clementine haut in die gleiche Kerbe – sie behauptet, ich hätte eine tiefe Stimme wie ein Junge und Haare auf dem Hintern. Juliette tritt entschieden für mich ein: Die Königin schützt ihre Favoritin und befiehlt den Frieden. Ich schlucke hinter der Tür meine Tränen hinunter.
Juliette dirigiert das Event, bestimmt die Reihenfolge des Auftritts, legt die Musik auf. Ihr Zimmer dient uns als Backstage-Bereich, wir ziehen uns dort eilig um, jede von uns hat das Recht auf vier Auftritte. Sie eröffnet den Ball mit einem Volantrock und einem orangenen Tanktop, die blonden Haare flattern im Rücken. Eine halbe Stunde später stockt mir vor Eifersucht der Atem, als sie die Modenschau mit einem nachtblauen Kleid mit zarten Trägern beschließt. Juliette läuft selbstsicher durch den Applaus, dreht sich einmal um sich selbst, blinzelt den hingerissenen Erwachsenen verschwörerisch zu. Am Montag darauf klaue ich ihr mittags das Pausenbrot und spucke ihr in den Ranzen.
Um berühmt zu werden, muss man Rachegedanken in ausreichender Zahl sammeln, monatelang vor Frust kochen, jahrzehntelang im eigenen Saft schmoren. Die Jahre, die ich im Schatten meiner besten Freundin verbracht habe, haben mir die nötige Ausdauer für die Jahre im Licht gegeben. Es ist kein Zufall, dass ich in der Frühphase meines Ruhms beschließe, mir die Haare blond färben zu lassen, wie Juliette. Ich habe noch eine Rechnung offen, und die beschränkt sich nicht auf die Haare.
Wenn ich abends im Bett liege, nehme ich es meinen Eltern übel, mir diesen zu kurzen und lächerlichen Vornamen gegeben zu haben. Warum Cléo? Ich würde lieber Juliette heißen, Mathilde, Émeline oder Éléonore. Ein Mädchenname, ein Prinzessinnenname, verspielt, bedeutsam (mindestens drei Silben}. Ich bin eifersüchtig und gehässig, ich hoffe, dass niemand zu Juliettes Geburtstag kommt oder noch besser, dass sie mir verkündet, ihre Mutter sei gestorben. Und dann male ich mir meine Vergeltungsfantasien genüsslich aus, fahre zärtlich mit den Fingerspitzen darüber. Wenn ich einmal auf dem Gipfel angekommen bin, werde ich für alle, die mich unterschätzt haben, keinen Blick mehr übrighaben. Ich werde ihnen nicht nur in die Tasche spucken, sondern auch ins Gesicht, werde sie zu Asche zermalmen.
Schade, dass meine Eltern mir das nicht früher beigebracht haben: Kinder, die alle Blicke auf sich ziehen, haben als Erwachsene nur selten ein besonders strahlendes Leben, den stärksten Familienzusammenhalt, die beeindruckendsten Karrieren. Der Grundschulstar wird sich nie zum Weltstar entwickeln. Ich habe das seitdem dutzendfach beobachten können: Berühmtheit ist nicht einfach ein Sieg, den man erringt, es ist das Ergebnis eines Rachefeldzugs.
An den Sommer, in dem ich vierzehn Jahre alt war, kann ich mich sehr deutlich erinnern: Fahrradtouren durch die Pinienwälder mit meinen Cousins und Cousinen, Picknick am Strand, ein Inlineskates-Rennen. Ich gehe mit meiner Tante zum Austernkaufen auf den Markt, mache Segelkurse und zupfe mir heimlich die Augenbrauen. Mein geheimes Tagebuch verstecke ich in der Unterhosenschublade – und habe meine Cousine Violette in Verdacht, dass sie darin liest, während ich unter der Dusche bin, und ein sadistisches Vergnügen daran findet, in unseren Gesprächen Auszüge daraus zu zitieren. Wenn sich der Zweifel in meinen Blick schleicht, freut sie das ungemein. Zumindest glaube ich das.
Die Schwester meiner Mutter hat einen Zweitwohnsitz auf der Île d’Oléron, ich verbringe seit jeher dort einen Teil meiner Ferien. Den Rest der Zeit bin ich bei meinen Großeltern in Aix-en-Provence, gehe in der Auvergne mit meinen Cousinen und meinem Onkel zelten oder fliege nach Boston, um der Familie meines Vaters einen Besuch abzustatten. In jenem Sommer kommt mein Vater uns eine Woche lang auf Oléron besuchen. Eines Nachmittags setze ich mich aus Neugier neben ihn aufs Sofa, während er gerade im Fernsehen die Olympischen Spiele schaut.
Vor dem Bildschirm durchfährt mich plötzlich eine glühende Ahnung, fast schon eine innere Revolte: Ich hasse Mannschaftssport. Handball, Volleyball, Basketball – seinen Sieg von jemand anderem als einem selbst abhängig zu machen, erscheint mir irrsinnig. Wenn der eigene Teammitspieler schlechte Arbeit auf dem Feld abliefert, wie sollte man ihn da nicht bei lebendigem Leib verbrennen wollen? Schwimmen halte ich für eine vernünftigere Disziplin (mit Ausnahme der Staffeln natürlich). Gestern hat eine siebzehnjährige Französin im 400-Meter-Freistil einen Überraschungssieg hingelegt. Unser neuer Nationalstar ist nur drei Jahre älter als ich und heute Morgen am Zeitungskiosk auf sämtlichen Titelseiten. Aus den Interviews erfahre ich fasziniert von all den Jahren, die sie dafür geopfert hat. Morgens früh aufstehen, täglich sechzehn Kilometer schwimmen, den Chlorgeruch ertragen, der der Haut anhaftet, dass einem fast übel wird, die vielen harten Trainingsstunden, nur um eine Zehntelsekunde schneller zu werden. Es passt alles: Charakterstärke, Schmerztoleranz, das Bedürfnis zu gewinnen. Darin erkenne ich die groben Züge meines eigenen Ehrgeizes.
Auch ich muss mich bewähren. Auch ich bin entschlossen, einen zehnmal so hohen Einsatz wie die anderen zu bringen. Auch ich bin bereit, mich in den Kampf zu stürzen. Auch ich bin eine Perfektionistin mit einer ungeheuerlichen Arbeitskapazität. Auch ich will in einer einfacheren Welt leben, in der nur der Beste gewinnt. Dass ich in meiner Klasse immer die Nummer eins bin, kommt nicht von ungefähr, ich habe mir meinen Rang nie von jemandem streitig machen lassen. Außerdem bin ich die Begabteste am Konservatorium, die Beste im Klavier-, Gitarren- und Gesangsunterricht. Wenn das Ziel bei zehn liegt, erreiche ich hundert. Eine overachieverin, wie mein Vater sagt. Und doch kann ich diese seltsame Eigenart nicht erklären. Warum will ich unbedingt berühmt werden? Um mich besonders zu fühlen, mächtig, geliebt? Natürlich halte ich mich für anders als die anderen, passe nicht ins Bild, fühle mich unverstanden, aber ist das bei Heranwachsenden nicht das universellste Gefühl überhaupt? Wie soll ich diese Wut also deuten? Haben meine Eltern mir nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt? Oder ist es im Gegenteil die Folge einer projizierten Ambition auf ein lange erwartetes und verwöhntes Einzelkind? Ist mein Hunger nach Ruhm die Folge einer angeborenen Neigung, einer erworbenen Erfahrung, einer Vernachlässigung, einer Gewalterfahrung, oder ist er vererbt? Ich weiß es nicht. Ich kann keinerlei Grund nennen, kann die Frage nicht beantworten, weder mit psychologischen, familiären, soziologischen, astrologischen, mystischen oder existenziellen Begründungen. Ich kann nicht erklären warum, aber ich sehne mich danach. Ich bin in den schönen Vierteln von Paris aufgewachsen und trotzdem ein Straßenköter.
»Schwimmen ist scheiß anstrengend«, lautet das Fazit meines Vaters, als gerade der Startschuss für die 100-Meter-Rückenschwimmen fällt.
Eine Minute später hat die französische Schwimmerin ihre zweite Goldmedaille errungen.
»Papa, glaubst du, sie wusste, dass sie gewinnen würde?«
»Natürlich. Wenn man im Leben Großes erreichen will, muss man große Träume haben.«
Im September pinne ich das Gesicht meiner neuen Idole an meine Schlafzimmerwände, lauter Schwimmerinnen, Boxerinnen, Fechterinnen. Ich habe meine Familie gefunden, sie besteht aus entschlossenen und disziplinierten Frauen, die mir ähnlich sind. Als Lebensmodell hat Céline Dion nie getaugt – außerdem findet Juliette sie altmodisch. Ich habe immer noch den Ehrgeiz, Sängerin zu werden, aber in den Reden meiner Lieblingskünstlerinnen erkenne ich mich nicht so recht wieder. Bei den Kreativen geht es mehr um Leidenschaft, um Inspiration und ausschweifende Lebensstile. Ich will ein Musikstar werden, weil ich eine Maschine sein will. Und bei meinem Aufstieg wird auch mein Körper eine entscheidende Rolle spielen.
Neben dem Musikunterricht habe ich mich außerdem mit Juliette zum Tennis eingeschrieben und mache Tanzkurse. Ich lerne, auf Kleinigkeiten zu achten, setze auf Wiederholung, auf Leistung. Abends trainiere ich für den Muskelaufbau; morgens steige ich auf die Waage. Ich wiege alle Lebensmittel akribisch ab, zähle Kalorien, achte auf meine Proteinzufuhr. Jede Woche trage ich mein Gewicht in eine Grafik auf Millimeterpapier ein. Wenn ich mal ein halbes Kilo zugenommen habe, jogge ich bis zur Erschöpfung.
Selbst die besten Athleten brauchen Erholung. Deshalb mache ich freitagabends eine Pause und schalte den Computer an. Die Sims ist mein Lieblingsspiel.
Charlotte, mein aktueller Avatar, spielt Gitarre und Klavier. Sie hat ein Sozialleben, einen Verlobten, einen Dalmatiner. Gestern ist bei ihr eingebrochen worden, und den Abend hat sie damit zugebracht, im Badezimmer ein Wasserleck zu reparieren. Um an ihrem Charisma zu arbeiten, macht Charlotte stundenlang vor dem Spiegel Sprechübungen. Ich zwinge sie außerdem zum Sport, lasse sie ihre Ernährung umstellen und immer wieder ihren Stil ändern. Denn ich mache das nicht einfach so, rein zum Vergnügen. Ich habe ein Ziel vor Augen, ich will sie zum Star machen. Und damit ihr das gelingt, muss sie sich unbedingt mit anderen berühmten Persönlichkeiten anfreunden und immer gut drauf sein.
Charlotte arbeitet hart. In einer Tour besucht sie Castings, Konzerte, Fotoshootings. Ich hätte eine andere Karriere für sie auswählen können; ihre engen Freunde sind Akrobaten, Bankräuber, Hundedresseure, Geheimagenten, Kampfpiloten. Aber ich werde erst zufrieden sein, wenn Charlotte endlich berühmt ist. Ich will, dass eine Limousine sie von zu Hause abholt, dass Unbekannte in der Stadt sie um ein Autogramm bitten. Erst dann werde ich ihr ein bequemeres Bett kaufen, Bilder von großen Meistern für ihr Schlafzimmer, eine Duschkabine mit frischen Silikonfugen, einen neuen Herd.
Solange ich die Klassenbeste bleibe, haben meine Eltern nichts dagegen, dass ich so viel Zeit vor dem Computer verbringe, aber gut finden sie es trotzdem nicht. »Willst du nicht lieber mal ein Buch lesen?«
Meine Partie dauert mehrere Wochen. Mein weiblicher Avatar strengt sich an, wird aber trotzdem nicht berühmt. Scheitern ist keine Option. Wird es niemals sein. Ich schicke Charlotte in den Garten und ziehe vier Wände um sie hoch. Sie wird sterben wie eine Klausnerin im Mittelalter: eingemauert.
Im Badezimmer streitet Juliette sich seit einer Stunde mit ihrem Freund. Heute Abend werden wir in der Wohnung ihres Vaters in der Rue Princesse meinen Geburtstag feiern. Das ganze Gymnasium weiß, dass meine beste Freundin die coolsten Feiern organisiert. Davor haben wir noch einen Schokoladenkuchen gebacken und ihren großen Bruder gebeten, den Alk zu besorgen.
Während Juliette mit ihrer großen Liebe ein Hühnchen rupft, unterhalte ich mich mit Nathan, einem Freund ihres Bruders, der aufs Lycée Henri IV geht. Er ist schüchtern und wird schnell rot, es ist das erste Mal, dass wir mehr als drei Sätze miteinander sprechen.
»Nathan ist das Diminutiv von Nathanaël. Das bedeutet ›Geschenk Gottes‹ auf Hebräisch. Und du, weißt du, wo Cléo herkommt?«
Etymologie als Anmache, das hat bisher noch keiner versucht – kein Zweifel, ich bin auf einer Saint-Germain-des-Prés-Veranstaltung gelandet. Und während er auf mich einredet, lächle ich innerlich, weil Nathan mich an einen Storch erinnert. Er hat lange dünne Beine und einen klitzekleinen Kopf.
»Cléo soll eine Anspielung auf Cleopatra sein.«
»Ah ja? Dein Vater ist Ägyptenspezialist, nicht wahr?«
»Genau, er wollte mich Cleopatra nennen, meine Mutter hat es ihm verboten, dann haben sie sich auf Cléo geeinigt. Aber er nennt mich trotzdem ständig Cleopatra.«
»Das ist hübsch, Cleopatra. Aber es muss doch eine Bedeutung haben.«
»Ja, das heißt ›Stolz des Vaters‹, glaube ich – jedenfalls erzählt mir das mein Vater ständig. Patros ist der griechische Genitiv von ›Vater‹.«
»Aber weißt du, ob Cléo auch eine eigene Bedeutung hat? ›Stolz‹ dann vielleicht?«
»Hab ich nie wirklich recherchiert.«
Ich google es mit meinem Handy. Der Empfang ist schlecht, also reden wir weiter, Nathan schenkt mir nach, eine Mischung aus Wodka und Orangensaft. In dem Moment kommt Juliette mit roten Augen aus dem Badezimmer; als ich vorher an der Tür vorbeikam, hörte ich Beschimpfungen und Weinen. Wie kann sie nur so viel Zeit mit diesem Typen verplempern? Hat sie nichts Besseres zu tun?
Im Wohnzimmer tanzen die Mädchen zum aktuellen Hit. Heiße, halbnackte Leiber, und wenn der Refrain kommt, wird der Text im Chor mitgebrüllt, Gespräche im Dunkeln, bei Bierdunst und Cannabisschwaden, in der Spüle stapeln sich die schmutzigen Gläser, das Fischgrätparkett ist vollgekrümelt, Nathans Augen sind grau. Auf dem Display meines Handys ploppt die Antwort auf, ich stütze mich auf seine Schulter, um nicht umzufallen, so sehr bin ich geflasht. Ich kann es kaum glauben, Cléo kommt von Griechisch kléos – und bedeutet »Ruhm«. Anerkennung. Berühmtheit.
Mein Leben ist ein Abenteuerfilm. Am Abend ihres fünfzehnten Geburtstags wird der Heldin das Geheimnis ihrer Herkunft offenbart. Dein Vorname bedeutet »Berühmtheit«, weil es dein Schicksal ist, ein Weltstar zu werden. Dabei habe ich meinen Vornamen schon immer gehasst, ich hatte ja nicht die geringste Ahnung, dass eine Prophezeiung in ihm steckte. Bei aller Bescheidenheit, mit dieser Entdeckung wird mir klar, dass ich auserwählt bin.
Ich habe schon lange geahnt, dass ich anders bin als die anderen, mir dieses seltsame Bauchgefühl aber nicht erklären können. Heute Abend wird alles klar. Ich schwärme nicht einfach für den Ruhm oder gebe mich wie eine unsichere Jugendliche der Fantasie davon hin – vielmehr werde ich ihn erreichen. Verdammte Scheiße, ich werde ihn wirklich erreichen!
Berühmt werden ist nicht bloß ein zarter Kindertraum von mir, auf mich wartet der Erfolg am Horizont. Ich stelle mir bildlich vor, wie ich am Rad des Schicksals drehe und das große Los gewinne, ich stehe oben auf dem Podium, nehme Huldigungen entgegen, einen Lorbeerkranz auf dem Haupt. Man hat mich in die falsche Wiege gelegt, ich stecke im falschen Körper, im falschen Leben fest. Und bald werde ich diesen Missstand beheben.
Ich denke nicht lange nach und packe Nathans Gesicht, um ihn zu küssen. Dann kippe ich in einem Zug mein Glas hinunter, stelle es mit Wucht zurück auf den Tisch, bevor ich Nathan mit auf die Toilette schleife. Ich sperre die Tür ab, öffne seinen Hosenschlitz, ziehe ihm langsam die Hose runter, dann knie ich mich hin. Ich will berühmt werden. Dass ich dabei passiv bleibe, kommt gar nicht in die Tüte, ich bin nicht mehr das kleine, brave Mädchen, das den Mund hält. Diesmal mache ich ihn weit auf.
Im Gegenzug habe ich große Lust, mich ein wenig fingern zu lassen, aber der Scherzkeks macht überhaupt keine Anstalten. Drecksköter. Spinner. Kauz. Ich bringe es selbst zu Ende und gehe wieder tanzen.
Ich nehme meinen Platz mitten auf der Tanzfläche ein, es umgibt mich ein Glorienschein, ich bin Alleinherrscherin. Ich schließe die Augen, bin der Mittelpunkt der Welt, rolle die Schultern, lasse meine Hüften kreisen, der Alkohol gibt mir Selbstsicherheit, alle Blicke sind auf mich gerichtet, ich spüre, wie sie über meinen Leib gleiten. Ich tanze im Rhythmus, aufgeladen, imperial. Ich bin die Königin der Bienen.
Ich verlasse die Feier, ohne mich von jemandem zu verabschieden, es ist nicht mal Mitternacht, ich habe meine Kerzen nicht ausgeblasen, sie werden meine Ankunft auf Erden ohne mich weiterfeiern. Ich bin mir sicher. So sicher. Ich spüre es. Freude. Friede. Diese Nacht ist meine Feuernacht, die Nacht meiner Offenbarung – was für ein Geistesblitz. Dass ich betrunken bin, steigert nur mein Hochgefühl, der eisige Wind brennt mir im Gesicht, ich fahre mit dem Rad den Boulevard Saint-Michel hinauf, radle durch die Nacht, erhebe mich aus dem Sattel, um besser den Hügel hinaufzukommen. Ich fahre am Jardin du Luxembourg vorbei, geradeaus bis zur Avenue de l’Observatoire, mein Herz klopft vor lauter Glück, mein Geburtstag sollte ein offizieller Feiertag sein. Aus meinen Kopfhörern kommt ein Jubelschrei, der superberühmte Hit zur Fußball-WM, »Samba de Janeiro«, ich muss kein Portugiesisch können, um die Euphorie zu verstehen, lasse die Trommeln in mir nachhallen. Ich überfahre die Ampel bei Rot, dann noch eine, anschließend geht’s im Zickzack um die Place Denfert-Rochereau, ich schließe die Augen, bin unbesiegbar, lasse mit einer Hand den Lenker los, dann mit beiden, hebe die Arme, fliege wie ein Vogel. Ich achte nicht auf die hupenden Autofahrer, die Hauptfigur lässt man nicht gleich zu Filmbeginn sterben. In die eiskalte Nacht hinaus schreie ich, immer lauter, die vier verheißungsvollen Buchstaben, die mein Schicksal bestimmen: C-L-É-O.
Als ich bei mir zu Hause ankomme, spucke ich den Spermarest, der mir noch am Zahnfleisch klebt, auf den Gehsteig. Mein Handy gibt einen Ton von sich, Nathan fragt mich, wo ich abgeblieben bin. Ich wundere mich nicht darüber, er hat sich schon verliebt. Ich antworte nicht auf seine Nachricht. Wozu auch? Wir können nicht zusammen sein – das wird zu kompliziert, wenn ich dann berühmt bin.
In der Wohnung ist es still, meine Eltern sind bereits zu Bett gegangen, und doch bin ich schon vor der Ausgangssperre zu Hause. Ich trinke ein Glas Wasser in der Küche, suche mir etwas Proviant zusammen. Die Nacht verspricht lang zu werden, die längste von allen.
Ich bin fünfzehn und habe gerade den unwiderlegbaren Beweis meiner zukünftigen Berühmtheit erhalten, jetzt gilt es herauszufinden, wie sich meine Lebensaufgabe konkret gestalten wird. Ich schlage ein kariertes Heft auf, meine Schrift ist fahrig, dazwischen immer wieder Pfeile, unterstrichene Wörter, Sätze in Großbuchstaben, nummerierte Ideenlisten. Halb betrunken erstelle ich meine erste Kompetenzbilanz.
Meine Disziplin, mein Perfektionismus, mein Bedürfnis, die Beste zu sein, mein Kampf gegen Faulheit und Oberflächlichkeit: Alles ergibt einen Sinn. Ich werde eine höchst niveauvolle Berühmtheit sein, kein Nullachtfünfzehn-Sternchen. Ich strebe nicht danach, nur eine Sängerin zu sein, sondern eine berühmte Persönlichkeit. Genau wie Cleopatra bin ich auf der Welt, um meine Zeit zu prägen. Tutanchamun, Homer, Platon, Aristoteles, Alexander der Große, Cäsar, Karl der Große, Shakespeare, Napoleon. Es gibt keine Frauen auf der Liste, ich melde mich freiwillig.
Ich habe eine umwerfende Stimme. Das lässt sich schwer ignorieren, mir werden Komplimente gemacht, sobald ich auch nur den Mund aufmache, um zu singen. Außerdem bin ich nicht der x-te Sopran mit glatter, hoher Nachtigallenstimme. Meine Stimme ist tief, rau, rauchig; sie ist gebrochen, komplex, charakteristisch – meine stimmliche Signatur wird das Publikum leicht erkennen können, sie wird vollkommen unverwechselbar sein. Alle werden mich lieben.
Ich kenne mich mit Poesie aus, habe eine exzellente literarische Vorbildung, kann meine Songs auf Französisch und auf Englisch schreiben, was mir eine internationale Reichweite garantieren wird. Hübsche Stimmen findet man an jeder Ecke: Ich bin mehr wert als das. Ich werde nicht bloß eine einfache Interpretin sein, ich werde mich meiner Feder bedienen. Ich bin dazu berufen, mit dem Singen von Eigenkompositionen Berühmtheit zu erlangen.
Die Pubertät ist selten ein Geschenk. Für mich ist sie ein Segen. Mein herzförmiges Gesicht wird weicher, meine Brust rundet sich, der Sport formt meinen Körper. Ich bin schlanker geworden, graziler – das kleine Mädchen mit den zu engen Klamotten ist verschwunden, jetzt habe ich einen Starkörper. Es gibt noch genug zu tun: den Haarschnitt ändern, den richtigen Lippenstift finden, der die Wirkung meiner Augen unterstreicht, schöne Kleider kaufen. Aber mit alledem wird man ein hübsches Poster machen können.
Mit der Beweisführung vor Augen kommt es jetzt darauf an, nicht zu prokrastinieren. Mein Aktionsplan ist es, ab jetzt an dem Song zu arbeiten, der mich berühmt machen wird. Ich suche eine Melodie, leise vor mich hin summend, um meine Eltern nicht zu wecken, die im Zimmer nebenan schlafen. In dem Moment, als ich mir den Refrain vornehme, denke ich an Céline Dion: Ihre Mutter und ihr Bruder haben ihr erstes Stück für sie geschrieben, als sie dreizehn Jahre alt war. Leider kann ich von meiner Familie keine Hilfe erwarten. Wenn sie schon keine potenziellen Texter sind, hätten sie mir ja wenigstens die Türen zum Showbiz öffnen können. Ich hätte liebend gern eine Regisseurin zur Mutter gehabt, einen Schauspieler zum Vater. Wie können sie sich mit so einem mickrigen Leben zufriedengeben? Niemand kennt sie, niemand wird sich an ihre Namen erinnern – und wenn man mit krummem Rücken über seinen Recherchen hängt, wird man auch kein Millionär. Meine Eltern sind einfache Leute, altmodisch, Versager, Hinterwäldler. Samstagabends sind sie nicht zu Vorpremieren eingeladen: Sie schauen sich einen Dokumentarfilm über den abstrakten Impressionismus oder die türkischen Eroberungen im Mittelmeerraum an, sie lesen auf dem Sofa im Wohnzimmer und gehen um 23 Uhr schlafen. Ich liebe meine Eltern, aber sie nützen mir nichts. Trotzdem weigere ich mich, wie ein Opfer zu denken. Es gibt für jeden immer mehr Gründe zu scheitern, als dafür, Erfolg zu haben. Ich vertiefe mich wieder in meinen Song. Wenn Thérèse und Jacques Dion das hinbekommen haben, kann ich das auch.
Die nächsten Stunden bin ich damit beschäftigt, an meinem Stück zu feilen und zu polieren. Inspiriert, entschlossen, erleuchtet brüte ich über der Geschichte einer unmöglichen Liebe. Mit meinem energischen Ich-weiß-was-ich-will-Blick bereite ich meinen Staatsstreich vor. Ich komponiere gerade ein Meisterstück in meinem Schlafzimmer, und alle werden hin und weg sein, wenn sie diese wundersame Hymne zum ersten Mal hören. »Hast du das ganz alleine geschrieben?«; »Wir wussten ja gar nicht, dass wir ein Musikgenie unter uns haben!«; »Dieser Song ist unglaublich, ich schicke ihn gleich meiner Tante, sie arbeitet beim Fernsehen, ich bin sicher, dass sie einen Produzenten für dich finden wird!«
Die ersten Sonnenstrahlen verkünden das Ende meiner Feuernacht. Schritte im Flur, das Geräusch eines Schlüssels im Schloss, die Wohnungstür schließt mit einem metallischen Klick. Wie jeden Sonntagmorgen geht mein Vater runter in die Boulangerie, um frisches Brot zu kaufen. Unterdessen macht meine Mutter sich im Bad fertig und hört dabei Radio. Sie trällert unter der Dusche, und ich schreibe meinen Song fertig.
Ich habe so oft behauptet, ich hätte mit acht Jahren angefangen, Chansons zu schreiben, dass ich am Ende meine eigenen Lügen geglaubt habe. Die Realität sieht banaler aus, ich habe mein allererstes Stück mit fünfzehn geschrieben. Und ich mag noch so sehr vom Feuer der Inspiration überwältigt gewesen sein, was dabei herauskam, war miserabel.
Wenn man mit 19,75 von 20 Punkten im Abitur glänzt, wenn man an der Sciences Po Jahrgangsbeste ist, träumt man von einer glänzenden Karriere in der Staatsverwaltung und nicht davon, ins Fernsehen zu kommen und Autogramme zu geben. Mit zwanzig habe ich alle Vorteile auf meiner Seite, ich bin hübsch wie ein Engel, die Zukunft reicht mir die Hand; trotzdem fühle ich mich ausgebremst, verbittert, ich habe das Gefühl, ein Leben zu führen, das mir nicht gehört, und ich nehme das der ganzen Welt übel. Alle sagen, ich hätte Erfolg, für mich fühlt sich das aber nicht so an. Ich habe mir das Semester anrechnen lassen, mit einer Gewissheit: Ich verschwende viel zu viel Herzblut auf dieses Diplom.
Selbstverständlich habe ich nicht vor, mein brillantes Hochschulstudium zu unterbrechen, um in irgendeiner verranzten Kneipe erste Auftritte zu bekommen. Ich habe Besseres verdient, als in schäbigen Sälen aufzutreten, zum Vorsingen zu gehen, mich einem Begleitchor anzuschließen. Aber mein Tarnmäntelchen der Musterschülerin raubt mir wahnsinnig viel Zeit, saugt mich aus, ohne mich zu inspirieren. Den Chansons, die ich abends komponiere, nachdem ich einen ganzen Tag lang geackert habe, fehlt es an Poesie, sie sind substanzlos, nicht sehr nuancenreich. Sie sind genau das, was ich nicht sein will: mittelmäßig.
Also bleibe ich im Schatten, um mein großes Entree vorzubereiten. Ich bin nicht tatenlos, ich bin gelähmt. Ich warte auf den guten Einfall, warte, dass ich bessere Stücke schreibe, warte, dass ich besser Klavier spielen kann, warte, dass ich mir eine neue Gitarre leisten kann, warte darauf, meinen Abschluss zu machen, die Zusage zu einem Praktikum zu bekommen. Ich warte auf die Ratschläge meines neuen Gesangslehrers, darauf, dünner zu sein und mir eine neue gerippte Cordsamtjacke kaufen zu können, ich warte auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, darauf, dass Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen, auf den 30. Februar. Zur Zeit brauche ich niemanden, um mich auf meinem Weg zum Ruhm auszubremsen. Das mache ich schon ganz allein.
»Könntet ihr etwas leiser sein? Das hier ist eine Bibliothek.«
Erste Verwarnung. Ich interveniere barsch, ehe ich mich wieder in meine Überarbeitungen vertiefe, und entsperre den Computer mit dem Passwort, das ich seit Jahren benutzte: Cléo_célèbre!
Ungeachtet meines Eingreifens sind die vier Trottel, die an meinem Tisch sitzen, weiter so unruhig. Ich komme hierher, um mich in die Gesellschaft von konzentrierten Leuten zu begeben, nicht in die von Versagern, die statt etwas zu lernen auf ihrem Notebook rumzocken. Zweite Verwarnung. Ich werfe ihnen mehrere eindringliche Blicke zu, dass sie still sein sollen – könnten meine Augen doch nur Feuer spucken! Leider unterhalten sich meine lieben Kommilitonen weiter.
Die Sorte kenne ich. Allumfassende Faulheit, Mangel an Disziplin, Willensschwäche. Sie entstammen alle dem gleichen Wurf: einer großen Familie von Nichtsnutzen. Bald werden sie wieder nach Hause gehen, stolz drauf, dass sie drei Stunden in der Bibliothek verbracht haben (effektiv genutzte Arbeitszeit: siebzehn Minuten). Ich starre den jungen Mann mit den fettigen Haaren und der schmutzigen Brille an und bin mir sicher, dass er zu denen gehört, die sich mit 13 von 20 zufriedengeben. Passabel, aber nicht ausgezeichnet. Der weiche Bauch der Klasse. Ich verachte mittelmäßige Leute, nullachtfünfzehn, zerstreut, gestrandet, die Kaugummi kauen, zwischen den Mahlzeiten snacken, die Nase hochziehen, keinen Sport treiben, künstlerisch dilettieren, zu spät kommen, bei ihren Aufgaben nicht ihr Letztes geben, dahin gehen, wo der Wind sie hinträgt, sich an der Uni in Geisteswissenschaften einschreiben, um mit ihren Schulfreunden zusammen abhängen zu können. Ihr Mangel an Ehrgeiz kotzt mich an.
Eines der Mädchen aus der Gruppe reißt eine Kekspackung auf, und ich starre auf ihr Doppelkinn, um ihr zu verstehen zu geben, dass sie keine zusätzlichen dreißig Gramm Zucker braucht. Chérie, leg diesen mit Schokolade überzogenen Keks weg, du siehst ohnehin schon aus wie eine wohlgenährte Truthenne.
Eine Stunde später gehen sie zum dritten Mal eine Zigarette rauchen (Pausenzeit seit ihrer Ankunft: siebenundvierzig Minuten). Sobald sie aus meinem Gesichtsfeld verschwinden, stehe ich auf und nähere mich, so natürlich wie möglich, ihren Sachen. Laptops, Bücher, Hefte, Federmäppchen, Taschenrechner. Ich lasse so viel wie möglich in meine Tasche gleiten, und gehe weiter. Sie hätten ja doch nichts damit anzufangen gewusst.
Mit dem Geld, das ich in ihren Geldbeuteln finde, kaufe ich mir ein Paar Wildlederstiefeletten. Magere Entschädigung dafür, dass sie mir meinen Arbeitsnachmittag geklaut haben. Die restlichen Sachen werfe ich in der Rue de Rivoli in einen Mülleimer.
Am Abend leistet mir Juliette Gesellschaft, und wir trinken ein Glas. Sobald sie mich sieht, springt mir meine Kindheitsfreundin in die Arme, küsst mich auf die Wange, zutraulich und anhänglich wie ein Labrador. Freundschaften sind keine starren Entitäten. In unserem Alter ändern sich die Spielregeln alle fünf Jahre. Juliette nennt mich immer noch Cléou, aber ich bin ihr nicht mehr vollkommen ergeben, und sie spielt schon lange nicht mehr die kleine Chefin.
Juliette ist im zweiten Jahr ihres Medizinstudiums, sie träumt davon, Rettungsärztin zu werden, sieht sich bereits voll in Aktion in einem Rettungswagen, mit dem sie den Unfallopfern im Straßenverkehr zu Hilfe eilt. Ich begrüße ihre Karrierewahl, denn wenn sie auf ihrem Pannenstreifen steht, kann sie mir nicht gefährlich werden. Vor allem bin ich jetzt endlich die Schönere von uns beiden. Kastanienbraunes Haar, 1,74 m groß, haselnussbraune Augen, perfekte Haut, dichte Augenbrauen, lange Wimpern, volle Lippen. Und das Wunder, das alles ändern sollte, ist letzten Sommer geschehen: ein Ponyschnitt.
Meine unanfechtbare Schönheit nehme ich als Erstes in den Augen anderer wahr. Wenn wir abends ausgehen, spricht man nicht mehr immer zuerst Juliette an, sondern mich. Dabei halte ich mich fern von all diesen Verliebten – vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen, potenziellen – das fällt mir nicht sonderlich schwer. Ich arbeite an meinem Image als lässige und coole junge Frau: umwerfend und dabei gleichgültig gegenüber allen Blicken, und umso großartiger, als sie sie gar nicht wahrzunehmen scheint.
Wir setzen uns auf die Terrasse, Juliette erzählt mir von ihren Liebesgeschichten, aktuell ist sie in einer Übergangsphase zwischen Nicolas und Antoine. Ich habe sie noch nie als Single gesehen, sie gehört zu denen, die schon im Kindergartenalter ständig in ernsten und komplizierten Beziehungen stecken. Das gerade Gegenteil von mir. Ich höre, wie sie mir erklärt, warum es diesmal anders ist als sonst (was nicht stimmt), aber der Idiot zu unserer Linken lenkt mich total ab.
»Können wir uns an einen anderen Tisch setzen? Ich krieg dauernd seinen Rauch ins Gesicht, das nervt.«
»Aber du rauchst doch auch«, erwidert Juliette.
»Ja, aber es ist nicht dasselbe, wenn es mein Rauch ist.«
»Du bist echt eine Tyrannin.«
Wir setzen uns ein bisschen weiter weg und bestellen uns ein zweites Glas.
Um 21 Uhr schleppt Juliette mich noch mit zu einer Veranstaltung bei ihren Freunden im 11. Arrondissement, ich ziehe im Treppenhaus noch einmal den mohnblumenroten Lippenstift nach. Ich habe nicht die geringste Lust hinzugehen, aber wir haben Samstagabend, ich bin zwanzig Jahre alt, also hake ich eben die Liste der Dinge ab, die zum Sozialleben einer Studentin dazugehören. Mein Problem ist, dass ich nie das Gefühl habe, genug gearbeitet zu haben, um eine Pause zu verdienen.
Ihre Bekannten aus dem Medizinstudium plaudern miteinander, stehen rauchend am Fenster, ein Bier in der Hand. Es gibt ein paar Jungs, die vielleicht ganz charmant sind, aber ich habe nur Augen für den schönen Brünetten mit dem Mahagoniglanz, der in einer Ecke des Wohnzimmers steht, – ich könnte schwören, dass mir das Yamaha-Klavier neben dem Bücherregal zugezwinkert hat. Es ist noch früh, niemand tanzt, ich ergreife die Gelegenheit: Ich erkundige mich freundlich beim Gastgeber, ob ich Klavier spielen darf. Zur Eröffnung spiele ich ein leises »Only You« von den Flying Pickets. Die Gespräche verstummen, es bildet sich eine schweigende Gruppe um mich. Ich mache weiter mit »Jealous Guy« von John Lennon, dann folgt »Le Chanteur malheureux« von Claude François. Ein übersensibles Mädchen weint noch vor dem ersten Refrain.
»Entschuldigung, ich wollte euch nicht die Stimmung vermiesen!«, stammle ich mit falscher Bescheidenheit.
»Nein, nein, mach nur weiter. Kennst du noch andere?«
»Gibt es hier eine Gitarre?«
Ich mache weiter mit »Don’t Go Breaking My Heart« von Elton John, bevor ich mit Bedacht mein letztes Stück wähle; und das soll »You Can’t Hurry Love« sein. Mehrere Gäste holen sich die Lyrics auf ihr Smartphone und singen mit. Perfekt, ich habe immer schon von einem Background-Chor geträumt.
Mein improvisiertes Konzert endet unter Applaus. Man sagt mir zehnmal, dreißigmal, hundertmal, dass ich eine phänomenale Stimme habe. Ich spiele es herunter.
»Ich hatte jahrelang Unterricht am Konservatorium.«
Sie bestehen mit unverhohlener Bewunderung auf ihrem Urteil, ich nehme mit gespielter Bescheidenheit die Komplimente entgegen.
»Und was machst du sonst so im Leben, Cléo?«
»Ich studiere Politikwissenschaft.«
»Ach genial, und wo?«
Trotz meiner kräftigen Stimme ahnt niemand, dass ich Weltruhm anstrebe, nicht einmal Juliette. Wie sollte ich ihr das übel nehmen? Im Gymnasium hatte sie zweimal pro Woche Volleyballtraining, jedes Wochenende ein Spiel, und trotzdem wollte sie keine Profispielerin werden.
»Du solltest ab und zu Konzerte geben, du bist so begabt, Cléo. Es gibt da eine Bar in Pigalle, die stellen jeden ersten Samstag im Monat ihre Bühne bereit. Du könntest …«
Ich lache los, als wäre Juliettes Bemerkung völlig daneben. Ich verdrehe die Augen und erwidere gelassen: »Ich muss mich noch auf die Zwischenprüfungen vorbereiten und mir einen Praktikumsplatz suchen, das hast du wohl vergessen.«