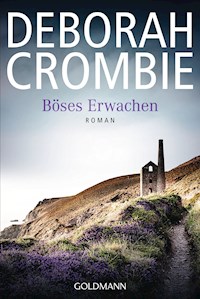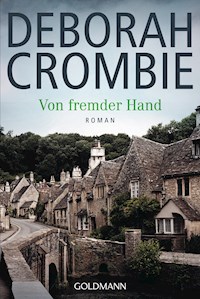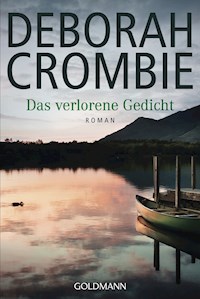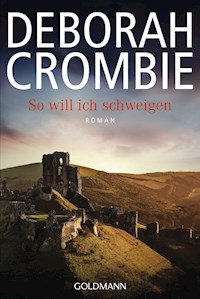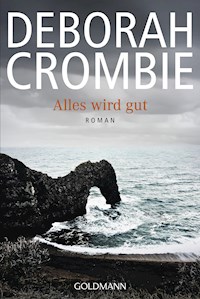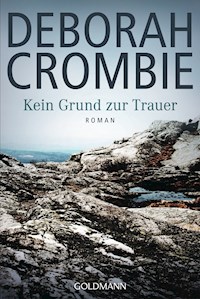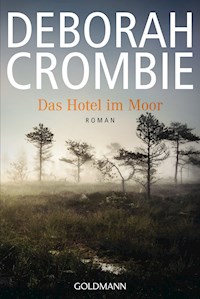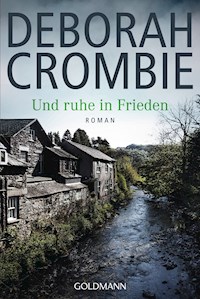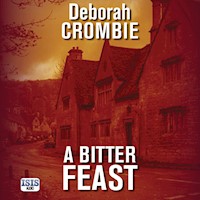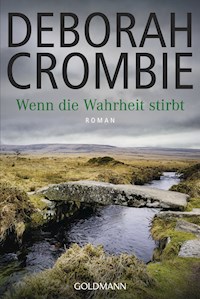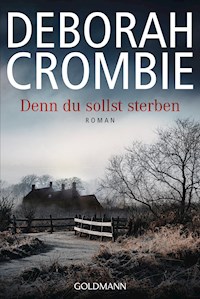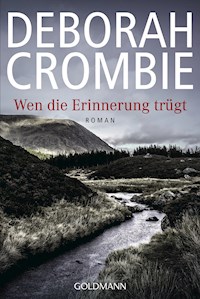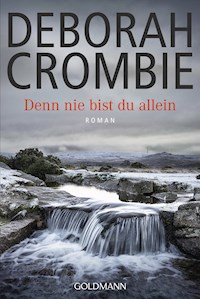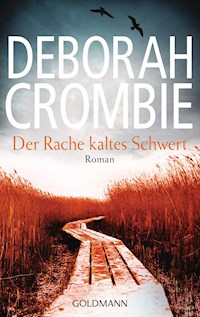
SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Als Kincaid und James zu einem Tatort gerufen werden, bietet sich ihnen ein schreckliches Bild: Eine junge Frau wurde umgebracht und grausam verstümmelt - und sie soll nicht das einzige Opfer des mysteriösen Mörders bleiben. Die beiden Ermittler arbeiten auf Hochtouren, um den Täter zu entlarven, doch dann wird ihr Hauptverdächtiger auf die gleiche brutale Art und Weise getötet wie alle anderen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2010
4,8 (30 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Von Deborah Crombie außerdem bei Goldmann erschienen:
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Copyright
Buch
Die junge Dawn Arrowood ist auf dem Weg nach Hause, wo ihr ein unangenehmes Gespräch mit ihrem Mann, dem Londoner Antiquitätenhändler Karl Arrowood, bevorsteht. Dawn hat soeben erfahren, dass sie schwanger ist, weiß aber, dass ihr Mann keine Kinder will. Zudem ist sie unsicher, ob ihr Mann der Vater ist oder der Porzellanhändler Alex Dunn, mit dem sie eine Affäre hat. Als Dawn vor ihrem Haus aus dem Auto steigt, wird sie brutal überfallen und ermordet. Superintendent Duncan Kincaid und Sergeant Gemma James, die zum Tatort gerufen werden, sind schockiert, als sie sehen, dass der Täter sein Opfer verstümmelt hat. Kincaid wird beim Anblick der Leiche an einen Fall erinnert, den er vor kurzem auf den Tisch bekam: den Mord an der Antiquitätenhändlerin Marianne Hoffman. Der Verdacht liegt nahe, dass es Scotland Yard mit einem Serienmörder zu tun hat. Gemmas Nachforschungen ergeben, dass Arrowood offensichtlich in Rauschgiftgeschäfte verwickelt ist. Und eine seiner Kundinnen war Marianne Hoffman. Aber Arrowood ist nicht der Einzige, der ein Motiv für die Morde hatte. Dann wird Arrowoods Leiche gefunden - und die Tat trägt dieselbe Handschrift wie die beiden vorhergehenden …
Autorin
Crombies Romane um das Scotland-Yard-Paar Duncan Kincaid und Gemma James wurden für den »Agatha Award«, den »Macavity Award« und den »Edgar Award« nominiert. Die Autorin lebt mit ihrer Familie im Norden Texas. Weitere Informationen zur Autorin unter: www.deborahcrombie.com
Von Deborah Crombie außerdem bei Goldmann erschienen:
Das Hotel im Moor. Roman (42618) Alles wird gut. Roman (42666) Und ruhe in Frieden. Roman (43209) Kein Grund zur Trauer. Roman (43229) Das verlorene Gedicht. Roman (44091) Böses Erwachen. Roman (44199) Von fremder Hand. Roman (44200)
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »And Justice There is None« bei Bantam Books, a division of Random Hous, Inc., New York.
Für Nanny
»Die Sonne hat den Schein verkehret, Untreu den Samen ausgeleeret, Allwärts über Feld und Rain. Der Vater bei dem Kind Untreue findet, Der Bruder seinem Bruder lüget Die Geistlichkeit in Kutten trüget … Gewalt siegt ob, des Rechtes Ansehn schwindet.«
Walther von der Vogelweide (1170-1230) Nahen des jüngsten Tages(Übertragung ins Neuhochdeutsche von Karl Simrock)
1
Mit einer Flottille von Schiffen der britischen Marinenahm Admiral Sir Edward Vernon den Hafen [von Porto Bello] im Jahre 1739 ein. … Inallen größeren Städtenwurden zur Feier des Sieges Freudenfeuer entzündet. …Straßen und Stadtviertel wurden nach Vernon und nachPortobello benannt.
Whetlor und Bartlett, aus: Portobello
Er lief, wie so viele andere auch liefen, geschützt vor dem Nebel durch seinen schwarzen Anorak, und die reflektierenden Abzeichen auf seinen Joggingschuhen leuchteten auf, wenn er an einer Straßenlaterne vorbeikam. Das Muster der Straßen war wie ein lebendiger Stadtplan in sein Gedächtnis eingegraben. Die Portobello Road entlang, unter der Autobahnbrücke durch, vorbei an Oxford Gardens, wo früher die Portobello-Farm gewesen war, dann zurück über Ladbroke Grove, vorbei an der Videothek und dem afrokaribischen Haarstudio, und schließlich durch die Lansdown Road mit ihren streng weiß getünchten viktorianischen Häusern. Er stellte sich vor, dass die Biegung der Straße dem Verlauf der alten Pferderennbahn folgte, die vor hundertfünfzig Jahren Notting Hill gekrönt hatte; dass seine Schritte der Strecke folgten, über die früher die Hufe hinweggedonnert waren.
Jetzt tauchten in den Vorgärten leuchtende Weihnachtsdekorationen auf. Sie schienen eine fröhliche Behaglichkeit zu versprechen, die ihm verschlossen bleiben musste. Andere Jogger begegneten ihm, und er grüßte sie mit einem Nicken, einem knappen Winken, doch er wusste, dass es da keine wirkliche Nähe gab. Sie dachten an ihre Pulsfrequenz, an ihr Zuhause und ihre Kinder, an die Belastung, die diese Feiertage für ihre Bankkonten darstellten.
Er lief, so wie die anderen auch, aber seine Gedanken bewegten sich im Kreis, drehten sich unentwegt um alte, dunkle Dinge, um Wunden, die nicht heilen wollten. Und sie würden auch nicht heilen, solange er sich nicht entschloss, sie selbst zu reinigen. Es würde keine Gerechtigkeit geben, wenn er nicht selbst dafür sorgte.
Da war der Turm der St. John’s Church - geisterhaft tauchte er über den nebelverhangenen Dächern auf. Das Blut schwoll in seinen Adern an, als er sich seinem Ziel näherte, und sein Atem ging schwerer und schwerer; die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Aber er konnte nicht mehr umkehren. Sein ganzes Leben lang hatte er sich auf diesen Punkt zu bewegt, auf diese eine Nacht, in der er zu sich selbst finden würde.
Eine Frau mit langen dunklen Haaren lief an ihm vorbei; ihr Gesicht blieb im Dunkeln. Sein Herz begann zu rasen, so wie jedes Mal; sie hätte seine Mutter sein können, wie er sie in seinen Träumen sah. In seinen Visionen spürte er manchmal, wie ihr Haar ihn umschmeichelte, seidig und kühl, ein flüchtiger Trost. Jeden Abend hatte er sie mit einer silbernen Bürste gekämmt, während sie ihm Geschichten erzählt hatte. So lange, bis sie ihm weggenommen worden war.
Er lief, so wie die anderen auch, aber er trug etwas in sich, was die anderen nicht hatten. Die Vergangenheit - und den Hass mit seiner fein geschliffenen, funkelnden Spitze.
Nach Ladenschluss nahm Portobello einen anderen Charakter an. Das dachte jedenfalls Alex Dunn, als er von der Sackgasse, wo er seine kleine Wohnung hatte, in die Straße einbog. Er hielt kurz inne und überlegte, ob er die Straße hoch bis Notting Hill Gate gehen sollte, um sich zur Feier des Tages eine Pizza im Calzone zu gönnen, aber das war eigentlich nicht die Art Lokal, wo man gerne allein hinging. Stattdessen wandte er sich nach rechts und ging die abfallende Straße entlang, vorbei an den Läden und dem von der St. Peter’s Church betriebenen Café, das schon geschlossen war. Das Pflaster war mit Abfall übersät; Überreste des vergangenen Tages, die der Straße ein trostloses Aussehen verliehen.
Aber morgen würde es anders sein. Bei Tagesanbruch würden die Verkäufer ihre Stände für den samstäglichen Flohmarkt aufgebaut haben, und in den Arkaden würden die Händler ihre Waren anbieten, von antikem Silber bis hin zu Beatles-Sammlerstücken. Alex liebte diese erwartungsfrohe Stimmung am frühen Morgen, den Geruch von Kaffee und Zigaretten, das Gefühl, dass dies vielleicht der Tag sein könnte, an dem man das Geschäft seines Lebens machte. Und das war gar nicht einmal so unwahrscheinlich, dachte er, und eine Welle der Begeisterung überkam ihn, denn schließlich hatte er heute den Kauf seines Lebens getätigt.
Er beschleunigte seine Schritte, als er in den Elgin Crescent einbog und die vertraute Fassade von Ottos Café erblickte - so nannten die Stammgäste das Lokal; auf dem verblichenen Schild stand einfach nur »Café«. Tagsüber machte Otto ein reges Geschäft mit Kaffee, Sandwiches und Kuchen, abends dagegen servierte er einfache Mahlzeiten, die bei den Bewohnern des Viertels ausgesprochen gut ankamen.
Drinnen klopfte sich Alex zunächst die Feuchtigkeit aus der Jacke, bevor er an seinem Lieblingstisch in der Nähe des künstlichen Kamins Platz nahm. Leider waren die Möbel des Cafés nicht für Menschen von über ein Meter fünfzig Körpergröße konstruiert - was überraschend war, wenn man sich Otto anschaute, der einen wahren Riesen abgab. Setzte er sich jemals auf seine eigenen Stühle? Er stand immer nur irgendwo herum, wie jetzt, da er sich gerade mit der Schürze über das Gesicht wischte. Trotz der schummrigen Beleuchtung glänzte seine Glatze hell.
»Komm, setz dich doch, Otto«, sagte Alex, der seine Hypothese überprüfen wollte. »Mach mal Pause.«
Otto warf seinem Assistenten Wesley, der sich um die gerade angekommenen Gäste kümmerte, einen kurzen Blick zu, dann drehte er einen der zierlichen Stühle mit geschwungenem Rücken um und setzte sich mit unerwarteter Grazie rittlings darauf.
»Scheußlich draußen, was?« Die breite Stirn des Cafébesitzers runzelte sich, als er Alex’ feuchte Haare und Kleider bemerkte. Obwohl Otto sein ganzes Erwachsenenleben in London verbracht hatte, haftete seiner Stimme immer noch etwas vom Tonfall seiner russischen Heimat an.
»Es kann sich nicht entscheiden, ob es schütten soll oder nicht. Was hast du denn heute Wärmendes auf der Speisekarte?«
»Rindfleischsuppe mit Graupen. Die und die Lammkoteletts, das dürfte reichen.«
»Gebongt. Und ich nehme eine Flasche von deinem besten Burgunder. Heute Abend begnüge ich mich nicht mit billigem Fusel.«
»Alex, altes Haus! Hast du vielleicht etwas zu feiern?«
»Du hättest es sehen sollen, Otto. Ich war in Sussex, um meine Tante zu besuchen, und habe zufällig mitbekommen, dass im Dorf eine Haushaltsauflösung stattfindet. Im Haus selbst gab es nichts, was einen zweiten Blick wert gewesen wäre. Aber in der Garage, auf einem der Tische mit Plunder, die da rumstanden, da hab ich sie entdeckt.« Alex schloss die Augen und kostete die Erinnerung aus. »Eine blauweiße Porzellanschüssel, völlig verdreckt, mit Pflanzhölzern und anderen Gartengeräten drin. Es war nicht mal ein Preisschild dran. Die Frau hat sie mir für fünf Pfund verkauft.«
»Ich nehme an, es war nicht wirklich Plunder?«, fragte Otto. Sein rundes Gesicht hatte einen amüsierten Ausdruck angenommen.
Alex blickte sich verstohlen um und senkte die Stimme. »Delfter Fayence, siebzehntes Jahrhundert. Englisch, wohlgemerkt, nicht holländisch. Ich würde es auf 1650 schätzen. Und unter dem ganzen Dreck kein einziger Kratzer, kein Sprung, nichts. Es ist ein Wunder, das sage ich dir.«
Es war ein Moment, für den Alex gelebt hatte, seit ihn seine Tante an seinem zehnten Geburtstag zu einem Flohmarkt mitgenommen hatte. Dort hatte er eine komische Schale entdeckt, die aussah, als hätte irgendwer ein Stück vom Rand abgebissen. Er war so begeistert gewesen, dass er sein ganzes Geburtstagsgeld dafür hingelegt hatte. Seine Tante hatte ein Buch über Porzellan beigesteuert, aus dem er erfahren hatte, dass sein Fund eine Barbierschüssel aus englischem Porzellan war, vermutlich Bristoler Manufaktur, frühes achtzehntes Jahrhundert. Vor seinem geistigen Auge hatte Alex all die Hände gesehen, durch die seine Schüssel gegangen war, all die Menschen, deren Leben sie gestreift hatte, und von diesem Augenblick an war er verloren gewesen.
Diese frühe Leidenschaft hatte ihn durch die Schulzeit begleitet, durch sein Studium, durch eine kurze Phase als Dozent für Kunstgeschichte an einem kleinen College. Danach hatte er das feste Einkommen zugunsten eines ungewisseren - und unendlich viel interessanteren - Lebens als Porzellanhändler aufgegeben.
»Also, wirst du mit dieser Schüssel dein Glück machen? Das heißt, falls du dich davon trennen kannst«, fügte Otto mit einem Augenzwinkern hinzu, aus dem seine langjährige Erfahrung mit Antiquitätenhändlern sprach.
Alex seufzte. »Muss ich wohl. Und ich weiß auch schon, wer sich dafür interessieren könnte.«
Otto musterte ihn einen Moment lang mit einem Ausdruck, den Alex nicht recht deuten konnte. »Du denkst, dass Karl Arrowood sie vielleicht haben will?«
»Das wäre doch was für ihn, findest du nicht? Du kennst ja Karl; er wird einfach nicht widerstehen können.« Alex malte sich aus, wie die Schüssel einen Ehrenplatz in dem elegant gestalteten Schaufenster von Antiquitäten Arrowood einnehmen würde - noch eine Schönheit, die Karl sein Eigen nennen konnte. Der bittere Neid begann sich in Alex’ Seele zu fressen.
»Alex …« Otto schien zu zögern, doch dann rückte er näher heran und sah ihn mit einem durchdringenden Blick seiner dunklen Augen an. »Ich kenne ihn allerdings, vielleicht besser als du. Verzeih mir, dass ich mich einmische, aber ich habe da gewisse Dinge über dich und Karls junge Frau gehört. Du weißt ja, wie es hier zugeht« - seine Geste schloss mehr als nur das Café ein - »hier bleibt nun mal nichts lange ein Geheimnis. Und ich fürchte, dir ist nicht ganz klar, worauf du dich da eingelassen hast. Karl Arrowood ist ein skrupelloser Mann. Es ist keine gute Idee, sich zwischen ihn und das, was er für sein Eigentum hält, zu stellen.«
»Aber -« Alex spürte, wie er rot wurde. »Wie -« Doch er wusste, dass das »Wie« keine Rolle spielte. Was zählte, war, dass seine Affäre mit Dawn Arrowood allgemein bekannt war. Und er war ein Narr gewesen, wenn er geglaubt hatte, sie geheim halten zu können.
Die Entdeckung dieser Barbierschüssel aus Porzellan war ein beinahe mystisches Erlebnis gewesen, und nicht minder seine erste Begegnung mit Dawn an jenem Tag, als er im Laden vorbeigeschaut hatte, um ein Tafelservice aus Creamware abzuliefern.
Dawn hatte der Verkäuferin beim Arrangieren der Waren im Schaufenster geholfen. Als er sie erblickt hatte, war Alex wie angewurzelt auf dem Gehsteig stehen geblieben. Noch nie hatte er so viel Schönheit und Vollkommenheit bei einer Person gesehen. Und dann hatte sie seinen Blick durch die Fensterscheibe erwidert und gelächelt.
Danach war sie öfter am Samstagmorgen zu seinem Stand gekommen, um zu plaudern. Sie war freundlich gewesen, ohne jede Spur von Geziertheit oder Koketterie, und er hatte sofort ihre Einsamkeit gespürt. Bald schon hatte die Vorfreude auf ihre samstäglichen Besuche seine Wochen ausgefüllt, doch mehr als das hatte er sich niemals zu erhoffen gewagt. Und dann war sie eines Tages unangemeldet an seiner Wohnungstür aufgetaucht. »Ich sollte so etwas eigentlich nicht tun«, hatte sie gesagt und den Kopf gesenkt, sodass die blonden Strähnen ihre Augen verdeckt hatten, aber sie war dennoch hereingekommen, und jetzt konnte er sich sein Leben nicht mehr ohne sie vorstellen.
»Weiß Karl Bescheid?«, fragte er Otto.
Otto zuckte mit den Achseln. »Ich denke, wenn er’s wüsste, würdest du es mitkriegen. Aber du kannst sicher sein, dass er dahinterkommen wird. Und ich möchte ungern einen guten Kunden verlieren. Alex, bitte, hör auf meinen Rat. Sie ist ein bezauberndes Ding, aber sie ist es nicht wert, dass du für sie dein Leben aufs Spiel setzt.«
»Mein Gott, Otto, wir sind hier schließlich in England! Hier schießt man einen nicht einfach über den Haufen, bloß weil man’ne Wut im Bauch hat wegen … na, du weißt schon.«
Otto stand auf und drehte bedächtig seinen Stuhl um. »Da wäre ich mir nicht so sicher, mein Freund«, entgegnete er und verschwand in der Küche.
»So ein Quatsch!«, brummte Alex. Er war entschlossen, Ottos Warnung in den Wind zu schlagen, und widmete sich mit grimmiger Entschlossenheit seinem Essen und seinem Wein.
Nachdem seine gute Laune einigermaßen wiederhergestellt war, ging er gemächlich zu seiner Wohnung zurück. Dabei dachte er an das zweite Fundstück, auf das er an diesem Tag gestoßen war - kein Schnäppchen wie die Fayence-Schüssel, aber dennoch ein wunderschönes Objekt - eine Art-déco-Teekanne von der englischen Keramikkünstlerin Clarice Cliff, mit einem Muster, das Dawn einmal in seiner Gegenwart bewundert hatte. Die Kanne würde sein Weihnachtsgeschenk für sie sein, ein Symbol für ihre gemeinsame Zukunft.
Erst als er schon im Begriff war, in seine Gasse einzubiegen, kam ihm ein beunruhigender Gedanke. Wenn Karl Arrowood die Wahrheit herausfände, dann würde seine eigene Sicherheit vielleicht gar nicht die größte seiner Sorgen sein.
Bryony Poole wartete, bis die Tür hinter der letzten Klientin des Tages ins Schloss gefallen war, einer Frau, deren Katze an einer Ohrinfektion litt. Erst dann wagte sie es, Gavin ihre Idee zu unterbreiten. In der engen Büroecke der Praxis setzte sie sich ihm gegenüber auf einen Stuhl. Nervös rutschte sie hin und her, während sie versuchte, einen Platz für ihre langen Beine und ihre gestiefelten Füße zu finden. »Hör mal, Gav, da gibt’s was, worüber ich gerne mit dir reden würde.«
Ihr Chef, ein kräftiger Mann mit rundem Schädel, dessen breite Schultern den Stoff seines weißen Laborkittels spannten, sah von der Karteikarte auf, die er gerade ausfüllte. »Das klingt ja bedenklich. Du willst mich doch nicht etwa verlassen, um dich beruflich zu verbessern?«
»Nein, ganz und gar nicht.« Gavin Farley hatte Bryony vor zwei Jahren als Assistentin in seiner kleinen Praxis eingestellt, als sie gerade ihr Studium der Veterinärmedizin abgeschlossen hatte, und sie schätzte sich immer noch glücklich, die Stelle zu haben. Zögernd fuhr sie fort. »Es ist nur - also, du weißt doch, wie viele Obdachlose Hunde haben?«
»Ist das vielleicht ein Quiz?«, fragte er skeptisch. »Oder willst du mich um eine Spende für den Tierschutzverein anhauen?«
»Nein … nicht direkt. Aber ich habe viel darüber nachgedacht, dass diese Leute es sich nicht leisten können, ihre Tiere medizinisch versorgen zu lassen. Ich würde gerne -«
Jetzt hatte sie seine volle Aufmerksamkeit.
»Bryony, das ist ja ausgesprochen bewundernswert von dir, aber wenn diese Leute Geld für Kippen und Bier übrig haben, dann können sie es sich doch wohl auch leisten, ihre Hunde zum Tierarzt zu bringen.«
»Das ist nicht fair, Gavin! Diese Menschen schlafen auf der Straße, weil die Nachtasyle keine Hunde aufnehmen. Sie tun, was sie können. Und du weißt doch, wie sehr wir unsere Preise erhöhen mussten.«
»Aber was kannst du denn überhaupt tun?«
»Ich würde gerne jede Woche eine kostenlose Sprechstunde abhalten, am Sonntagnachmittag beispielsweise, und dabei leichte Erkrankungen und Verletzungen behandeln.«
»Hat das irgendetwas mit deinem Freund Marc Mitchell zu tun?«
»Ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen«, antwortete Bryony abwehrend.
»Und wo genau wolltest du diese Sprechstunde abhalten?«
Sie errötete. »Na ja, ich hatte gedacht, Marc würde mir vielleicht seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen …« Marc Mitchell führte am unteren Ende der Portobello Road eine Suppenküche für Obdachlose - »im Freien übernachtende Mitbürger«, wie die Regierung sie gerne nannte, als ob sie sich freiwillig zu einem permanenten Campingurlaub entschlossen hätten. Gewiss, ein paar Häuser weiter gab es da noch die Heilsarmee, aber in einer Branche, die sich der Hilfe für Bedürftige widmete, existierte so etwas wie Konkurrenzdenken nicht. Es gab sowieso nie genug für alle. Marc versorgte sie mittags und abends mit warmen Mahlzeiten, außerdem mit allem, was er an grundlegendem medizinischem Bedarf und persönlichen Gegenständen auftreiben konnte. Aber das Wichtigste war vielleicht seine Bereitschaft, ihnen zuzuhören. Er strahlte eine Ernsthaftigkeit aus, die sie ermutigte, sich ihm zu öffnen, und manchmal war das allein schon Anstoß genug, um sie auf den Weg der Besserung zu bringen.
»Und wie hattest du dir vorgestellt, die Geräte und Medikamente zu finanzieren?«, fragte Gavin.
»Zunächst mal aus meiner eigenen Tasche. Und dann könnte ich vielleicht die hiesigen Ladeninhaber um Spenden bitten.«
»Na, das eine oder andere Pfund könntest du so vielleicht eintreiben«, gab er widerwillig zu. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Kundschaft anzieht, wenn vor dem Schaufenster räudige Hunde rumlungern. Aber mal angenommen, die Sache kommt in Gang. Was tust du denn, wenn du einmal persönliche Beziehungen zu diesen Leuten aufgebaut hast und sie dann nach und nach mit ihren schwer verletzten Hunden oder gar mit krebskranken Tieren hier aufkreuzen?«
»Ich … daran hatte ich nicht gedacht …«
Gavin schüttelte den Kopf. »Wir können hier keine Katastrophenhilfe bieten, Bryony. Wir kommen sowieso schon kaum über die Runden, mit der Mieterhöhung und deinem Gehalt und all dem. Es gibt einfach keinen Spielraum für selbstlose Gesten.«
»Damit werde ich schon fertig, wenn es erst mal so weit ist«, antwortete sie entschlossen. »Das mindeste, was ich ihnen im schlimmsten Fall anbieten kann, ist, die Tiere einzuschläfern.«
»Und das willst du aus deiner eigenen Tasche bestreiten? Du schadest dir nur selbst mit deiner Großzügigkeit«, sagte Gavin mit einem resignierten Seufzer, während er die letzte Eintragung machte und aufstand. »Den Verdacht hatte ich schon, als ich dich das erste Mal gesehen habe.«
Bryony lächelte. »Aber du hast mich trotzdem eingestellt.«
»Das habe ich, und ich habe es auch nicht bedauert. Du bist eine gute Tierärztin, und du kannst auch gut mit den Klienten umgehen, was fast genauso wichtig ist. Aber …«
»Was?«
»In unserer Branche wandeln wir nun einmal auf einem schmalen Grat zwischen Mitgefühl und nüchternem Geschäftssinn, und es würde mir gar nicht gefallen, wenn ich zusehen müsste, wie du stolperst. Es wird dich aufzehren, dieses Gefühl, nie genug tun zu können. Das habe ich schon bei hartgesotteneren Tierärzten erlebt. Mein Rat lautet: Mach deine Arbeit, so gut du kannst, und geh anschließend nach Hause und setz dich mit einem Drink vor den Fernseher. Du musst irgendeine Möglichkeit finden, abzuschalten.«
»Danke, Gav. Ich werde es mir merken. Versprochen.«
Sie grübelte über seine Worte nach, während sie zu Fuß die kurze Strecke von der Praxis zu ihrer Wohnung am Powis Square ging. Natürlich wusste sie, wo die Grenze war; natürlich war ihr klar, dass sie nicht jedem Tier helfen konnte. Aber nahm sie tatsächlich mehr auf sich, als sie tragen konnte, sowohl in emotionaler als auch in finanzieller Hinsicht? Und wie sehr war sie durch den uneingestandenen Wunsch motiviert, auf Marc Mitchell Eindruck zu machen?
Im Lauf der letzten Monate waren sie und Marc gute Freunde geworden und hatten sich häufig zum Essen oder auf einen Kaffee verabredet. Aber er hatte sich Bryony gegenüber nie so verhalten, dass sie es wirklich als amouröse Absichten hätte interpretieren können. Und sie hatte geglaubt, sie hätte sich zu der Überzeugung durchgerungen, dass es ihr nichts ausmachte. Anders als Gavin hatte Marc nicht gelernt, die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen. Seine Arbeit war sein Leben, und Bryony hatte den Verdacht, dass es in diesem Leben einfach keinen Platz mehr für irgendetwas Anspruchsvolleres als eine Freundschaft gab.
Dieser Gedanke war so schmerzlich, dass sie ihn sofort wieder verdrängte. Sie wollte doch nur den Tieren helfen, das war alles; und wenn das bedeutete, dass sie Marc ein wenig näher kommen konnte, dann war es eben einfach so.
Inspector Gemma James verließ die Polizeiinspektion Notting Hill pünktlich um sechs Uhr. Das war so ungewöhnlich, dass der Beamte am Empfang fragend die Stirn runzelte.
»Nanu, Inspector«, meinte er, »haben Sie etwa ein Date?«
»Richtig geraten«, antwortete sie mit einem verschmitzten Lächeln. »Und ich bin entschlossen, ausnahmsweise einmal nicht zu spät zu kommen.«
Kincaid hatte sie vom Yard aus angerufen und sie gebeten, sich mit ihm nur wenige Häuserblocks vom Revier entfernt zu treffen. Er hatte ihr keine Erklärung geliefert, sondern nur darauf bestanden, dass sie pünktlich sein solle. Das allein hatte genügt, um ihre Neugier zu wecken. Als Superintendent der Mordkommission von Scotland Yard hatte Duncan einen mindestens ebenso anstrengenden Dienstplan wie sie selbst, und für beide waren Überstunden eher die Norm als die Ausnahme.
Natürlich hatte sie versucht, wegen ihres »delikaten Zustands«, wie Kincaid es halb scherzhaft nannte, ein wenig kürzer zu treten, jedoch mit wenig Erfolg. Sie hatte nicht die Absicht, ihre Vorgesetzten von ihrer Schwangerschaft in Kenntnis zu setzen, solange es sich noch irgendwie vermeiden ließ, und wenn es einmal so weit wäre, würde sie noch viel weniger Lust haben, um Urlaub zu bitten.
Und wenn eine ungeplante Schwangerschaft schon einigermaßen katastrophale Folgen für ihre Karriereaussichten als frisch beförderte Kriminalinspektorin haben musste, so würde die Tatsache, dass sie unverheiratet war, ihr noch weniger Sympathien von ihren Vorgesetzten eintragen. Als sie Toby bekommen hatte, war sie wenigstens mit dem Vater des Kindes verheiratet gewesen.
Sie überprüfte noch einmal die Adresse, die sie auf einen Zettel gekritzelt hatte, und ging die Ladbroke Grove entlang bis St. John’s Gardens, wo sie nach links abbog. Die alte Kirche stand wie ein Wachturm an der höchsten Stelle von Notting Hill, und selbst an einem so trüben Abend wie diesem genoss Gemma die Stille der Gegend. Aber Kincaids Wegbeschreibung ließ sie weitergehen, den Abhang hinunter Richtung Westen. Nachdem sie noch ein paar Häuserblocks hinter sich gelassen hatte, begann sie nach den Hausnummern Ausschau zu halten.
Als Erstes entdeckte sie seinen MG, dessen Verdeck wegen des feuchten Wetters dicht verschlossen war, und dann auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Hausnummer, die er ihr genannt hatte. Es war das letzte Haus in einer Zeile von Reihenhäusern, jedoch mit der Front zu St. John’s Gardens und nicht zur Querstraße hin. Im Schein der Außenbeleuchtung und der Straßenlaterne erkannte sie dunkelbraune Backsteinmauern, von denen sich die leuchtend weißen Fensterrahmen und eine in lebhaftem Kirschrot gestrichene Haustür deutlich abhoben. Durch die Bäume im Vorgarten erblickte sie einen kleinen Balkon im zweiten Stock.
Duncan öffnete die Tür, bevor sie klingeln konnte. »Wie, bist du vielleicht ein Hellseher?«, fragte sie lachend, während er sie auf die Wange küsste.
»Eins von meinen zahlreichen Talenten.« Er nahm ihr die feuchte Jacke ab und hängte sie an einen schmiedeeisernen Kleiderständer in der Diele.
»Was geht hier eigentlich vor sich? Treffen wir uns hier mit irgendjemandem?«
»Nicht direkt«, antwortete er mit einem verschmitzten Grinsen, das sie an ihren vierjährigen Sohn erinnerte, wenn er eine Überraschung für sie hatte. »Schauen wir uns doch mal ein bisschen um, ja?«
Die Küche lag zur Linken, ein in fröhlichem Gelb gehaltener Raum mit einem Tisch aus abgeschliffenem Kiefernholz und einem dunkelblauen Herd, der mit Öl betrieben wurde. Gemmas Herz krampfte sich vor Neid zusammen. Es war alles perfekt - genau die Küche, die sie sich schon immer gewünscht hatte. Sie warf einen sehnsüchtigen Blick über die Schulter, als Kincaid sie auf den Flur hinausdrängte.
Die Wand zwischen Esszimmer und Wohnzimmer war entfernt worden, um einen einzigen langen Raum zu schaffen, mit tiefen Fenstern und einer Glastür, durch die man, wie Gemma vermutete, in den Garten gelangte. Die Esszimmermöbel hatten eine provenzalische Note, und im Wohnzimmer waren ein schon etwas betagtes, gemütlich aussehendes Sofa und zwei Sessel um einen künstlichen Kamin gruppiert. Die Bücherregale reichten bis zur Decke. In ihrer Phantasie sah Gemma die Regale mit Büchern angefüllt, ein warmes Glimmen im Gasofen.
»Ganz nett, was?«, meinte Kincaid.
Gemma warf ihm einen Seitenblick zu. Ihr Verdacht wuchs. »Mmm.«
Unbeeindruckt von ihrer Zurückhaltung setzte er den Rundgang fort. »Und hier, versteckt hinter der Küche, ein kleines Klo.« Nachdem sie das Örtchen gebührend bewundert hatte, führte er sie in das letzte kleine Zimmer auf der linken Seite, eine Art Arbeitszimmer oder Bibliothek. Aber in den Regalen standen keine Bücher, und in der Küche hatte sie kein Geschirr entdecken können, ebenso wenig wie irgendwelche persönliche Gegenstände oder Fotos im Wohn- und Essbereich.
»Ich würde den Fernseher hier reinstellen, was meinst du?«, redete er fröhlich weiter. »Um die Atmosphäre des Wohnzimmers nicht zu verderben, weißt du.«
Gemma drehte sich um und sah ihm direkt in die Augen. »Duncan, willst du vielleicht deinen Polizeijob an den Nagel hängen und Immobilienmakler werden? Ich gehe keinen Schritt weiter, wenn du mir nicht auf der Stelle erklärst, was das Ganze eigentlich soll.«
»Sag mir zuerst, ob es dir gefällt, Schatz. Denkst du, du könntest hier wohnen?«
»Natürlich gefällt es mir! Aber du kennst doch die Quadratmeterpreise in dieser Gegend - so was wie das hier könnten wir uns niemals leisten, selbst wenn wir unsere Gehälter zusammenlegen -«
»Lass dir noch ein bisschen Zeit, bevor du ein endgültiges Urteil fällst. Sehen wir uns erst mal den Rest des Hauses an.«
»Aber -«
»Vertrau mir.«
Sie folgte ihm nach oben in den ersten Stock und grübelte indessen über ihre Situation nach. Es musste sich etwas ändern in ihrem Leben, das war klar. Die winzige Garagenwohnung, in der sie zur Miete lebte, war viel zu klein für ein weiteres Kind, und Kincaids Wohnung in Hampstead war genauso ungeeignet - zumal es so aussah, als würde sein zwölfjähriger Sohn in den Ferien bei ihm einziehen.
Seit sie Kincaid von dem Baby erzählt hatte, hatten sie darüber gesprochen, dass sie zusammenziehen und aus ihren zwei Familien eine machen wollten, aber Gemma hatte festgestellt, dass sie noch nicht bereit war, sich einer so weitreichenden Veränderung zu stellen.
»Zwei große Schlafzimmer und ein Bad auf dieser Etage.« Kincaid öffnete die Türen und schaltete die Lichter ein, damit sie alles in Augenschein nehmen konnte. Es handelte sich offensichtlich um Kinderschlafzimmer, aber auch hier waren an den Wänden nur die helleren Rechtecke zu sehen, wo Bilder und Poster gehangen hatten.
»Und jetzt kommt das Glanzstück.« Er nahm sie bei der Hand und führte sie die Treppe hoch in den zweiten Stock.
Gemma blieb wie angewurzelt in der Tür stehen. Das komplette Obergeschoss war in eine offene, luftige Suite umgewandelt worden, von der man auch auf den Balkon gelangte, den sie von der Straße aus gesehen hatte.
»Und das ist noch nicht alles.« Kincaid öffnete eine andere Glastür. Gemma trat hinaus in einen kleinen Dachgarten. »Hinter dem Hausgarten ist noch ein Gemeinschaftsgarten. Da kannst du einfach so reinspazieren.«
Gemma stieß einen entzückten Seufzer aus. »Oh, die Jungs wären total begeistert. Aber das ist doch nicht möglich … oder?«
»Es wäre sehr wohl möglich - wenigstens für die nächsten fünf Jahre. Dieses Haus gehört der Schwester des Chefs -«
»Chief Superintendent Childs?« Denis Childs war Kincaids direkter Vorgesetzter bei Scotland Yard und auch Gemmas ehemaliger Chef.
»Ihr Mann hat gerade einen Fünfjahresvertrag bei irgendeiner Hightechfirma in Singapur unterschrieben. Sie wollen das Haus nicht verkaufen, aber sie wollen, dass es in guten Händen ist - und wer wäre dafür besser geeignet als zwei Polizeibeamte mit Referenzen vom Chief Super persönlich?«
»Aber wir könnten es uns trotzdem nicht leisten -«
»Die Miete ist durchaus erträglich.«
»Und was ist mit deiner Wohnung?«
»Ich denke, dass ich sie für wesentlich mehr als die monatlichen Ratenzahlungen vermieten kann.«
»Und was ist mit Toby? Ohne Hazel als Babysitterin -«
»Ein paar Häuser weiter vom Revier ist ein Kindergarten. Und eine gute Gesamtschule für Kit ist auch in der Nähe. So, noch irgendwelche weiteren Einwände?« Er fasste sie an den Schultern und sah ihr in die Augen.
»Nein … es ist bloß … es klingt einfach zu schön, um wahr zu sein.«
»Du kannst die Zukunft nicht ewig vor dir herschieben, Schatz. Und wir werden dich nicht enttäuschen. Das verspreche ich dir.«
Vielleicht hatte er ja Recht … Nein! Sie wusste, dass er Recht hatte. Als Tobys Vater sie mit dem neugeborenen Kind im Stich gelassen hatte, da hatte sie sich geschworen, dass sie sich nie wieder von irgendjemandem abhängig machen würde. Aber Kincaid hatte sie noch nie in irgendeiner Weise enttäuscht - warum also sollte sie ihm nicht auch in diesem Fall vertrauen? Gemma ließ sich entspannt in seine Arme sinken.
»Blaues und gelbes Geschirr in der Küche«, murmelte sie, das Gesicht an seine Brust geschmiegt. »Und ein bisschen frische Farbe in den Schlafzimmern, was meinst du?«
Er vergrub seine Nase in ihren Haaren und fragte leise: »Heißt das ›Ja‹?«
Gemma hatte das Gefühl, schwankend am Rande eines Abgrundes zu stehen. Wenn sie sich darauf einließe, würde sie die Sicherheit ihres alten Lebens mit einem Schlag aufgeben. Es würde keinen Weg zurück geben. Aber sie konnte es sich nicht mehr leisten, die Entscheidung aufzuschieben, bis sie sich auch den letzten Zweifel ausgetrieben hatte. Mit dieser Erkenntnis kam eine gänzlich unerwartete Welle der Erleichterung, und dazu das unverwechselbare Prickeln der freudigen Erwartung.
»Ja«, antwortete sie. »Ich denke, es heißt ›Ja‹.«
Feuchte Luft umgab die Straßenlaternen entlang der Park Lane mit kreisrunden Lichtkränzen, während der Dezembertag allmählich in einen trüben Abend überging. Die Atmosphäre war irgendwie bedrückend, und die vereinzelten Lichter der Weihnachtsdekorationen kämpften vergeblich gegen die allgemeine Düsternis an.
Verdammter Freitagsverkehr, dachte Dawn Arrowood. In einem plötzlichen Anflug von Platzangst öffnete sie das Fenster ihres Mercedes und reihte sich vorsichtig in die lange Autoschlange an der Ecke zum Hyde Park ein. Sie hatte gewusst, dass es keine gute Idee war, mit dem Auto ins West End zu fahren, aber die Vorstellung der überfüllten U-Bahn hatte sie abgeschreckt, mit dem unvermeidlichen Geschiebe und Gedränge und der allzu intimen Begegnung mit den ungewaschenen Körpern fremder Menschen.
Nicht an diesem Tag, nicht ausgerechnet an diesem Tag.
Sie hatte sich so gut es ging gewappnet: ein Einkaufsbummel bei Harrod’s vor dem Arzttermin, Tee mit Natalie bei Fortnum & Mason hinterher. Hatte sie geglaubt, diese Zerstreuungen würden die Wirkung der Nachricht, die sie so fürchtete, irgendwie abmildern und alles leichter machen?
Und der Trost, den ihre alte Freundin Natalie ihr so bereitwillig gewährt hatte, machte die Sache kein bisschen besser.
Sie war schwanger. Punkt, aus. Tatsache.
Und sie würde es Karl sagen müssen.
Vor ihrer Heirat, die inzwischen fünf Jahre zurücklag, hatte ihr Mann ganz unmissverständlich erklärt, dass er keine zweite Familie wollte. Er war fünfundzwanzig Jahre älter als sie, hatte zwei Söhne, die nicht nach seinen Vorstellungen geraten waren, und eine Exfrau, die nichts als Ärger machte. Er hatte sehr deutlich gemacht, dass er keine Lust hatte, diese Erfahrung zu wiederholen.
Für einen schwachen Moment gestattete Dawn sich die Hoffnung, dass er seine Meinung ändern würde, sobald er die Nachricht hörte, doch sie wusste, dass es nur eine Wunschvorstellung war. Karl hatte noch nie seine einmal gefasste Meinung geändert, und er reagierte auch ziemlich wütend, wenn man seine Wünsche missachtete.
Die Ampel sprang endlich auf Grün, und während sie in die Bayswater Road einbog, nahm sie die Zigarettenpackung aus der Ablage und schüttelte sich eine Zigarette heraus. Sie würde das Rauchen aufgeben, das schwor sie sich - aber noch nicht gleich … zuerst musste sie sich einen Plan zurechtlegen.
Wenn sie darauf bestand, das Kind auszutragen, was würde Karl dann tun? Würde er sie auf die Straße setzen, ohne Geld, ohne alles? Der Gedanke jagte ihr Angst ein. Sie hatte es weit gebracht seit ihrer Kindheit in einem Reihenhaus in East Croyden, und sie hatte nicht vor, all das wieder aufzugeben, was sie erreicht hatte. Wenigstens das hatte Natalie begriffen. Du hast doch auch Rechte, hatte Natalie gesagt, doch Dawn hatte nur den Kopf geschüttelt. Karl hatte einen sehr teuren Anwalt engagiert, und sie war sich sicher, dass weder er noch sein Anwalt sich von so einer Kleinigkeit wie ihren verbrieften Rechten würden abschrecken lassen.
Und natürlich rechnete sie bei alldem noch damit, ihn irgendwie davon überzeugen zu können, dass das Kind von ihm war.
Bei diesem Gedanken durchfuhr sie unwillkürlich ein Schauder. Alex. Sollte sie es Alex sagen? Nein, das wagte sie nicht. Er würde verlangen, dass sie Karl verließ, würde behaupten, sie könnten doch zu dritt glücklich und zufrieden in seiner winzigen Wohnung an der Portobello Road leben. Er würde darauf bestehen, dass Karl sie gehen ließ.
Nein, sie würde mit Alex Schluss machen müssen, in seinem eigenen Interesse; irgendwie würde sie ihn davon überzeugen müssen, dass es nur eine flüchtige Affäre gewesen war. Als sie sich auf das Verhältnis mit Alex eingelassen hatte, war ihr nicht klar gewesen, welch einen gefährlichen Kurs sie da steuerte - und sie hatte auch nicht geahnt, dass sie sich ausgerechnet den Mann zum Liebhaber gewählt hatte, den ihr Mann ihr nie verzeihen würde.
Der Verkehr begann zügiger zu rollen, und schon bald - zu bald, wie es schien - erreichte sie Notting Hill Gate. Die abendliche Pendlerschar drängte zu den Eingängen der U-Bahn wie Lemminge auf dem Marsch zum Meer - Zeitungen und Weihnachtseinkäufe unter die Arme geklemmt, eilten sie nach Hause, zu ihrem Vorstadtleben, das aus Babys, Fernsehen und Fertiggerichten bestand. Das Bild versetzte ihr einen Stich, und mit dem Neid und dem Bedauern kamen die Tränen, die in letzter Zeit beim geringsten Anlass zu fließen begannen. Verärgert tupfte sich Dawn die unteren Wimpern - sie würde keine Zeit mehr haben, ihr Make-up aufzufrischen. Sie war ohnehin schon spät dran, und Karl würde erwarten, dass sie fertig wäre, wenn er nach Hause kam, um sie für ihre Einladung zum Abendessen abzuholen.
Karl lebte vom äußeren Schein, und sie wusste inzwischen nur zu gut, dass er sie genauso skrupellos an sich gerissen hatte wie eines seiner Ölgemälde aus dem achtzehnten Jahrhundert oder ein besonders schönes Porzellangeschirr. Was sie in ihrer Naivität für Liebe gehalten hatte, war nichts als Besitzanspruch gewesen - und sie war das Juwel, das er schon im Hinblick auf die Fassung gekauft hatte, in die er es setzen würde.
Und was für eine Fassung es war, dieses Haus im Grünen auf der höchsten Erhebung von Notting Hill, gleich gegenüber der St. John’s Church mit ihrer verblichenen Eleganz. Anfangs hatte Dawn es geliebt, dieses viktorianische Haus mit seinem blassgelben Putz, seinen hervorragend proportionierten Räumen und der wunderschönen Ausstattung, und einen Augenblick lang gab sie sich der Trauer um diese unschuldigen Freuden hin.
An diesem Abend waren die Fenster dunkel, als sie in die Einfahrt einbog; das Licht der Scheinwerfer spiegelte sich in den leeren Scheiben. Sie hatte es also geschafft, vor Karl zu Hause zu sein, und würde noch ein paar Minuten für sich haben. Sie schaltete den Motor aus und griff nach ihren Paketen, hielt dann aber inne und kniff die Augen zu. Zum Teufel mit Karl! Zum Teufel mit Alex! Ganz gleich, was sie sagen oder tun würden, sie würde eine Möglichkeit finden, mit dieser Sache fertig zu werden, eine Möglichkeit, das Kind zu behalten, das sie so sehr wollte, wie sie noch nie irgendetwas gewollt hatte.
Sie stieg aus, die Schlüssel in der einen und die Taschen in der anderen Hand, und duckte sich, um den feuchten Zweigen der Hecke auszuweichen, die ihre Einfahrt säumte.
Ein Geräusch ließ sie erstarren. Die Katze, dachte sie und atmete erleichtert auf, bis ihr plötzlich einfiel, dass sie Tommy entgegen Karls strikter Anweisung im Haus eingesperrt hatte. Tommy war krank gewesen, und sie hatte ihn nicht unbeaufsichtigt aus dem Haus lassen wollen, weil sie befürchtete, er könnte in eine Auseinandersetzung mit einer andern Katze geraten.
Da war es wieder. Ein Rascheln, ein Schnaufen, irgendetwas, das nicht zu der Stille des feuchten Winterabends passte. Panik erfasste sie, drückte ihr das Herz zusammen und ließ sie wie gelähmt auf der Stelle verharren.
Sie zwang sich zum Nachdenken und packte den Schlüsselbund in ihrer Hand noch fester. Die Haustür am Ende der Einfahrt schien unendlich weit weg. Wenn sie erst einmal die Tür erreicht und sich dahinter in Sicherheit gebracht hätte, könnte sie sich einschließen, könnte Hilfe herbeirufen. Sie hielt den Atem an und machte einen Schritt -
Die Arme schlangen sich von hinten um sie, eine behandschuhte Hand drückte sich grausam auf ihren Mund. Zu spät begann sie sich zu wehren und zerrte vergeblich an dem Arm, der ihre Brust umklammert hielt, trat mit aller Kraft auf einen Schuh. Zu spät betete sie, dass die Scheinwerfer von Karls Wagen in der Einfahrt auftauchten.
Der Atem des Angreifers drang in heftigen Stößen an ihr Ohr. Sein Griff wurde fester. Die Taschen entglitten ihren tauben Fingern, ohne dass sie es bemerkt hätte. Dann ließ der Druck auf ihrer Brust nach, und in diesem Moment der Erleichterung durchfuhr ein blitzartiger Schmerz ihren Hals.
Sie spürte eine brennende Kälte, dann senkte sich die Dunkelheit wie eine Decke auf sie herab und hüllte sie ein. In den letzten trüben Momenten, bevor sie das Bewusstsein verlor, glaubte sie zu hören, wie jemand flüsterte: »Es tut mir Leid, es tut mir so Leid.«
2
Portobello war die Einkaufsstraße unserer Familie. Hier gab es jede Menge koschere Metzgereien … acht oder neun in der unmittelbaren Umgebung, dazu jüdische Lebensmittelläden, die köstliche Bagels und Brotspezialitäten verkauften.
Whetlor und Bartlett, aus: Portobello
Sie saß auf der Vortreppe und raschelte träge mit dem Kleid zwischen ihren Beinen, während sie auf die Klänge des neuen Cliff-Richard-Songs lauschte, die aus dem offenen Fenster auf der anderen Straßenseite herüberwehten. Sie hatte sich ihren zwölften Geburtstag ein wenig anders vorgestellt, aber ihre Eltern waren der Meinung, dass man um solche Anlässe nicht so viel Aufhebens machen sollte. Sie glaubten auch nicht, dass sie einen eigenen Plattenspieler brauchte, das einzige Geschenk, das sie sich wirklich sehnlichst wünschte. »Eine absolut überflüssige Ausgabe«, war der Kommentar ihres Vaters gewesen, und alle ihre Argumente waren an ihm abgeprallt.
Sie seufzte vernehmlich, schlang die Arme um die Knie und malte ihren Namen in den Staub auf der Treppenstufe. Ihr war fürchterlich langweilig - und heiß war ihr auch. Eine neue, sonderbare Art von Unruhe hatte sie erfasst.
Wenn ihre Mutter nach Hause käme, würde sie sie vielleicht überreden können, sie zur Feier ihres Geburtstags ins Kino gehen zu lassen, um sich einen neuen Film anzusehen. Im dunklen Saal würde es wenigstens schön kühl sein, und sie würde ihr Taschengeld für Süßigkeiten vom Kiosk ausgeben können.
Sie fragte sich gerade, ob Radio Luxemburg heute Abend wohl die neue Platte von Elvis bringen würde, als sie ganz in der Nähe das Knattern eines Motors hörte. Ein Lastwagen fuhr vor dem Nachbarhaus vor. Auf der offenen Ladefläche sah sie Matratzen, ein orangefarbenes Sofa, einen Sessel mit fröhlichem Blumenbezug, alles bunt durcheinander gewürfelt und aufgeheizt von der glühenden Augustsonne.
Die Fahrertür ging auf, ein Mann stieg aus und blickte zu dem Haus auf. Er trug ein weißes Hemd und eine schwarze Krawatte, und seine Haut hatte den tiefen Farbton der Zartbitterschokolade, die ihre Mutter zum Backen benutzte.
Eine Frau schlüpfte auf der Beifahrerseite heraus. Die Absätze ihrer Pumps klapperten beim Aussteigen auf dem Asphalt. Wie ihr Mann war sie schick und elegant gekleidet; ihr Hemdblusenkleid war frisch gebügelt und gestärkt. Sie gesellte sich zu ihm und betrachtete das Haus mit enttäuschter Miene. Er lächelte und fasste sie am Arm, dann wandte er sich zur Ladefläche des Lkws um und rief irgendetwas.
Zwischen den Kartons und Bündeln kam ein Mädchen hervorgekrochen. Sie war etwa in ihrem Alter; ihre nackten Beine waren dünn und braun, und sie trug ein pinkfarbenes Rüschenkleid. Als nächstes kam ein Junge; er war ein oder zwei Jahre älter, hoch aufgeschossen und schlaksig. Es kam ihr vor, als habe der heiße Wind diese Familie hergeweht, von irgendeinem fernen, exotischen Ort, der ganz anders war als dieses schäbige Londoner Vorortviertel und seine Reihenhäuser mit bröckelndem Putz. Von einem Ort voller Düfte und Farben, die sie nur in ihrer Phantasie gekannt hatte. Die vier gingen im Gänsemarsch die Stufen hoch und verschwanden im Haus, und ohne sie wirkte die Straße mit einem Mal ganz leblos.
Als ihr klar wurde, dass sie nicht gleich wieder herauskommen würden, verschränkte sie frustriert die Arme vor der Brust. Dann würde sie eben irgendjemandem davon erzählen, aber wem? Ihre Mutter würde erst in ein, zwei Stunden zurück sein, aber ihren Vater würde sie im Café antreffen, wo er gewöhnlich hinging, wenn das Vormittagsgeschäft an seinem Schmuckstand gut gelaufen war.
Sie sprang die Stufen hinunter und lief los. Die Westbourne Park Road entlang bis zur Portobello, wo sie geschickt die Obst- und Gemüsestände umrundete, dann um die Ecke in den Elgin Crescent. Vor dem Café blieb sie stehen und schnappte nach Luft, während sie sich die Nase an der Scheibe plattdrückte. Ja, da war er - dort hinten an seinem Lieblingstisch konnte sie ihn gerade eben ausmachen. Sie strich ihr Kleid glatt und schlüpfte durch die offene Tür in das dunkle Café hinein. Die Gäste saßen in Hemdsärmeln an den Tischen, Männer, die in polnischen Zeitungen lasen und die heiße, stickige Luft mit den dicken Rauchwolken aus ihren Pfeifen und Zigaretten erfüllten.
Sie hustete unwillkürlich, worauf ihr Vater den Kopf hob und sie stirnrunzelnd ansah. »Was machst du denn hier, meine Kleine? Ist irgendwas nicht in Ordnung?«
Er glaubte immer, dass irgendetwas nicht in Ordnung sei. Sie vermutete, dass seine Erlebnisse im Krieg der Grund waren, weshalb er sich immerzu Sorgen machte, doch er redete nie darüber. Ihr Vater war 1946 mit seiner Mutter nach England gekommen, gleich nachdem er aus der Armee entlassen worden war, fest entschlossen, den Krieg hinter sich zu lassen und sich eine neue Existenz als Juwelier und Silberschmied aufzubauen.
Neun Monate später war sie dann auf der Bildfläche erschienen, aber er hatte es dennoch weit gebracht - weiter als manch anderer Mann hier im Café, wie sie wohl wusste. Trotzdem hing er immer noch an den Dingen, die ihn an die alte Heimat erinnerten: dem Duft von Borschtsch und Piroggen, den mit polnischem Kunsthandwerk dekorierten dunklen Holzpaneelen - und der Gesellschaft der drallen Kellnerinnen mit ihren gefärbten Haaren.
»Nein, alles in Ordnung«, antwortete sie und setzte sich neben ihm auf die gepolsterte Sitzbank. »Und ich bin auch nicht klein. Ich wünschte, du würdest mich nicht so nennen, Papa.«
»Und warum kommt meine sehr erwachsene Tochter dann hier hereingeplatzt, als wäre der Leibhaftige hinter ihr her?«
»Bei uns nebenan sind neue Leute eingezogen.«
»Und was ist daran so außergewöhnlich?«, fragte er, immer noch in diesem neckenden Ton.
»Sie sind aus Westindien«, flüsterte sie und merkte, wie sich die Köpfe zu ihnen drehten. »Vater, Mutter und zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, ungefähr in meinem Alter.«
Ihr Vater ließ die Neuigkeit in seiner bedächtigen Art auf sich einwirken, bevor er schließlich den Kopf schüttelte. »Ärger. Das wird Ärger geben.«
»Aber sie sehen sehr nett aus -«
»Das spielt keine Rolle. Jetzt geh brav nach Hause und warte auf deine Mutter, und halte dich von diesen Leuten fern. Ich will nicht, dass dir irgendwas zustößt. Versprich mir das.«
Mit hängendem Kopf antwortete sie: »Ja, Papa«, doch sie vermied es, ihm in die Augen zu sehen.
Langsam schlenderte sie nach Hause zurück. Die Reaktion ihres Vaters hatte ihren Enthusiasmus deutlich gedämpft. Sicherlich irrte er sich - was sollte denn schon passieren? Sie wusste, dass es Ärger gegeben hatte, als Familien aus der Karibik anderswo im Viertel eingezogen waren; im Blenheim Crescent, gleich um die Ecke vom Café, war es sogar zu regelrechten Krawallen gekommen. Aber die meisten Leute in ihrer Straße kannte sie schon seit frühester Kindheit; sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie zu den Dingen fähig sein sollten, über die sie die Erwachsenen hatte flüstern hören.
Doch als sie in der Westbourne Park Road ankam, sah sie, dass sich vor dem Nachbarhaus eine Menschenmenge gebildet hatte. Schweigend und wachsam standen sie um den Lastwagen herum. Von den Neuankömmlingen war nichts zu sehen.
Sie zögerte einen Moment, als sie sich an die Anweisungen ihres Vaters erinnerte. Dann tauchte an einem Fenster im ersten Stock ein dunkles Gesicht auf, und die Menge wurde unruhig; ein bedrohliches Gemurmel erhob sich.
Ohne einen weiteren Gedanken an ihr Versprechen zu verlieren, bahnte sie sich einen Weg zur Ladefläche des Lastwagens, schnappte sich die größte Kiste, die sie tragen konnte, und marschierte damit zur Haustür. Sie warf der Versammlung noch einen trotzigen Blick über die Schulter zu, dann drehte sie sich um und klopfte an die Tür.
Als sie die Treppe vom obersten Stock des Hauses herunterkamen, vernahm Kincaid das leise, aber hartnäckige Klingeln eines Telefons. Das Geräusch schien aus der Nähe des Kleiderständers zu kommen. Gemma fluchte halblaut vor sich hin, während sie das Zimmer durchquerte und die Hand in die Tasche ihrer Jacke steckte, um das Handy herauszuholen.
Aus der Art, wie sie der Stimme am anderen Ende mit unbewegter Miene lauschte, schloss Kincaid, dass sie keinen romantischen Abend zu zweit verbringen würden, um den Beginn eines neuen Zeitabschnitts in ihrer Beziehung zu feiern.
»Worum ging’s?«, fragte er, als sie das Gespräch beendet hatte.
»Ein Mord. Ganz in der Nähe, bei der Kirche.«
»Dein Fall?«
Sie nickte. »Vorläufig jedenfalls. Der Superintendent ist nicht zu erreichen.«
»Irgendwelche Einzelheiten?«
»Eine junge Frau. Ihr Mann hat sie gefunden.«
»Komm. Du wirst schneller dort sein, wenn ich dich hinfahre.« Er spürte schon den gewohnten Nervenkitzel, doch während sie zum Wagen eilten, wurde ihm zu seiner Enttäuschung klar, dass er bei diesem Fall nur ein Zuschauer sein würde, ganz gleich, welche interessanten Herausforderungen er bereithalten mochte.
Als sie den höchsten Punkt des Hügels erreichten, sah er auf der linken Straßenseite das Blaulicht aufleuchten. Kincaid parkte hinter dem letzten Streifenwagen. Sie stiegen aus, und er folgte Gemma, die bereits den Polizisten begrüßte, der zur Sicherung des Tatorts eingeteilt war.
»Was können Sie mir sagen, John?«, fragte sie leise.
Der junge Mann war ein wenig grün im Gesicht. »Ich war als Erster vor Ort. Dieser Gentleman kam nach Hause und fand seine Frau am Boden zwischen dem Wagen und der Hecke. Er hat gleich einen Krankenwagen gerufen, aber es war schon zu spät - sie war tot.«
»Todesursache?«
»Jemand hat ihr die Kehle durchgeschnitten.« Er schluckte. »Alles voller Blut.«
»Ist die Gerichtsmedizin verständigt worden? Und die Jungs von der Spurensicherung?«
»Ja, Ma’am. Sergeant Franks hat das Kommando bis zu Ihrem Eintreffen übernommen.«
Kincaid bemerkte, wie Gemma das Gesicht verzog, doch sie sagte nur: »Danke, John, das genügt. Sie werden doch den Tatort abgesperrt haben, bevor die Spurensicherung eintrifft?«
»Ja, Ma’am. Constable Paris übernimmt das.« Während er sprach, trat eine Polizistin hinter dem letzten der Streifenwagen hervor. Sie begann das blauweiße Band zu entrollen, mit dem sie die Grenzen des Tatorts markieren würde.
Kincaid blieb hinter Gemma zurück, während sie mit der jungen Frau sprach, und sah als Erster den korpulenten Mann auf sie zukommen, der bereits den für Tatortbegehungen vorgeschriebenen weißen Overall übergezogen hatte. Das musste Sergeant Franks sein, von dem Gemma mit Abneigung und dennoch mit Respekt gesprochen hatte. Franks, ein Mann in mittleren Jahren mit beginnender Glatze und einem faltigen Gesicht, das ihm einen Ausdruck permanenter Unzufriedenheit verlieh, sprach Gemma an, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten. »Sie sollten sich auch was überziehen, bevor Sie weitergehen.«
»Danke, Gerry«, antwortete Gemma verbindlich. »Haben Sie noch einen Overall da? Oder vielmehr zwei.« Sie blickte sich nach Kincaid um und fügte hinzu: »Das ist Superintendent Kincaid vom Yard.«
Während sie in die Overalls schlüpften, die Franks aus dem Kofferraum eines der Autos genommen hatte, fragte Gemma: »Was können Sie bisher sagen, Gerry?«
»Der Ehemann kam nach Hause, rechnete damit, dass seine Frau ausgehbereit auf ihn warten würde. Sie waren zum Abendessen eingeladen. Ihr Wagen stand in der Einfahrt, aber das Haus war dunkel. Er ging hinein und rief nach ihr, sah sich um, ging wieder nach draußen und fand die Leiche in der Einfahrt. Versuchte sie hochzuheben, rief dann den Notarzt.«
»Haben die Rettungssanitäter sie angefasst?«
»Nein, aber der Mann. Er ist über und über mit Blut beschmiert.«
»Wie ist sein Name?«
»Karl Arrowood. Wesentlich älter als seine Frau, schätze ich, und gut situiert. Hat ein exklusives Antiquitätengeschäft in der Kensington Park Road.«
Dass er gut situiert war, konnte man kaum übersehen, dachte Kincaid, als er einen Blick auf das Haus warf. Die Fenster im Erdgeschoss waren jetzt hell erleuchtet und ließen den blassgelben Außenputz und die weiß gestrichenen klassischen Säulen erkennen, die das Vordach stützten. In der Einfahrt standen zwei Mercedes-Limousinen Seite an Seite.
»Wo ist Mr. Arrowood jetzt?«
»Constable Talbot ist mit ihm ins Haus gegangen, um ihm eine Tasse Tee zu machen. Ich könnte allerdings wetten, dass er mehr der Typ für härtere Sachen ist.«
»Gut. Er läuft uns ja nicht weg. Ich muss mir zuerst die Leiche anschauen, bevor die Gerichtsmedizin kommt. Wie sieht’s mit Licht für den Tatort aus?«
»Bringt die Spurensicherung mit.«
»Dann müssen wir eben so zurechtkommen. Wie heißt sie übrigens? Ich meine die Frau.«
»Dawn. Hübscher Name.« Franks zuckte mit den Achseln. »Nützt ihr jetzt auch nicht mehr viel.«
Gemma wandte sich an Kincaid. »Willst du mir zur Hand gehen?«
»Das möchte ich mir nicht entgehen lassen.«
Sie streiften sich Schutzhüllen mit Gummizug über die Schuhe und gingen vorsichtig die Einfahrt hoch, wobei sie die dem Haus zugewandte Seite wählten. Es war unwahrscheinlich, dass der Täter hier entlanggegangen war. Nachdem sie sich an den Autos vorbeigeschoben hatten, fanden sie den Weg durch ein schmiedeeisernes Tor versperrt, das auf der anderen Seite der Einfahrt an eine Hecke grenzte.
»Hier kann man sich nirgendwo verstecken, außer in der Hecke«, murmelte Gemma.
Die Leiche lag vor dem Wagen, der neben der Hecke stand, ein dunkler Schatten, den sie beim Näherkommen als eine schlanke Frau in einer Lederjacke erkannten. Ein deutlicher Eisengeruch hing in der feuchten Luft - Blut.
Kincaid spürte, wie ihm die Galle hochkam, als er in die Hocke ging und mit seiner Taschenlampe Dawns reglose Gestalt anstrahlte. Als Gemma sich bückte, um die Leiche in Augenschein zu nehmen, ohne sie zu berühren, sah er die Schweißperlen auf ihrer Stirn und ihrer Oberlippe glänzen. »Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er leise, und es gelang ihm nur mit Mühe, den Ausdruck ängstlicher Sorge aus seiner Stimme herauszuhalten. Gemma hatte fast eine Fehlgeburt erlitten, als sie sechs Wochen zuvor in einer dramatischen Aktion eine junge Mutter und ihr Neugeborenes vom Gipfel des Glastonbury Tor gerettet hatte. Zwar hatten die Ärzte sie angewiesen, künftig kürzer zu treten, aber sie war nicht bereit gewesen, sich beurlauben zu lassen, und nun musste er feststellen, dass er wie eine Glucke über sie wachte.
»Ich hätte besser auf das Curry zum Mittagessen verzichten sollen.« Gemma setzte ein bemühtes Lächeln auf. »Aber ich will verdammt sein, wenn ich es vor Gerry Franks’ Augen wieder rauskotze.«
»Ganz zu schweigen davon, dass es die Spurensicherung erheblich erschweren würde«, witzelte er, zutiefst erleichtert, dass es nur eine gewöhnliche Übelkeit war, die sie plagte.
Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Opfer zu. Jung - vielleicht Anfang dreißig -, das blonde Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, der jetzt leicht zerzaust war; ein fein geschnittenes Gesicht mit hohen Wangenknochen, das, wie er vermutete, im Leben auffallend schön gewesen war. Das Bild wurde gründlich verdorben durch die hässliche, tiefe Schnittwunde unter dem Kinn. Im Licht der Taschenlampe war das weiße Schimmern des Knorpelgewebes zu erkennen.
Die Bluse der Frau war aufgeschnitten und zurückgestreift worden, und Kincaid glaubte unterhalb der Blutspritzer, die aus der Halswunde stammten, eine weitere Verletzung in der Brust ausmachen zu können. Bei der schlechten Beleuchtung konnte er sich allerdings keineswegs sicher sein. »Keinerlei Zögern. Der Kerl hat genau gewusst, was er wollte.«
»Du gehst davon aus, dass es ein Mann war?«
»Sieht nicht wie die Tat einer Frau aus, oder? Das passt weder in physischer noch in emotionaler Hinsicht. Warten wir ab, was die Gerichtsmedizin sagt.«
»Wer redet da von mir?«, rief eine Stimme von der anderen Seite der Einfahrt.
»Kate!«, sagte Kincaid herzlich, als eine weitere weiß gekleidete Gestalt auf sie zutrat. Sie hatten schon bei verschiedenen früheren Fällen mit Dr. Kate Ling zusammengearbeitet, und er hatte eine hohe Meinung von ihren Fähigkeiten - ganz zu schweigen von ihrem Aussehen.
»Hallo, Superintendent. Schön, Sie zu sehen. Scheint, als würden sie es hier bald mit einem ziemlichen Medienzirkus zu tun bekommen.«
»Eigentlich ist es gar nicht mein Fall«, klärte er sie auf, während er sich insgeheim verfluchte, weil er Gemma in eine so unangenehme Situation gebracht hatte. »Inspector James leitet die Ermittlungen. Ich bin hier bloß ein Zuschauer.«
»Oh, jetzt muss man also Inspector sagen«, meinte Dr. Ling lächelnd. »Herzlichen Glückwunsch, Gemma. Schauen wir mal, was wir hier haben.«
Kincaid und Gemma traten zur Seite, als sie neben der Leiche niederkniete.
»Das Blut hat sich unter ihrem Körper angesammelt, das heißt, sie ist nicht von der Stelle bewegt worden«, sagte die Gerichtsmedizinerin mehr zu sich selbst als zu ihnen. »Keine offensichtlichen Anzeichen für ein Sexualverbrechen. Die Wunde im Hals ist glatt und ohne Zögern beigebracht worden. Keine offensichtlichen Abwehrverletzungen.« Sie blickte zu Gemma auf. »Keine Waffe?«
»Nicht dass ich wüsste.«
»Nun, ich werde Ihnen Genaueres über die Art der verwendeten Waffe sagen können, wenn ich die Leiche auf dem Seziertisch habe; jedenfalls ist die Wunde sehr sauber und tief.« Sie tastete mit ihren behandschuhten Fingern die Brust ab. »Hier scheint noch eine kleine Stichwunde zu sein.«
»Was können Sie über den Todeszeitpunkt sagen?«
»Nicht sehr lange her, würde ich sagen. Sie fühlt sich noch warm an.«
»Verdammt«, flüsterte Gemma. »Ich bin vor kaum mehr als einer Stunde direkt an diesem Haus vorbeigegangen. Ist es denkbar …«
»Hast du irgendetwas gesehen?«, fragte Kincaid.
Gemma schüttelte den Kopf. »Nein. Aber ich habe ja auch nicht genau hingeschaut, und jetzt frage ich mich, was ich wohl übersehen haben könnte.« Sie wandte sich an Kate Ling. »Wann können Sie die Obduktion machen?«
»Gleich morgen früh«, antwortete Ling seufzend. »Meinen Termin bei der Maniküre werde ich wohl verschieben müssen.« Sie stand auf, als Stimmen im Hintergrund die Ankunft der Beamten ankündigten, die die Leiche und den Tatort fotografieren und alles, was als Beweismittel dienen konnte, einsammeln würden. »Also gut, dann will ich mal Platz machen und die Jungs nicht bei der Arbeit stören. Wenn sie so weit sind, dass sie die Leiche abtransportieren können, sagen Sie ihnen bitte, sie sollen sie in der Leichenhalle des St. Charles Hospital abliefern. Das ist ganz in der Nähe und auch günstig für mich.« Ling winkte Kincaid zum Abschied lässig zu und verschwand, wie sie gekommen war.
»Und ich will dir auch nicht auf den Füßen rumstehen«, sagte Kincaid, der Gemmas zögernden Blick in seine Richtung bemerkt hatte.
»Kannst du nach Toby sehen und Hazel sagen, was passiert ist? Ich habe keine Ahnung, wann ich nach Hause komme.«
»Ich werde gleich selbst bei Toby bleiben. Mach dir keine Sorgen.« Er berührte sie leicht am Arm, dann ging er zur Straße zurück. Aber anstatt in seinen Wagen zu steigen, blieb er stehen und sah aus der Ferne zu, wie Gemma ihrem Team Anweisungen gab. Als sie die Stufen hochging und im Haus verschwand, hätte er alles darum gegeben, an ihrer Seite zu sein.
»Verdammt!«, tobte Doug Cullen, während er die Wohnungstür hinter sich zuknallte und die Aktenmappe in die Ecke feuerte. Er hatte im Bus Akten gelesen, wie fast jeden Abend auf dem Heimweg von Scotland Yard, und war dabei auf eine rasch hingekritzelte Notiz von Kincaid gestoßen, in der dieser seine Schlussfolgerungen nach der Vernehmung eines mutmaßlichen Mittäters kritisierte.
Ich glaube, da steckt mehr dahinter, als man im ersten Moment denken mag, Doug. Es würde sich lohnen, den Burschen noch mal zu vernehmen. Lassen Sie sich diesmal Zeit und versuchen Sie sich in ihn einzufühlen.
»So wie Sergeant James«, imitierte Cullen Kincaids Kommentar,
Umwelthinweis:Alle bedruckten Materialien dieses Taschenbuches sind chlorfrei und umweltschonend.
Deutsche Erstausgabe Januar 2003
Copyright © der Originalausgabe 2002 by Deborah Crombie
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2003 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen Umschlagfoto: Wolf Huber Titelnummer: 45308 Redaktion: Claudia Fink BH · Herstellung: Sebastian Strohmaier
eISBN : 978-3-641-03819-9
www.goldmann-verlag.de
1 3 5 7 9 10 8 6 4 2
Leseprobe
www.randomhouse.de