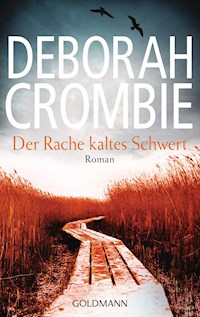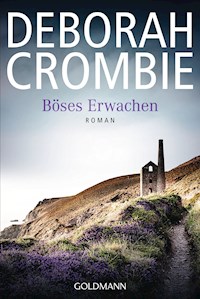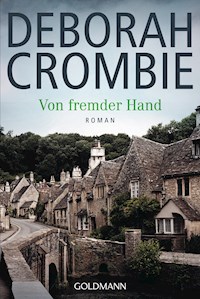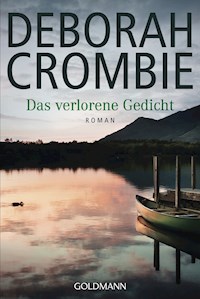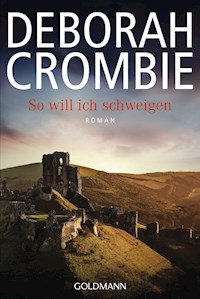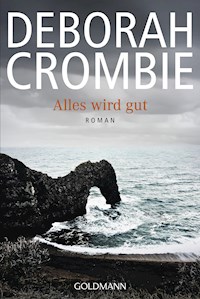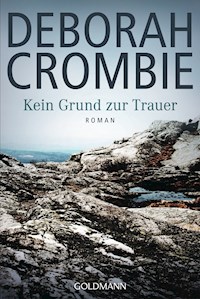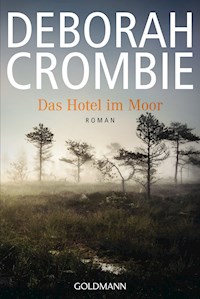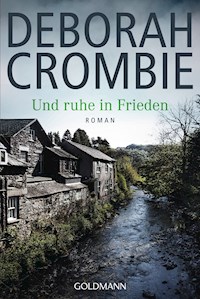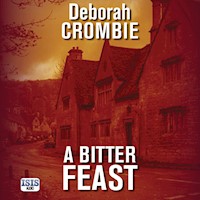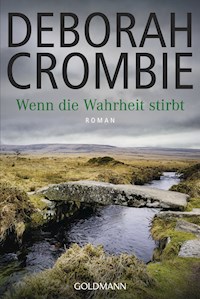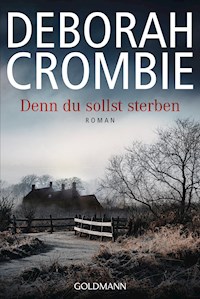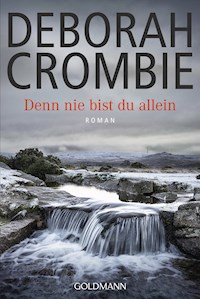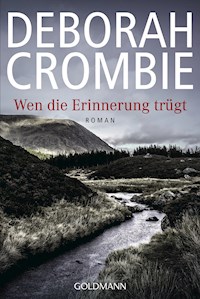
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Mord kommt in den besten Familien vor
Als Erika Rosenthal 1939 aus Berlin floh, verlor sie eine wertvolle Brosche. Nun, fast 70 Jahre später, wird das Schmuckstück in einem bekannten Londoner Auktionshaus angeboten und von einer jungen Frau ersteigert. Erika bittet ihre Freundin Inspector Gemma James herauszufinden, wer die Frau ist. Doch kurz nachdem Gemma die Identität der Käuferin ausfindig gemacht hat, wird diese tot aufgefunden. Bei ihren Nachforschungen stoßen Gemma und ihr Mann und Kollege Superintendent Duncan Kincaid auf ein grausames Geheimnis in Erikas Familie …
Der neue große Roman mit dem beliebten Ermittlergespann Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Buch
Im Katalog seines bekannten Londoner Auktionshauses wird eine Art-déco-Brosche angepriesen. Als Erika Rosenthal von der Auktion erfährt, erkennt sie das kostbare Schmuckstück sofort wieder: Sie hatte es vor vielen Jahren auf der Flucht aus Nazi-Deutschland verloren. Erika bittet ihre Freundin Inspector Gemma James, herauszufinden, in wessen Besitz sich die wertvolle Brosche nun befindet. Gemma befragt daraufhin eine Mitarbeiterin des Auktionshauses, die jedoch den Namen des Verkäufers nicht herausgeben will. Kurz darauf wird die junge Frau ermordet aufgefunden.Gemmas Mann Superintendent Duncan Kincaid übernimmt den Fall. Er hat kaum mit den Ermittlungen begonnen, als ein weiterer Mord geschieht. Gemma und Duncan hegen schon bald den Verdacht, dass die Verbrechen im Zusammenhang mit dem viele Jahre zurückliegenden Mord an Erikas Mann David zu tun haben. Bei ihren Nachforschungen decken sie immer mehr Fälle von Betrug und Verrat in Erikas Umfeld auf. Und schließlich stoßen sie auf ein ebenso gut gehütetes wie grausames Geheimnis in Erikas Vergangenheit. Deborah Crombies höchst erfolgreiche Romane um Superintendent Duncan Kincaid und Inspector Gemma James von Scotland Yard wurden mit dem »Macavity Award« ausgezeichnet und für den »Agatha Award« und den »Edgar Award« nominiert. Die Autorin lebt mit ihrer Familie im Norden von Texas, verbringt aber viel Zeit in England, wo ihre Romane angesiedelt sind. Weitere Informationen zur Autorin unter www.deborahcrombie.com. Deborah Crombies Romane mit Ducan Kincaid und Gemma James in chronologischer Reihenfolge:Das Hotel im MoorAlles wird gut Und ruhe in Frieden (als E-Book erhältlich) Kein Grund zur Trauer (als E-Book erhältlich) Das verlorene Gedicht Böses Erwachen (als E-Book erhältlich) Von fremder Hand (als E-Book erhältlich) Der Rache kaltes Schwert Nur wenn du mir vertraust (als E-Book erhältlich) Denn nie bist du allein So will ich schweigen Wen die Erinnerung trügt Wenn die Wahrheit stirbt (als E-Book erhältlich) Die stillen Wasser des Todes (als E-Book erhältlich) Wer Blut vergießt Wer im Dunkeln bleibt Beklage deine Sünden
Deborah Crombie
Wen dieErinnerung trügt
Roman
Deutschvon Andreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Where Memories Lie« bei William Morrow, New York, an imprint of Harper Collins Publishers.
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Deborah Crombie
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009
by Wilhelm Goldmann Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by Arrangement with Deborah Crombie
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische
Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
BH · Herstellung: Str.
Redaktion: Claudia Fink
ISBN 978-3-641-02756-8V006
www.goldmann-verlag.de
Für Diane
Illustrierte Karte: © 2008 by Laura Hartman Maestro
Prolog
Und dann die große Liebe meines Lebens, die City von London – diese Stadt in Schutt und Asche zu sehen, auch das brach mir das Herz.
Virginia Woolf, aus einem Brief an Ethyl Smith, September 1940
Oktober 1945
Erika Rosenthal erwachte mit einem Ruck. Der dumpfe Einschlag der Bombe ließ sie zusammenfahren, und vor ihren geschlossenen Lidern zuckte der Lichtblitz des Feuersturms. Sie schlug die kratzende Wolldecke zurück und hatte schon die Hand nach David ausgestreckt, um ihn wachzurütteln, als ihr auffiel, dass die Nacht vollkommen still war. Keine Sirenen, kein grollender Geschützdonner. Sie rieb sich die vom Schlaf getrübten Augen und sah, dass das Licht der Straßenlaterne durch den Spalt zwischen den Schlafzimmervorhängen fiel und ein Muster auf die Bettdecke malte, schimmernd wie Mondschein. Es musste dieser Lichtglanz gewesen sein, der sich in ihr Unterbewusstsein eingeschlichen hatte, oder vielleicht die Spiegelung der Lichter eines vorbeifahrenden Autos. Sie musste sich erst noch an die nicht abgedeckten Scheinwerfer gewöhnen. Selbst in ihren wachen Stunden ließ ihr grelles Licht sie jedes Mal zusammenzucken.
Mit schmerzhaft pochendem Herzen sank sie auf das Kissen zurück und schimpfte über ihre eigene Torheit. Es war vorbei – der Krieg war schon seit Monaten zu Ende, und in London herrschte eine geradezu übernatürliche Stille. Ihr Verstand wusste es, aber nicht ihr Körper, und auch ihre Träume wussten es nicht.
David lag auf dem Rücken, reglos wie eine Marmorstatue, und nicht einmal im Licht, das durch die Vorhänge ins Zimmer drang, war das Heben und Senken seines Brustkorbs zu erkennen. Wieder gab ihr diese irrationale Angst einen Stich ins Herz. Sie legte die Finger ganz leicht auf die empfindliche Haut an der Innenseite seines Handgelenks und tastete nach dem beruhigenden Pochen seines Pulses. Das war eine Gewohnheit aus den Tagen der deutschen Luftangriffe, als sie im Rettungstrupp ihres Viertels Notting Hill gearbeitet hatte – das zwanghafte, unwiderstehliche Bedürfnis, sich zu vergewissern, dass ein Leben nicht so ohne weiteres ausgelöscht werden konnte.
Der Rhythmus von Davids Atem wurde plötzlich hörbar, und unter ihren Fingerspitzen spürte sie, wie sich sein Körper beim Erwachen anspannte.
1
Die gewaltigen Stuckpaläste der Kensington Park Road und der angrenzenden Straßen waren schon vor langer Zeit in separate Wohnungen aufgeteilt worden, in denen der stetig anschwellende Strom von Flüchtlingen aus allen Teilen der einst zivilisierten Welt eine notdürftige Unterkunft fand, ähnlich den Höhlenbewohnern des finsteren Mittelalters, die in den Galerien und Logen des Kolosseums Unterschlupf suchten.
Sir Osbert Lancaster, All Done from Memory, 1963
Es war ein absolut scheußlicher Tag für Anfang Mai, selbst in Anbetracht der bekannten Launenhaftigkeit des englischen Wetters. Kurz vor vier Uhr nachmittags war es schon düster wie zur Dämmerstunde, und der Regen prasselte unbarmherzig herab. Die Windböen hatten Henri Durrells Schirm immer wieder umgestülpt, bis er es schließlich aufgegeben hatte und nun mit gesenktem Kopf und hochgezogenen Schultern die Old Brompton Road hinunterstapfte, den Sturzbächen trotzend, die vom Himmel fielen. Während er den Wasserfontänen der vorbeifahrenden Autos auswich, musste er aufpassen, dass ihm nicht einer der mit stabileren Schirmen bewaffneten Passanten ein Auge ausstach.
Ein jäher Schmerz schoss ihm in die Hüfte, und er verlangsamte seinen Schritt. Er ging auf die achtzig zu, und das feuchte Wetter setzte seinen Gelenken ganz gemein zu, auch ohne die Belastung eines ungewohnten Dauerlaufs.
Was hatte er sich bloß dabei gedacht? Wäre er nur im Victoria and Albert geblieben, bis das Museum schloss, dann wäre das schlimmste Unwetter vielleicht schon vorüber gewesen. Er hatte sich mit einem Bekannten im Museumscafé zum Samstagnachmittags-Tee getroffen – immer eine nette Abwechslung –, doch er hatte es nicht lange ausgehalten, getrieben von dem Wunsch, so bald wie möglich wieder in seiner Wohnung in Roland Gardens zu sein, mit ihren verlockenden Annehmlichkeiten: seinem Buch, einem kräftigen Whisky, der wohligen Wärme des Gaskaminofens – und Matilde, seiner Katze.
Als ein vorüberhastender Passant Henri anrempelte, musste er stehen bleiben, um das Gleichgewicht wiederzuerlangen, und fand sich vor dem Schaufenster des Auktionshauses Harrowby’s wieder. Ein Plakat warb für eine Versteigerung von Art-déco-Schmuck. Normalerweise war Henri als begeisterter Sammler auf diesem Gebiet stets auf dem Laufenden, doch er war gerade erst von einem Frühjahrsurlaub in seiner Heimat Burgund zurückgekehrt – wo Gott sei Dank die Sonne geschienen hatte – und hatte die Ankündigung dieser Auktion daher verpasst.
Sie sollte am kommenden Mittwoch stattfinden, wie er zu seiner Erleichterung sah. Er könnte sich immer noch einen Katalog kaufen und ihn in Ruhe studieren – falls es nicht schon nach vier war und das Auktionshaus geschlossen hatte. Rasch warf er einen Blick auf seine Armbanduhr: genau eine Minute vor vier. Henri schüttelte seinen nassen Schirm aus, wobei er sich selbst eine unfreiwillige Dusche verpasste, und schlüpfte rasch durch die noch offene Eingangstür von Harrowby’s.
Wenige Minuten später kam er wieder heraus, aufgeheitert durch seine Errungenschaft und einen netten Plausch mit der Empfangsdame. Der Rest seines Heimwegs kam ihm weniger beschwerlich vor, obwohl der Regen nicht nachgelassen hatte. Zu Hause trocknete er sich ab, zog frische Socken an und schlüpfte in seine Pantoffeln, ein nicht ganz einfaches Unterfangen mit Matilde, die um seine Knöchel strich und ihn mit dem Kopf anstieß. Er entschied sich für Tee statt Whisky, um einer Erkältung vorzubeugen, und als dieser fertig gezogen hatte, schaltete er den Gasofen ein und machte es sich in seinem Lieblingssessel bequem, den Katalog auf den Knien balancierend. Er war exquisit gestaltet, wie es die Kataloge von Harrowby’s immer waren – das Haus war noch nie durch einen Mangel an Stil aufgefallen –, und Henri schlug ihn mit einem Seufzer der Befriedigung auf. Nachdem er für die hartnäckige Katze Platz gemacht hatte, begann er die Broschüre durchzublättern, und die Schönheit der Stücke verschlug ihm schier den Atem. Er hatte Kunstgeschichte gelehrt, bis er vor kurzem in Pension gegangen war, und die klaren, innovativen Formen der Werke aus jener Periode sprachen ihn ganz besonders an.
Hier waren die großen Meister allesamt vertreten: ein Diamant-Saphir-Anhänger von Georges Fouquet, ein diamantener Cocktailring von Rene Boivin …
Und dann erstarrte seine Hand in der Bewegung. Sein Blick blieb an einer bestimmten Abbildung haften, und sein Herz begann vor Aufregung zu flattern. Das war doch einfach nicht möglich, oder?
Er betrachtete das Foto genauer. Henri war ein Freund kräftiger Farben, weshalb Diamanten allein ihn nie so begeistern konnten wie etwa solche Stücke, bei denen Platin mit dem Rot, Blau oder Grün von Rubinen, Saphiren oder Smaragden kontrastierte, aber das hier …
Die Brosche war aus Diamanten gefertigt, die in Platin gefasst waren; eine doppelte Tropfenform, die ihn an einen Wasserfall oder das Rad eines Pfaus erinnerte. Die geschwungenen Linien waren ungewöhnlich für den Art-déco-Stil, der strenge geometrische Formen in den Vordergrund gestellt hatte. Doch dies war ein spätes Werk, datiert auf das Jahr 1938, und der Name – er kannte diesen Namen, und der Schock ließ seinen Puls wie wild hämmern.
Kopfschüttelnd stand er auf, wobei er Matilde unsanft von ihrem Ruheplatz auf seinem Schoß vertrieb. Doch plötzlich zögerte er. Sollte er darum bitten, einen Blick auf das Stück werfen zu dürfen, bevor er irgendwelche Maßnahmen ergriff? Aber nein – das Auktionshaus würde bis Montag geschlossen bleiben, und er bezweifelte, dass es sich um einen Irrtum in der Zuschreibung handelte – genauso wenig, wie er an seiner Erinnerung zweifelte.
Er steckte den Katalog sorgfältig zurück in die Tüte und trug ihn in die Diele, wo er wieder in seine nassen Schuhe schlüpfte, den triefenden Mantel anzog und widerstrebend seine behagliche Wohnung verließ.
»Verdammt, wieso musste es ausgerechnet jetzt regnen?« Gemma James hievte die Plastiktüten vom Supermarkt auf ihren Küchentisch und strich sich eine klatschnasse Haarsträhne aus dem Gesicht. Das Wasser, das in regelrechten Bächen von den Tüten herabfloss, sammelte sich in Pfützen auf der Kiefernholz-Tischplatte. Gemma schnappte sich ein Küchentuch, um es aufzuwischen, während Duncan Kincaid seine eigene triefende Last abstellte.
»Weil es Mai in London ist?«, fragte er grinsend. »Oder weil der Schutzheilige der Essenseinladungen dich auf dem Kieker hat?«
Sie schlug mit dem nassen Tuch nach ihm, musste aber unwillkürlich lachen. »Okay, schon verstanden. Nein, im Ernst: Ich wollte eigentlich Blumen aus unserem Garten nehmen, aber das können wir vergessen. Und außerdem werden die Jungs und die Hunde uns Berge von Matsch ins Haus tragen.«
»Die Jungs sind bei Wesley – die werden sich vermutlich mit den Süßigkeiten von Wesleys Mama die Bäuche vollschlagen und dabei die Glotze auch nicht eine Sekunde aus dem Blick verlieren. Und was die Hunde betrifft: Ich werde höchstpersönlich jeden noch so kleinen Krümel Dreck von sämtlichen Pfoten wischen, und ich kann auch rasch in die Portobello Road laufen und an einem der Stände Blumen besorgen.« Er schlang den Arm um ihre Schultern. »Keine Sorge, Schatz. Du wirst einsame Spitze sein.«
Einen Moment lang gestattete sie sich, ihren Kopf an seiner Schulter ruhen zu lassen. Sein Hemd war feucht vom Regen, und durch den Stoff konnte sie die beruhigende Wärme seiner Haut spüren. Sie schmiegte sich ein wenig enger an ihn, ehe sie den verlockenden Gedanken bewusst verdrängte, dass es bessere Arten gäbe, einen verregneten Samstagnachmittag zu verbringen, an dem die Kinder aus dem Haus waren.
Sie hatten als Partner bei Scotland Yard begonnen. Irgendwann hatte Gemma sich wider besseres Wissen auf eine klammheimliche Affäre mit ihm eingelassen, bis ihre Beförderung zum Inspector und ihre Versetzung zum Revier Notting Hill die berufliche Trennung gebracht hatte. Nachdem ihrer Beziehung somit nichts mehr im Wege gestanden hatte, waren sie zusammengezogen, wobei beide je einen Sohn aus einer gescheiterten Ehe mitgebracht hatten – und damit Probleme, die ihnen bisweilen unüberwindlich erschienen waren. Aber sie waren mit allen Herausforderungen fertig geworden, und auch den Verlust ihres gemeinsamen Kindes nach der Hälfte von Gemmas Schwangerschaft hatten sie gemeinsam durchgestanden. Und seit ihrem Besuch bei Duncans Familie in Cheshire an Weihnachten letztes Jahr schien der Zusammenhalt ihrer Patchwork-Familie deutlich besser zu sein.
Ein glücklicher Zufall hatte sie in dieses Haus in gehobener Lage im Londoner Stadtteil Notting Hill verschlagen, das sie sich unter normalen Umständen nie hätten leisten können, auch nicht mit Duncans höherem Gehalt als Superintendent. Das Haus gehörte der Schwester von Duncans Chef, die mit ihrer Familie aus beruflichen Gründen für fünf Jahre ins Ausland gegangen war. Duncan und Gemma waren ihr als ideale Mieter empfohlen worden.
Gemma hätte nie geglaubt, dass sie sich an das Leben in Notting Hill gewöhnen würde, Welten entfernt von dem Londoner Arbeiterviertel, in dem sie aufgewachsen war. Aber inzwischen hatte sie das Haus und die ganze Nachbarschaft so liebgewonnen, dass sie sich gar nicht vorstellen konnte, je wieder woanders zu wohnen, und wenn sie an das Ende ihres Mietverhältnisses dachte, empfand sie es wie eine dunkle Bedrohung am Horizont.
Womit sie sich dagegen nie richtig hatte anfreunden können, das war die Rolle der perfekten Gastgeberin. Und für heute Abend hatte sie sich zu einer Essenseinladung überreden lassen, die sie schon im Vorfeld fast den letzten Nerv gekostet hatte. Die Gästeliste umfasste Chief Superintendent Denis Childs, Duncans Chef und der Bruder ihrer Vermieterin, mit seiner Gattin, die Gemma noch nicht kennengelernt hatte; Gemmas Chef Superintendent Mark Lamb, mit Frau; Doug Cullen, der jetzt Duncans Sergeant war; und PC Melody Talbot, die mit Gemma in Notting Hill arbeitete.
Doug Cullen und Melody Talbot kannten sich nur flüchtig, und Gemma spielte mit der Vorstellung, die beiden zu verkuppeln, auch wenn Kincaid sie augenzwinkernd gewarnt hatte, dass sie mit den Konsequenzen einer solchen Einmischung würde leben müssen.
Sie richtete sich seufzend auf und betrachtete die Fülle von Köstlichkeiten, die sich aus den Einkaufstüten über den Küchentisch ergoss. Frische Lachsfilets, Zitronen, Fenchelknollen mit zartem grünem Kraut, kleine Kirschtomaten, die wie Juwelen glänzten, und Brot aus ihrer Lieblingsbäckerei in der Portobello Road, dazu mehrere Flaschen trockener Weißwein und genug Zutaten für einen Salat, um eine ganze Armee zu verpflegen. Das Dessert hatte sie fertig gekauft – eigentlich eine Schande für die Tochter eines Bäckers –, einen prächtigen Obstkuchen von Mr. Christian’s Deli am Elgin Crescent. Wenn sie auch noch versucht hätte zu backen, wäre sie irgendwann komplett durchgedreht.
»Im Kochbuch hat alles so kinderleicht ausgesehen«, sagte sie. »Und wenn es dem Chief Super nun nicht schmeckt? Oder wenn er seiner Schwester erzählt, dass wir ihr Haus ruiniert haben?«
»Dass du ihn ja bei Tisch nicht ›Chief Super‹ nennst! Du musst üben, ›Denis‹ zu sagen.« Kincaid tätschelte ihre Schulter und machte sich daran, ihre Einkäufe auszupacken. »Und was das Haus betrifft – es sieht besser aus als bei unserem Einzug. Das Essen wird fantastisch sein, die Tafel eine Augenweide, und wenn alle Stricke reißen«, fügte er grinsend hinzu, »kannst du dich immer noch ans Klavier setzen. Was soll da noch schiefgehen?«
Gemma streckte ihm die Zunge raus. »Irgendwas geht immer schief«, sagte sie finster.
Es goss in Strömen. In silbrig glänzenden Bahnen floss der Regen am Gartenfenster herab, und das Trommeln auf dem Glasdach des Wintergartens klang wie Maschinengewehrfeuer.
Erika Rosenthal hatte den Regen immer gemocht – die heimelige Atmosphäre, die er schuf; die willkommene Gelegenheit, sich von der Welt abzuschotten; doch an diesem Maitag, da die sintflutartigen Niederschläge die Welt schon am späten Nachmittag in abendliches Dunkel tauchten, empfand sie ihn als unangenehm bedrückend.
Sie saß in ihrem Lieblingssessel im Wohnzimmer, ein aufgeschlagenes Buch auf dem Schoß, die Tasse mit dem bereits erkaltenden Kaffee – koffeinfrei, auf Anweisung ihres Arztes – neben sich auf dem Couchtisch; und sie hatte das Gefühl, als würde der Regen mit seinem unablässigen Geprassel durch Dach und Wände dringen, bis er am Ende auch die schwache Barriere ihrer Haut überwand.
Ausgerechnet ihr, für die der Tag nie genug Stunden gehabt hatte, in denen sie lesen, schreiben, Musik hören oder ihre geliebten Blumen arrangieren konnte, fiel es in letzter Zeit zunehmend schwer, sich längere Zeit mit etwas Bestimmtem zu beschäftigen. Ihre Konzentration verflog wie Sandkörner im Wind, ihre Gedanken schienen von allein abzuschweifen, und die Erinnerungen, die dabei aufstiegen, waren so lebhaft wie Wachträume.
An diesem Morgen hatte sie beim Anziehen plötzlich gedacht, dass sie sich beeilen müsse, wenn sie nicht zu spät zur Arbeit bei Whiteley’s erscheinen wollte. Dann war ihr mit einem kleinen Schock bewusst geworden, dass diese Tage längst vergangen waren, dass sie nie wiederkehren würden, ebenso wenig wie David; und ihre Trauer um das, was unwiederbringlich verloren war, schien plötzlich so frisch wie am ersten Tag.
Sie ließ sich auf die Bettkante sinken, und ihr Atem ging schwer und rasselnd, während sie sich bewusst auf die Disziplin besann, die sie über die Jahre so sorgfältig geübt hatte – das Aufbieten der kleinen, kostbaren Freuden, die jeder Tag zu bieten hatte, gegen die ständige Bedrohung der Verzweiflung.
Hatte sie den Kampf verloren? War es wirklich so, dass die Ereignisse eines Menschenlebens am Ende ineinander verschmolzen, sodass einem nichts anderes übrig blieb, als zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her zu pendeln und all die Verletzungen und Erschütterungen noch einmal zu durchleben, die man längst überwunden geglaubt hatte?
Nein, dachte sie jetzt und schalt sich, weil sie sich so sehr dem Selbstmitleid hingegeben hatte. Entschlossen stemmte sie sich aus dem Sessel hoch.Wenn man so alt war wie sie, durfte man schon mal einen schlechten Tag haben, und mehr war es schließlich nicht. Morgen würde die Sonne scheinen, sie würde sich mit der Sonntagszeitung in den Garten setzen, den Kindern beim Spielen zusehen und sich mit der Nachbarin über Kompost und Nistkästen für Singvögel unterhalten, und die Welt wäre wieder in Ordnung. Und jetzt würde sie sich erst einmal einen wohlverdienten Sherry einschenken und den komplizierten, hochliterarischen Roman, der auf ihrem Tisch lag, gegen etwas Heiteres und Vertrautes eintauschen – Jane Austen vielleicht.
Sie hatte gerade die Küche betreten und war dabei, die dünne Brühe, die sich Kaffee schimpfte, in den Ausguss zu schütten, als der Türsummer ertönte. Sie schrak zusammen und sah zum Gartenfenster hinaus in den immer noch strömenden Regen. Wer konnte auf die Idee kommen, ihr bei diesem Hundewetter einen Besuch abzustatten? Vielleicht ein kranker Nachbar, der Hilfe brauchte?
Doch als sie den Knopf der Sprechanlage drückte, hörte sie eine vertraute Stimme. »Erika? Ich bin’s, Henri. Henri Durrell. Darf ich reinkommen?« Er klang erregt.
Sie eilte zur Tür, um ihm zu öffnen, und schüttelte missbilligend den Kopf, als sie sah, in welchem Zustand sein Mantel und sein Hut waren. »Henri! Was machst du denn da draußen bei dem Wolkenbruch?«, fragte sie, als sie ihn hereinließ. »Bei so einem Wetter jagt man doch keinen Hund vor die Tür.«
Er gab ihr einen Kuss auf die Wange, während sie ihm seine triefnassen Sachen abnahm und an die Garderobenhaken neben der Tür hängte.
»Du siehst wie immer blendend aus«, sagte er, ohne ihre Frage zu beantworten, und strich sein feuchtes, aber volles weißes Haar glatt. Er war immer noch ein gut aussehender Mann, mit fein geschnittenem Kinn und blauen Augen, die einen durchdringend ansahen, und seine Haltung war stets kerzengerade, obwohl er, wie sie wusste, Probleme mit der Hüfte hatte.
Er hatte seinen französischen Akzent fast vollständig abgelegt, was Erika ebenso amüsierte wie die Tatsache, dass er früher einmal ihr Student gewesen war und sie eine Zeitlang mit dem Gedanken gespielt hatte, sich auf eine Affäre mit ihm einzulassen. Am Ende hatte sie seine Annäherungsversuche zurückgewiesen, weil sie sich wegen des Altersunterschieds albern vorgekommen war – heute dagegen fand sie es albern, dass sie damals auf das Vergnügen verzichtet hatte, nur um ihre Würde zu wahren.
Die Erinnerung an eine andere versäumte Gelegenheit schoss ihr durch den Kopf, doch der bloße Gedanke daran war einfach zu schmerzlich, auch heute noch. Sie verdrängte ihn, während sie Henri die Hand drückte und ihn bat: »Komm rein, komm rein!« Sie freute sich geradezu unbändig, ihn zu sehen. »Wir machen ein Feuer im Kamin, obwohl es ja angeblich eine Sünde ist, so spät im Jahr, und dann schenke ich uns einen Sherry ein.«
»Du weißt doch, dass ich das Zeug nicht ausstehen kann«, erwiderte Henri, während er ihr ins Wohnzimmer folgte. Nachdem er sorgfältig seine Hose abgeklopft hatte, nahm er in dem Sessel neben ihrem Platz und wischte dann die Plastiktüte, die er mitgebracht hatte, mit einem Taschentuch trocken, das er aus seiner Jackentasche fischte.
»Dann eben einen Whisky. Du weißt ja, dass ich die Flasche nur für dich aufhebe.«
Zögernd antwortete er: »Nein, lass nur, Erika. Ich will deine Gastfreundschaft nicht ausnutzen.« Er räusperte sich. »Das hier ist auch eigentlich kein Freundschaftsbesuch.«
Beunruhigt fragte sie: »Was ist denn passiert, Henri? Bist du etwa krank?«
»O nein, nichts dergleichen. Bloß meine Arthritis, die meldet sich natürlich wieder bei diesem feuchten Wetter. Es ist nur …« Er brach ab und strich mit der Hand über die Plastiktüte. Erika sah, dass sie den Schriftzug des Auktionshauses Harrowby’s trug. »Es ist nur so, dass ich heute auf etwas sehr Merkwürdiges gestoßen bin, und es mag sein, dass ich mich in Dinge einmische, die mich nichts angehen, aber ich dachte mir, dass du das sehen solltest.«
»Henri, wovon redest du eigentlich?«
Er zog ein schmales, broschiertes Buch aus der Tüte, und sie sah, dass es ebenfalls das Harrowby’s-Logo auf dem Einband trug. Als sie genauer hinsah, erkannte sie, dass es sich um den Katalog für eine bevorstehende Auktion von Art-déco-Schmuck handelte – und ihr stockte der Atem.
Henri schlug den Katalog auf, blätterte ihn rasch durch, bis er die Seite im hinteren Teil gefunden hatte, und hielt ihn Erika hin. »Hier. Ich habe sie natürlich an dem Namen erkannt und durch deine Beschreibung.«
Ihre Hände zitterten, als sie ihre Lesebrille von dem Buch nahm, das sie angefangen hatte. Als sie sie aufsetzte, stand die Seite plötzlich gestochen scharf vor ihren Augen. Sie musste nicht erst die Beschreibung lesen. Die Wände des Zimmers schienen zurückzuweichen, und mit aller Kraft stemmte sie sich gegen den Ansturm der Erinnerung.
Mit verständnisloser Miene blickte sie zu Henri auf. »Aber das ist nicht möglich. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie noch einmal zu Gesicht bekommen würde.«
Henri nahm ihr den Katalog ab und legte ihn beiseite, und erst, als er ihre Hände in seine nahm, merkte sie, dass ihre plötzlich eiskalt waren. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Irrtum ist, Erika.« Mit sanfter Stimme fügte er hinzu: »Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, wo die Vergangenheit wieder hergeben muss, was sie genommen hat.«
Sie waren inzwischen bei Dessert und Kaffee angelangt, und endlich begann Gemma sich ein wenig zu entspannen. Sie hatte sich gefreut, Chief Superintendent Childs wiederzusehen – Denis, mahnte sie sich –, und seine Frau Diane hatte sich als ganz reizend entpuppt, ebenso gesprächig, wie ihr Mann reserviert war. Ihr eigener Chef, Mark Lamb, war ein alter Bekannter von Duncan seit der Polizeiakademie, und Gemma hatte seine Frau Christine schon öfter bei dienstlichen Feiern getroffen.
Alle waren voll des Lobes für das Haus gewesen, der geschmorte Lachs mit Fenchel war hervorragend angekommen, und das Einzige, was Gemmas Freude über das gelungene Essen ein wenig trübte, war die Tatsache, dass es zwischen Doug Cullen und Melody Talbot offenbar nicht so recht funken wollte.
Sie war gerade aufgestanden, um Kaffee nachzuschenken, als das Telefon in der Küche klingelte. Kincaid, der am anderen Ende des Tisches saß, fing ihren Blick auf und zog fragend eine Braue hoch.
Sie schüttelte den Kopf und formte mit den Lippen: »Ich gehe hin.« Es war ihr Privatanschluss, nicht Gemmas Handy, also war es wahrscheinlich nicht dienstlich. Ihr Herz krampfte sich vor Sorge ein wenig zusammen, wie immer, wenn die Jungs aus dem Haus waren – auch wenn sie wusste, dass sie bei Wesley Howard waren, der oft auf sie aufpasste und sehr verantwortungsbewusst war.
Sie entschuldigte sich, ging mit der Kaffeekanne in der Hand in die Küche und nahm das Telefon von der Basisstation auf der Anrichte.
»Gemma?« Es war eine Frauenstimme, und sie zitterte so, dass Gemma sie zuerst gar nicht erkannte. »Gemma, hier spricht Erika. Ich störe Sie wirklich sehr ungern, und dann auch noch am Samstagabend. Wie ich höre, haben Sie Gäste. Ich kann morgen noch einmal anrufen, wenn …«
»Nein, nein, Erika, es ist schon in Ordnung«, versicherte Gemma ihr, wenngleich sie ein wenig überrascht war. Sie hatte Erika kennengelernt, kurz nachdem sie nach Notting Hill versetzt worden war, und obwohl sich zwischen ihnen eine Freundschaft entwickelt hatte, die Gemma viel bedeutete, hatte sie es noch nie erlebt, dass Erika einfach so angerufen hätte – es sei denn, um sie zum Tee oder zum Lunch einzuladen oder um auf eine Einladung von Gemma zu antworten. Dr. Erika Rosenthal war eine pensionierte Hochschullehrerin, eine deutsche Jüdin, die zu Beginn des Krieges nach England emigriert war und sich als Historikerin einen Namen gemacht hatte; und sosehr Gemma sich durch die Aufmerksamkeit und die Unterstützung der alten Dame geschmeichelt gefühlt hatte, war Erika doch stets eifrig auf ihre Unabhängigkeit bedacht gewesen.
»Ist etwas nicht in Ordnung?«, fragte Gemma nun. Sie stellte die Kaffeekanne ab und lauschte aufmerksam.
2
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, denn ich war ja kein Jude.
Zugeschrieben Pastor Martin Niemöller, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und ehemaliger U-Boot-Kapitän.
Mai 1952, Chelsea
Er kannte die Eigenheiten des Türschlosses so gut, dass es ihm trotz seiner leicht beeinträchtigten Koordination gelang, den Schlüssel umzudrehen und die Tür zu öffnen, ohne dass auch nur das leiseste Geräusch entstand. Allerdings nützte ihm diese Meisterleistung der Diskretion wenig, denn das Klicken, mit dem das Schnappschloss hinter ihm einrastete, konnte er unmöglich verhindern.
»Gavin? Bist du das?«, rief Linda aus der Küche. Seine Frau hatte Ohren wie ein Luchs.
Na, wer denn sonst?, dachte er. Vielleicht ein Einbrecher, der zufällig einen Schlüssel hat? Doch er seufzte nur und sagte: »Tut mir leid, dass es so spät geworden ist. Ich musste noch etwas erledigen.«
»Und das ganze Revier hat dir dabei geholfen, wie?« Linda kam in die Diele und wischte sich die Hände an ihrer rosa Blümchenschürze ab. Sie rümpfte die Nase, womit sie ihm zu verstehen gab, dass sie den Geruch von Bier und Tabak auf fünf Meter Entfernung wahrnehmen konnte. Vielleicht eher ein Spürhund als ein Luchs, dachte er, und seine Mundwinkel mussten unwillkürlich gezuckt haben, denn sie sagte: »Was ist daran so komisch? Du warst mit deinen Kumpels im Pub, und dein Abendessen ist wieder mal angebrannt.«
Der unangenehm süßliche Geruch von angekokeltem Kartoffelauflauf mit Hackfleisch stieg ihm in die Nase, und sein Magen rumorte bedenklich. »Ich habe auf dem Revier etwas gegessen …«, setzte er an, und er sah, wie sie die Lippen zu einem dünnen Strich zusammenpresste. Gleich würde sie ihm vorwerfen, dass er seine Hackfleischration vergeudet hatte.
»Ich weiß«, kam er ihr zuvor. »Die Kinder hätten meine Portion essen können.« In diesem Moment fiel ihm auf, dass die Wohnung ganz still war, bis auf das leise Gemurmel des Radios, das Linda immer in der Küche laufen ließ, um ein wenig Gesellschaft zu haben. Die Kinder waren offenbar nicht da. Seine Erleichterung währte nur einen Augenblick, dann schämte er sich für seine Reaktion.
Wenn er im Rahmen seiner Arbeit Familien zu Hause aufsuchte, sah er oft, wie die Kinder sich um ihre Eltern scharten, ihre Beine umklammerten und lautstark ihre Aufmerksamkeit forderten, aber er konnte sich nicht erinnern, dass seine eigenen sich je so verhalten hätten, und je älter sie wurden, desto weniger schien er ihnen zu sagen zu haben – oder sie ihm.
Stuart war zwölf, gezeugt im ersten Taumel der Leidenschaft, kurz nachdem er Linda kennengelernt hatte. Die Kriegsgefahr hatte damals einen unersättlichen Lebens- und Liebeshunger ausgelöst, von dem heute nichts mehr zu spüren war. Susan war die Frucht eines kurzen Fronturlaubs zwei Jahre später. Dieses Mal hatte ihn der verzweifelte Wunsch getrieben, etwas von sich selbst zu hinterlassen, falls er nicht zurückkehren sollte.
Doch er hatte überlebt, und wenn er ehrlich war, musste er zugeben, dass er von seinen Kindern enttäuscht war. Der Sohn, den er sich als seinen besten Kumpel vorgestellt hatte, der Junge, dem er das Fußballspielen beibringen und mit dem er lange Nachmittage am Ufer der Themse vertrödeln wollte, war dünn und ernst, hatte stets die Nase in einem Buch und schien nicht einmal den Unterschied zwischen Rugby und Kricket zu kennen.
Und Susan, die Prinzessin, die er so gerne im Arm gehalten und gekitzelt hätte, war ein kräftiges, schwerfälliges Mädchen, das mit seinen Freundinnen zusammensteckte und keckernd lachte wie eine Hyäne, ihn jedoch mit den unergründlichen braunen Augen, die sie von der Mutter geerbt hatte, nur verständnislos anstarrte.
All das lastete mit einem Mal so schwer auf ihm, dass er förmlich in sich zusammensank und sich mit der Schulter an die Wand lehnen musste. Es war ein schlimmer Tag gewesen – sie waren Hinweisen von Hausbewohnern nachgegangen, dass aus einer Nachbarwohnung ein unangenehmer Geruch dringe. Daraufhin hatten sie die Tür aufgebrochen und einen Mann entdeckt, der in seinem schäbigen möblierten Zimmer in einem Sessel saß. Er wirkte ganz entspannt – bis auf dieTatsache, dass sein Gehirn sich über die Wand hinter ihm verteilt hatte. Sein Dienstrevolver war ihm aus der Hand gefallen und lag in seinem Schoß.
Von den Nachbarn, die neugierig zusammengelaufen waren, erfuhr Gavin, dass der Mann ein hochdekorierter Kriegsveteran war, der aber bei seiner Heimkehr hatte feststellen müssen, dass seine Familie nicht mehr da war und es keine Arbeit gab für einen Mann, der bei der Landung in der Normandie im Kampf gegen die Nazis zum halben Krüppel gemacht worden war. Seither hatte der Mann, ein gewisser Terence Billings, ein zurückgezogenes Leben geführt und sich, wie man annahm, mit seiner Rente durchgeschlagen.
»Was war es?«, hatte Gavin seine Männer gefragt, nachdem sie ihren Bericht abgeschlossen und sich in ein Pub in der Nähe des Reviers zurückgezogen hatten. Er stellte die schäumenden Pints auf den Ecktisch und zwängte sich auf seinen Platz. »Was glaubt ihr, was letztlich der Auslöser war?«
»Wahrscheinlich konnte er im Laden an der Ecke keine Zigaretten kriegen«, meinte PC Will Collins und schüttelte den Kopf.
»Oder vielleicht ist seine Katze gestorben«, mutmaßte Gavins Sergeant John Rogers, nur halb im Scherz. Alle hatten sie es schon erlebt, dass solche scheinbar völlig banalen Dinge einen Menschen endgültig in die Verzweiflung stürzen konnten. Und sie waren alle an der Front gewesen – jeder wusste, dass der Mann im Sessel ebenso gut er selbst hätte sein können. Und auch wenn sie nicht darüber sprachen – es war diese gemeinsame Erfahrung, die sie noch lange dort im Pub beisammensitzen, rauchen und zu viel Bier trinken ließ, obwohl sie schon längst zu Hause hätten sein sollen.
»Was ist denn, Gav? Hast du etwas?« Lindas Stimme schwankte zwischen Missbilligung und Sorge.
Er dachte daran, wie sie gewesen war, als er sie kennengelernt hatte, wie er sie für ihre unbändige Energie und ihre Forschheit geliebt hatte. Er hatte gedacht, dass sie mit allem fertig werden würde, aber sie hatte sich nie mit der Rolle der Polizistengattin anfreunden können, und das hatte sie zu der Frau gemacht, die jetzt vor ihm stand: der verhärmte Schatten des Mädchens, das sie vor langer Zeit gewesen war.
Und die Kinder – war es seine Schuld? Hatte er als Vater versagt? Und wenn es so war, was hatte er stattdessen erreicht? Gewiss hatte er nichts getan, um das Leben für den Mann erträglicher zu machen, den sie heute in seinem Sessel gefunden hatten, oder für andere wie ihn.
»Gav? Du siehst ja aus, als hättest du einen Geist gesehen.« Seine Frau kam auf ihn zu und hob die Hand, um ihm mit den Fingerrücken über die Wange zu streichen.
Die Geste war so unerwartet in ihrer längst vergessenen Zärtlichkeit, dass ihm die Tränen in die Augen traten. Er fasste ihre Hand und drückte sie, und sie schmiegte sich leicht an ihn. Ihr Körper war so zart, so warm. Er schluckte und flüsterte: »Es tut mir leid … Ich habe alles falsch gemacht, ich …«
Das Läuten des Telefons ließ sie beide zusammenfahren, und wie ertappte Teenager ließen sie voneinander ab. Einen Moment lang sahen sie einander in die Augen, dann hielt er es nicht mehr aus, und sein Blick ging unwillkürlich zum Telefon, das wie ein schwarzes Monster auf dem Tisch am Ende des Flurs hockte und bei jedem Rasseln erzitterte.
»Ich sollte wohl besser drangehen«, sagte er.
»Das tust du ja immer«, entgegnete seine Frau und zog ihre Hand zurück.
Gavin verließ seine Wohnung am Tedworth Square und ging die Tite Street hinunter in Richtung Fluss. An der Royal Hospital Road bog er rechts ab, und als er die Uferstraße erreichte, hielt er einen Moment inne, um einen Blick nach Westen auf die glitzernde Silhouette der Albert Bridge zu werfen, die sich vor dem orange- und purpurfarbenen Himmel abzeichnete. Vor einem Jahr war die Brücke für das Festival of Britain mit Lichterketten geschmückt worden, und bei ihrem Anblick stockte ihm noch immer der Atem. Ihre luftige, schwebende Erscheinung verstärkte noch das Gefühl der Losgelöstheit, das ihn verfolgte, seit er von zu Hause aufgebrochen war.
Er hatte natürlich protestiert, doch der diensthabende Sergeant vom Revier Chelsea hatte darauf beharrt, dass Gavin nun einmal der nächste verfügbare ranghöhere Beamte der Kriminaldirektion sei, und mit einem Seufzer hatte Gavin sich in sein Schicksal ergeben.
Jetzt fragte er sich, ob er einen Teil von sich selbst hinter sich gelassen hatte – jenen Teil, der vielleicht dageblieben wäre und sich zärtlich um seine Frau gekümmert hätte. Hatte er einen Anflug von Verständnis in ihren Augen gesehen, als sie ihm nachgeblickt hatte? Oder hatte er an einer entscheidenden Kreuzung den falschen Weg eingeschlagen? Gab es kein Zurück mehr?
Unsinn – das war doch alles dummes Zeug. Er hatte einen Job zu erledigen. Er schüttelte sich, wandte sich nach Osten und marschierte los, in die heraufziehende Dunkelheit hinein.
Der Constable, eine Silhouette in dunkler Uniform, erwartete ihn am Tor des kleinen, dicht mit Bäumen und Sträuchern bestandenen Parks am Ende des Cheyne Walk. »Inspector Hoxley.«
Er erkannte den Mann, als er zu sprechen begann – ein junger Constable namens Simms –, und beim angespannten Ton seiner Stimme stellten sich Gavin die Nackenhaare auf. Hier ging es nicht bloß um einen Saufbruder, der im Park seinen Rausch ausschlief. »Ist sonst schon jemand da?«, fragte er.
»Nein, Sir. Ich wollte eigentlich dableiben – bei dem Mann, Sir –, aber ich hatte Angst, dass Sie mich dann nicht finden würden.«
»In Ordnung, Simms, dann lassen Sie uns mal sehen, was Sie gefunden haben.«
Er folgte dem flackernden Licht von Simms’ Taschenlampe, als der Constable durch das Tor trat und vorsichtig einen Kiesweg entlangging, der sich vor ihnen als schwach leuchtendes Band abzeichnete. Hinter einer Biegung tauchten die Umrisse einer Bank auf, und darunter lag etwas – eine dunkle Form, die an einer Stelle weiß schimmerte.
Dass es sich um den Körper eines Menschen handelte, war unverkennbar, und dass er nicht mehr lebte, daran ließ die unnatürliche Haltung keinen Zweifel. »Halten Sie die Lampe ruhig, Mann«, sagte Gavin, als der Lichtstrahl zu zittern begann. Als er sich umblickte, zuckte der Strahl nach oben, und er sah, dass der Constable selbst bedenkliche Ähnlichkeit mit einer Leiche hatte.
Zu jung, um im Krieg gewesen zu sein, rief Gavin sich ins Gedächtnis – vielleicht war das hier sogar die erste Leiche des Mannes. »Wenn Sie sich übergeben müssen, gehen Sie so weit wie möglich weg«, mahnte er ihn, doch sein Ton war freundlich.
»Nein, Sir, es geht schon.« Simms nahm Haltung an und bemühte sich, die Lampe ruhig zu halten.
Gavin schob den Hut in den Nacken. Wenn das der erste Tote war, den der junge Mann zu Gesicht bekam, dann war er noch glimpflich davongekommen. Höchstwahrscheinlich einer der Veteranen vom Royal Hospital Chelsea, der auf der Bank eine Zigarette geraucht und den Blick auf den Fluss genossen hatte, als sein Herz plötzlich stehen geblieben war.
Doch als er genauer hinsah, erkannte er, dass der Tote nicht die traditionelle marineblaue Uniform der Chelsea-Veteranen trug, sondern einen schwarzen Anzug. Stirnrunzelnd kniete er sich hin, und der widerliche Geruch des Bluts schlug ihm entgegen.
»Mein Gott«, murmelte er. Er schluckte, dann herrschte er Simms an: »Geben Sie mir die Lampe!« Der Lichtstrahl glitt über einen schlanken Mann, dessen Körper so verdreht war, dass Brust und Gesicht nach oben gewandt waren. Ein Arm war ausgestreckt, als hätte er sich im Fallen irgendwo festhalten wollen – vielleicht an der Bank. Sein dichtes, gewelltes Haar war von grauen Strähnen durchzogen, doch sein glatt rasiertes Gesicht korrigierte den ersten Eindruck um etliche Jahre nach unten – Gavin schätzte ihn auf Ende vierzig oder Anfang fünfzig. Die dunkle Jacke war offen, und auf seinem weißen Hemd zeichneten sich große Blutflecken ab.
»Irgendwelche Papiere?«, fragte Gavin und blickte zu Simms auf.
»Nein, Sir. Ich habe nur rasch seine Taschen durchsucht, aber da ist nichts – keine Brieftasche, nicht mal ein bisschen Kleingeld.«
»Sie haben ihn nicht bewegt?«
»Nein, Sir.« Simms wirkte gekränkt. »Eine alte Aktentasche habe ich gefunden, so eine weiche, wie ein Schulranzen. Die lag neben der Bank, aber da war auch nichts drin.«
»Merkwürdig«, sagte Gavin laut, als er sich wieder der Leiche zuwandte. Ein ungewöhnlicher Ort für einen Raubüberfall, und die Kleider des Mannes waren zwar von guter Qualität, aber abgetragen. Der Saum seines Hemdkragens war mit sorgfältigen Stichen ausgebessert.
Was konnte dieser Mann aus offensichtlich verarmten Verhältnissen bei sich gehabt haben, das Anlass zu einer solchen Gewalttat gegeben hätte? Und warum sollte ein gewöhnlicher Dieb seinem Opfer alles wegnehmen, was es identifizieren könnte?
Dann bemerkte er ein Glitzern am Hals des Mannes und richtete die Taschenlampe darauf. Es war eine dünne Goldkette, halb verdeckt vom Kragen des weißen Hemds. Gavin nahm sein Taschentuch heraus und schlug vorsichtig den Hemdkragen zurück. Ein kleiner Anhänger, nicht größer als sein Fingernagel, ruhte auf der weißen Haut am Schlüsselbein des Mannes. Gavin hob ihn so behutsam an, wie es ihm mit seinen vom Taschentuch verhüllten Fingern möglich war, und die Kette löste sich vom Hals des Toten – sie war nahe dem Verschluss gerissen.
Gavin ging in die Hocke und betrachtete stirnrunzelnd den Anhänger.
»Was ist es, Sir?«, fragte Simms und beugte sich schwer atmend über Gavins Schulter. »Sieht aus wie eine Miniatur-Hantel.«
»Nein.« Gavins Gedanken wanderten zurück zu den Nachbarn seiner Kindheit, den Kaplans, und er erinnerte sich, wie er an schönen Tagen mit den Kaplan-Jungen Fangen gespielt hatte, immer zur Haustür hinaus und wieder herein. Er hielt den Gegenstand hoch, sodass er sich funkelnd im Schein der Lampe drehte.
»Wenn ich mich nicht irre, ist das hier eine Mesusa, ein jüdisches Schutzsymbol.«
Trotz der angeregten Gespräche am Tisch registrierte Kincaid den leicht beunruhigten Ton von Gemmas Stimme, als sie nebenan telefonierte. Er entschuldigte sich bei den anderen Gästen mit einem Lächeln und einem kurzen Blick in Doug Cullens Richtung.Auf dessen unmerkliches Nicken hin stand er auf und schlängelte sich am Tisch vorbei in die Küche.
»Wir haben gerade Gäste zum Abendessen, aber ich könnte morgen früh vorbeischauen«, hörte er Gemma sagen, als er eintrat. Auf seinen fragenden Blick hin legte sie die Hand über den Hörer. »Es ist Erika. Sie sagt, sie müsse mit mir über etwas reden. Aber ich …« Ihr Blick ging zum Esszimmer, und sie zuckte mit den Achseln.
Kincaid war überrascht. Er konnte sich nicht vorstellen, dass eine so selbstständige und ausgesucht höfliche alte Dame wie Erika Rosenthal ohne ernsthaften Grund um diese Zeit anrufen würde.
»Geh«, sagte er. »Du hast die Prüfung als Gastgeberin glänzend bestanden, und es herrscht sowieso schon Aufbruchstimmung.« Er deutete in Richtung der Tafelrunde. »Wir sagen ihnen, dass deine Freundin krank ist. Und du kommst auf die Weise um den Abwasch herum.«
»Herzlichen Glückwunsch.« Gemma schenkte ihm ein flüchtiges Lächeln und nahm die Hand von der Sprechmuschel. »Erika, ich bin in einer Viertelstunde bei Ihnen.«
Irgendwann während des Essens hatte der Regen aufgehört, und jetzt war die Luft frisch und kühl. Gemma merkte, dass der Wein ihr ein bisschen zu Kopf gestiegen war, und so beschloss sie, die kurze Strecke bis Arundel Gardens zu Fuß zu gehen. Das würde ihr auch die Gelegenheit geben, den anstrengenden Dauer-Smalltalk bei Tisch auszublenden und ein wenig zur Besinnung zu kommen.
Als reine Vorsichtsmaßnahme schnappte sie sich einen Schirm aus dem Ständer in der Diele, den sie beim Gehen wie einen Spazierstock schwang und mit der Spitze auf das Pflaster schlug. Bald hatte sie die von grünen Bäumen gesäumte Lansdowne Road hinter sich gelassen und passierte die Reihenhäuser von Arundel Gardens. In den Erdgeschossfenstern von Erikas Haus brannte Licht, wie um ihr den Weg zu weisen.
Gemma fiel auf, dass sie noch nie abends bei Erika gewesen war – immer nur zum Lunch oder zum Tee. Sie hatte stets angenommen, dass Erika eine Frühaufsteherin sei und auch entsprechend zeitig zu Bett gehe. Als sie klingelte, warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr: Es war halb zwölf.
Erika kam rasch an die Tür und fasste Gemma zur Begrüßung an den Händen – eine ungewöhnliche Geste, da sie sonst Körperkontakt eher vermied. Während sie ins Wohnzimmer voranging, sagte sie: »Ich hätte Sie nicht so spät herbitten sollen. Sie werden denken, dass ich unsere Freundschaft ausnutze.«
Gemma blickte sich mit dem Wohlbehagen um, das sie hier jedes Mal empfand. Sie hatte dieses Zimmer von Anfang an geliebt, seit ihrem ersten Besuch kurz nach ihrer Versetzung nach Notting Hill als frischgebackener Inspector. Damals hatte sie persönlich eine Einbruchsanzeige übernommen, einfach nur, um wieder ein Gefühl für die Straße zu bekommen. Und dabei hatte sie Dr. Erika Rosenthal kennengelernt, eine zierliche weißhaarige Frau mit Feuer in den dunklen Augen, die ihr empört den Diebstahl ihres Fernsehers und einiger Schmuckgegenstände gemeldet hatte. Es war mehr die Verletzung ihrer Privatsphäre als der materielle Verlust, worüber sie aufgebracht war, und Gemma, die mit Sorge sah, wie schutzlos die allein lebende alte Dame war, hatte ihr vorgeschlagen, die Sicherheitsvorkehrungen an ihrem Haus zu verstärken. Es war ihr klar gewesen, dass die Frau ihre Sachen höchstwahrscheinlich nie wiedersehen würde.
Sie erinnerte sich, dass sie noch eine Weile geblieben war, um ein wenig mit der alten Dame zu plaudern, und wie sie das Zimmer mit den tiefroten Wänden bewundert hatte, mit den teuren, aber sympathisch verschlissenen Möbeln, den Bücherregalen und den leuchtenden Landschaftsbildern. Und dann war da Erikas Flügel gewesen, der Gemma mit Neid erfüllt hatte, bis Duncan ihr ein eigenes Instrument geschenkt hatte.
Wenige Wochen später hatte Gemma im Rahmen eines Falles, in den Verwandte von Duncan in Glastonbury verwickelt waren, über das Thema Göttinnenverehrung recherchiert und war dabei auf eine Monografie von Dr. Erika Rosenthal gestoßen. Sie hatte sich an den Namen erinnert und sich Rat suchend an Erika gewandt, und das war der Beginn einer ziemlich ungewöhnlichen Freundschaft gewesen.
Ungeachtet des großen Unterschieds in Alter, Herkunft und Bildung hatte Erika Gemma stets Unterstützung und Rat gewährt, und die alte Dame zeigte auch großes Interesse an den Kindern, insbesondere an Kit, den sie ermutigte, seinen Traum zu verfolgen und Biologe zu werden.
Jetzt fragte Gemma sich, ob sie auch nur halb so viel in die Beziehung eingebracht hatte, wie sie davon profitiert hatte. »Sie nutzen mich selbstverständlich nicht aus«, sagte sie rasch, während ihr Blick auf das aufgeschlagene Buch neben Erikas Sessel fiel und auf das halb leere Glas daneben – Whisky, wie es aussah. Der Anblick erfüllte sie mit leisem Unbehagen – sie hatte ihre Freundin noch nie irgendetwas Stärkeres trinken sehen als ab und zu ein Glas Sherry oder Wein.
»Ich darf Ihnen doch etwas anbieten«, sagte Erika, »dafür, dass Sie sich zu dieser späten Stunde herbemüht haben. Ich hätte Sherry oder Whisky da, oder ich könnte Ihnen einen Tee machen.«
»Nein, danke, das ist wirklich nicht nötig.« Gemma setzte sich auf ihren gewohnten Platz, den Sessel neben Erika, und betrachtete ihre Freundin eingehend. »Sagen Sie mir einfach nur, was passiert ist.«
Erika ließ sich in ihren eigenen Sessel sinken, und nach der herzlichen Begrüßung schien sie ihre ganze Energie geradezu aufgebraucht zu haben und in sich zusammenzusinken. Sie wirkte zerbrechlich und müde, und auf ihren Wangen breiteten sich ungesunde rote Flecken aus. Mit fahrigen Bewegungen griff sie nach dem aufgeschlagenen Buch auf ihrem Couchtisch und sagte: »Ich komme mir inzwischen ganz albern vor, weil ich Sie angerufen habe, wo doch eigentlich gar nichts … Aber es war ein solcher Schock, und ich konnte nicht …«
Das Buch fiel ihr aus der Hand und landete mit den aufgefächerten Seiten nach unten auf dem Boden vor Gemmas Füßen. Als sie es aufhob, sah sie, dass es sich nicht um ein Buch handelte, sondern um einen geschmackvoll gestalteten broschierten Katalog des Auktionshauses Harrowby’s. »›Art-déco-Schmuck‹?«, las sie laut vom Einband ab. »Ich verstehe nicht recht.«
»Nein, natürlich nicht.« Erika schüttelte den Kopf, machte aber keine Anstalten, den Katalog wieder an sich zu nehmen. »Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.«
Gemma saß einfach nur da und hörte bis in die letzte Körperfaser konzentriert zu – eine Kunst, die sie sich bei ihren Vernehmungen angeeignet hatte.
Nach einer Weile seufzte Erika und sah ihr kurz in die Augen. »Ich spreche nicht oft über diese Dinge. Ein paar meiner Freunde wissen etwas darüber, weil wir einiges gemeinsam erlebt haben … aber trotzdem ist es nicht einfach, nach all den Jahren.« Ihre Redeweise nahm einen förmlicheren Klang an, als ob ihre deutsche Muttersprache an die Oberfläche ihres Bewusstseins drängte.
»Sie wissen, dass ich kurz vor Beginn des Krieges von Berlin hierher nach London gekommen bin?«
»Zusammen mit Ihrem Mann. Ja, das haben Sie mir erzählt«, bestätigte Gemma, wobei ihr klar wurde, dass sie darüber hinaus kaum etwas wusste.
»Es klingt so einfach, ja?« Erikas Lächeln reichte nicht bis zu ihren Augen, und ihre Finger schienen sich von allein ineinander zu verschränken. »Mein Vater war nach dem Ersten Weltkrieg aus Russland nach Deutschland gekommen«, fuhr sie fort, »wo er mit seiner Braut ein neues Leben anfangen wollte. Sie sehen also, wir sind Flüchtlinge aus Tradition, wie fast alle Juden. Sein Name war Jakob Goldshtein, und er war ein Handwerker, der großes Geschick im Bearbeiten von Metall hatte. Er ging bei einem Goldschmied in die Lehre, und Anfang der Dreißigerjahre hatte er seinem Meister schon den Rang abgelaufen und sich einen Namen gemacht.
Er liebte den neuen Art-déco-Stil, die Einflüsse der ägyptischen und afrikanischen Kunst – er sagte, dass sie ihn an all die fernen Länder denken ließen, die er nie sehen würde. Er liebte den Kontrast von Silber oder Platin mit Steinen in leuchtenden Farben, aber mehr als alles andere liebte er Diamanten. Er war ein lustiger Mann, mein Vater, und er machte gerne Witze über seinen Namen. Er fand es amüsant, dass er ausschließlich mit silberfarbenen Metallen arbeitete.
Als die Nazis an die Macht kamen, war meine Mutter bereits tot, und mein Vater hatte sich nicht nur einen guten Ruf, sondern auch Wohlstand erworben. Er nahm Aufträge von der neuen deutschen Elite an, auch wenn das bedeutete, dass er seine wunderschönen Halsketten und Broschen mit Häkchen versehen musste, an denen sie ihre Hakenkreuze aufhängen konnten.« Erikas Züge waren weicher geworden, während sie über ihren Vater gesprochen hatte, und in ihrer Stimme lag kein Tadel.
»Er dachte natürlich, dass es nicht von Dauer sein würde, dieses neue Regime, wie es gewöhnlich der Fall war mit solchen Phänomenen. Und so schickte er seine verwöhnte einzige Tochter auf die Universität, und die verliebte sich dort in ihren Professor und heiratete ihn.«
Erika brach ab. Ihre Hände lagen jetzt reglos in ihrem Schoß, und es wurde ganz still im Zimmer. Keine gedämpften Stimmen aus den Nachbarhäusern waren zu hören, keine Schritte auf der Straße, und Gemma zögerte, obwohl die Frage ihr schon auf der Zunge lag, weil sie sich nicht sicher war, ob sie den Bann damit verstärken oder brechen würde. Schließlich sagte sie ganz leise: »Sie sprechen von Ihrem Mann?« Und während sie es sagte, wurde ihr bewusst, wie selten sie Erika von ihrer Ehe hatte erzählen hören.
»David, ja. Er war fünfzehn Jahre älter als ich, ein Philosoph und Pazifist, sehr bekannt in intellektuellen Kreisen. Es war sogar die Rede davon, dass er für den Nobelpreis nominiert werden könnte.Aber 1938 starb Carl von Ossietzky an den Folgen seiner KZ-Haft, und meinem Vater war klar, was David einfach nicht sehen wollte: dass weder David noch seine Ideen weiter geduldet werden würden.
Wir hatten wenig Geld, aber mein Vater verfügte über Mittel und Beziehungen. Er sorgte dafür, dass wir das Land anonym und ohne Aufsehen verlassen konnten, und David musste einsehen, dass es das einzig Richtige war.«
Die Spannung im Raum war jetzt mit Händen zu greifen, und Gemma sah deutlich, wie sich Erikas Kehlkopf auf und ab bewegte, als die alte Dame schluckte. Sie selbst hielt unwillkürlich die Luft an, und diesmal wagte sie es nicht, Erika zu unterbrechen.
»Mein Vater gab mir ein Abschiedsgeschenk, das schönste Stück von allen, die er je geschaffen hatte. Es sollte mein Erbteil sein, meine Absicherung für die Zukunft, falls die Dinge nicht so laufen sollten, wie wir es geplant hatten.«
Im gleichen Moment, als Gemma die Bedeutung des Buches, das sie in der Hand hielt, zu dämmern begann, griff Erika danach. Langsam und bedächtig strich sie die Seiten glatt, dann ließ sie den Katalog scheinbar willkürlich aufklappen. Während Erika gebannt auf die Seite hinabstarrte, stand Gemma auf und schaute ihr über die Schulter.
Vor Überraschung und Entzücken verschlug es ihr schier den Atem. Es war ein ganzseitiges Foto mit schwarzem Hintergrund, und vor der samtigen Dunkelheit ergossen sich die Diamanten in einer doppelten Kaskade. Die Beschreibung auf der rechten Seite lautete: Jakob Goldshtein, Diamant-Brosche in Kaskadenform mit Doppelclip, 1938. »Sie ist wunderschön«, hauchte Gemma.
»Ja. Das Meisterstück meines Vaters.« Erika hob den Kopf und sah ihr in die Augen. »Das letzte Mal habe ich sie in Deutschland gesehen, vor mehr als einem halben Jahrhundert. Ich brauche Ihre Hilfe, um herauszufinden, wie sie in eine englische Auktion geraten konnte.«
»Und, wie haben Sie sich mit Melody verstanden?« Kincaid hielt Doug Cullen einen tropfenden Kochtopf hin und warf seinem Sergeant, der sogleich eifrig mit dem Geschirrtuch zu Werke ging, einen Seitenblick zu.
Er und Doug hatten die rundum satten, zufriedenen und leicht angeheiterten Gäste verabschiedet, und jetzt, nachdem Kit und Toby heimgekommen waren und die Hunde die Hoffnung aufgegeben hatten, noch irgendwelche Reste ergattern zu können, hatten sie die Spülmaschine eingeräumt und sich darangemacht, die Töpfe und Pfannen abzuwaschen.
Mit seinem blonden Haar und seinem ausdrucksvollen Gesicht wirkte Doug Cullen immer noch wie der Mädchenschwarm vom Schulhof, und es war normalerweise nicht schwierig, an seiner Miene abzulesen, was in ihm vorging. Doch diesmal konnte Kincaid den Blick, den er ihm zuwarf, nicht deuten. »Da läuft wohl nichts, glaube ich«, sagte Cullen und griff nach dem nächsten Topf.
»Weil Melody nicht auf Sie steht oder umgekehrt?«, fragte Kincaid. Gemma würde sicher enttäuscht sein, dass ihr Kuppelversuch gescheitert war.
Cullen zuckte mit den Achseln und schob mit dem feuchten Zipfel des Geschirrtuchs seine Brille hoch. »Ist vielleicht nur mein verletztes Ego, aber ich habe den Eindruck, dass PC Talbot grundsätzlich nicht so auf Kerle steht.«
Kincaid sah ihn verblüfft an. »Ehrlich?«
»Sie hat jedenfalls diese Ausstrahlung – als wollte sie sagen: Lasst uns doch alle Kumpels sein.«
»Könnte auch ein Schutzmechanismus sein. So was kommt öfter vor.« Melody Talbot war attraktiv, dunkelhaarig und von heiterem, zupackendem Wesen, und sie hatte sich als Gemmas Assistentin inzwischen beinahe unentbehrlich gemacht. Wenn Melody lesbisch war und sich entschieden hatte, ihre sexuelle Orientierung für sich zu behalten, dann war das ihre Sache. Weibliche Polizeibeamte hatten es ohnehin schon schwer genug … Sein Gedankengang brach jäh ab, als er sich daran erinnerte, wie eifrig Melody stets um Gemma bemüht war – all die kleinen aufmerksamen Gesten, von denen Gemma ihm oft nach Feierabend berichtete.
»Und wie sieht’s mit der kratzbürstigen Maura Bell aus?«, fragte Kincaid.
Vor einer Weile hatten sie bei einem Fall in Southwark mit Inspector Bell aus Schottland zusammengearbeitet, und obwohl sie und Cullen so verschieden waren wie Tag und Nacht, hatte es zwischen den beiden hörbar geknistert. Doug hatte sogar mit seiner langjährigen Freundin Stella Fairchild-Priestly Schluss gemacht, aber in letzter Zeit hatte er Maura immer seltener erwähnt.
Diesmal waren Cullens Gefühle allzu offensichtlich, denn er errötete bis unter die Wurzeln seines blonden Haars. »Keine Ahnung«, antwortete er knapp, und Kincaid wusste, dass er zu weit gegangen war. Es wurde ihm plötzlich klar, dass er ebenso wenig über Cullens Privatleben wusste wie Gemma offenbar über das von Melody Talbot.
Und daran würde er heute Abend jedenfalls nichts mehr ändern können, denn nachdem Cullen rasch die restlichen Töpfe abgetrocknet hatte, machte er sich mit einer hingemurmelten Entschuldigung aus dem Staub.
»Scheiße, Mann, das war ja nur noch erbärmlich!«, wetterte Cullen laut, während er sich auf einen Sitzplatz im Nachtbus fallen ließ, der die Bishop’s Bridge Road entlangrumpelte. Dafür kassierte er einen missbilligenden Blick von einer alten Dame, die für den lauen Maiabend viel zu warm eingepackt war. Er hatte überlegt, die U-Bahn zu nehmen, was bestimmt schneller gegangen wäre, aber es war Wochenende, und die Vorstellung, mit Scharen betrunkener Nachtschwärmer und knutschenden Pärchen in einem Wagen zusammengepfercht zu sein, hatte ihn abgeschreckt.
Doch auch der flotte Fußmarsch und das Warten an der Bushaltestelle hatten es nicht einfacher gemacht, den Gedanken an Maura Bell zu verdrängen, und sein Gesicht glühte erneut vor Scham, als er sich an seine Reaktion auf Kincaids Frage erinnerte. Warum hatte er sich nicht einfach mit einem Achselzucken und irgendeinem passenden Macho-Spruch aus der Affäre ziehen können? Wie gewonnen, so zerronnen. Frauen – was soll man da noch sagen?
Aber nein, er hatte sich ja vor seinem Chef unbedingt komplett zum Idioten machen müssen.
Die Wahrheit war, dass er ein paarmal mit Maura ausgegangen war – auf ein Bier, zum Essen oder ins Kino. Er hatte das Gefühl gehabt, dass sie ihn mochte, aber seine Internatserziehung, kombiniert mit seiner unausrottbaren Schüchternheit, hatte ihn im entscheidenden Moment immer gehemmt. Und als er endlich seinen ganzen Mut zusammengenommen und einen ernsthaften Annäherungsversuch gestartet hatte, da war sie zurückgewichen, als hätte er sie geschlagen.
Er hatte irgendwelche Entschuldigungen gestammelt, und sie hatte ihn mit einer fadenscheinigen Ausrede mitten auf der Millennium Bridge stehen lassen, so gedemütigt, dass er einen Moment lang mit dem Gedanken gespielt hatte, in den Fluss zu springen. Aber dann hatte die Vernunft obsiegt. Vielleicht war selbst das erbärmlich – dass er zu so einer großartigen romantischen Geste gar nicht fähig war.
Er war in seine graue Wohnung in der Euston Road zurückgegangen, und als Maura ihn in den nächsten Tagen immer wieder angerufen hatte, war er einfach nicht drangegangen. Nach einer Weile hatten die Anrufe aufgehört, und in den Monaten, die seither vergangen waren, hatte er sich mit übertriebenem Eifer in die Arbeit gestürzt und sich zum besten Rechercheur im Dezernat entwickelt. Seine sozialen Kontakte hatte er unterdessen auf einen gelegentlichen Feierabend-Drink mit Kincaid und die monatlichen Besuche bei seinen Eltern in Saint Albans reduziert, denen er ausgeschmückte Storys von seiner bedeutsamen Arbeit bei der Polizei auftischte.
An der Great Portland Street bremste der Bus ab, und einen Moment lang spielte Cullen mit einer verrückten Idee. Er könnte immer noch die Circle Line nehmen. Dann mit der Docklands Light Railway weiter zur Isle of Dogs. Er könnte sich vor Maura Bells Haus stellen und warten, bis er einen Blick auf sie erhaschte – nur um zu sehen, ob sie noch so war, wie er sie in Erinnerung hatte.
Doch dann schnaubte er angewidert. Stalking, so nannte man das, was er da vorhatte, und so tief war er noch nicht gesunken – noch nicht.Aber die dick eingemummte Frau schien da anderer Meinung zu sein. Sie funkelte ihn mit bebendem Doppelkinn an, und ihr Blick ließ keinen Zweifel daran, dass sie ihn für einen gefährlichen Zeitgenossen hielt. Schließlich stand sie auf und ging schwerfällig ganz nach hinten zur letzten Sitzbank.
Nachdem Cullen gegangen war, wischte Kincaid noch einmal über die Arbeitsplatten, schaltete dann alle Lichter bis auf die kleine Lampe in der Küche aus und blieb stehen, um zu lauschen. Als Wesley die Jungs abgeliefert hatte, waren sie vor lauter Pizza und Limo ganz aufgedreht gewesen, aber jetzt war das Gekicher im Obergeschoss verstummt. Selbst die Hunde waren verschwunden. Tess, die kleine Terrierhündin des dreizehnjährigen Kit, war wohl bei ihrem Herrchen, während Geordie, Gemmas Cockerspaniel, es sich am Fußende ihres Betts bequem gemacht haben dürfte. Und Sid, der schwarze Kater der Familie, hing sowieso immer wie eine Klette an dem kleinen Hund, für den er ein ganz und gar nicht katzenhaftes Faible entwickelt hatte.
Das Haus schien auszuatmen und sich auf die tiefe Stille der Nacht einzurichten, die langsam, aber stetig dem Morgen entgegenrückte, und Kincaid warf einen besorgten Blick auf die Uhr über dem Herd. Es war halb eins – sicher würde Gemma bald nach Hause kommen.
Er war ein klein wenig besorgt wegen Erikas Anruf. Es schien so gar nicht zu der alten Dame zu passen – allerdings fand er Gemmas Freundschaft mit Erika ohnehin etwas merkwürdig. Nicht dass er sie nicht gemocht hätte, aber wenn sie ihn mit ihren hellwachen Augen musterte, kam er sich vor wie ein Schwiegersohn in spe unter den taxierenden Blicken seiner künftigen Schwiegermutter – ein unangenehmes Gefühl für einen Mann, der sich sonst nicht so leicht einschüchtern ließ.
Missbilligte sie etwa die Tatsache, dass er und Gemma nicht verheiratet waren? Aber sicherlich kannte sie Gemma gut genug, um zu wissen, dass es ihre Entscheidung war und nicht seine.
Kincaid zuckte unwirsch mit den Achseln. Er ärgerte sich über sich selbst, weil er seine Gedanken in diese Richtung hatte abschweifen lassen, doch er musste feststellen, dass er unmöglich ins Bett gehen oder es sich mit einem Buch gemütlich machen könnte, solange Gemma noch nicht zu Hause war. Er hatte gerade beschlossen, stattdessen den Fernseher einzuschalten, als es an der Tür klingelte. Das Geräusch wirkte entsetzlich laut in dem stillen Haus, und oben jaulte einer der Hunde erschrocken auf.
Während er zur Tür eilte, wurde er plötzlich von Panik gepackt. Gemma war unterwegs – war ihr etwas zugestoßen?
Er sagte sich gerade, dass seine Befürchtungen albern seien und dass es sicher nur einer der Gäste sei, der etwas vergessen hatte, als er die Tür öffnete und Gemmas Vater auf der Schwelle erblickte.
Das Restaurant mit Nachtclub in der All Saints Road war einer der jüngsten Versuche, die immer noch etwas zwielichtigen unteren Bezirke von Notting Hill aufzuwerten. Aber an diesem Samstagabend schienen die Tierklinik vis-à-vis und die verrammelten Ladenfronten irgendwie zum Ambiente dazuzugehören, und im Restaurant selbst war die Atmosphäre so cool, dass man Frostbeulen bekam. Kein Gast war älter als Anfang dreißig; alle waren reich – oder taten wenigstens so.
Kristin Cahill gehörte zu denen, die noch nicht den Status erreicht hatten, den sie vorspiegelten. Sie lehnte an der Bar in ihrem kleinen Schwarzen, einem Markenimitat, das durch Eleganz wettmachte, was ihm an Echtheit abging, und ihre milchweiße Haut betonte. Ihr fransig gestuftes dunkles Haar schmeichelte ihren knabenhaften Zügen und ihrem langen Hals, und ihre vollen Lippen waren sorgfältig in Pink nachgezogen.
Nachdem sie sich zum hundertsten Mal vergewissert hatte, dass ihr Lippenstift nicht verschmiert war, klappte sie die Puderdose wieder zu. Sie hätte als Französin durchgehen können – ein Typ wie Audrey Hepburn, Leslie Caron oder auch Edith Piaf –, aber es war niemand da, der ihre Bemühungen zu schätzen wusste, bis auf den Barkeeper, und sie hatte es allmählich satt, seinen allzu interessierten Blicken auszuweichen.