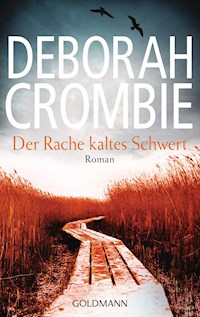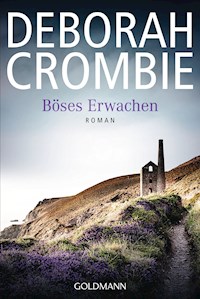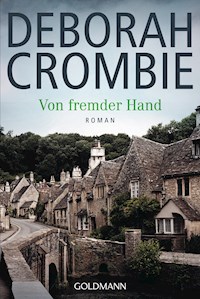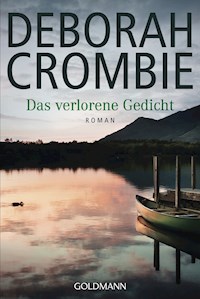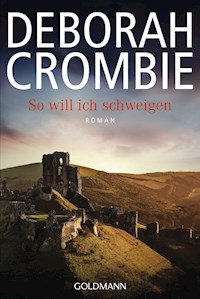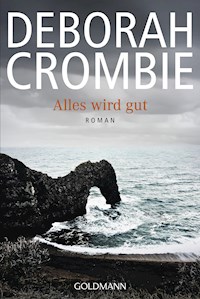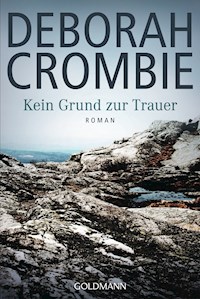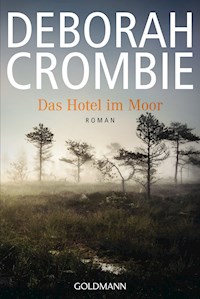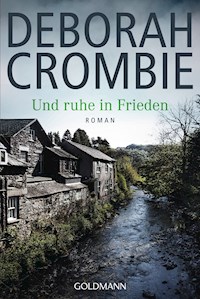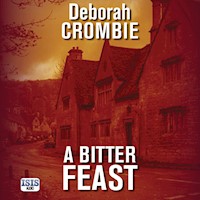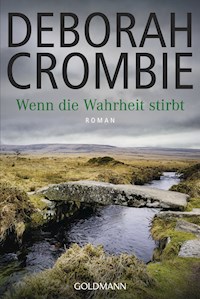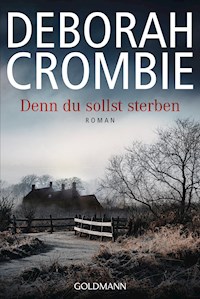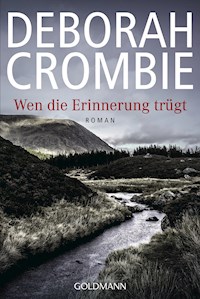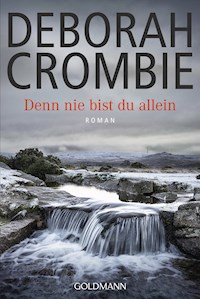9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Kincaid-James-Romane
- Sprache: Deutsch
Der neue Fall aus der Bestseller-Serie um Duncan Kincaid und Gemma James.
Am Londoner St. Pancras Bahnhof wird ein Bombenanschlag verübt, bei dem mehrere Menschen sterben. Ryan March, Mitglied einer Protestgruppe, der eine verdächtige Tasche mit sich führte, gehört zu den Toten. War er der Täter? Superintendent Duncan Kincaid übernimmt die Ermittlungen, muss aber feststellen, dass die einzelnen Puzzleteile des Falls überhaupt nicht zueinanderpassen. Mit Hilfe seiner Frau, Inspector Gemma James, kommt er schließlich peu à peu den Hintergründen der Tat auf die Spur. Doch was er entdeckt, ist unfassbar grausam ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Superintendent Duncan Kincaid wurde vom Hauptsitz des Scotland Yard in den Stadtteil Camden versetzt. Ausgerechnet dort, am altehrwürdigen Bahnhof St. Pancras, wird ein Bombenanschlag verübt, bei dem mehrere Menschen z. T. schwer verletzt werden. Zufällig wird Detective Sergeant Melody Talbot, eine Kollegin seiner Frau Gemma, Zeugin des Anschlags. Ein junger Mann stirbt vor ihren Augen einen grässlichen Tod. War er der Täter?
Militante Umweltschützer, die im Bahnhof protestierten, glauben, dass es sich bei dem Toten um Ryan Marsh handelt, ein Mitglied ihrer Organisation. Aber sie behaupten, Ryan hätte lediglich eine Rauchbombe zünden wollen, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Kincaid übernimmt die Ermittlungen und muss schnell feststellen, dass die einzelnen Puzzleteilchen des Falls überhaupt nicht zueinanderpassen. Mit Hilfe von Melody Talbot und seiner Frau, Inspector Gemma James, deckt er peu à peu die Hintergründe der Tat auf. Doch was er entdeckt, lässt ihn seinen Beruf und die Werte, an die er bisher glaubte, infrage stellen. Und ihm wird schlagartig bewusst, wie verwundbar seine eigene geliebte Familie ist …
Informationen zu Deborah Crombie
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Deborah Crombie
Wer im Dunkeln bleibt
Roman
Deutsch vonAndreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
»To Dwell in Darkness« bei William Morrow & Company, London,
und Harper Collins, New York.
Deutsche Erstveröffentlichung April 2015
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Deborah Crombie
Published by Arrangement with Deborah Crombie
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische
Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: UNO Werbeagentur München
Covermotive: © Marcin Bublewicz / Trevillion Images; FinePic®, München
Vorsatzkarte: © Laura Maestro
Redaktion: Claudia Fink
BH · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-14364-0 V003
www.goldmann-verlag.de
Dem besten Unterstützerkreis, den eine Autorin sich nur wünschen kann – meinen schreibenden Kolleginnen von Jungle Red Writers: Rhys Bowen, Lucy Burdette, Hallie Ephron, Julia Spencer-Fleming, Susan Elia MacNeal und Hank Phillippi Ryan. Eure Freundschaft und eure ermutigenden Rückmeldungen waren und sind mir eine Freude und eine Ehre.
Jungle Reds rock!
1
St. Pancras oder Pankratius ist der Schutzheilige der Kinder und wird gegen Meineid und falsches Zeugnis angerufen.
Anonym
In den ersten Sekunden nach dem Aufwachen wusste er nicht einmal, wer er war.
Der Schwebezustand hielt an, bis sein Bewusstsein allmählich aus den trüben Fluten des Schlafs auftauchte. Die harte Kante seiner eigenen Fingerknöchel drückte gegen seinen Wangenknochen, und er registrierte, dass er auf der Seite lag.Als er die Hand bewegte, spürte er raue Stoppeln auf der Haut. Vorsichtig tastete er mit der Zunge in der Mundhöhle umher. Sie fühlte sich pelzig an, und er musste schlucken, um gegen den säuerlichen Nachgeschmack des Biers anzukämpfen.
Wortfetzen drangen an sein Ohr, verrauscht und abgehackt wie aus einem alten Radio. Waren es Mädchenstimmen? Einen Moment lang glaubte er, es seien seine Töchter, die mit ihren Freundinnen über irgendetwas kicherten. War er zu Hause? Aber nein, die Stimmen klangen angespannt. Sie lachten nicht, sie stritten sich. Er machte eine weibliche Stimme aus, dann eine männliche.Als er sich herumwälzte, spürte er, wie der Stoff seines Schlafsacks über seine Haut glitt, dann den Druck der harten Dielen des alten Holzbodens, auf dem er lag.
Also nicht zu Hause. Nicht in seinem eigenen Bett, neben seiner Frau.
Schlagartig kam die Erinnerung zurück. Er war in der Wohnung in der Caledonian Road. Von dem Schnellrestaurant im Erdgeschoss stieg der Duft von Brathähnchen auf und verstärkte das flaue Gefühl in seinem Magen.
Er merkte, dass die Hand unter seinem Gesicht eiskalt war. Die Wohnung war nicht geheizt.
Die Stimmen wurden lauter, kamen näher. Er erkannte Matthew – arrogant, ungeduldig, aufbrausend. Dann Paul, der ihm widersprach, mit mürrischem, zunehmend quengelndem Unterton.
Er würde mit ihnen reden. Gemeinsam würden sie die beiden zur Vernunft bringen, er und Wren.
Wren. O Gott.
Die Erinnerung holte ihn ein und mit ihr eine so abgrundtiefe Verzweiflung, dass es ihm den Atem raubte. Wren würde nicht wiederkommen.
Jetzt wusste er, wer er war, und er wusste genau, wo er war. Es schien ihm mehr, als er ertragen konnte.
Doch dann fiel ihm wieder ein, was er an diesem Tag zu tun hatte.
London war elend kalt für Mitte März. In den Parks und Vorgärten zeigten sich schon ein paar kühne Krokusse, aber ein strenger Frost hatte die Narzissen erfrieren und die frühen Blüten der Obstbäume zu Kristall erstarren lassen.
Detective Superintendent Duncan Kincaid ging von der U-Bahn-Station Holborn zur Southampton Row, den Mantelkragen hochgeschlagen, den Hals mit einem dicken Wollschal umwickelt, die behandschuhten Hände tief in den Manteltaschen vergraben. Der Himmel war dunkelgrau, und als Kincaid nach Osten in die Theobald’s Road einbog, holte ein Windstoß ihn fast von den Füßen. Er senkte den Kopf und marschierte unverdrossen weiter. Die Wetterfrösche sagten, dass der Wind von der sibirischen Steppe herwehte – er überlegte schon, ob er sich eine dieser russischen Fellmützen mit Ohrenklappen zulegen sollte. Wenigstens verstand er jetzt, warum die Russen diese albernen Kopfbedeckungen trugen.
Er beschleunigte seine Schritte, als der Betonklotz der Polizeiwache von Holborn vor ihm auftauchte. Auch wenn die Architektur des Gebäudes ein wenig an einen Gulag erinnerte, verhieß es doch zumindest Wärme.
Holborn Station – seit nunmehr zwei Wochen sein zweites Zuhause. Und doch fühlte er sich immer noch so fehl am Platz wie an seinem schwierigen ersten Tag. Und er war noch genauso wütend.
Als er Mitte Februar nach seiner Elternzeit seinen Dienst bei Scotland Yard wieder hatte antreten wollen, hatte er sein Büro leer vorgefunden. Er war von seinem Posten als Leiter des Morddezernats beim Yard, den er jahrelang innegehabt hatte, zu einem Sonderermittlungsteam hier in Holborn versetzt worden. Es war eine Herabstufung, auch wenn er seinen Dienstgrad behalten hatte. Es hatte keine Vorwarnung und keine Erklärung gegeben.
Sein unmittelbarer Vorgesetzter, Chief Superintendent Denis Childs, hatte wegen eines Notfalls in der Familie ins Ausland reisen müssen. Das hatte Kincaids Sorgen noch vermehrt, hatte er doch mit seiner Familie das Haus von Childs’ Schwester Liz gemietet, nachdem deren Mann sich für fünf Jahre beruflich in Singapur verpflichtet hatte.
Er mochte Liz Davies, obwohl sie immer nur per E-Mail kommuniziert hatten, und er hoffte, dass der familiäre Notfall im Ausland nichts mit ihr zu tun hatte.
Im Zuge von Kincaids Versetzung nach Holborn hatte sein Sergeant Doug Cullen einen Job in der Datenerfassung beim Yard aufs Auge gedrückt bekommen – vordergründig, um seine Wiedereingliederung nach einem Knöchelbruch zu erleichtern. Und so musste Kincaid nun bei der Einarbeitung in seinen neuen Job ohne Cullens kompetente, zuweilen etwas oberlehrerhafte Unterstützung auskommen.
Einen guten Detective Sergeant zu verlieren – einen Partner, mit dem man mehr Stunden verbrachte als mit der eigenen Frau –, das rangierte in seinen Augen auf der Skala der biografischen Brüche knapp unterhalb einer Scheidung. Und mit seinem neuen Team hatte es keine Flitterwochen als Entschädigung gegeben.
Und da sah Kincaid auch schon seinen neuen Detective Constable, George Sweeney, die Stufen des LA-Fitnesscenters gegenüber dem Polizeirevier heruntertraben. Frisch von seinem morgendlichen Trainingsprogramm kommend, trug Sweeney einen Dreiteiler, den er sich vom Gehalt eines Constables eigentlich nicht leisten konnte, dafür keinen Mantel. Sein kurzes Haar war noch feucht und zu einer modischen Stachelfrisur gegelt, die Wangen leuchteten rot von seinen gesundheitsförderlichen Anstrengungen.
»Morgen, Chef«, rief Sweeney mit übertriebenem Enthusiasmus, als sie beide den Eingang der Wache erreichten. »Sie sehen ja aus wie der Tod auf Urlaub«, fügte er mit einem Seitenblick auf Kincaid hinzu. »Bisschen zu viel gefeiert gestern?« Sweeney zwinkerte und schien es sich gerade noch zu verkneifen, Kincaid den Ellbogen in die Seite zu stoßen. Der Mann konnte echt lästig sein.
»Krankes Kind«, erwiderte Kincaid knapp. Ihre dreijährige Pflegetochter Charlotte hatte einen schlimmen Husten, und er und Gemma hatten abwechselnd bei ihr gewacht.
»Na ja.« Sweeney zuckte mit den Schultern. »Dann kann der Tag ja nur noch besser werden, was, Chef?«
Kincaid spürte einen leichten Stich auf der Wange und gleich darauf einen zweiten. Aus den tief hängenden Wolken begann Eisregen niederzuprasseln.
»Ich zieh doch keine Strickjacke an«, sagte Andy Monahan.
Dazu setzte er die störrische Miene auf, die Detective Sergeant Melody Talbot in den zwei Monaten, die sie nunmehr ein Paar waren, zur Genüge kennengelernt hatte. Es hatte sie all ihre Überredungskunst gekostet, ihn in die angesagte Boutique in Soho zu lotsen.
Sie wartete gespannt, während Andy sich im Spiegel betrachtete. Immerhin hatte er sie nicht gleich wieder ausgezogen. Er hob das Revers an und verzog angewidert den Mund. »Ich seh aus wie ein Opa. Fehlt bloß noch die Regimentskrawatte.«
Andy war Ende zwanzig, und mit seinen zerzausten blonden Haaren, den dunkelblauen Augen und einem Gesicht, das allenfalls ein wenig zu ernst und angespannt war, um hübsch genannt zu werden, sah er aus wie ein Rockstar, bei dessen Anblick die Mädchen reihenweise in Ohnmacht fielen. »Du rollst die Ärmel hoch und trägst dazu ein weißes T-Shirt und eine Levi’s«, bestimmte Melody. »Und du siehst überhaupt nicht aus wie mein Opa.«
Dabei lächelte sie verführerisch, doch Andy schluckte den Köder nicht. »Ich seh aus wie Liberaces Opa. Das verdammte Teil ist babyblau.«
»Nur ohne Strass«, entgegnete sie grinsend. »Und es betont deine Augenfarbe. Außerdem«, spielte Melody ihren Trumpf aus, »kannst du unmöglich zulassen, dass Poppy dich in den Schatten stellt. Vertrau mir einfach.«
Andy beäugte sie kritisch. »Du bist doch die Frau, die im Dienst Super-Detective-Kostüme trägt, und da soll ich deinem modischen Rat vertrauen?« Doch sein Mund hatte sich entspannt, und sie bemerkte ein angedeutetes Blitzen in seinen blauen Augen. »Wenn ich es kaufe, kommst du dann zu dem Gig?«
»Ich werde da sein. Ich hab’s dir doch versprochen.« Der besagte Auftritt sollte am späten Nachmittag in der Haupthalle des Bahnhofs St. Pancras International stattfinden, im Rahmen eines Frühjahrsfestivals mit angesagten Indie-Pop- und Rockbands. Das Konzert würde live im Radio übertragen werden, und zur Rushhour würden Scharen von Pendlern zugegen sein. Es war ein Beleg für den kometenhaften Aufstieg von Andy und seiner neuen Partnerin Poppy Jones, dass sie die Hauptattraktion des Festivals waren.
Melody wusste, dass er nervös war. Es kursierten Gerüchte, dass ein Scout einer großen Plattenfirma im Publikum sein könnte.
»Ganz vorne, an der Bühne?«, fragte Andy, der die Strickjacke für den Moment ganz vergessen hatte.
Auf diese Diskussion wollte Melody sich auf keinen Fall einlassen. Nicht hier, nicht jetzt. Melodys Beharren darauf, in der Öffentlichkeit nicht als Andys Freundin in Erscheinung zu treten, hatte sich zum größten Konfliktpunkt in ihrer Beziehung entwickelt.
Und sie hatte einflussreiche Unterstützung. Sowohl Andys Manager Tam Moran als auch Poppys Manager Caleb Hart war daran gelegen, das Beste aus der harmonischen Bühnenpräsenz des Duos herauszuholen, und die Beziehung ihres Gitarristen mit einer Kriminalbeamtin der Metropolitan Police war in ihren Augen nicht gerade ein verkaufsfördernder Faktor.
Und Melody konnte sich vorstellen, dass auch ihre Vorgesetzten davon nicht sonderlich begeistert wären.
Doch das Problem ging noch tiefer. Von klein auf hatte sie stets eifersüchtig über ihre Privatsphäre gewacht, und das aus gutem Grund. Nur ein paar ihrer engsten Freunde wussten, dass ihr Vater der Besitzer einer der erfolgreichsten – und reißerischsten – überregionalen Boulevardzeitungen war. Wenn diese Verbindung allgemein bekannt würde, könnte es das Ende ihrer Karriere bedeuten. Ganz zu schweigen davon, dass sie es Andy noch nicht erzählt hatte. Irgendwann würde sie reinen Tisch machen müssen – aber nicht heute.
»In dem Teil würde ich dich allerdings auch aus der letzten Reihe mühelos erkennen.« Sie zupfte spielerisch am Ärmel der Strickjacke, bemüht, einen Streit abzuwenden. »Vielleicht lässt sich Poppy dazu überreden, sich zur farblichen Abstimmung ein paar blaue Strähnchen ins Haar zu machen.«
Andy verdrehte die Augen. »Bring sie ja nicht auf Ideen.« Poppy war ohnehin schon ein überkandideltes Blumenkind, da musste man sie nicht noch ermuntern.
»Na los doch, gib dir einen Ruck. Zeig ein bisschen Mut.«
Er sah sie herausfordernd an. »Krieg ich auch eine Belohnung?«
»Über das Après-Gig können wir noch reden.« Sie strich zärtlich über den Ärmel der Strickjacke.
Der Verkäufer, der Andy interessiert beäugt hatte, schnalzte angewidert mit der Zunge.
»Tja, tut mir leid.« Melody zwinkerte dem Verkäufer zu, während sie Andy die Strickjacke von den Schultern zog. »Der ist schon vergeben. Aber wenigstens haben Sie ein Geschäft gemacht.«
Detective Inspector Gemma James starrte den Bericht auf ihrem Computerbildschirm an und widerstand der Versuchung, den Kopf auf den Schreibtisch sinken zu lassen. Das Stimmengewirr im CID-Büro des Reviers South London, das Klappern der Tastaturen, das Läuten der Telefone, alles verschwamm zu einem einschläfernden Summen.
Gestern Abend war Charlotte das erste Mal krank geworden, seit sie und Kincaid sie im vergangenen Herbst zu sich genommen hatten, und Gemma befürchtete, dass sie beide angesichts eines ganz gewöhnlichen Kinderhustens überreagiert hatten.
Jetzt zählte sie die Minuten, bis sie sich guten Gewissens einen Nachmittagskaffee gönnen könnte. Sie streckte sich, blinzelte und versuchte sich wieder auf den Bildschirm zu konzentrieren.
Gemma und ihre Kollegen von der Mordkommission South London verdächtigten einen Mann, ein zwölfjähriges Mädchen namens Mercy Johnson entführt, vergewaltigt und ermordet zu haben. Es war der dringlichste Fall des Teams, doch bislang hatten sie nichts hinreichend Konkretes in der Hand, das eine Hausdurchsuchung gerechtfertigt hätte, geschweige denn einen Haftbefehl.
Dillon Underwood war weiß, stammte aus einer Mittelschichtfamilie und verfügte über einen ausgesprochen manipulativen Charme; das Opfer, Mercy, kam dagegen aus der Unterschicht und war schwarz. Gemma und ihr Team befürchteten daher, dass Underwoods geschmeidige, einnehmende Art ihm bei seiner Verteidigung helfen würde. Und so hatten sie viele Stunden damit zugebracht, die Akten nach belastenden Indizien zu durchkämmen, um zumindest seine Wohnung durchsuchen zu können und ein DNS-Profil zu bekommen.
Gemmas Detective Sergeant, Melody Talbot, hatte den Nachmittag damit verbracht, Underwoods Kollegen noch einmal zu befragen, in der Hoffnung, vielleicht die entscheidende Information herauszufiltern, die ihnen bisher entgangen war.
Melody würde anschließend nicht mehr ins Büro zurückkommen – sie hatte Gemma erklärt, dass sie vorhabe, von dort gleich zum Bahnhof St. Pancras zu fahren, wo ihr Freund ein Konzert gab.
Bei dem Gedanken musste Gemma lächeln. Ihre adrette, gewissenhafte und stets makellos gekleidete Assistentin an der Seite eines leicht gammligen Rockgitarristen.
Sie wandte sich wieder dem Monitor und den Angaben zu ihrem Verdächtigen zu. Der zweiundzwanzigjährige Dillon Underwood arbeitete als Verkäufer in einem Elektronikgeschäft in Brixton, und er war in seinem Job offenbar recht erfolgreich. Besonders bei der weiblichen Kundschaft, wenn man den anderen Angestellten Glauben schenken durfte. Mercy Johnson hatte den Laden in den Wochen vor ihrem Tod mehrmals aufgesucht. Sie hatte sehnsüchtig die Computer bewundert, denn sie hatte gehofft, ihre Mutter dazu zu überreden, dass sie ihr zum dreizehnten Geburtstag einen schenkte. Aber die Überwachungskameras des Ladens konnten nicht belegen, dass Mercy von Dillon bedient worden war, und so blieben ihnen nur die Aussagen der besten Freundinnen des Mädchens. Wieder nur ein Indizienbeweis – und die Verteidigung würde keine Mühe haben, die Zeugenaussagen zweier Zwölfjähriger in Zweifel zu ziehen.
Es gab Zeugen, die Underwood am Abend von Mercys Verschwinden in einem gut besuchten Club in der Brixton Road gesehen haben wollten, doch es war die Art von Lokal, wo man seine Freunde im Gedränge leicht für ein, zwei Stunden aus den Augen verlieren konnte.
Mercys Leiche war zwei Tage darauf von einer Spaziergängerin, die ihren Hund im Park von Clapham Common ausführte, in einem Gebüsch gefunden worden. Underwood besaß kein Auto, wenn er also den Club lange genug verlassen hatte, um Mercy treffen und töten zu können, müsste er zu Fuß gegangen sein. Und er müsste sich mit Mercy im Park verabredet haben.
Als das Mobiltelefon auf Gemmas Schreibtisch klingelte, stürzte sie sich gleich darauf, in der Hoffnung, dass es Duncan war. Sie machte sich Sorgen um ihn, seit er den neuen Job in Holborn angetreten hatte. Sicherlich hatte sie damit gerechnet, dass es eine Umstellung für ihn sein würde, aber nun war doch schon einige Zeit vergangen, und die Situation schien sich kaum gebessert zu haben.
Doch der Anruf kam von Kit, ihrem vierzehnjährigen Stiefsohn, und ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass die Kinder wohl schon von der Schule zurück waren.
Hastig nahm sie das Telefon ans Ohr und sagte: »Hi, Schatz, ist alles in Ordnung?«
Aber es war nicht Kit. Die Stimme ihres sechsjährigen Sohnes Toby tönte so laut in ihr Ohr, dass sie zusammenzuckte.
»Mummy, Mummy, Kit hat gesagt, ich darf sein Handy benutzen. Wir haben eine Katze gefunden. Im Garten. Mit Babys!«
»Babys? Wo? In welchem Garten?«, fragte sie verwirrt. Sie hatte immer noch nicht richtig umgeschaltet.
»Katzenbabys!«, rief Toby begeistert. »Aber die sind voll klein. Wie – wie Schweinchen!«
»Schweinchen?«, fragte Gemma. Dann hörte sie Kits Stimme im Hintergrund, offenbar korrigierte er Toby. »Toby, Schätzchen«, sagte sie, »gib mir doch mal Kit.«
Es raschelte ein wenig, und dann meldete sich Kit. »Gemma.« Ein banges Gefühl beschlich sie. Wenn Kit entspannt war oder sie necken wollte, nannte er sie immer »Mum«.
»Was hör ich da von einer Katze im Garten?« Sie blickte aus dem Fenster des CID-Büros zu dem bleigrauen Himmel auf. Die Temperatur schwankte um den Gefrierpunkt, und sie wusste, dass der Wind eisig war.
»Du kennst doch den Schuppen?«
Ihr Haus in Notting Hill grenzte mit der Rückseite an einen Gemeinschaftsgarten mit einem kleinen Schuppen in der Mitte, in dem Gartengeräte aufbewahrt wurden.
»Wir waren mit den Hunden draußen«, fuhr Kit fort, »und sie haben etwas gehört.« Tess war der Terrier, der Kit zugelaufen war; Geordie war Gemmas Blauschimmel-Cockerspaniel; beide hatten einen guten Jagdinstinkt. »Als wir die Tür aufgemacht haben …«
»Ist da nicht ein Schloss dran?«, unterbrach ihn Gemma.
Nach einer kurzen Pause sagte Kit: »Ich hab einen Hammer benutzt. Wir haben so ein Wimmern gehört, und wir dachten, es könnte ein Baby sein oder so.«
Gemma ließ das für den Moment auf sich beruhen. »Und?«
»Da war ein Haufen Sackleinen. Ich hab Toby gesagt, dass er die Hunde draußen festhalten soll. Und dann hab ich die Katze gesehen, die hatte sich da so eine Art Nest gemacht. Mit vier Jungen. Gemma, sie ist so dünn, und die Kätzchen sind so winzig. Ich hab Angst, dass sie sterben.«
»Aber Kit, es ist nicht unsere Katze. Vielleicht gehört sie einem der Nachbarn …«
»Sie ist am Verhungern, Gemma. Sie kann kaum noch den Kopf heben. Wir müssen irgendetwas tun.«
Kätzchen. Du lieber Himmel. »Okay, Kit, warte mal einen Moment«, sagte Gemma und versuchte sich zu sammeln. »Du kannst sie nicht einfach ins Haus bringen, allein schon wegen Sid und den Hunden, selbst wenn sie es zulassen würden.« Sie biss sich auf die Lippe, während sie nachdachte. »Bryony«, sagte sie. »Ruf Bryony an.«
Bryony Poole war ihre Tierärztin – und sie war es gewesen, die Gemma dazu überredet hatte, Geordie zu adoptieren. »Bryony wird schon wissen, was zu tun ist.«
»Kommst du bald nach Hause?«
Sie hörte das leichte Beben in Kits Stimme. Er gab sich solche Mühe, erwachsen zu sein, doch er konnte es nicht ertragen, irgendein Wesen hilflos oder verletzt zu sehen – oder schlimmer noch, verlassen oder ausgesetzt.
»Ja, Schatz«, sagte sie. »Ich komme, sobald ich kann.«
Nichts, was Paul Cole tat, war für seine Eltern jemals gut genug. Auch nicht für seine Lehrer damals in der Schule. Und jetzt auch nicht für alle anderen in der Gruppe. Nicht für Matthew, der sich für ein Geschenk Gottes an die gesamte Menschheit hielt.
Und vor allem nicht für Ariel.
Sie hatte nicht geglaubt, dass er das heute durchziehen würde, doch er würde ihr das Gegenteil beweisen.
Er rückte die Riemen seines Rucksacks zurecht und spürte, wie ihm der Schweiß unter den Armen ausbrach, obwohl es hier in der oberen Halle des St. Pancras International verdammt kalt war. Er stand in der Nähe der Rolltreppen am Nordende der Halle, sodass er die obere und die untere Ebene gut überblicken konnte. Jetzt trat er an die gläserne Brüstung und sah auf die anschwellenden Pendlerscharen hinunter. Es war Rushhour, die Leute schoben und drängelten, alle wollten noch rasch ihre Einkäufe erledigen und ihren Zug erwischen. Sie huschten umher wie die Ratten, ohne je aufzublicken, und niemand hatte ein Auge für das prächtige himmelblaue Tonnendach des Bahnhofs.
Und auch die Züge interessierten sie nicht. Hinter Searcys, der Yuppie-Champagnerbar, die sich quer über die Mitte der oberen Halle erstreckte, warteten zwei schnittige gelbe Eurostar-Züge am Bahnsteig auf die Abfahrt nach Paris. Die Männer und Frauen in ihren maßgeschneiderten Anzügen und Kostümen, die ihren Feierabend-Schampus schlürften, hatten keinen Schimmer, was für Wunderwerke diese Züge waren oder was alles nötig war, um sie am Laufen zu halten. Sie nahmen alles in ihrem Luxusleben als selbstverständlich hin. Nun, wenn sie heute Abend zu Bett gingen, würden sie vielleicht nicht mehr ganz so selbstgefällig sein.
Paul riss sich vom Anblick der Züge los und sah auf seine Uhr, ehe er wieder die untere Halle absuchte. Die anderen sollten bald hier sein. Direkt unter dem Searcys konnte er Musiker sehen, die sich auf ihren Auftritt vorbereiteten. Es war das erste Konzert des Frühjahrs-Musikfestivals im Bahnhof. Das war einer der Gründe, weshalb sie gerade diesen Tag gewählt hatten – mit den Zuschauerscharen, die sich um die Bühne drängten, wären mehr Menschen auf engem Raum versammelt, und die Presseberichterstattung über die Band wäre ein weiterer Pluspunkt.
Eine zierliche junge Frau mit roter Stachelfrisur ging in die Hocke und nahm eine Bassgitarre aus einem Kasten, während ein blonder Typ an einem Verstärker herumhantierte. Die ersten Passanten blieben stehen, um zuzuschauen. Jetzt wurde es ernst.
Dann sah er die Gruppe. Sie kamen von der U-Bahn-Station am anderen Ende der Halle. Matthew – durch seinen hohen Wuchs und seinen federnden Gang auf den ersten Blick zu erkennen, auch wenn er eine Strickmütze über seinen dunklen Lockenschopf gezogen hatte. Cam. Iris. Trish. Lee. Und Dean – er zog den flachen Rollkoffer mit ihren Plakaten, die nur noch zusammengesteckt werden mussten. Es würde ihnen nicht viel Zeit bleiben.
Er suchte nach Ariel, doch sie schien nicht mit dem Rest der Gruppe gekommen zu sein. Aber sie war auch irgendwo in der Nähe, da war er sich sicher. Genau wie Ryan.
Paul runzelte die Stirn. Irgendetwas an Ryan Marsh war ihm von Anfang an nicht ganz koscher vorgekommen. Und seit der Sache mit Wren war etwas in seinem Blick, das Paul Angst machte. Nicht, dass er Ryan die Schuld geben würde, um Gottes willen, nein. Allein bei dem Gedanken wurde ihm ganz schlecht. Aber dennoch – manchmal machte Ryan ihn einfach nervös. Er hatte mit Matthew darüber reden wollen, aber Matthew hatte ihn abblitzen lassen, genau wie an diesem Morgen. Dieser blöde Matthew – immer wusste er alles besser. Nur diesmal vielleicht nicht.
Die große Bahnhofsuhr über der Skulptur eines sich umarmenden Paars rückte auf siebzehn Uhr dreißig vor. Die Musiker spielten ein paar Soundcheck-Takte auf ihren Instrumenten. In der Mitte der unteren Ebene schien die Menge sich zu bewegen und anzuschwellen wie ein einziges Lebewesen. Die Gruppe hatte sich zerstreut und auf verschiedene Läden verteilt; sie wollten unbemerkt bleiben, bis die Band richtig zu spielen begonnen hatte und die Kameras der Presse auf sie gerichtet waren.
Dann, nachdem sie noch einmal ihre Instrumente gestimmt hatten, sagte das rothaarige Mädchen etwas ins Mikrofon, und der Gitarrist schlug den ersten Akkord an.
Jetzt wurde es wirklich ernst.
Das Herz schlug ihm bis zum Hals, als er den Rucksack über die Schulter schwang und ans obere Ende der Rolltreppe trat.
Melody nahm die U-Bahn von Brixton nach King’s Cross/St. Pancras. Mit dem Auto hätte sie es im Feierabendverkehr niemals rechtzeitig zu Andys und Poppys Konzert im Bahnhof am anderen Ende der Stadt geschafft. Dennoch wurde sie kurz von Panik gepackt, als bei der Einfahrt in die Station Oxford Circus die Meldung Person im Gleis über den Lautsprecher kam. Sie hasste es, in der U-Bahn festzustecken. Als eine zweite Durchsage den Reisenden auf der Central Line riet, eine andere Route zu nehmen, seufzte sie erleichtert auf.
Der Unfall hatte sich nicht auf ihrer Strecke ereignet. Es gab nichts, was sie hätte tun können, und sie war nur heilfroh, dass ein solcher Albtraum nicht während ihrer Schicht passiert war. Ein Mal hatte sie es im Dienst mit einem Schienensuizid zu tun gehabt, und es gab kaum etwas Schlimmeres.
Sie schüttelte sich bei der Erinnerung, obwohl sie sich zwischen den dicht gepackten Leibern im hinteren Wagen des Zuges kaum rühren konnte. Aber sie war entschlossen, sich nicht von der Arbeit die Vorfreude auf Andys großen Auftritt verderben zu lassen – dem ersten von vielen, da war sie sich sicher. Und sie konnte es kaum erwarten zu sehen, ob er auch wirklich die blaue Strickjacke anhatte.
Eine Frau mittleren Alters, die neben ihr eingezwängt war, sah ihre strahlende Miene und lächelte zurück. Melody nickte ihr zu und beschloss, den kleinen Kontakt als gutes Omen zu werten. Die meisten Londoner waren doch gar nicht so übel, wenn man ihnen nur ein bisschen entgegenkam. Und ein Hoch auf die Leute von London Transport – die taten wirklich ihr Bestes, um den Betrieb am Laufen zu halten.
Doch als der Zug länger als sonst an der Warren Street hielt und dann wieder in Euston, wuchs Melodys Beunruhigung. Andy wäre am Boden zerstört, wenn sie es nicht rechtzeitig schaffte. Sie hatte fast schon beschlossen, in Euston auszusteigen und den Rest zu Fuß zu gehen, als die Türen sich schlossen und der Zug wieder anfuhr.
Als die U-Bahn in King’s Cross einlief, war Melody als Erste draußen. Sie rannte auf die Ticketschleuse zu und trabte von dort weiter in Richtung der Halle von St. Pancras. Nur gut, dass sie heute wegen der Kälte Stiefel angezogen hatte, dachte sie, und nicht die hochhackigen Schuhe mit einem jener Kostüme, derentwegen Andy sie so gerne aufzog. Als sie das südliche Ende des Bahnhofs erreichte, war ihr ganz warm, ihre Wangen waren gerötet, und sie musste einen Moment innehalten, um durchzuatmen.
Die Musik drang schwach an ihre Ohren, in unregelmäßigen Schüben, doch sie erkannte sie augenblicklich wieder. Bevor sie Andy kennengelernt hatte, wäre es ihr schwergefallen, eine Gitarre von einem Banjo zu unterscheiden, aber jetzt hätte sie den charakteristischen Klang von Andys Gitarre überall erkannt. Und da, in der nächsten Klangwelle, die sie auffing, war Poppys einmalige, volltönende Leadstimme, unterlegt von Andys Harmoniegesang.
Wenn sie weiter hinten bliebe, würde Andy vielleicht nicht merken, wie sehr sie sich verspätet hatte.
Als sie die Halle selbst betrat, erblickte sie schon jenseits des verglasten Aufzugs die Menschenmenge, die sich um die kleine temporäre Bühne versammelt hatte. Und als sie näher heranging, konnte sie das Duo deutlich erkennen – Poppy in einem fließenden weißen Top über einem kurzen geblümten Rock, wie immer mit Strumpfhose und Stiefeln, und Andy, ein Blickfang in der himmelblauen Strickjacke. Lichtreflexe spielten in seinem zerwühlten Blondhaar und auf seiner leuchtend roten Gitarre.
Andy hatte sie nicht gesehen. Er und Poppy hatten einen neuen Song angestimmt, beide spielten und sangen dazu, voller Konzentration. Melody spürte die gleiche kribbelnde Erregung, die sie empfunden hatte, als sie die beiden das erste Mal hatte spielen hören. Andy und Poppy hatten etwas Elektrisierendes, wenn sie zusammen musizierten, sie verschmolzen zu einem Ganzen, das mehr war als die Summe seiner Teile, und Melody spürte, wie die Energie des Duos die Zuschauer ansteckte.
Unter den Café-Arkaden zu ihrer Linken erblickte sie Tam und Caleb, die Manager der beiden. Sie standen da, mit ihren Kaffeetassen in der Hand, beobachteten gebannt das Geschehen auf der Bühne und grinsten zufrieden.
Dann zog etwas anderes ihren Blick auf sich: Zu ihrer Rechten, in der Nähe des Marks & Spencer Foodstores, reckten ein halbes Dutzend Demonstranten gleichzeitig ihre Plakate in die Luft. Da sie von ihr abgewandt standen, konnte sie nicht lesen, was auf den Schildern stand, doch die Gruppe wirkte eigentlich recht harmlos. Dennoch wollte sie nicht, dass irgendetwas Andys und Poppys besonderen Moment störte. Als sie sich umschaute, sah sie eine uniformierte Beamtin der British Transport Police mit dem Funkgerät in der Hand auf die Demonstranten zugehen.
Gut. Das hätte ihr gerade noch gefehlt, dass sie hier in offizieller Funktion eingreifen müsste. Sie wandte sich wieder der Bühne zu, wo Andys und Poppys Stimmen sich in der letzten Strophe des Songs in einem Crescendo aufschwangen.
Sie hob die Hände, um zu applaudieren, als sie ein dumpfes Zischen hörte, dann ein hohes, schrilles Heulen. Menschen schrien in Panik, als Melody herumfuhr.
Instinktiv zuckte sie zurück und hielt den Atem an. Dort, in dem offenen Bereich im Übergang von der Einkaufspassage zum westlichen Taxistand, brannte ein Feuerball, hell wie ein aufflammendes Streichholz. Und in seiner Mitte war eine menschliche Gestalt.
2
St. Pancras Old Church ist eine Pfarrkirche der Church of England in Somers Town, einem Bezirk der Londoner Innenstadt. Sie ist dem römischen Märtyrer St. Pankratius geweiht und nach verbreiteter Meinung eine der ältesten christlichen Kultstätten in England.
Wikipedia (engl.),St. Pancras Old Church
Geblendet von dem grellen Lichtblitz, riss Melody instinktiv den Arm hoch, um ihre Augen zu schützen, doch während sie noch blinzelte und etwas zu erkennen versuchte, setzten ihre eingeübten Reflexe ein. Sie zog das Mobiltelefon aus der Jackentasche und drückte die einprogrammierte Durchwahl der Notruf-Leitstelle. Die Leitungen der allgemeinen Notrufnummer 999 würden im Nu völlig überlastet sein, und sie konnte nicht riskieren, in der Warteschleife zu landen. Als die Disponentin sich meldete, musste Melody die Stimme heben, um sich bei dem anschwellenden Lärm in der Bahnhofshalle verständlich zu machen. »Detective Sergeant Melody Talbot. Notfall in St. Pancras International, Haupthalle. Ein Mann steht in Flammen – möglicher Bombenanschlag.« Die Musik brach abrupt ab, und plötzlich hörte sie sich selbst schreien: »Alle Rettungsdienste, so schnell wie…«
Und dann brach vor ihren Augen die Gestalt in der Mitte des Feuerballs zusammen. Ein Schwall heißer, chemisch riechender Luft verätzte ihre Nase. Sie begriff, dass die Leute nicht nur aus Panik schrien – es standen noch mehr Menschen in Flammen, verzweifelt schlugen sie auf ihre Kleidung ein. »Korrigiere: Mehrere Opfer«, meldete sie der Leitstelle. »Alle Dienste. Beeilung!«
»Bleiben Sie dran, Sergeant«, sagte die Disponentin. »Sie müssen uns auf dem Laufenden …«
»Ich muss helfen. Ich stelle auf Lautsprecher.« Ehe die Disponentin protestieren konnte, schob sie das Telefon wieder in die Tasche, fischte ihren Dienstausweis heraus und hielt ihn hoch. Sie blickte sich um, konnte aber die Beamtin der British Transport Police, die sie vorhin gesehen hatte, nirgends entdecken. Sie war auf sich gestellt.
Die Schreie wurden lauter. Rauchschwaden breiteten sich in der Halle aus. Andy und Poppy waren noch auf der temporären Bühne, und Andys Stimme hallte aus den Lautsprechern. »Was ist denn hier …«
»Andy«, schrie sie und sah, wie er die Menschenmenge nach ihr absuchte. Sie schwenkte die Arme und formte dann die Hände zu einem Megafon, um das Tohuwabohu zu übertönen. »Andy! Nimm das Mikro und sag den Leuten, sie sollen die Halle räumen. Und dann haut ab!«
Sie sah die Erleichterung in seiner Miene, als er sie entdeckte. Dann zögerte er. »Aber du …«
Melody schüttelte den Kopf. »Mach schon! Schick alle raus.«
Sie wandte sich ab, und gleich darauf hörte sie Andy ins Mikrofon rufen: »Alles raus hier! Räumen Sie die Halle! Gehen Sie zum nächsten Ausgang. Los, schnell!«
Melody hielt weiter auf die brennende Gestalt zu, ihren Dienstausweis erhoben wie einen wirkungslosen Schutzschild. Der Rauch verwandelte sich in einen weißen Nebel. Menschen, die sie nur undeutlich erkennen konnte, rempelten sie an und brachten sie ins Wanken. Stimmen, die sie nicht zuordnen konnte, schrien und fluchten. Dann rutschte sie auf etwas aus, und als sie nach unten sah, erblickte sie einen umgekippten Kaffeebecher, aus dem sich die braune Flüssigkeit über einen zertrampelten Supermarkt-Strauß aus rosa Nelken ergoss.
Aus den Lautsprechern war jetzt auch Poppys Stimme zu vernehmen, die Andys Anweisungen wiederholte. Sie klangen beide unglaublich weit weg. Dann hörte sie, wie Andy einen Zuschauer, den sie nicht sehen konnte, anschnauzte: »Nein, das ist kein dummer Witz, du Idiot!«
Der Rauch wurde dichter. Ihre Nase lief, ihre Augen tränten, und sie musste husten. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Leute nach Flammennestern an ihren Kleidern und in ihren Haaren schlugen. »Wälzen Sie sich am Boden«, rief sie. »Ersticken Sie die Flammen mit Ihren Jacken oder was auch immer.« Hustend stolperte sie über einen vergessenen Koffer, stieß sich das Schienbein an, fiel und rappelte sich wieder auf. Ihre Kehle brannte.
Und dann drang der Gestank zu ihr durch, trotz der chemischen Rauchwolke, die sie einhüllte: verbrannte Haare. Fett. Fleisch. Menschenfleisch.
Plötzlich war da ein Mann neben ihr und schrie mit heiserer Stimme: »Zurück! Alles zurück! Nicht den Rauch einatmen!« Er schubste sie, ein harter Stoß aus dem Nebel heraus. »Verdammt, zurück hab ich gesagt!«
Sie krallte nach ihm und erwischte seine Jacke. »Ich bin Polizistin! Um Himmels willen, helfen Sie mir, Mann!«
Durch eine Lücke in den Schwaden erhaschte sie einen Blick auf sein rußverschmiertes Gesicht, das jetzt nur wenige Zentimeter von ihrem entfernt war. Hellbraunes Haar, blutunterlaufene blaue Augen. »Halten Sie sich was vors Gesicht«, sagte er, nachdem er ihre Erklärung mit einem Nicken quittiert hatte. Sie sah, dass er ein blaues Taschentuch in der Hand hatte. »Das Feuer – das ist eine Phosphorgranate!«
Er hielt sich das Taschentuch wie eine Maske vors Gesicht, während er mit der anderen Hand ihren Ellbogen umfasste. Gemeinsam rückten sie vor, bahnten sich ihren Weg durch die Menschentraube, die in die andere Richtung strebte. Sie folgte seinem Beispiel und zog sich mit ihrer freien Hand ihre Jacke vor Mund und Nase.
Und dann war der Rauch plötzlich über ihnen, er stieg zu dem hohen hellblauen Dach der Halle empor, und Melody konnte erstmals in aller Deutlichkeit sehen, auf was sie da zugingen.
Der verkohlte Körper lag mit angewinkelten Armen und Beinen auf der Seite wie eine groteske Imitation eines Boxers. Immer noch stiegen Rauchfähnchen von der geschwärzten Haut und der zerfetzten Kleidung auf. Und immer wieder loderten an verschiedenen Stellen des Körpers kleine Flammen auf und erloschen wie Glühwürmchen an einem Sommerabend.
»O Gott.« Der Mann neben ihr packte ihren Arm fester, bis es sich anfühlte wie ein Schraubstock.
Melody riss sich vom Anblick der Leiche los. Sie fing den Blick ihres Begleiters auf und sah nicht nur Entsetzen, sondern Schmerz und Verzweiflung.
»Was zum … Wie hat …« Seine Stimme war ein Krächzen. Er schüttelte den Kopf und setzte erneut an. »Scheiße. Es gibt nichts … Wir können nichts mehr für ihn tun. Jetzt kann niemand mehr irgendetwas für ihn tun.«
Duncan Kincaid stand an der Tür seines Büros im Polizeirevier Holborn und ließ den Blick über die Schreibtische der Einsatzzentrale schweifen, während er diskret ein Gähnen unterdrückte.
Es gab ihm einen regelrechten Stich ins Herz, wenn er an Scotland Yard dachte. Ja, es hatte beim Morddezernat bisweilen öde Tage gegeben, aber dennoch hatte in dem Gebäude stets eine prickelnde Atmosphäre von Zielstrebigkeit und Entschlossenheit geherrscht. Und er vermisste sein eigenes abgeschlossenes Büro, in dem er sich so wohlgefühlt hatte, dass es ihm im Lauf der Jahre fast zu einem zweiten Zuhause geworden war.
Er hatte sich noch nicht einmal die Mühe gemacht, seine Bücher hierherzuschaffen. Er kam sich vor wie auf Abruf. Vertrieben von seinem angestammten Platz. Doch die Folge dieser Haltung war eine sterile Umgebung, die ihn nicht dazu inspirierte, auch nur eine Minute länger als nötig in der Arbeit zu verbringen.
Und so vertrieb er sich die Zeit damit, seine neue Mitarbeiterin Detective Inspector Jasmine Sidana etwas genauer zu betrachten. Aus ihrer Personalakte wusste er, dass sie fünfunddreißig Jahre alt und unverheiratet war. Dort stand auch, dass sie am University College London studiert und sich anschließend im Polizeidienst rasch nach oben gearbeitet hatte, von der Streife zum CID, bis sie ihre gegenwärtige Position erlangt hatte.
Im Dienst trug sie Tag für Tag die gleiche gestärkte weiße Bluse mit langen Ärmeln und den gleichen dunklen knielangen Rock. Anscheinend trank sie keinen Alkohol, und beim geselligen Beisammensein im Kollegenkreis nach Feierabend glänzte sie stets durch Abwesenheit. Sie war adrett, tüchtig und geradezu übertrieben gut organisiert. Es war auch kein Geheimnis, wie sehr sie auf seinen Job spekuliert hatte und auf die Beförderung, die damit einhergegangen wäre. Sidana machte aus ihrer Verbitterung keinen Hehl, ebenso wenig wie aus der Tatsache, dass sie sich aufgrund ihres Geschlechts und ihrer ethnischen Herkunft diskriminiert fühlte.
»Sir?« Sidanas Ton war noch frostiger als gewöhnlich, als sie von ihrem Schreibtisch aufblickte, und er hätte sich in den Hintern treten können, weil er sich dabei hatte erwischen lassen, wie er sie anstarrte.
»Nichts, Detective.« Kincaid rang immer noch mit der Frage, wie er sie anreden sollte. Bei den meisten der ihm unterstellten Beamten hatte er kein Problem damit, sie zumindest nur beim Nachnamen zu nennen, wenn nicht gar beim Vornamen. Aber bei Sidana fühlte er sich selbst mit dem Nachnamen unwohl, und doch konnte er sie schwerlich immer »Detective Inspector« nennen, außer in hochoffiziellen Situationen.
Er seufzte, und für den Bruchteil einer Sekunde glaubte er einen Anflug von Besorgnis in ihrer Miene zu sehen. Wenn dem so war, dann wurde er sehr schnell durch ein Stirnrunzeln abgelöst, bei dem sich ihre dunklen Augenbrauen zu einer strengen Linie zusammenzogen. Eins zu null für Sidana, dachte er.
Er zog sein Telefon aus der Tasche, um Gemma anzurufen, als er das unverwechselbare SMS-Signal von Sweeneys Handy hörte – das Zischen einer Bierflasche beim Öffnen. Und dann Sidanas Postboten-Glocke – und während beide nach ihren Handys griffen, fielen die anderen Mobiltelefone im Raum mit vielstimmigem Trillern, Läuten und Dudeln ein.
Und dann begann das Telefon in seiner Hand zu vibrieren.
Bei ihm war es keine SMS, sondern ein Anruf, und zwar, wie die Anzeige ihm verriet, von Chief Superintendent Thomas Faith, dem Bezirkskommandanten. »Mist«, murmelte Kincaid halblaut und straffte sich automatisch, mit einem Schlag hellwach.
»Sir«, meldete er sich.
Faith klang angespannt. »Möglicher Bombenanschlag, St. Pancras International. Das SO15 ist dran und die Feuerwehr, aber ich will auch das CID in voller Stärke vor Ort. Sie werden mit DCI Callery vom SO15 Verbindung aufnehmen.«
Specialist Operations 15. Kommando Terrorismusbekämpfung. Verflucht.
Kincaid sah, dass seine Leute schon aufgesprungen waren und nach Jacken und Taschen griffen. »Irgendwelche weiteren Informationen, Sir?«
»Nein. Fahren Sie einfach hin und machen Sie Meldung, sobald Sie Genaueres wissen.« Faith legte auf.
In diesem Moment erst fiel Kincaid ein, dass sein Freund Andy Monahan heute in der Bahnhofshalle von St. Pancras einen Auftritt hatte.
Melody wich unwillkürlich einen Schritt zurück, hustete und wischte sich die tränenden Augen. Zum ersten Mal registrierte sie das Heulen von Sirenen, das die Schreie und das Stimmengewirr übertönte.
»Gott sei Dank. Es ist Hilfe unterwegs.« Sie wandte sich um, wollte ihren Begleiter beruhigen und sich zugleich bei ihm rückversichern.
Doch er war verschwunden. Sie konnte noch den Druck seiner Finger oberhalb ihres Ellbogens spüren, wo er ihren Arm umklammert hatte. »Was zum …« Sie schüttelte den Kopf. Später. Sie würde später darüber nachdenken. Und er hatte recht gehabt – niemand konnte mehr irgendetwas für den Unglücklichen tun, der vor ihr auf dem polierten Hallenboden lag.
Einen Augenblick lang stand Melody nur da und starrte den verkohlten Leichnam an.
Plötzlich fühlte sie sich in der Zeit zurückversetzt – sie war wieder die unerfahrene Streifenpolizistin am Schauplatz ihres ersten schweren Verkehrsunfalls. Die Insassen schrien, als das Auto in Flammen aufging, und in dem heißen Luftzug roch sie versengte Haare und verbranntes Fleisch. Der Geruch schien sich wie ein zäher Schmierfilm in ihren Nasenlöchern und auf ihrer Zunge festzusetzen. Ihr wurde übel, und sie hob eine Hand vor den Mund.
Die instinktive Geste brachte sie mit einem Ruck in die Gegenwart zurück. Die Schreie waren echt. Sie hörte ein Kind weinen, eine Frau schluchzen. Und dieses quäkende Geräusch war das Telefon in ihrer Jackentasche – sie hatte es auf Lautsprecher gelassen, und die Disponentin rief nach ihr.
Hastig nahm sie das Telefon ans Ohr und hörte noch: »… Lagebericht! Sergeant Talbot, können Sie …«
»Ich bin hier.« Melody gab sich Mühe, das Chaos um sie herum zu erfassen. »Ein Toter. Irgendeine Art Sprengkörper. Mehrere Verletzte. Ich brauche …«
»Noch weitere Vorfälle?«
Melody ließ den Blick über die Menge schweifen. »Nicht, dass ich …«
In diesem Moment sah sie Tam. Er wälzte sich neben einem der umgestürzten Cafétische am Boden, und er brannte. Caleb Hart versuchte die Flammen mit seiner Jacke zu ersticken.
»Augenblick«, sagte Melody zu der Disponentin.
Während sie auf die beiden zulief, kam eine junge Frau aus dem verglasten Innenraum des Cafés gelaufen. Ihre schwarze Uniform verriet, dass sie zum Personal gehörte, und sie hatte einen Feuerlöscher in den Händen.
»Hier!«, rief Melody, als sie bei ihren Freunden ankam. Sie registrierte das kreideweiße Gesicht und die zusammengekniffenen Lippen der Kellnerin, sah aber mit Staunen, dass die junge Frau den Feuerlöscher wie ein Profi bediente. Der chemische Schaum bedeckte in Sekundenschnelle Tams Körpermitte, und endlich verloschen auch die letzten Flammen.
»Gut reagiert«, lobte Melody sie, während sie sich zu Tam kniete. Dann blickte sie auf und fügte hinzu: »Können Sie noch jemanden sehen, der Hilfe braucht?« Das Mädchen nickte und lief auf ein anderes Opfer zu.
Melody wandte ihre Aufmerksamkeit Tam zu und berührte vorsichtig seine Schulter. Sie konnte das Ausmaß seiner Verletzungen nicht einschätzen, doch er war blass und schwitzte, seine Augen waren glasig vor Schock. Sein Markenzeichen, die zerschlissene Schottenmütze, lag neben ihm am Boden.
»Es ist einfach so aus dem Nichts auf ihn gespritzt«, sagte Caleb erregt. Er wirkte geschockt, schien aber unverletzt. »Ich habe Kaffee über ihn geschüttet. Kalten Kaffee. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen.«
»Das hast du genau richtig gemacht, Caleb. Jetzt halt ihn warm, und ich gehe Hilfe holen.«
Sie zog ihre rote Jacke aus und deckte Tam vorsichtig damit zu. Der Verletzte blickte auf, und sie sah an dem Flackern in seinen Augen, dass er sie erkannte.
»Melody, mein Mädel.« Seine Stimme war nur ein Krächzen. »Es tut höllisch weh.«
»Schsch.« Sie strich ihm über die Wange. »Nicht reden. Ich hole Hil…«
Sie schrak zusammen, als eine Hand sich auf ihre Schulter legte.
»Melody!« Es war Andy, und Poppy stand gleich hinter ihm. »Gott sei Dank, dir ist nichts passiert. Ich hatte schon Angst …« Er erstarrte, als er Tam erblickte. »Tam. O Mann, Scheiße. Er ist verletzt. Wird er …«
»Er wird schon wieder«, sagte Melody mit einer Überzeugung, die sie so nicht empfand. Sie wandte sich an Poppy. »Ihr beide bleibt bei Tam und Caleb.« Sie wusste, dass sie sie eigentlich zum Verlassen der Halle auffordern sollte. Aber sie wusste auch, dass sie auf taube Ohren stoßen würde, und sie hatte keine Zeit, sich mit ihnen herumzustreiten. »Ich muss mich um diese Sache kümmern.« Unwillkürlich schielte sie zu der Leiche, und Andy und Poppy folgten ihrem Blick.
»Mein Gott«, flüsterte Andy.
Poppy wurde kreideweiß und begann zu schwanken.
Melody packte beide mit festem Griff. »Andy, du musst dich mit Caleb um Tam kümmern. Poppy, hör mir zu.« Endlich sah Poppy ihr wieder in die Augen, und sie schluckte hörbar. »Poppy.« Melody schüttelte sie ein wenig. »Du hilfst, die Verletzten zu versorgen. Alle, die noch gehen können, sollen sich hier versammeln.« Sie deutete auf einen freien Bereich neben einer der Säulen. »Ich brauche deine Mithilfe. Okay?«
Poppy nickte und schickte sich an, der jungen Frau aus dem Café zu helfen, die ihren Feuerlöscher abgestellt hatte und die Opfer zu beruhigen versuchte.
Andy sah Melody intensiv an. »Du bist der Boss.« Er tätschelte ihre Schulter, dann kniete er sich zu Caleb und Tam und hüllte seinen verletzten Freund behutsam in Melodys Jacke.
Die Halle hatte sich weitgehend geleert, nachdem die Menschen in Panik zu den Ausgängen geströmt waren. Von denen, die geblieben waren, halfen die meisten den Verletzten, manche schienen auch zu geschockt, als dass sie sich hätten nützlich machen können. Hier und da flackerten noch ein paar Flammen auf.
Melody wusste, dass sie den Tatort sichern und alle unverletzten Zeugen aus dem Bahnhof schaffen musste, um sie in irgendeinem abgeschlossenen Bereich zu versammeln. Wo zum Teufel blieb die Unterstützung?
Ihr Blick fiel auf die große Bahnhofsuhr am Südende der oberen Ebene – waren wirklich erst zehn Minuten vergangen, seit das hier angefangen hatte?
Sie merkte, dass sie immer noch das Telefon in der Hand hielt. Als sie gerade noch einmal in der Leitstelle nachhaken wollte, wo die Rettungsdienste blieben, sah sie zwei Männer in den gelben Warnwesten der British Transport Police vom Südende der Halle auf sich zulaufen.
Sie hielt ihren Dienstausweis hoch und rief: »CID!«
Der jüngere Mann kam als Erster bei ihr an. »Sind Sie die Detective Sergeant?« Er war blond und rotwangig, ein wenig außer Atem.
»Melody Talbot. Sagen Sie, wo bleiben eigentlich …«
»Mein Gott«, echote der Bahnpolizist Andys Worte, als sein Blick an Melody vorbei auf die Leiche fiel. »Die Leitstelle sagte etwas von einem Todesopfer, aber …«
Melody fiel ihm ins Wort. »Liefern Sie mir einen Bericht. Wo bleibt die verdammte Feuerwehr? Und die uniformierte Verstärkung?«
»Die Feuerwehr ist unterwegs«, sagte der ältere Beamte, der inzwischen zu seinem Kollegen aufgeschlossen hatte. »Der Verkehr ist durch die Evakuierung der Halle komplett zum Erliegen gekommen. Wir haben das Gebäude abgesperrt, und die bewaffnete Einheit der Transport Police macht sich einsatzbereit, während wir auf das SO15 warten.«
SO15. Terrorismusbekämpfung. Schlagartig wurde Melody die Dimension des Geschehens bewusst. Sie hatte bisher nur reagiert, ohne nachzudenken. Jetzt musste sie erst einmal durchatmen. »Gibt es noch weitere Vorfälle?«
»Es wurde nichts gemeldet. Wir sind noch dabei, den Bahnhof zu räumen. Aber wir mussten den kompletten Betrieb einstellen, sowohl hier als auch in King’s Cross, einschließlich der U-Bahn. Das wird ein gewaltiges Chaos geben.« Sein Blick fiel wieder auf den Toten. »Hat der Kerl sich in die Luft gejagt?«
»Es war keine Bombe, sondern eine Art Brandsatz. Irgendjemand« – sie dachte wieder an den verschwundenen Unbekannten – »sagte etwas von Phosphor. Wir haben Opfer mit Brandverletzungen, die möglichst schnell versorgt werden müssen. Ich werde den Tatort sichern, bis der leitende Ermittler hier ist.« Ihr war bewusst, dass die Sache ein wenig heikel war, denn eigentlich war hier im Bahnhof die British Transport Police zuständig. Aber sie war die einzige CID-Beamtin vor Ort, und sie würde den Tatort keinem anderen als dem zuständigen Ermittler übergeben.
Sie hoffte nur, dass wer immer den Fall zugewiesen bekam sein Handwerk verstand.
3
Die St. Pancras Old Church befindet sich in der Pancras Road im Londoner Bezirk Camden … Die im viktorianischen Zeitalter weitgehend neu erbaute Kirche darf nicht mit der St. Pancras New Church verwechselt werden, die rund einen Kilometer entfernt in der Euston Road steht.
Wikipedia (engl.), St. Pancras Old Church
Obwohl jetzt im März die Tage wieder länger wurden, hatten der Nieselregen und die tief hängenden grauen Wolken die Dämmerung früher hereinbrechen lassen. Das flackernde Blaulicht der langen Reihe von Einsatzfahrzeugen, die sich um St. Pancras International versammelt hatten, warf Muster auf die dunkelroten Ziegelmauern des großen viktorianischen Bahnhofs, die unter anderen Umständen vielleicht wie eine festliche Illumination gewirkt hätten.
In Duncans Augen signalisierten sie eine Katastrophe.
Es hatte fast eine halbe Stunde gedauert, einen Wagen zu organisieren und die kurze Strecke vom Revier Holborn hierher zurückzulegen. Es war Rushhour, und der Strom der Menschen aus der evakuierten Bahnhofshalle, kombiniert mit dem Eintreffen der Rettungsfahrzeuge, hatte den Verkehr völlig zum Erliegen gebracht. Das Adrenalin, das durch Kincaids Adern strömte, ließ ihn die Lichtflecken grell und scharfkantig sehen, und er trommelte nervös mit den Fingern auf die Armlehne des Wagens.
Platzend vor Ungeduld sprang Kincaid aus dem Wagen, als sie die Euston Road erreichten. Er wies Jasmine Sidana an, ihm zu folgen, und ließ DC Sweeney am Steuer zurück.
»Parken Sie irgendwo«, beschied er Sweeney knapp. »Auf dem Gehsteig, wenn’s sein muss.«
Sidana hielt sich dicht an seiner Seite, als sie die Euston Road überquerten und sich ihren Weg durch die Menge auf dem Gehsteig bahnten. Kincaid hatte Order, sich mit seinem Kollegen vom SO15 am Osteingang zu treffen. Als sie an der U-Bahn-Station King’s Cross/St. Pancras vorbeikamen, sah er, dass uniformierte Beamte den Eingang versperrten.
Sie bogen in die Pancras Road ein und passierten die Costa-Coffee-Filiale sowie einen weiteren bewachten U-Bahn-Eingang. Der Nordwind blies ihnen voll ins Gesicht, und wieder spürte Kincaid die kleinen Nadelstiche des Eisregens auf der Haut. Die Ostfassade des Bahnhofs erstreckte sich vor ihnen. Kincaid beschleunigte seine Schritte und wich den entgegenkommenden Passanten aus. Sidana begann zu traben, um mit seinen langen Schritten mitzuhalten. Sie kamen an der Taxi-Haltezone für den Eurostar vorbei, die ebenfalls bewacht war.
Weiter vorne erspähte Kincaid zwei Feuerwehrfahrzeuge, weitere blau-gelb lackierte Streifenwagen der Metropolitan Police sowie drei Rettungswagen. Als sie näher kamen, sah er Menschen auf dem Gehsteig kauern. Manche saßen auf ihren Koffern, bewacht von weiteren uniformierten Beamten. Sie hatten den Haupteingang des Bahnhofs erreicht.
Die Presse war ihnen zuvorgekommen. Schon drängten Reporter gegen die Polizeiabsperrung, Fotoapparate und Videokameras im Anschlag, Mikrofone am Mund. Sie würden Mühe haben, bei diesem Wind einen brauchbaren Ton zu bekommen, dachte Kincaid, doch zugleich fragte er sich, ob sie etwas wussten, was er noch nicht wusste.
Er und Sidana zeigten einem der Uniformierten ihre Dienstausweise und wurden sofort durchgelassen.
»SO15?«, fragte Kincaid.
»Gleich da drüben, Sir«, antwortete der Constable und wies auf die Glastüren unter dem Bogen des Haupteingangs.
Das Erste, was Kincaid auffiel, als sie das eigentliche Bahnhofsgebäude betraten, war die Wärme. Und das Zweite war die Leere. In diesem zentralen Bereich des Bahnhofs, der quer zu den langen, nord-südlich ausgerichteten Hallen verlief, wimmelte es normalerweise von Menschen, die zu ihren Zügen hasteten oder sich an einem der diversen Stände und Märkte einen Imbiss kauften.
Jetzt war außer den Beamten der British Transport Police – zum Teil bewaffnet und in voller Einsatzmontur –, den Feuerwehrleuten und einigen wenigen Beamten in Zivil weit und breit niemand zu sehen.
Kincaid wusste auch ohne Vorstellung, wer von den Letzteren Nick Callery sein musste, der DCI vom Kommando SO15. Silberblondes Haar, militärisch kurz geschnitten. Silbergrauer, teurer Anzug, keine Krawatte, kein Mantel. Er war schlank und bewegte sich leichtfüßig wie ein Boxer. Als er Kincaid erblickte, unterbrach er sein Gespräch mit einem anderen Beamten und kam mit ausgestreckter Hand auf ihn zu.
»Callery, Terrorismusbekämpfung.«
Kincaid stellte sich und Sidana vor und fragte dann: »Wie ist die Lage?«
»Soweit wir wissen, hat so ein Spinner sich selbst abgefackelt. Weißer Phosphor, laut den Kollegen von der Feuerwehr. Bislang haben wir im Bahnhof weiter nichts Verdächtiges gefunden, aber wir sind noch nicht ganz durch.« Callery hatte einen leichten nordenglischen Akzent.
»Weitere Verletzte?«, fragte Kincaid.
»Ja, etliche. Die Sanitäter machen gerade die Triage.«
»Ist der Tote schon identifiziert?«
»Ha.« Callery schüttelte den Kopf. »Schön wär’s. Aber sehen Sie selbst. Ich bringe Sie hin – er liegt da hinten beim Marks & Spencer.«
Kincaids Herz krampfte sich zusammen. Genau dort wurde immer die temporäre Bühne für Konzerte im Bahnhof aufgebaut. »Hat da eine Band gespielt? Ein Duo?« Jasmine Sidana sah ihn verwirrt an.
Callery runzelte die Stirn und antwortete: »Ich habe gesehen, dass da Equipment rumsteht, anscheinend alles unversehrt. Von den Musikern weiß ich nichts. Sie sind wahrscheinlich evakuiert worden.«
Kincaid hatte weder Andy noch Poppy unter den Menschen gesehen, die sich vor dem Osteingang versammelt hatten, aber sicherlich hatten die Flüchtenden auch die anderen Ausgänge benutzt.
»Zum Glück war eine Kollegin vom CID in der Nähe und hat den Tatort bis zu unserem Eintreffen gesichert«, fügte Callery hinzu. »Die Feuerwehr wird uns Schutzausrüstungen zur Verfügung stellen.«
»Na gut.« Kincaid nickte. »Dann wollen wir uns die Sache mal anschauen.«
Die Haupthalle sah ebenso unheimlich leer aus wie die Einkaufspassage und die Schalterhalle. Die Läden waren hinter ihren Glasfronten erleuchtet, aber verlassen. Hier und da lag eine Jacke oder ein Schal herum, Abfälle von den Imbissbuden sprenkelten den Boden wie Konfetti, dazwischen verstreut der Inhalt einer Einkaufstüte. Vor der Teestube von Peyton and Byrne lag ein umgekippter Stuhl.
»Kein vergessenes Gepäck?«, fragte Kincaid Callery.
»Da waren ein paar Stücke, aber wir haben sie von den Hunden überprüfen lassen und sie dann im Büro der Bahnhofsvorsteherin eingeschlossen. Komisch, wie gut die Leute in so einer Katastrophe auf ihre Habseligkeiten achtgeben.«
»Sie waren bemerkenswert schnell.«
»Das haben wir hauptsächlich den Kollegen von British Transport zu verdanken. Die Hunde standen sowieso schon für das Eurostar-Gepäck bereit.« Callery deutete zur oberen Ebene, wo Kincaid gerade eben ein Stückchen eines glänzend gelb lackierten Eurostar-Zugs auf dem Abfahrtsgleis erkennen konnte. »Die Bahnhofsvorsteherin rauft sich schon die Haare«, fuhr Callery fort. »Nicht nur, weil jetzt gerade die Hauptzeit für internationale Ankünfte und Abfahrten ist. Jede Verzögerung auf den Inlandsstrecken kann Verspätungen bis aufs Festland zur Folge haben, aber wir können den Bahnhof erst wieder freigeben, nachdem wir den Tatort klargemacht und sichergestellt haben, dass sich nicht noch mehr kranke Spinner irgendwo versteckt halten. Die Kacke ist also ganz schön am Dampfen.«
Als Kincaid sich kurz zu Sidana umblickte, die neben ihm ging, sah er, wie sie missbilligend die Lippen zusammenpresste. Er wunderte sich, dass eine Frau, die Anstoß an vulgären Ausdrücken nahm, es so lange im Polizeidienst ausgehalten hatte. Callery schien ihr Unbehagen nicht bemerkt zu haben.
Ein uniformierter Hundeführer der British Transport Police kam auf sie zu, in der Hand eine Leine, an deren Ende ein English Springer Spaniel zerrte. Der Hund arbeitete systematisch, er schnüffelte an allen Türen und vergessenen oder fallen gelassenen Gegenständen.
»Zweiter Durchgang«, meldete der Hundeführer Callery und blieb kurz bei ihnen stehen. »Alles sauber bisher.«
»Kann der Hund Phosphor aufspüren?«, fragte Kincaid.
»Sie ist nicht eigens dafür ausgebildet«, antwortete der Mann. »Aber sie ist auf Sprengstoffe auf Düngemittelbasis abgerichtet, also denke ich schon, dass sie etwas bemerken würde. Und wir wollen sichergehen, dass es nicht noch mehr unschöne Überraschungen gibt.« Die Hündin winselte schon ungeduldig, und so setzten die beiden ihren Weg fort.
Weiter vorne erblickte Kincaid Gestalten in Schutzanzügen, die um eine Sichtschutzwand herum auf und ab gingen. Gleich darauf stieg ihm ein merkwürdiger Geruch in die Nase. Wie nach abgebrannten Streichhölzern und … Knoblauch?
Ein Feuerwehrmann kam auf sie zu, schlug seine Kapuze zurück und nahm die Atemschutzmaske ab. »Detective.« Er nickte Callery zu und sah Kincaid fragend an.
»Detective Superintendent Kincaid, CID Camden.« Kincaid zögerte immer noch, wenn er sich vorstellte. Es war ein komisches Gefühl, Camden sagen zu müssen anstatt Scotland Yard. »Und das ist DI Sidana«, fügte er hinzu.
»John Stacey, Gruppenführer«, stellte der Feuerwehrmann sich vor, ein stämmiger Mann mit kurzen schütteren Haaren. »Die gute Nachricht ist, dass wir hier wohl nicht mehr allzu viel Gefahrstoffe in der Luft haben, dank dem Durchzug, der in der Halle herrscht. Der Rauch hat sich größtenteils schon verzogen.«
Kincaid registrierte, dass es inzwischen selbst in der unteren, beheizten Ebene der Bahnhofshalle bitterkalt war.
»Ich empfehle trotzdem, dass die Kollegen von der Spurensicherung und der Rechtsmedizin Schutzkleidung anlegen – sie werden sich schließlich länger in der Nähe des Opfers aufhalten. Und Ihnen dreien würde ich auch dazu raten, falls Sie vorhaben, auf Tuchfühlung zu gehen.«
»Dieser Geruch …«, sagte Kincaid. »Gab es in dem Café auch eine Explosion?«
»Sie meinen den Knoblauchgeruch? Nein, das ist ein Bestandteil des weißen Phosphors. Aber ich denke, Sie werden sicher nicht ohne Atemmaske allzu nahe an das Opfer rangehen wollen, Kontamination hin oder her.«
Jetzt konnte Kincaid neben dem Phosphor noch einen Übelkeit erregenden, öligen Geruch wahrnehmen.
»Ich habe die DS, die den Tatort gesichert hat, auch in einen Schutzanzug gesteckt«, fuhr Stacey fort. »Gehört sie zu Ihrem Team?«
Kincaid schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht.«
»Hat jedenfalls gute Arbeit geleistet. Also, ich lasse Ihnen mal die Anzüge bringen. Sie können sie da drüben bei dem Geldautomaten anlegen, kurz vor der Bühne.«
Direkt vor ihnen bildete der quadratische Mittelteil von Searcys Champagner-Bar in der oberen Halle eine Brücke, und darunter erblickte Kincaid den freistehenden vertikalen Quader eines der Geldautomaten des Bahnhofs. Die Explosion hatte sich also offensichtlich ganz in der Nähe der Bühne ereignet, doch er schob seine Sorgen um Andy und Poppy beiseite, bis er sich mit eigenen Augen überzeugen könnte.
Stacey sagte etwas in sein Funkgerät, und ein anderer Feuerwehrmann brachte drei Tyvek-Anzüge.
Nachdem sie sich in die Anzüge und Überschuhe gezwängt hatten – eine Übung, die nie ohne einige Verrenkungen zu bewerkstelligen war –, reichte Stacey ihnen die Atemschutzmasken und führte sie weiter.
Hinter der Treppe zur oberen Halle konnte er Feuerwehrleute und Sanitäter sehen, die den Verletzten halfen und Fahrtragen aufbauten. Dann sah er, was hinter der faltbaren Sichtschutzwand lag, und alle anderen Gedanken waren schlagartig vergessen.
»Ach du Scheiße.«
Neben ihm schnappte Sidana kurz nach Luft, deutlich vernehmbar trotz ihrer Schutzmaske, doch diesmal war es nicht, weil sie Anstoß an seiner Ausdrucksweise nahm. Beide starrten an, was da vor ihnen am Boden lag.
»Hab’s Ihnen ja gesagt«, bemerkte Callery, jedoch ohne eine Spur von Genugtuung.
Es war nicht das erste Mal, dass Kincaid eine Brandleiche zu Gesicht bekam – die Erinnerung an das Feuer in dem Lagerhaus in Southwark schoss ihm durch den Kopf wie auch die schrecklichen Ereignisse in Henley im vergangenen Herbst. Doch dieser Anblick schien in besonderem Maße erschütternd, vielleicht wegen des absurden Kontrasts zwischen dem verkohlten Leichnam und der glänzenden Perfektion des Bahnhofsgebäudes.
Callery hatte gesagt, das Opfer sei männlich, doch Kincaid konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand anderes als ein Rechtsmediziner in der Lage wäre, das Geschlecht zweifelsfrei zu bestimmen.
Eine kleinere Gestalt in Schutzkleidung trat von der Leiche weg und kam auf sie zu. »Da ist Ihre Kollegin«, sagte Callery.
Kincaid sah unter der Kapuze dunkle Haare hervorlugen, und über die Maske hinweg blickten ihn wohlbekannte blaue Augen an. Er schüttelte ungläubig den Kopf. »Melody?« Die Atemmaske dämpfte seine Stimme.
Sie packte seinen Arm und drückte ihn, und trotz der Maske war die Erleichterung in ihrer Miene deutlich zu erkennen. Sie deutete in die Richtung, aus der sie gekommen waren, und die anderen folgten ihr.
Als sie an dem Geldautomaten anlangten, riss Melody sich die Atemmaske herunter und schlug die Kapuze zurück. Ihr Gesicht war verschmiert, ihre Augen rot gerändert. »Duncan! Ich bin so froh, dass du es bist. Irgendwie war mir nicht bewusst…«
»Ich nehme an, Sie beide kennen sich«, warf Nick Callery ein, während alle sich ihrer Masken entledigten.
»Mel… DS Talbot arbeitet mit meiner Frau zusammen in einem Team in South London.« Kincaid drehte sich zu Sidana um. »Melody, das ist meine Kollegin, DI Jasmine Sidana.«
Melody wollte schon ihre behandschuhte Hand ausstrecken, überlegte es sich aber anders und schenkte Sidana stattdessen ein unsicheres Lächeln.
»Du warst bei dem Konzert«, sagte Kincaid, als bei ihm endlich der Groschen fiel.
»Ich habe gesehen, wie es passierte.« Melodys Augen waren schreckgeweitet. »Ich meine, ich habe ihn brennen sehen. Ich wollte helfen, aber es war zu spät.«
»Bist du sicher, dass es ein Mann war?«, fragte Kincaid.
Melody zögerte und runzelte die Stirn. »Ich glaube schon, ja. Ich habe seine Silhouette in den Flammen gesehen. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es anders sein könnte.«
Sidana, die gerade eine SMS bekommen hatte, sagte: »Wir werden es bald genau wissen. Die Rechtsmedizin und die Spurensicherung sind hier. Sweeney bringt sie her.«
»Melody«, sagte Kincaid, »Andy und Poppy – sind sie beide okay?«
»Ihnen ist nichts passiert. Sie waren fantastisch – haben geholfen, die Halle zu räumen. Aber, Duncan …« Sie schluckte und fuhr fort: »Tam und Caleb waren hier. Sie haben vor dem Café gestanden, vielleicht sechs oder sieben Meter von dem Mann entfernt. Die Umstehenden wurden mit Phosphor bespritzt. Tam hat Verbrennungen erlitten. Die Sanitäter machen ihn gerade transportfertig. Ich fürchte, es ist ziemlich schlimm.«
Als Gemma die St. John’s Gardens entlangfuhr, sah sie Wesley Howards weißen Transporter gegenüber von ihrem Haus stehen. Wesley, ein Freund der Familie, hatte ihr netterweise den freien Parkplatz direkt vor der Haustür überlassen. Und als sie eingeparkt hatte und aus dem Wagen stieg, musste sie zugeben, dass es verdammt noch mal viel zu kalt war, für Mensch und Tier gleichermaßen. Selbst in ihrer Daunenjacke fröstelte sie, und sie zog den Kragen bis unters Kinn. Es war bereits dunkel, und das Licht, das in den Fenstern zur Straße schien, war wie ein warmer Willkommensgruß.