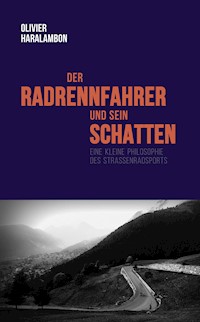
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Covadonga
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Als ich dreizehn Jahre alt war, spürte ich, wie ich als Kind der Pedale geboren wurde.« Die meisten Menschen glauben, nichts sei leichter und mechanischer, als ein Pedal zu bewegen. Der Radsport gilt als kulturlose Barbarei, Radrennen bestenfalls als eine klinische, aseptische Fassung von Modern Times, ohne Chaplin und bar jeder Poesie. Der Radsport, das sind Poulidor und Thurau und Lance Armstrong, es riecht nach Kampfer und Zitronentee, nach hohlen Phrasen und EPO. Der Radsport, das ist die Tour de France im Fernsehen, die erst dann nicht mehr langweilt, wenn man auf dem Sofa eingeschlafen ist. Der französische Schriftsteller und Philosoph Olivier Haralambon weiß es besser. Zehn Jahre lang ist er selbst Radrennen gefahren. Er hat in der Welt der Radsportler gelebt, er ist einer von ihnen geworden. Und er ist zu der Überzeugung gekommen: Bücher machen nicht unbedingt schlauer, der Radsport schon. Denn der Radsport besitzt die heilsame Tugend der Enttäuschung. In diesem sprachmächtigen, präzise beobachteten Essay erzählt Haralambon von den Verzauberungen, die uns der Radsport beschert. Er offenbart, warum stark zu sein und schnell zu fahren zwei grundverschiedene Dinge sind. Dass ein Pedal mehr umsponnen und gestreichelt werden will, denn nur getreten. Dass die, die man für Rohlinge hält, in Wahrheit empfindsam sind wie Tänzerinnen, feinsinniger als manche Schriftsteller - denn sonst kämen sie nicht voran…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Ähnliche
Olivier Haralambon
DERRADRENNFAHRERUND SEINSCHATTEN
Aus dem Französischenvon Christoph Sanders
Die Originalausgabe dieses Buches erschien unter dem Titel »Le coureur et son sombre« bei Premier Parallèle, Paris. Diese Ausgabe erscheint gemäß einer Vereinbarung mit dem Originalverlag Premier Parallèle unter Mitwirkung von L’Autre Agence, Paris, als seinem rechtmäßig bestellten Vertreter.© Premier Parallèle, 2017
Olivier Haralambon: Der Radrennfahrer und sein Schatten –Eine kleine Philosophie des Straßenradsports.Aus dem Französischen von Christoph Sanders.
© der deutschsprachigen Ausgabe: Covadonga Verlag, 2018Covadonga Verlag, Spindelstr. 58, D-33604 BielefeldISBN (Print): 978-3-95726-028-4 / ISBN (E-Book): 978-3-95726-030-7
Coverfoto: Stéphane Guitard / Porträtfoto: Claire MoliterniE-Book-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net
Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe, auch auszugsweise,nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.dnb.deabrufbar.
Covadonga ist der Verlag für Radsportliteratur.Besuchen Sie uns im Internet: www.covadonga.de
Für Katia,die den Schatten vertreibt
…mich packte der Schweiß:Feuerbälle willst du schauen, rot glühende Boliden?Da stehen und lauschen, dem Summen von milchig weißströmenden Sternen und den schwärmenden Asteroiden?
Arthur Rimbaud, L’Homme juste
Inhalt
Mein Begleitschatten
Flacher Kosmos
Der Finger des ungläubigen Thomas
Wettkampf
Flüssiger Körper
Alles andere als ein Beruf
Das Monster
Intimitäten
Gnade und Ungnade
Mit seinem Körper zum Himmel fahren
Nachts
Formbar
Abdruck
Der Alte
Mein Begleitschatten
Mehr als an jedem anderen Tag geschieht es sonntagmorgens. Zur Stunde der Frühmesse begegnet man diesen kleinen wandelnden Kirchen, die es offensichtlich eilig haben, zum Stadttor hinauszukommen. Gruppen von Rennradfahrern, die noch vor Tagesanbruch und bei jedem Wetter ausfahren. Es ist meist nicht leicht, diese Männer und wenigen Frauen zu verstehen, deren auffällige Aufmachung jeder Körperfalte folgt; ehrlich gesagt liegt sie so eng an, dass sie nur geschaffen scheint, Unvollkommenheiten des Körpers herauszustreichen. Man wundert sich über ihre Silhouetten, die sich über die Fragilität schmaler Felgen beugen. Man weiß nicht so recht, ob ihre Körper den Schatten folgen oder umgekehrt und wer von wem geformt wird. Der Anblick ihrer Kopfbedeckungen und überdimensionierten Brillen belustigt.
Wer nicht vom Radsport ergriffen ist, dem bleibt er letzthin fremd. Häufig ruft die Erwähnung des Begriffes einige berühmte Namen hervor, manchmal ordnet man ihnen sogar antiquierte Spitznamen zu, die körperlos bleiben wie Apostel in einem Gemälde. Jacques Anquetil, Louison Bobet, Raymond Poulidor hatten sicher ein Gesicht, aber das kennt man nicht mehr. Ebenso wenig würde ein Gymnasiast Balzac oder Flaubert auf einem Foto wiedererkennen. Vergessen ist auch, dass Eddy Merckx noch schöner war als Elvis Presley.
Nur der allgegenwärtigen Tour de France gelingt es manchmal, einen hinteren Platz im komplexen Geflecht unserer Erinnerung einzunehmen. Es ist in der Tat nicht möglich, der Imprägnierung durch die Tour zu entkommen, wenn man Französisch zur Muttersprache hat. Doch nicht selten lässt sich das, was man von ihr weiß, in ein paar Floskeln zusammenfassen. Der Radsport und die Tour bilden einen Teil des Juli-Hintergrundes, so wie die Farbe des Himmels oder des Sandes, die lang ersehnte Sanftheit des Windes, der einem um die Nase weht oder lautlos das trockene Gras kräuselt. Hintergrundgeräusch ist der Fernseher, vor dem man sich an den heißen Stunden des Nachmittags in jalousiengefiltertem Licht räkelt. Wem ist es nicht schon passiert, während einer Tour-de-France-Etappe einzuschlummern?
In den Augen vieler bleiben Radrennen ein schrecklich eintöniges Ereignis. Stunde um Stunde der Wiederholung einer immer gleichen Bewegung zuzusehen, die in zehntausendfacher Einförmigkeit abläuft, entbehrt jeden Interesses. Selbst wenn man bemerkt, dass sich der Rhythmus ihrer Beine ändert, dass sie manchmal spektakulär beschleunigen, reihum aus dem Sattel gehen, ein Stück weit im Wiegetritt fahren und sich dann wieder setzen, auch wenn man die Steilheit einiger Anstiege kennt und sich die Pupille angesichts der Geschwindigkeit weitet, mit der sie bewältigt werden, ist man der Anstrengungen doch bald überdrüssig. Hat man lang genug ungläubig staunend, mit zwischen Respekt und Mitleid wechselndem Gesichtsausdruck, am Schauspiel ihrer Qualen teilgenommen, wendet man den Blick ab und widmet sich lieber etwas anderem.
Pedalieren gilt als die mechanischste aller Übungen. Eine Bewegung, die jeder beherrscht, sobald er als Kind gelernt hat, auf zwei Rädern das Gleichgewicht zu halten. Ist es nicht das Rad, das in gewisser Weise die Pedale bewegt, reicht es nicht, der eindeutigen, fast unveränderlichen Bewegungsrichtung zu folgen, die die rotierende Kurbel einmal vorgegeben hat? Man erzählt sich sogar, diese stumpfsinnig dem Räderwerk der Maschine aufgezwungene Arbeit sei lediglich das Werk von Radprofis auf Drogen. Was ist daran noch zu bewundern, worüber sollen wir noch staunen, wenn sogar der Wille mechanisiert wurde und alle Anstrengung nur Täuschung ist?
Tatsächlich gibt es auf diese Fragen auch Antworten. Es sind sogar sehr viele – die aber sind so facettenreich und tiefgründig, dass man unweigerlich vor der Mühe zurückschreckt, sie alle aufzuzählen. Als Kinder einer Epoche, die von der seriellen Reproduktion des Gleichen besessen ist und fast manisch alles einer Objektivierung unterwirft, sind Sportkommentare in einer Reihe von Klischees erstarrt, die den Radrennfahrer in einer zumindest ungelenken Schwarzweiß-Malerei einsperren (hier die Verdienstvollen, dort die Betrüger) und einige schematisierte Rennverläufe katalogisieren, die beliebig wiederverwendbar sind. Diese systemische Komponente erzeugt mit ihrem Jargon einen Code, der darauf zielt, Eingeweihte und Willige zu vereinen, hilft aber nicht im mindesten, die Neugier des Novizen zu wecken – im Gegenteil: Das Resultat ist eine Abschirmung. Da vernimmt man vage etwas von »Sprints«, von »Kletterern« und »Ausreißern«, ja, sogar von »Windkanten« und »Belgischem Kreisel«, und man staunt über die Ausdrucksformen. Von Radrennen versteht man danach immer noch nichts, geschweige denn, dass man im Rennen etwas erkennt und es durchschauen könnte.
Ich dagegen habe den verhängnisvollen Biss schon früh empfangen. Noch vor dem Stimmbruch begann ich, Rennrad zu fahren, und ich bestritt Rennen, bevor der sexuelle Appetit die Welt auf den Kopf stellte. Manchmal habe ich unter den kleinen Verachtungen gelitten, immer aber unter dem Unverständnis, das man meinem Zeitvertreib entgegenbrachte, der bald zum Mittelpunkt meines Lebens wurde, dessen Ausmaß von allem Besitz ergriff und meinen Alltag völlig vereinnahmte.
Jetzt aber, nachdem meine Existenz ein wenig vorangeschritten ist und ich zu den strengen Vorschriften und fast sektiererischen Regeln, die mein Leben damals bestimmten, gewissen Abstand gewonnen habe, will ich diesen Weg noch einmal beschreiten. Ich würde mir gerne etwas bewusst machen, oder vielmehr möchte ich mich noch einmal all der Verzauberungen annehmen, die mir zuteilwurden, während ich über Jahre nur mit Radrennfahrern verkehrte, nur mit ihnen lebte, nur wie sie lebte, um schließlich ad vitam einer von ihnen zu sein.
Merkwürdigerweise hat dieses Rad, das so viel Leiden mit sich bringt, mir gleichzeitig die optimistischste Perspektive aufgezeigt, in der ich mich je einrichten konnte. Natürlich habe ich es geliebt, auf dem Rad zu sitzen und in die Pedale zu treten und mich neben dem Dämon meines Schattens zu verausgaben – er war mein Haustier, das mir in die Waden biss, sobald die Sonne ihm die Gelegenheit dazu gab, und ich habe es wild über zehntausende Kilometer mitgeschleppt, ohne dass es jemals von mir gelassen hätte. Ich habe geschwitzt, gespuckt, geweint und gelacht, genossen, gesabbert und manchmal auf den Asphalt und in die Landschaft geblutet. Ich habe mein Rad und die Radrennen heftig geliebt, weil sie mir eine Art Vertrauen zur unermesslichen Größe des Lebens gegeben haben, ein Vertrauen in die Vertikalität der Zeit. Ohne dies hätte ich sonst niemals die geringste Ewigkeitserfahrung gemacht – nicht die Erfahrung einer mythologischen, sondern die einer gelebten Ewigkeit.
Sicher, im Laufe der Jahre und mit fortschreitendem Training habe ich mich auch von meinen eigenen Fähigkeiten blenden lassen. Nie hätte ich als Kind geglaubt, dass meine Beine eines Tages so viel Glut und Kraft ausstrahlen könnten. Manchmal ging es so weit, dass ich mich für schier unermüdlich hielt und für unempfindlich gegenüber Schmerzen – lange Ausfahrten auf leeren Magen, Steigungen, die man hundertmal bezwingt, sengende Hitze.
Aber gerade weil es genau dort auftauchte, wo ich es am wenigsten erwartete, kann das Rad, von dem ich rede, ein vielleicht unverhofftes Interesse erwecken. Durch das Rennrad, durch eine unermüdliche, fast verzweifelte Ausübung des Radfahrens (nie ist die Hoffnung größer als kurz vor der Verzweiflung), wurden mir die Eckpfeiler des Daseins offenbart. Vieles von dem, was ich eigentlich von den Älteren, meinen Lehrern, der Schule oder den Büchern erwartet hätte, lernte ich durch das Radrennfahren und meine Radfahrerkollegen. Die Vorstellung, die ich mir vom Körper und von der Zeit machte (die Ewigkeit erwähnte ich bereits), meine Fähigkeit, Angst und auch die zersetzenden Folgen der Melancholie niederzuringen, doch vor allem und über allem die Vorstellung, die ich mir von der Intelligenz der anderen machte. Die besten Rennfahrer nämlich – und das ist kaum bekannt und liefert gleichzeitig einen fehlenden Schlüssel – zählen zu den intelligentesten, subtilsten Vertretern der menschlichen Gattung. Selbst wenn sie sich fast immer vom Gegenteil überzeugen lassen und ihre eigene Feinfühligkeit komplett verleugnen. Ich habe mich den Tatsachen gebeugt: Lesen bildet, macht aber nicht schlauer, das Radrennfahren schon. Einem Radrennen ist die Tugend der Enttäuschung eigen. Man denkt, nichts sei einfacher oder selbstverständlicher, als ein Pedal zu bewegen, und Radrennen liefen wie eine Wiederholung von Modern Times ab, nur ohne Chaplin und bar jeder Poesie. Man ahnt beispielsweise nicht, dass schiere Kraft und Geschwindigkeit zwei grundverschiedene Dinge sind. Dass ein Pedal mehr umsponnen und gestreichelt wird, als einfach nur niedergedrückt. Dass man, um diese Anstrengung durchzustehen und den Schmerz ertragen zu können, gelernt haben muss, diesen nur zu streifen; es ist, als lupfe man mit dem Pedal den Deckel vom Schacht des Schmerzes, um ihn dann in der Schwebe zu halten, während diese Bestie dort unten um sich schlägt und alles zu vernichten droht.
Ich wiederhole es: Eigentlich sehen Sie nichts. Sie halten sie für Rohlinge, dabei sind sie sensibel wie Tänzerinnen und feinsinniger als manche Schriftsteller. Denn anders würden sie nicht vorankommen. Nur ist ihre Körpersprache nicht leicht lesbar, da man den Regeln der Erscheinung nach glaubt, ihre Körper würden von ihren Maschinen eingezwängt, weshalb man überzeugt ist, ihr Bewegungsraum sei eingeschränkt und verengt. Als Kinder der Emphase und der weitschweifigen Bewegung erkennen wir nichts, da ihnen die Gestik fehlt. Ich selbst war noch ein Kind, das vor dem Fernseher hockte, als Hinault Weltmeister wurde, indem er sich an der Côte de Domancy geradezu zerriss. Es sollte Jahre dauern und viele Enttäuschungen brauchen, um zu begreifen, wie viel Finesse sich in diesem Körper hinter einem räudigen Blick und der struppigen Haartolle verbarg.
Die Kolosse, die am besten gewappnet sind, dem Wind und dem miserablen Kopfsteinpflaster der Rennen im Norden zu trotzen, sind ballerinesker Zartheit fähig; Paris–Roubaix und die Ballettkleider von Repetto ziehen in die gleiche Schlacht! Aber das scheint niemand zu wissen. Man hat große Texte zum Tanz und zum Körper verfasst – ich denke an Paul Valéry. Auch über Radrennen, sicher, da war der wundervolle Antoine Blondin und viele andere in seinem Fahrwasser. Aber eine zu strahlende Darstellung hat häufig die Schattenseiten überbelichtet und dabei oft das Absolute, das Entgrenzte der radsportlichen Praxis ausgeblendet, bei der das Training eine Form der Askese und die Höchstleistung zu einer Art Gnosis wird. In den meisten Fällen werden die herausragenden Großtaten der Champions im naiven Licht reiner Affirmation gefeiert – schlimmer noch: nur als Erfolge –, ohne zu ahnen, wie sehr sie von ihrem Weltschmerz, ihrem taedium vitae, angetrieben sind. Das Radrennfahren wird nur noch anhand grober moralischer Raster bewertet und, in Verleugnung des Offensichtlichen, mit naiven, pseudowissenschaftlichen Erklärungen abgehandelt: Wenn diese Männer Irrwege beschreiten (besonders im Doping), dann sündigen sie meistens »aus zu heftigem Verlangen, sich mit Gott zu vereinen«, und weil »das Schlechte das korrumpierte Gute ist«. Ironischerweise wird ihnen etwas vorgeworfen, was eigentlich verziehen werden sollte. Kurzum, man liegt meilenweit daneben.
Radrennen sind etwas zu Großes und Lebendiges, um zu einem wissenschaftlichen Untersuchungsgegenstand eingeschrumpft zu werden. Und vor diesem Rätsel will ich mich nun verneigen. Seine Lösung erfordert letztlich nur innere Einkehr, und darum ist alles, was ich, außer ein wenig Nachsicht über meine Selbstgefälligkeit, in der ersten Person zu sprechen, vom Leser verlange, mich zu begleiten; denn ich will vor ihm meinen Schädel öffnen. Die Hirnschale ist der einzige Ort der Leistung, dort wird ihre Welt erzeugt, entworfen und gestaltet.
Tänzer, Artisten und Seeleute, Schriftsteller, Toreros und Poeten, Handwerker und Arbeiter, Mystiker und Asketen, was auch immer Sie wollen, aber keine Sportler.
Vergessen Sie den Sport.
Flacher Kosmos
Er war winzig und das Rad sehr groß. Schon schlug es ihn in seinen Bann. Jedem Gefühl von Zeit und Raum enthoben, Hände in Kopfhöhe, ließ er die seltsame Maschine ein paar Zentimeter zurücklegen – vielleicht wagte er auch einen vollen Meter? Sofort drang das Klackern in ihn ein, als fielen die Kugeln des Freilaufs einzeln auf sein Trommelfell, irgendwo dort auf dem Grund seiner aufgerissenen, runden Augen. Ein Schaudern lief ihm über den Kopf, und um ihn zu schützen, zog er ihn leicht zwischen die Schultern. Die unglaubliche Winzigkeit der Berührungspunkte mit dem Boden und die Labilität eines Gleichgewichts, das nur durch Geschwindigkeit und rasche Bewegung zustande kommt, reichten, einen Riss durch die Welt gehen zu lassen.
All unsere Geburten beruhen auf einem Vergessen. Manche Spalte und Risse, durch die wir uns zwängen und dabei das Hindernis unserer Körperlichkeit mitziehen, verschließen sich für immer. Wir können das fallende Laub hinter unserem Rücken nicht mehr sehen, während wir noch den Flug der Blätter spüren. Schon muss man auf den nächsten Schritt achten.
Es gibt meiner Meinung nach keinen Radrennfahrer, der diese Verblüffung nicht durchlebt hat. Der nicht imstande ist, hunderttausende Kilometer später und im Augenblick seines letzten Atemzugs die Spur dieses Zaubers in den Windungen seines Gedächtnisses nachzuverfolgen.
Ich kenne keinen einzigen Radrennfahrer, der nicht irgendwann im Lauf seiner Karriere regelmäßig das Bedürfnis verspürt hat, wie beim ersten Mal vor dieser Vollkommenheit niederzuknien. Selbst wenn man jahrzehntelang im Bad der seichten Unterhaltung von (Fernseh-)Bildern eingetaucht war, denen die Inszenierung radsportlicher Tragödien so viel verdankt, ist es nicht möglich, das weißglühende Gleißen dieser Szene anders als mit zusammengekniffenen Lidern wiederzuerleben. Das erste Rennrad (es gibt kein anderes Rad als das Rennrad), dem man begegnete, konnte nicht anders, als im Strahlenkranz von einem lichtdurchfluteten Himmel herabgestiegen sein.
Wie im Traum sehe ich noch an manchen Sonntagen meiner frühen Kindheit im Licht eines Zimmers, eines Flures oder Kellers Staubkonstellationen zwischen Rahmen und Speichen wirbeln. Lichtklingen, die den Raum zerteilen. Und ich spüre noch die Kontraktion dessen, was in mir noch an Waden eines Kindes steckt, wie ich mich ohne zu zittern auf den Fußspitzen aufrichte, und dort oben, auf der salzigen Oberfläche des Sattelleders, fühle ich noch das Gewicht meiner Hand ruhen. Als sie auf das kalte Rohr der Maschine zurückfällt, folgt sie langsam deren Rückgrat und dem übrigen Skelett bis in die feinsten Knöchelchen. Dieses Rad, das ich meine und das mir eines schönen Morgens die Augen öffnete, zieht mir bis heute den Gaumen zusammen – unablässig öffneten und schlossen sich meine feuchten Handflächen um seinen Körper, streichelten die eckigen Rundungen des mageren Stahlgestells. Es war ein Mercier. Die weißen Buchstaben stachen aus einem tiefen Rosa hervor, einem fleischfarbenen Rosa, dessen Geschmack und Geruch ich jetzt noch spüre. Heute frage ich mich oft, wo es geblieben ist, nachdem es schon so lange Zeit weit entfernt von mir gelitten und anderen Belastungen ausgesetzt war. Ich stelle mir die Risse und Blasen seiner lackierten Oberfläche vor.
Auch weiß ich, dass der blöde Plastiknuckel, der die am Rahmen eingehängte Trinkflasche verschließt, mir gleichsam einverleibt ist – ein gewissermaßen archaisches Element meiner Sexualität: Durch diese Öffnung nahm ich den größten Teil des Wassers auf, aus dem ich bestehe. Mit geneigtem Kopf habe ich diese zuckerverklebten Plastikflaschen wie Brüste gepresst, wobei meine Augen nie die Straße und ihren Verlauf aus dem Blick verloren. Ich bestehe aus Wasser, das von der groben Körnung der Straße durchgerüttelt wurde. So kann man nicht stillhalten. In mir gibt es nicht den kleinsten Winkel stillen Wassers. Jeder Radrennfahrer besteht aus einer Brandung.
Tausende Male wurde versucht, die Poesie dieses Gegenstandes zu beschreiben, der aber widersetzt sich; tausende Male hat man mit dem Finger auf den Halo gedeutet, der diesen kleinen flachen Kosmos umgibt. Man hat mit dem Mikroskop – keine Vergrößerung reicht dazu aus – die Feinheiten dieser besteigbaren Galaxie dargestellt. Man weiß, dass jeder Punkt der Felge ein Satellit der Nabe ist, genau wie die 53 Zähne des Kettenblatts jene der Tretlagerachse, dem Ursprung des gesamten (Planeten-)Systems. Und man weiß, dass die Pedale am äußersten Punkt der Kurbel eine weiter entfernte Umlaufbahn beschreiben, welche wiederum ein lebender Fuß bewegt, der, nur eine Sohlendicke entfernt, die unvollkommene Ellipse seiner eigenen Umlaufbahn beschreibt. Die über eine Kette verbundenen Kettenblätter und Ritzel und die von den Füßen gezogenen Pedale beleben sich samt den Rädern und entreißen das Zusammenspiel der Kreisbahnen der Reglosigkeit. Schon wird der menschliche Körper angesprochen, dessen durch Gelenke verbundene Gliedmaßen sich diesem gleichermaßen komplexen wie zyklischen System hinzufügen. Dieser Ruf wühlt den Magen des Rennfahrers in heftiger Liebeswallung auf.





























