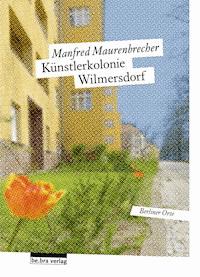Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BeBra Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Manfred Maurenbrecher ist einer der bedeutendsten deutschen Liedermacher. In diesem Buch beschreibt er seinen Weg in die schillernde Welt der professionellen Popmusik, in die ihn Anfang der 1980er Jahre der Fotograf Jim Rakete und der Spliff-Schlagzeuger Herwig Mitteregger einschleusten. Maurenbrecher schildert die Atmosphäre eines Jahrzehnts, das geprägt war von so unterschiedlichen Musikern wie Nina Hagen, Pannach und Kunert, Rio Reiser, Ulla Meinecke, Anette und Inga Humpe, Reinhard Mey oder Jürgen von der Lippe, und er berichtet von seinen oft verstörenden Erlebnissen im Zwielicht zwischen Politik und den schrägen Milieus der Musikwelt. "Geheimtipp auf Lebenszeit: Das ist wohl das Schicksal des Literaten, Sängers und Pianisten Manfred Maurenbrecher. Gäbe es auf der Welt überhaupt so etwas wie Gerechtigkeit, ganze Fußballarenen müssten ihm zujubeln." Frankfurter Allgemeine Zeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Maurenbrecher
Der Rest ist Mut
Vom Liedermachenin den Achtzigern
Abbildungsnachweis:
Manfred Becker S. 33, 60, 61, 68, 80, 90, 95, 114, 118, 134; Ulrich Dornieden S. 18; Kristjane Maurenbrecher S. 29, 224; Jim Rakete S. 109, 182, 185, 204, 269; Thomas Räse S. 220, 222, 245; Marco Saß S. 149; Andreas Uthoff S. 211. Die anderen Bilder stammen aus dem Archiv von Manfred Maurenbrecher. Trotz sorgfältiger Recherche konnte nicht in jedem Fall der Fotograf ermittelt werden, für entsprechende Hinweise sind Autor und Verlag dankbar.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren
elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
© edition q im be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2021
KulturBrauerei Haus 2
Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin
Lektorat: Ingrid Kirschey-Feix, Berlin
Umschlag: Manja Hellpap, Berlin
Satz: ZeroSoft
Schrift: Stempel Garamond 10.5/13.6 pt
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, Regensburg
ISBN 978-3-8393-2144-7
www.bebraverlag.de
Inhalt
Vorab
1980–1982 Die Entscheidung
1983–1984 In Fahrt
1985–1986 Wasserscheide
1987–1988 Über’n Berg
1989 Neuland
Der Rest ist Mut
Dank
Personenregister
Der Autor
Vorab
April 2020. Sommersonne, ein sanfter Wind. Ich bin spazieren in einer Gegend Berlins, die ich seit langem kenne. Von der Gotzkowskibrücke links Richtung Huttenstraße, wo Moabit immer noch, wie vor 35 Jahren, zerfleddert in Autohäuser, Motorradkneipen und Fabriklofts. Hier hatten die Spliffer ihr Studio. Anfang der Achtziger ging ich hier ein und aus, meist lief ich vom U-Bahnhof Mierendorffplatz her, nervös, angekratzt und stolz, dass ich an diesem begehrten Ort meine Lieder aufnehmen durfte. Nina Hagen, Nena, jetzt ich. Nebenan war das Lager von Revue, der Beschallungsfirma, da wuchteten sie die größten Geräte herum und man konnte beim Zuschauen lernen, was harte Arbeit ist.
Am 26. April ’86 kam ich dort vorbei, um ein paar Bänder mit Schlagzeugspuren abzuholen, denn damals machten wir meine nächste Platte in einem kleinen Studio in Neukölln. Das von der inzwischen angesagten Band Spliff war zu teuer geworden, und ich gefiel mir darin, es diesmal mit einer eigenen Band ganz im Alleingang zu schaffen.
»Diesmal hat’s aber richtig gekracht«, empfing mich Reinhold Heil im kleinen Besucherraum, »Reaktor 4 ist explodiert, schon gehört? Ein altes Kernkraftwerk, der Ort heißt Schernobel oder so.«
Ich hatte nichts gehört auf dem Weg. Dass man Neuigkeiten vom mobilen Telefon tankt, gab es noch nicht. Jemand hatte in der U-Bahn gesagt, in Polen wäre was passiert.
»Ist das polnisch, Schernobel?«
»Weißrussland oder so, an der Grenze. Bei Ostwind ist die Radioaktivität ruckzuck hier.«
Reinhold, der Keyboarder von Spliff, war normalerweise gut informiert über so ziemlich alles, und ich schätzte ihn als Kenner aller hochtechnischen Aspekte, in der Musik wie auch sonst im Leben. Wenn der jetzt Angst in den Augen hat, dann ist was dran, dachte ich.
Andere in den Studioräumen überspielten die Dramatik. »Na, da hat der Iwan ja ’n feines Geschenk rausgelassen« – solche Sätze fielen auch. »Atomkraft Nein danke? Wer sagt’s denn …«
Nachdem ich die Schlagzeugbänder eingesammelt hatte, saßen wir noch ein Weilchen im kleinen Aufenthaltsraum. »Wird es uns hier erreichen?« – »Das hängt vom Wind ab. Er soll südöstlich wehen, sagen die im Radio. Wenn das Zeug aber erst mal hier ist, dann bleibt’s. Die Halbwertzeit dieser Stoffe ist endlos …«
Das Wort Halbzeitwert hörte ich damals zum ersten Mal. Keine Ahnung, was es bedeutete. Ich brach wieder auf. Mein Tonband mit den Aufnahmen in einem Stoffbeutel über der Schulter ging ich über die Sickingenbrücke, am Verbindungskanal lang, drehte dann links ab in die Kaiserin-Augusta, wo es ein kleines Café gab, in das ich noch einkehren wollte. Ein Schwarzer mit Baseballcap fuhr auf dem Fahrrad knapp an mir vorüber. Er und ich waren im Moment die einzigen in Bewegung, der Rest erstarrte gerade wie auf einem Foto, und die Sonne strahlte.
Mir wird nichts geschehen, dachte ich.
Wie jetzt, 2020. Die Sonne strahlt genauso. Ich könnte mir selbst entgegenkommen. Die Pandemie hat die Straßen leergefegt, man weicht sich aus, erstarrt, wenn man nicht gleich ganz zu Haus bleibt. Das Café von damals ist ein Tätowierladen geworden, und der hat zu. Der Typ mit dem forschen Schritt, dunkle Brille, kurzhaarig und Schnäuzer, in meiner Größe, so Mitte dreißig, hat gar keinen Stoffbeutel dabei, er schwenkt eine Plastiktüte beim Gehen.
Ich versuche mich zu erinnern. Alle Auftritte sind erstmal abgesagt, ich hätte ja Zeit. Das Jahrzehnt erzählen, als ich halb so alt war wie jetzt.
Das dunkelhäutige Mädchen mit Baseballcap, das mich gerade fast umfährt, lacht und lacht und fährt weiter.
1980–1982 Die Entscheidung
Silvester 1979 verbrachte ich auf dem Kleinhof, jenem Bauernhof im ländlichen Bereich zwischen Düsseldorf, Wuppertal und Essen, auf dem meine Freundin Meg aufgewachsen war. Ich hatte sie im Frühling ’78 beim Straßenmusikmachen kennengelernt, von Osnabrück war ich mit ihr nach Münster getrampt, wo sie sich mit einer Kommilitonin eine Studentenbude teilte. In mein Notizheft für das erste Jahr im neuen Jahrzehnt hatte ich auf die Rückseite des Einbands mit kleiner Schrift ihre Münsteraner Adresse notiert, und sie hatte mit ihren großen, geschwungenen Buchstaben, die ihr immer dann gelangen, wenn sie gut drauf war, dazugefügt: »So oft schreibst Du mir, dass Du die nicht mal auswendig kannst! Und was schließt Du daraus?«
Wir verbrachten Zeit mit ihrer Familie, für die ich mittlerweile der Doktorand und damit ein Schwiegersohn in spe geworden war. Nichts an meinem gegenwärtigen Lebenswandel deutete noch auf den Hallodri hin, als den sie mich knapp zwei Jahre vorher kennengelernt hatten. Ich lief in dicken sauberen Winterklamotten herum statt in zerrissenen Anoraks und trug sogar einen Anzug darunter. Ich wollte mich – wie der dichtende Triebwandler, über den ich meine Dissertation schrieb, Hans Henny Jahnn – mit Bürgerlichkeit tarnen, ein bisschen vor den anderen und mehr noch vor mir selbst. Meg wusste das, ihr ging es ja ähnlich. Sie war das brave katholische Bauernkind, solange sie sich in den pädagogischen Hochschulfluren der westfälischen Bischofsstadt herumdrückte, und wurde zum Paradiesvogel, sobald die Fiedeln der Folkmusic loslegten, dann konnte alles geschehen.
Wir stützten uns, ein wenig weltirre beide. Musik war für uns das verlockende Leben, aber Meg würde Erzieherin werden, ich Lehrer. Das glaubten wir zwar beide nicht und hofften auf andere Verläufe, aber wir duckten uns auch unter das Diktat. Wir konnten uns mit der pathetischen Frage, die Münder geweitet, die Blicke entsetzt ineinander versenkt, ganz wohlig erschrecken: »Was soll bloß werden aus uns?«
Dass sich dem Bauernkind diese Frage lebensbedrängender stellte als dem Bürgersohn, spürte ich damals schon, aber wollte nicht so recht nachdenken über die Folgen und ob sie verhängnisvoll sein konnten. Die Welt meiner Bücher war kompliziert genug. Wenn meine Freundin hilflos wurde und sich als Opfer der Welt erlebte, vergaß ich die klugen Ausführungen meiner Meister Freud, Caruso (»Die Trennung der Liebenden«) und Canetti und wurde zum freundlichen Charmeur, der die bunten Frühlingsfarben beschwor und die guten Seiten von Lust und Liebe. Eine Hilfe, die manchmal verfing, aber den Abgrund, zu dem die Begleiterin sich hingezogen fühlte, nicht weglachen konnte.
Manchmal verfiel ich dann selbst der Litanei, dass alles ganz sinnlos wäre. So fuhr ich im März ’80 an einem Sonntag im Zug nach Hamburg, geplant waren zehn Tage Archivarbeit in der Unibibliothek am Nachlass Jahnns. Ich saß bewegungsunfähig im vollen Abteil und schaute in das graue Land da draußen. Es würde mir nicht gelingen, diesen fremden Hans Henny Jahnn, der so vieles war, nicht nur ein Schriftsteller, sondern auch Pferdezüchter, Orgelbauer, Sektengründer, bisexueller Liebhaber, Kriegsgegner, Rebell und Opportunist – diesen erstaunlichen Selfmade-Mann wenigstens ein wenig zu entschlüsseln.
Außerhalb Hamburgs in Wedel logierte ich bei einer Jugendfreundin meiner Mutter, wurde freundlich empfangen und gab den düsteren jungen Wissenschaftler. Die alte Dame war verheiratet mit einem Kapitän zur See. Der war gerade in Rente gegangen und wohnte jetzt mit im Haus, was er vorher die dreißig Jahre der Ehe lang kaum getan hatte, nur immer auf Landurlaub, zwei Kinder gezeugt, wieder fort. Jetzt saß er mit am Abendbrottisch und fragte mich laut, wie meine Reise denn gewesen sei, viermal, fünfmal. Ich antwortete immer vorsichtiger, bis das Gespräch versiegte. »Er verliert das Gedächtnis«, flüsterte seine Frau mir beim Abwasch zu, »manchmal erkennt er mich nicht.« Ich sah das Entsetzen in ihrem Gesicht. Ein Fremder war zu ihr gekommen, nichts als ein Pflegefall.
Es ist erbärmlich, aber das fremde Unglück baute mich wieder auf. Die Tage in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek wurden unerwartet vergnüglich, meine Ausbeute war reich. Ich wurde willkommen geheißen und vom Jahnn-kundigen, leise und hoch sprechenden Dr. Rolf Burmeister durch die Regale geführt, in die Registraturen eingewiesen und vertraut gemacht mit dem, was der Fachmann schon bereitgelegt hatte, weil er es für mein Vorhaben brauchbar fand. Ich tauchte ein in zwei Welten, die des Kämpfers und des verzweifelten Jahnn und die des Sammlers, Kenners und Verwahrers Burmeister. Staunte über die elegante Art wissenschaftlichen Prahlens, wie sie die Bibliothekare hier pflegten. In einer Männerwelt, der das Weibliche nicht abging. Meine Eltern waren ja beide Bibliothekare, öffentliche, sozusagen die Volksvariante. Ich kannte die Mädchen- und Frauenfreundschaften meiner Mutter gut, in der Männer wie mein Vater eine Seltenheit, fast Fremdkörper waren. Hier fand ich nun das Pendant auf männlicher Seite vor, in der Beamtenhierarchie drei Stufen höher angesiedelt, die wissenschaftlichen Registrateure, die sich eine Freude daraus machten, junge Forscher wie mich mit einer Überfülle an Information zu füttern wie mit erlesenem Süßkram und die Jungs damit auch ein bisschen zu verwirren.
Ich bekam Material für drei Doktorarbeiten, wich den privaten Einladungen aus und machte der Gastgeberin in Wedel mit meinen Schilderungen des wissenschaftlichen Treibens in der Innenstadt großen Spaß.
Ich hatte keine Berührung mit der Musikszene in der Stadt.
Es hat mir immer Freude gemacht, Rollen anzunehmen, mich in ein vorgegebenes Gefüge einzupassen, mir die Übereinkünfte abzuschauen, ein Weilchen, so gut es ging, mitzuspielen, dann wieder rauszuschlüpfen.
Es gab drei Kreise in Berlin, in denen ich mich zu jener Zeit bewegte. Eine enge Freundesclique hatte sich aus den Unitagen gebildet, gleichgesinnt, aber auch höchst verstritten, in den ersten Semestern Germanistik, Politik und Psychologie zusammengeraten, erst eine Lerngemeinschaft, dann der hochgereckte Mittelfinger zu den studentischen K-Gruppen, jenen modischen Aufbauorganisationen für eine neue Kommunistische Partei. Unsere bescheidene Antwort darauf war die ASMO (antisektiererische Massenorganisation), ein Haufen von ca. 25 Leuten in einer angemieteten Kellerwohnung in der Kreuzberger Nostitzstraße. Entzündungspunkt für feurige Diskussionen, herzzerreißende Verliebtheiten und schlurfenden Arbeitsalltag von schlechtgelaunten anarchistischen Narzissten. Ein Pulk mit Querverbindungen in so ziemlich jede Himmelsrichtung, von Kultur über Politik, Karrieren bis in die Verschwörungen und den bewaffneten Kampf. Mein Fixstern darin war und blieb Ulli D., einer meiner frühesten Freunde.
Die Musikgruppe Trotz&Träume und ihr weites Umfeld war der zweite Kreis, in dem ich vorkam. Im eiskalten Dezember 1976 hatten wir uns gegründet als eine Art Männergesangsverein, sechs junge Leute, getrieben vom Wunsch nach Zusammengehörigkeit und musikalischem Nachdruck, alle ganz verschieden. Da war der Gitarrenmeister und Akkordzauberer Alli, später Lehrer, er lebt schon nicht mehr. Der zauberhafte, damals zurückhaltend lernende Burkhard ist heute emeritierter Stararchitekt mit dem Fachgebiet Wärmedämmung. Dann der abseitig-pointierte meisterhafte Liederschreiber und Bühnenmensch Rudl aus Franken, heute Friedhofsgärtner in Osnabrück. Und Henner Reitmeier, unser Gruppenideologe, ein böser Begriff, aber so etwas strebte er damals an. Auf Reitmeiers Internetseite findet man einiges über die Geschichte dieser Gruppe und bleibt vielleicht überhaupt dort hängen, denn der Schriftsteller stellt sein großes literarisches Werk frei zur Verfügung.
Wir hatten mehrere Tourneen hinter uns und einen umjubelten Auftritt beim »Tunix-Kongress«. Dieses nationale Treffen von tausenden Alternativen hatte 1978 im Audimax der TU Berlin stattgefunden – der Spießer-Vorwurf, das seien ja alles Nichtstuer, wurde positiv gewendet zum Titel der Veranstaltung. Von unserem Erfolg beflügelt nahmen wir anschließend eine schaurig klingende LP auf, mit musikalischer Verstärkung durch die undogmatische Band Pille Palle und die Ötterpötter, deren Trompeter mich übrigens in einen Leidenschaftstaumel schlimmer Art trieb, und deren Bassist, der linksradikale Drucker, Michael Stein, mir später viel bedeuteten würde. Ich hatte, die schlechte LP, die sinnlose Verliebtheit und das mühsame Baggern um Aufmerksamkeit mal summiert, im Herbst ’79 das Handtuch geworfen und mich – »ich promoviere« – an einen stillen Schreibtisch zurückgezogen.
Der stille Schreibtisch stand in der Wohnung der Eltern in meinem alten Zimmer. Dorthin fuhr ich auch nach den Hamburger Tagen mit Stapeln kopierter Seiten und Notizen im Gepäck wieder zurück.
Ich glaube, meine Eltern waren glücklich, dass ich nach Jahren des Austobens für die Forscherei noch einmal zu ihnen zurückgekehrt war. Dass ich fast ein Jahr brauchen würde, um die Arbeit abzuschließen, hatten sie aber so wenig kalkuliert wie ich selbst, und irgendwann wird es ihnen gereicht haben. Zumal ich mich manchmal aufführte wie ein verzogener Prinz. Und aus dem, was ich ihnen zu lesen gab, konnten sie nur wenig mehr ziehen als ein Erschrecken vor drastischen Themen und das Gefühl einer vagen Ahnungslosigkeit der Begriffswelt gegenüber, in der da gedacht und geschrieben wurde. Mein gleichzeitig nachdenklicher, langsamer und wacher Vater zog sein Vergnügen aus der Fremdheit, die ihm in meiner Arbeit begegnete, während meine Mutter eine schwere Ungeduld erfasste. Sie fand das alles so unpraktisch, lebensfremd.
Das wissenschaftliche Arbeiten war mühsam. Ich versuchte seine Regeln zu beherrschen, aber sie auch mit meiner Begeisterung für den Unsinn zu verbinden, der darin trotzdem manchmal stattfinden darf, und mit der Ahnung, dass das alles zwar zu keinem Erkenntnisziel führt, aber als Reise, ohne aus dem Haus zu gehen, sehr aufregend sein kann. Und dass sich die Helden des Bildungsbürgertums, die Hochpromovierten, mit der Unsagbarkeit des Wahren genauso beschäftigen wie die Unterhaltungskünstler, die ›dummes Zeug‹ machen. Deshalb stellte ich meiner Arbeit ein Zitat von Hanns Dieter Hüsch voran:
»Hagenbuch hat jetzt zugegeben, dass er, je mehr er sich damit befasse, umso weniger davon verstehe. Und je weniger er davon verstehe, desto mehr befasse er sich damit. So dass, wenn er sich nur noch damit befasse, er gar nichts mehr davon verstünde.«
Mein Tageslauf in den Monaten bis zur Fertigstellung der Arbeit: ausschlafen, Frühstück, lesen und schreiben, kurzer Spaziergang, vielleicht jemanden besuchen, dann weiter schreiben, Abendessen mit den Eltern, noch weiter schreiben. Und spätabends einen Film auf dem Schwarzweißfernseher bei mir im Zimmer, meist DDR-Programm, denn die brachten die älteren Krimis. Aus der Forschungsumgebung tauchte ich zu diesen Filmen wie ein Tiefseeforscher vom Meeresboden ins Hafengelände auf.
Aufregung verschaffte mir eine angekündigte Jahnn-Tagung Ende Mai 1980 in Kassel, auf der ich ein Referat halten sollte, dazu noch einen Artikel schreiben für »Text und Kritik«. Beides brachte mich aus dem Promotions-Trott, aber ablehnen wollte ich natürlich nicht.
Ich hielt ein provokantes Referat. In der Jahnn-Forschung wurden ein paar Themen gern ausgespart oder mythisch verbrämt, zum Beispiel die Faszination des Autors gegenüber Leichen und Verwesung oder die Verherrlichung einer bedingungslosen Knabenliebe. Vor Kurzem war das epochale Buch »Männerphantasien« von Klaus Theweleit erschienen. Es hatte meinen Horizont erweitert und es mir ermöglicht, Parallelen zu ziehen zwischen den gewaltbegeisterten Präfaschisten der zwanziger Jahre und Jahnn, der mit einer ähnlichen psychischen Grundausstattung zum Einzelkämpfer für eine völlig andere humane, pazifistische Welt geworden war. Ein spannendes Spiel, und so wurde es vom Auditorium auch verstanden.
Auf dem Weg zur Promotion …
»Bemerkenswert, ja aufregend« fand »Theater heute«, »was ein junger (noch) Outsider mit Jahnn anzufangen wusste.«
Meine Liebe zu Hans Henny Jahnns Romanen und Dramen hatte bis zu dieser Tagung ein paar raue Zeiten überstanden. Als Schüler war ich von seinen Attacken auf die scheinheilige Bürgerwelt begeistert gewesen und sehr einverstanden mit seiner Gleichsetzung von Triebverzicht und organisierter, hierarchischer Gewalt. Seine Art, Beobachtungen aus der Natur mit seelischen Stimmungen zu verbinden, innen und außen genau zu beschreiben und miteinander zu verzahnen, entsprach meinem eigenen Empfinden, und in der Verzweiflung, die seine Erzählerstimmen oft überkam, fand ich mich wie entblößt wieder. Später dann, in den ersten Semestern an der Uni, lehnte ich solche Selbstentblößung als kleinbürgerlich und ohne Klassenstandpunkt entwickelt ab, als frisch gebackener Marxist war mir meine eigene Zuneigung peinlich. Vieles von dem, was ich mir für meine Doktorarbeit anlas, diente auch dazu, mir mein jugendliches Empfinden neu zu erklären und mir Jahnn als einen wichtigen Autor zurückzuholen. Mit meinem Referat war ich ein erwachsener Wissenschaftler geworden, der aber inhaltlich alle Überhebungen und Maßlosigkeiten der Pubertät rechtfertigte.
Diese Gedanken erreichten auch die gleichaltrige Schauspielerin Regina Schulte am Hülse, die eine Hauptrolle in dem sonst nur von Männern bevölkerten Drama »Pastor Ephraim Magnus« spielte, das in Kassel gezeigt wurde. Wir zogen uns für ein langes Nachtgespräch zurück und fühlten uns wie Gleichgesinnte, von diesem quergeistigen Autor ähnlich aufgerührt. Ich bat sie, über ihre Eindrücke einer jungen Frau als Bühnenfigur und Schauspielerin in Jahnns verquerer Männerwelt etwas zu formulieren und nahm mir vor, aus diesen Gedanken dann das Schlusswort meiner Arbeit zu machen.
Um uns herum tobte das wilde Tagungsleben. Ich konnte nicht anders als manchmal rüberzuhorchen und die Gesprächsfetzen aufzuschnappen. Der Leiter eines Zentralarchivs für Begräbniskultur kam ins Schwärmen über die Gewaltakte der Roten Khmer, begangen von jungen Männern, die für ihn eine Art Naturgewalt darstellten, um in Kambodscha den kapitalistischen Westen noch einmal abzuwenden. Wo bist du hier?, fragte mich die leise Stimme, die meistens bei mir ist. Der selbstempfundene Star der Tagung, Professor Hans Mayer fand vor seinem Vortrag einen Reklamezettel mit ›Keine Feier ohne Meyer‹ im Jackett. Beleidigt wollte er zunächst abreisen, blieb dann aber doch und fragte nach seiner Rede als erstes den Mitorganisator, Jahnn-Forscher Freeman: »Thomas, wie war ich?«
Zwei Menschen lernte ich in Kassel kennen, zu denen der Draht, den man spontan spürt, auch hielt: den Literaturredakteur Wend Kässens und die Dramaturgin Hedda Kage, die die Tagung organisiert hatte. Wie sie extreme Charaktere verband, war eine Kunst für sich, scheue Spezialisten begegneten marktschreierischen Feuilletonstars, an der Mode orientierte Studierende saßen am gleichen Kantinentisch wie Forscher zur harmonikalen Musik des frühen Mittelalters. Mir brachte es ein dankbares Glücksgefühl, in dem Panoptikum mitgemacht und kurz auf dem Treppchen gestanden zu haben, als einer der Modernsten, unbekannt bestaunt.
Bühnenluft geschnuppert zu haben!
Das Leben danach zu Hause wurde lahm und hart. Ich wünschte, meine Arbeit würde sich von selbst schreiben, ihren Ruf hatte sie weg, alles Weitere musste Enttäuschung sein.
Mitte August 1980 war ich fertig mit dem Manuskript. Mein Doktorvater Professor Emrich hatte mir in einem handgeschriebenen Brief mitgeteilt, er sei nach dem plötzlichen Tod seiner Frau wie außer Gefecht und überließe die Abfassung der Dissertation ganz mir selbst. Also schickte ich den Papiertrumm in eine Art luftleeren Raum zu ihm. Jahre vorher hatte er mich, als ich ihm meinen Promotionswunsch vortrug, angezwinkert und ausgerufen: »Ja, wissen Sie überhaupt, wer hier auf Ihrem Platz saß mit gleichem Ansinnen?« – rhetorische Pause, mein Kopfschütteln, Atemholen: »Eine äußerst attraktive Studentin mit Namen Gudrun Ensslin! Dass Sie mir nicht so werden wie die!«
Ich versorgte ein paar Verlage mit meinem Brocken und trampte nach Amsterdam, um am nächsten Tag ein Flugzeug nach Dublin zu nehmen, wo ich mit Meg verabredet war. »Die 500 Seiten liegen knackklug im Osten«, steht im Stichwort-Tagebuch, »Menschenmassen. Gebummelt, angeturnt. Grachten. Mit Neger, Mädchen, allein. In Flipp-Kneipe mit Rashneesh-Rechtsanwalt. 1 Uhr ins Hotel. Krach an der Rezeption (Schlüssel). Unruhig geschlafen.«
Reisen war mein Element. Ich staunte, wie lange ich es am Schreibtisch hatte aushalten können. Meg hatte mich nicht mehr ausgehalten und war schon voraus gefahren nach Irland; ich war ein bisschen aufgeregt, ob sie mich abholen würde oder in den Fängen eines wilden balladensingenden Iren gelandet war. Am Flughafen wartete sie schon mal nicht.
Unsere Liebe zueinander hatte vorsichtig begonnen, und mit gegenseitigem Befragen bremsten wir sie immer wieder ab. Jedes Mal, wenn wir ohne Ablenkung füreinander da sein konnten, wurde eine große Leidenschaft daraus, und wir wuchsen zu etwas Anderem, Neuem zusammen. Das war zum Beispiel auf Kreta passiert, wo ich den Winter 1978 über blieb und Meg mich für zwei Wochen besuchen kam. Dort schon mischten sich allerdings auch andere in unsere Leben ein, die Mitfreaks, denen man beim Überwintern am Strand nicht entgehen kann. Die Keile, die sie zwischen uns trieben, waren schmerzhaft. Wir gewöhnten uns einen Umgang miteinander an, der beiden viel Freiheit ließ, Freiheiten, die man eigentlich so gar nicht brauchte: Bloß kein Besitz des anderen sein. Dann sich lieber schon mal richtig weh tun. Das entwickelte sich fort, als Meg mit dem Studium fertig und nach Berlin gezogen war, mir zwar näher, aber mit streng hochgezogenem Visier, was meinen Freundeskreis betraf. Alle Begegnungen wurden immer wieder neu ausgehandelt. Und beide zogen wir uns manchmal wegen einer Bekanntschaft, eines Techtelmechtels voneinander zurück.
Deshalb meine Aufregung auf dem Flughafen, im verregneten Dublin, wo ich meine Geliebte kurz vor der Schließung der Jugendherberge dann doch noch aufspürte. Sie war eben lange spazieren gewesen. Wir taten beide kühl, aber die Freude ließ sich nicht mehr verheimlichen.
Zielsicher ging es ans westliche Ende der Insel mit Bahn und Bus. Tagsüber Wanderungen in den Bergen, abends das fettige Essen, Bier, Whisky, Musik. Wo wir hockten, spielten Bands, erklang der Rundgesang, standen Leute an den Tischen auf, Frauen, Männer, alt und jung, trugen eine Strophe vor, forderten den Chor heraus, der Saal sang mit, und der nächste Einzelne übernahm. Dank der anfeuernden Neugier meiner Freundin wurde die Reise eine Art Feldforschung zum Stand des Musizierens im bettelarmen Westen der Republik Irland. Wir gerieten von Cliften weiter hoch in den Norden und übernachteten einmal auch in dem Ort Gweedore in einer Musikerpension, geführt von Megs Lieblingsband, einem Familienunternehmen namens Clannad. Ein etwa zwanzigjähriges wuschelköpfiges Mädchen brachte uns morgens das Frühstück. Vielleicht irre ich mich, aber ich behaupte, dass das Enya gewesen ist, die Jüngste im Clan, die eigentlich Eithne heißt und sich ein Jahr später von dort loslöste und ihre Solokarriere begann.
Während Meg die Rundgesänge glücklich machten, verliebte ich mich in die endlosen irischen Balladen. Ein musikalisches Erzählen, das keine Grenze kennt, Detail auf Detail, Zeitebene auf Zeitebene, kein Refrainzwang, Melodie gewordene Freiheit. Schon lange hatte ich für Van Morrison geschwärmt und damit weniger seine knackig-rock’n’rolligen Popsongs gemeint, sondern eher die weiträumigen Meditationen, seine Wikinger- und Keltengeschichten, die er mit ein paar Instrumenten und Grundakkorden auf uns losließ, die Schifffahrten, wo seine Aussprache unentschieden ließ, ob es ins Neblige oder ins Mystische ging.
Ich wusste jetzt, woher er das hatte, und fragte mich manchmal, ob es in meinem Sprach- und Musikraum etwas auch nur vage Vergleichbares wie dieses irische Volkssingen gegeben hat. Der ewige Verweis auf die Nazizeit, die das deutsche Volkslied kaputtmarschiert hatte, ist nicht ausreichend. Ähnlich verheerend haben wohl auch die romantischen Professoren, die Grimms und von Arnims schon gewirkt, indem sie die Gesänge zusammenkürzten und »dem Volk« eine »Seele« einimpfen wollten – in Anführungszeichen, denn was hat das mit Menschen, die tagsüber ihrer Arbeit nachgehen und abends erzählen und singen, zu tun? Dass wir von keiner einzigen Autorin, von keinem Komponisten ›von dort unten‹ einen Namen überliefert bekommen haben, dass die Volksquelle eine gesichtslose Masse geblieben ist, sagt doch eigentlich alles. Und dann noch entkeimt, ›entböst‹, damit die gesammelten Märchen den Bürgerkindern stubenrein angeboten werden konnten?
Glückliches Irland, damals jedenfalls noch. Und zum glücklichen Irland gehörten andererseits natürlich auch die Zuchtanstalten für ›gefallene Mädchen‹, die katholische Enge samt päderastischer Übergriffigkeit. Sinéad O’Connor lebte in solch einem Heim in dem Jahr, als ich Irland zum ersten Mal sah.
Meg kannte die Insel schon länger, und sie war auf dem bäuerlichen Boden dort viel mehr Abenteurerin als zu Haus, geschweige in Berlin. Am letzten Abend tat es ihr ein sensibler Franzose mit Laute und Kussmund so an, dass ich eifersüchtig die Flucht ergriff und bis zum Morgengrauen die Bars der Stadt durchstöberte, mich wie eine Figur aus einem Dubliner Zeitkolorit-Roman der Zwanziger fühlen durfte: verschmäht, versenkt, verwegen.
Nur drei mündliche Prüfungen standen noch an. Gezielt lernen und reden konnte ich, also kam das Musikmachen wie von selbst wieder auf mich zu. Außerdem hagelte es von den Verlagen, die meinen Jahnn-Trumm gewollt hatten, Absagen. 500 Seiten über ein entlegenes Thema? Darauf wartete niemand. Meine Freunde Henner und Burkhard warteten stattdessen auf den dritten Mann, also planten wir eine Tournee. Damals hieß das, heute anzurufen und einen Monat später auftreten zu können. Man lebte noch sehr in den Tag hinein in den Sponti-Kreisen, in denen Trotz&Träume ein Name war. Die alternative Ökonomie war gerade erst am Entstehen. Wir hatten außerdem als Band bei den Veranstaltern im ›Sumpf des Gegenmilieus‹, wie man damals sagte, den Ruf einer unabhängigen Truppe und mussten niemandem nach dem Mund singen, wie manche Stars der Bewegung. Wer uns buchte, wusste, dass es einen musikalischen Rundumflug zu existentiellen Themen geben würde, die alle »Ausgeklinkten« (so einer unserer Liedtitel) berührten: Drogen, Sex, Verlassenheitsängste, Fernweh und Abenteuerlust. Und Hass auf den terroristischen Staat. Denn so kam die BRD in unseren Liedern vor – das von Kanzler Schmidt vor der Welt gepriesene ›Modell Deutschland‹ erlebten wir als eine ›Eisblumenzeit‹, die Nachrichten in der Tagesschau als ›Schweinebotschaft‹, die demokratischen Regularien als Scheingefechte in der Totalen des Profitdenkens. Wir komponierten keine massentauglichen Gegenhymnen, sondern gesungene Geschichten, in denen ein Arbeitsloser aus dem Ruhrpott zu Wort kam oder ein malträtierter Schwuler im Fummel. »Wenn Männer aus der Rolle fallen wollen« hatte unser erstes Programm geheißen. Wir standen ideologisch zwischen der mächtigen Lyrik von Ton Steine Scherben und den harmlosen Kifferliedern der Teller Bunte Knete-Band, die zeitgleich in Westberlin die angesagteste Szene-Truppe war. Auch bei uns gab es Witziges und Rocksongs, aber wir professionalisierten beides nicht, sondern spielten eine Art Folk-Punk: Folk, weil es viel zu erzählen gab, und Punk, weil wir unsere Instrumente nicht ganz richtig beherrschten, aber unbedingt klingen lassen wollten, und zwar laut.
Was mich betraf, fühlte ich mich nach dem abgeschlossenen Studium ziemlich frei, machte auch dem ›Gegenmilieu‹ zu Liebe keine Eingeständnisse und versuchte, die dort gemochten Klischees beim Texten loszuwerden, das, was heute ›political correctness‹ genannt wird. »FJS wär ne Abwechslung, die Grünen hinter Chrom«, lautete eine Zeile in einem Zwei-Akkorde-Rap, den ich im Herbst ’80 über den Kanzlerwahlkampf schrieb und der den Titel trug »Faule Zähne fallen aus dem Mund«. Gerichtet an die selbstgewissen Szenegurus, die zukünftig um Senatsposten buhlen würden. Ich war 30 und wollte ein Punk sein, ein promovierter Punk immerhin.
Auf eine zweite Tourneerunde gingen nur Burkhard und ich im Duo. Zum ersten Mal testeten wir auch kleine Sketche zwischen den Liedern, die wir uns auf den Autofahrten ausgedacht und in Raststätten aufs Papier gekritzelt hatten. Die Reise führte tief in die südwestlichen Land-WGs mit ihren fröhlichen Latzhosen-Frauen, so freundlich und zutraulich und oft so erschreckend ironiefrei. Ähnlich niedlich haben wir aber vielleicht auch gewirkt, der kleine Dickliche am Klavier und der hagere baumlange Gitarrist, nur wenig angekränkelt von Professionalität und dramaturgischer Berechnung. »Was für eine Chuzpe«, flüsterte Dramaturg Christian Stahr vom Stuttgarter Theater der Altstadt nach der Pause begeistert, als wir im letzten Moment noch einen neuen Sketch geprobt, das dritte Läuten überhört hatten und jetzt eilig der Bühne zustrebten.
Wir saßen irgendwo in Franken beim Bier, als wir vom Tod John Lennons erfuhren. Trotz täglich wechselnder Kulisse war uns einsam zumute. Wie schnell so ein Leben vorbei sein kann, wie leicht man es vertat. Dass dieses Herumfahren, Eigenes spielen, Reaktionen auslösen und einheimsen – auch wenn sie manchmal nur von vier Anwesenden kamen –, dass dieses Mühsals- und Misserfolgsspiel mit den plötzlichen unberechenbaren Triumphen darin das reichere Leben sein könnte, dieser Gedanke bildete sich jetzt allmählich in mir aus. Reicher auch im Wortsinn: Nach etlichen Überarbeitungen und Neufassungen war nämlich mein Jahnn-Aufsatz bei »Text und Kritik« erschienen, mit einem Begleitbrief, in dem ein Scheck lag über 120 Mark, einlösbar bei der Postbank. Circa 40 Stunden Arbeit für 120 Mark. Im Wissenschaftsbetrieb als Freier – das bedeutete Hungern auf hohem Niveau.
Zum Jahresende 1980 bündelte ich die neugeschriebenen Lieder und Fragmente und zog mich mit meiner Akai-Tonbandmaschine in mein altes Zimmer bei den Eltern zurück. Ich wollte so viel wie möglich aufnehmen und tat so, als wäre es teure amtliche Studiozeit. Schon seit Jahren gab es immer zur Jahreswende für Freunde ein neues Band mit zehn oder zwanzig Liedern. Ich holte mir damit Lob und Tadel, machte ein paar Menschen Freude und hatte wieder eine meiner Werkphasen festgehalten.
Diesmal plante ich den Einstieg ins Profilager, die Soloplatte – meine Erlebnisse mit dem Publikum hatten mich mutiger und die Studioarbeit für Trotz&Träume in Mikrotechnik und Spieldynamik fitter gemacht. Die neuen Lieder kamen mir konzentrierter vor als alles andere vorher, in jeder Richtung verschärft, intimer und gleichzeitig politisch zupackender. Nur richtig grooven tat nichts davon, das konnte ich partout nicht ändern.
Mit Ulli D. besprach ich das Ergebnis, er würde ab jetzt mein ›Mann für die Öffentlichkeit‹ sein, machte gleich Fotos, wir schrieben zusammen den Infotext, und mit einem Begleitbrief versehen schickte ich die vom Band gezogenen Kassetten an verschiedene Plattenfirmen und Einzelpersonen.
Seit diesem Moment bin ich nie mehr ohne ein nervöses Verlangen am Briefkasten vorbeigegangen. Immer hat etwas an mir gezerrt, die Erwartung einer Antwort auf ein losgeschicktes Angebot oder die Erwartung an mich selbst, mich gefälligst häufiger und besser anzubieten. Wie beschaulich und anspruchslos hatte ich bisher gelebt, wie unbelastet. Aber es gab kein Zurück.
»Du kannst sie kriegen«, dachte ich so deutlich zum ersten Mal, als ich im Januar 1981 mit den zwei anderen von Trotz&Träume in einer Art Dachgeschoss saß, in einer zu Wohnlofts umgebauten Fabrik in Friedenau. Es war der originellste Auftrittsort, den ich je kennengelernt habe. Ein Rundlingsdorf aus Fachwerkhäusern, in der Mitte dieser Platz, auf dem wir neben ein paar Bäumchen in großen Schüttmulden musizierten, und die Zuhörer hockten auf den Terrassen der Häuschen, in Vorgärten und auf Mäuerchen um uns herum, 60 Meter hoch über den Straßen, über uns allen ein beleuchteter Plexiglashimmel, durch den der echte, flugzeugdurchquerte tiefdunkle Nachthimmel schimmerte. Keine Ahnung, ob es dieses Loft noch gibt. Ich beneidete die Bewohner sehr. Und spürte die Kraft, die an diesem Abend von mir aus- und auf die Zuhörenden überging.
Das blieb so auf der nächsten Tour, wo ich an verschiedenen Orten neue Stücke schrieb, zum Beispiel »Zwei Jungs am Hafen« und die »Einstiegsdroge«. Der Himmel über Meg und mir bezog sich mit Gewitterwolken. Sie wurden dichter, als wir, in Berlin zurück, gleich ein Dreier-Konzert im Charlottenburger Hinterzimmer gaben. Da war ich zu ihrem Missfallen der bejubelte Mittelpunkt, was ich in Ansagen und witzigen Bemerkungen über meine beiden Bandkollegen weidlich ausnutzte. Für Trotz&Träume war es der letzte gemeinsame Abend. Der Veranstalter umarmte mich und bot mir hier und jetzt seine Unterstützung an. Es war die Kleinkunstlegende Horst Steffen Sommer und ich empfand es wie einen Adelsschlag. Damit trat sozusagen stellvertretend die altehrwürdige, schon ein wenig ergraute Westberliner Folk- und Nonsens-Szene auf mich zu und akzeptierte mich als ebenbürtig.
Horst Steffen Sommer in seiner Welt
Es wird Zeit, mal einen Blick auf die Westberliner Musikszene der damaligen Zeit zu werfen. So schwarzweiß, wie sie in vielen Erinnerungsvideos und Kultfotos erscheint, war sie nicht, eher ein bunter Flickenteppich von Fraktionen, die sich durchdrangen und trotzdem heftig voneinander abgrenzten. Für alle galt: Vielfalt und Risiko wurden gefördert, existentielle Not für Künstler gab es kaum, gemessen an dem, was wir heute gewohnt sind. Das Feld war weit. Es gab die Elektronik-Bands aus den Sechzigern, von denen einige, Tangerine Dream zum Beispiel, mittlerweile um die halbe Welt konzertierten, und ich konnte mich noch erinnern, sie als Abiturient in einer Dahlemer Schulaula erlebt zu haben. Es gab die blühende Freejazz- und Rockjazzszene, aufgeregte Musik von Spieler/innen, die andauernd ihre Bands wechselten, aus stilistischen und kommerziellen Gründen, ihr höchster Tempel das Quasimodo, wo ich ein paarmal im Publikum gestanden und mir geschworen hatte, dieses Wetteifern auf den Instrumenten sei meins nicht – dann schon lieber solide Klassik. Aus dem Rockjazz gab es Überläufer zum Rocktheater, meist politisch links engagiert, das bekannteste die Lok Kreuzberg, heftige Musik, gewerkschaftsnaher Blick auf Schüler und Lehrlinge, knapp aufklärende Texte. Daneben spielten solide Rockbands wie Bel Ami und Morgenrot, die sich aus dem Schüler-Rock’n’Pop der Sechziger entwickelt hatten und deren höchstes Lob untereinander es war, etwas »amtlich« arrangiert und nachgespielt zu haben. Zwischen ihnen und der Kultband der Anarcho- und Hausbesetzerszene Ton Steine Scherben gab es wenig Ähnlichkeit oder Freundschaft, so wenig wie zwischen uns anarchistisch orientierten Studies und den ›Revis‹, also den Anhängern des ›real existierenden Sozialismus‹ im anderen deutschen Staat. Revis nannten die sich nicht selbst, sondern die studentischen K-Gruppen, die sich an China und Nordkorea orientierten, hatten ihnen den Namen verpasst, der ja behauptete, sie hätten Marx und Lenin ›revidiert‹. Aus diesem K-Gruppen-Feld kamen nur wenige Musiker, aber einige Maler und viele spätere Grüne wie Jürgen Trittin oder Antje Vollmer. Wenn aber Anette Humpe bei Ideal im New Wave-Hymnus ›Ich steh auf Berlin‹ vom »Büro der Partei« singt, ist solch ein K-Ableger gemeint. Die »Neue deutsche Welle« (abgekürzt N.d.W., so die Industriebezeichnung) war Ende der Siebziger das Angesagte, ein Schmelztiegel, einer, gegen den sich fast alle aus den ernsthaften Musikbereichen entrüstet wehrten und sich doch lustvoll in ihn hineinziehen ließen. Flotte Musik, Pogo oder Punk, ergänzt durch Schlagerrefrains und freche, verrückte Texte mit Anleihen aus dem Dada. Die echten Punks, die ein auch geistig obdachloses Leben mit ihrer Musik verbanden, fanden den Stil weicheierig schlecht, die hochgerüsteten Jazzer kümmerlich amateurhaft, Popmusiker und Popper nannten ihn schnöde und billig, aber unwiderstehlich zog der Erfolg der verrückten neuen deutschsprachigen Musik sie alle doch an. Hier konnte man plötzlich tun, was man wollte, es musste nur kurz und frech sein wie neuerdings die Klamotten der jungen Frauen. Irgendwie spiegelte dieser Trend, dessen kunstsinnigster Vorreiter Max Goldt mit Foyer des Arts war, die Insellage der Stadt wider, die Anette Humpe in ihrem Lied so begeistert feierte: In Westberlin gab es seinerzeit für das künstlerische Austoben eigentlich keine existentielle Grenze. Die Mieten radikal niedrig, Fördergelder immer greifbar, ein Publikum zumindest aus dem großen Kollegenkreis garantiert – was sollte passieren? Auch die besseren Liedermacher tendierten schon eine Weile zum Experiment. Die ganzen Siebziger hindurch hatten sie, inspiriert von ihren Vorbildern Mey, Degenhardt und Wader, auf Missstände hingewiesen, Probleme bereimt und vertont. Die Medienöffentlichkeit hatte dem deutschsprachigen Lied mit Anspruch ein Jahrzehnt lang so weit offen gestanden, dass sich mittlerweile jede und jeder Junge mit drei Akkorden auf der Klampfe, einem Thema und einem Reimlexikon in der Hinterhand auf eine Bühne traute. Weshalb die Begabteren gleich Verrückteres wollten, sich politisch radikaler engagierten oder den Übergang ins Rockige versuchten. Für alle drei Spielarten bot die »Neue deutsche Welle« eine Art Rückendeckung: Jetzt konnte man Hardrock mit Poesie so verbinden wie Interzone durch ihren genialischen Sänger Heiner Pudelko, Existentialismus und Unbehaustheit im Schweinesystem so sinnlich besingen wie Ton Steine Scherben durch Rio Reiser, oder sich von den Trends so eigenständig fernhalten wie Ulla Meinecke oder Klaus Hoffmann, aber auch wie die am Rand des Kunstbetriebs arbeitenden Konzeptkünstler.
Das politisch und musikalisch Korrekte war abgesagt, alles im Umbruch, die Lok Kreuzberg