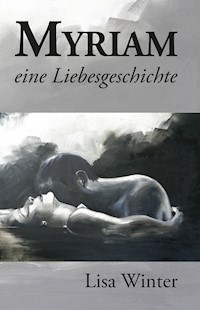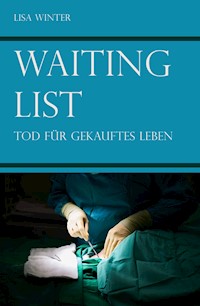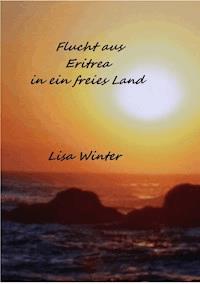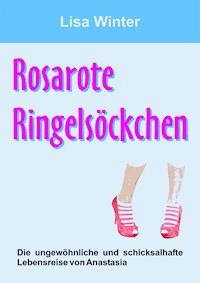10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
LISA WINTER "Der Rinnsteinfischer" (Lesungen mit eigenen Songs zum Roman) Biographischer Debut-Roman über den vermeintlichen "König der Vagabunden", Gregor Gog - von der Großnichte des Hauptprotagonisten, Lisa Winter - mit viel Fingerspitzengefühl geschrieben, verfolgt die Handlung dessen politische Häutungen. Auf der Straße lernt die junge Tochter des Zeitungsmoguls Prosse den Malervagabunden, Hans Tombrock, kennen und lieben. Dieser bringt das junge Mädchen zu Gregor Gog, der mit Frau und Kind in einem Holzhaus auf dem Stuttgarter Sonnenberg lebt. Als der Menschenbesitzer Wilhelm Prosse erfährt, wo sich seine Tochter aufhält, lässt er seine Beziehungen spielen. Diese reichen weit ins nationalsozialistische SA-Milieu hinein und bringen seine Tochter und Gregors Familie in große Gefahr. Die Handlung des Romans bezieht sich auf den Zeitraum Mai 1929 bis November 1931 und spielt in Berlin und Stuttgart. Hauptbeweggründe für die Autorin diesen Roman zu schreiben, waren zwei Bücher, die 1980 erschienen sind: Klaus Trappmann "Landstraße, Kunden, Vagabunden", "Wohnsitz nirgendwo" sowie ihre Bekanntschaft mit Gregor Gogs Lebensgefährtin: Gabriele Stammberger (Michael Peschke "Gut angekommen - Moskau" 1999). Diese inspirierten die Autorin dazu, sich mit dem Enfant Terrible der Weimarer Republik näher zu beschäftigen. Denn in der eigenen Familie wusste man bis dato nichts über den Verbleib des bekennenden Anarchisten (Individualisten). Ausgangspunkt der Handlung des Romans ist der "Internationale Vagabunden-Kongress", den Gregor Gog 1929 auf dem Stuttgarter Killesberg veranstaltete. Dieser sollte den von der Gesellschaft Ausgegrenzten: Vagabunden, Obdachlosen, Speckjägern, Tippelschicksen und Vaganten Mut machen. Obschon nur wenige zum Kongress kamen, schlägt dieser, bis in die heutige Zeit hinein, hohe Wellen. Der Roman richtet sich an den politisch interessierten Leser. Softcover und E-Book erscheinen am 17.06.2024.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lisa Winter
Der Rinnsteinfischer
Lisa Winter
Der Rinnsteinfischer
ROMAN
© 2024 Lisa Winter
Umschlag, Illustration: Alexandra Winter
Lektorat: Pamela Cropp
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland ISBN
Hardcover ISBN 978-3-384-09512-1
e-Book ISBN 978-3-384-09513-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Meinem Großonkel, Gregor Gog, dessen erster Ehefrau, Erna Gog, und deren Nachkommen in Liebe gewidmet.
Inhalt
Cover
Halbe Titelseite
Titelblatt
Urheberrechte
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
ANHANG
Der Rinnsteinfischer
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
KAPITEL I
KAPITEL IV
Der Rinnsteinfischer
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
22
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
Schaut in mein vor Leidenschaft zerfurchtes Gesicht: Es liegt mein Herz im Kopf; erschreckt euch nicht!“
(Lisa Winter: „Märchen des Verlorenen Sohnes“ - Lied)
KAPITEL I
Die sperrige Staffelei, mit der daran angebundenen Palette, schliff über den Boden. Siegi wurden die Arme schwer und ihm war, als wenn die gleißende Sonne seine Gliedmaßen noch mehr in die Länge zöge.
Dreimal waren sie von den Stuttgarter „Schanddarmen*“, wie Hannes immer sagte, schon verscheucht worden; doch heute war es schlimmer als sonst. Aber so kurz nach den „Ersten-Mai-Unruhen“, hätten sie sich das eigentlich denken können.
Hannes trug den vorbereiteten Malkarton, dessen Farbe noch nicht richtig trocken war, achtsam aufgestellt wie ein Schild vor sich her; über dem einen Arm schlenkerte eine abgewetzte Militärtasche, die bei jedem Schritt leise mit Siegis Klampfe* am breiten Band über Hannes anderem Arm zusammenschlug. Ganze dreißig Pfennige hatten sie bislang verdient – doch man sollte die Hoffnung ja nie aufgeben.
Vor den Aushangkästen einer Tageszeitung waberte eine unförmige Menschentraube. Während graue Schatten einander bei den Stellenanzeigen in Fünferreihen auf den Füßen herumtraten und gierig drängelnd einzelne Buchstaben zu erhaschen suchten, fanden die tagespolitischen Seiten weitaus weniger Zulauf. In übergroßen Lettern drangen dort die reißerischen Schlagzeilen in die Köpfe der Leser vor:
„33 Tote bei Mai-Unruhen in Berlin“,- „Die Blutschuld der Kommunisten“,- „Moskau braucht Leichen“,- „Der Louis als Demonstrant.“
Keiner regte sich darüber auf, niemand schmiss die Scheiben ein oder riss gar das gemeine Schandblatt heraus; ein jeder nahm das Geschreibsel für bare Münze, weiter begierig in Richtung Stellenannoncen schielend, ob nicht doch endlich ein kleines Plätzchen frei geworden war.
Der Maler Hannes und Siegi der Musikant schwenkten auf einen freien Platz ein. Siegi, der ein paar Schritte vor Hannes gegangen war, bemerkte nicht, dass sein Freund vor einer Litfaßsäule unvermittelt stehen geblieben war und schlurfte weiter seinen behäbigen Trott.
Bis Siegi bemerkte, dass Hannes nicht mehr hinter ihm war, dauerte es eine Weile.
Im selben Tempo wie er gekommen war, schlenkerte Siegi den Weg zurück und fand seinen Tippelfreund* Hannes völlig verändert vor.
Mit glänzenden Augen starrte Hannes auf eine bestimmte Stelle der Litfaßsäule und dann geschah, was Siegi nie für möglich gehalten hätte: Hannes lächelte
Noch nie hatte er Hannes lächeln gesehen – es wurde ihm offenbar zeitig abgewöhnt, - zuerst als Kind, im qualmigen Ruhr-Kohlenpott und dann unter Tage im Bergwerk. Es sah auch irgendwie verkehrt aus dieses Lächeln. Ein Kopf mit tief in den Höhlen liegenden Augen, ein Totenschädel, lächelte. Langsam hob Hannes den Arm und deutete mit dem Finger auf ein schlecht geklebtes Plakat.
„Das ist meine Litfaßsäule, da steht mein Name drauf“; eng wie an eine Frau kuschelte sich Hannes an die Säule
„Lies vor, Hannes, lies vor“, bat Siegi, obschon er genau wusste, was auf dem Plakat stand, zumal er es selbst dorthin geklebt hatte.
„Kunsthaus Hirrlinger*, Eröffnung der Vagabundenkunstausstellung am 21. Mai um 10 Uhr
Veranstalter: Bruderschaft der Vagabunden*, Schriftführer Gregor Gog
Ausstellende Künstler: Max Ackermann, Gerhart Bettermann, Hans Tombrock und Otto Heim.
Rotation: Vagabunden-Lieder von Gerhart Sigismund, genannt Siegi.“
Jetzt lächelte auch Siegi.
Er lehnte Hannes Staffelei an die Litfaßsäule an, zog eine zerknautschte Mütze aus der Hosentasche und legte sie vor sich auf den Boden.
Schnell hängte er sich bummernd die Klampfe um und sang schief, aber laut und voller Inbrunst:
DAS LIED VON MUTTER GRÜN*
Bei Mutter Grün liegt die Sache ganz einfach,
Bei Mutter Grün gibt es alles umsonst;
Wenn du bei Mutter Grün wohnst.
Uns als deinen uneh’lichen Kindern,
Bietest du als Erbschaft Schnee und Eis,
Bei dir leben ist zwar nicht gesünder;
Im Winter ist es kalt, im Sommer ist es heiß.
Bei dir gibt’s Wanzen, Dreck und Läuse,
Ameisen haufenweis’ und Mäuse.
Doch du gibst uns die Freiheit,
Unsrer Wege zu gehen,
Achtest nicht auf die Kargheit,
In der wir vor dir stehen.
Zu Mutter Grün geht’s hier durch den Wald,
Bei Mutter Grün werden wir alt.
Hannes lächelte nicht mehr. Stattdessen betrachtete er sein Bild. Doch schon war er mit seinen Gedanken wieder ganz woanders: Was wohl nach der Ausstellungseröffnung in der Zeitung stehen würde? „Könner in Lumpen“, oder „Kunst aus dem Rinnstein“, oder..? Ihm wäre wohl noch vieles eingefallen, doch dann fragte er sich, ob sie wohl überhaupt einen Rezensenten schicken würden und stellte die grundierte Pappe auf die Staffelei.
Hannes öffnete seine abgegriffene Tasche und entnahm ihr Palette, Farben, Pinsel und einen winzigen Klapphocker.
Während er seine Farben auf der Palette anrührte, dachte Hannes daran, wem er das Ganze letztlich zu verdanken hatte.
Erst gestern hatte Gregor noch zu ihm gesagt: „Quassel’ nich’ so ville, Hannes, male!“, und hatte ihn einfach stehen lassen.
Früher hatte Hannes seine „Mennecken*“ für ein paar Groschen, einen Teller Suppe oder ein Butterbrot gemalt; meist auf Karton oder Papier, das er akribisch sammelte und hütete wie einen wertvollen Schatz. Anfangs mit Kohle oder Bleistift skizziert, nahmen seine Mennecken dann im Laufe der Jahre immer konkretere Formen an.
Schließlich waren sogar teure Leinwandmalereien entstanden; die Mennecken jedoch blieben immer was sie waren: Armselige kleine Menschlein – Elendsgestalten.
Hannes setzte sich, die Palette in der Linken haltend wie eine Trophäe, vor den grundierten Malkarton und starrte ihn an. Minuten verstrichen, Hannes rührte sich nicht. Nur wenn man es verstand, in seinen Augen zu lesen, konnte man etwas von dem unbedingten Willen seiner Schaffenskraft verspüren, deren Drangsal wie winzige Glühwürmchen ab und an aus seinen Augen hervor sprühte.
Doch im Gegensatz zu anderen Malern, denen der Schöpfungsakt irgendeine Form von Genuss bereiten mochte, litt Hannes dabei Höllenqualen.
Als „Flagellant der Rinnsteinkunst*“ hatte er sich selbst einmal bezeichnet.
Er vergesse dabei Zeit und Raum und immer befände er sich in einer dunklen Höhle, stolpere über halb verfaulte Skelette, Schutt –und Geröllmassen, krieche durch engste Steinschlünde, klettere zittrig über erhabene Felsvorsprünge, deren schroffe Absplitterungen hunderte Meter in die Tiefe rasten, wate durch eiskaltes Wasser und bewege sich mühsam auf einen kleinen Lichtpunkt in der Ferne zu.
Erst wenn er diesen Lichtpunkt erreicht habe, sehe er das fertige Bild vor sich und könne malen.
Plötzlich kam Bewegung in das bleiche Antlitz. Wie in den Wehen krümmte sich Hannes auf seinem Höckerchen zusammen, raufte sich die Haare und stöhnte entsetzlich. Gequollen traten die Adern an seinen Schläfen hervor und bildeten bläuliche Gebirgsketten.
Ein dicker Herr in Knickerbockern und Tweedjacke blieb stehen und wollte der Jammergestalt aufhelfen. Siegi jedoch machte ihm ein Zeichen, dass alles in Ordnung sei und der dicke Herr ging seiner Wege.
Immer mehr Passanten gesellten sich zu dem wunderlichen Paar hinzu. Geldstücke klingelten in der Mütze.
Ein plötzliches Zucken in Hannes Auge verriet seinem Freund Siegi, dass das Spektakel begann.
Palette und Pinsel in Hannes Händen, fingen leicht zu zittern an. Hannes hastete zur Staffelei, tupfte einen Strich, ging ein paar Schritte zurück, stöhnte auf und setzte sich wieder. Kaum hatte er sich hingesetzt, sprang er auch schon wieder auf, rückte das Bild in ein anderes Licht und wandte sich ab.
Mit dem Rücken an der Litfaßsäule lehnend, starrte Hannes auf den Gemüseladen gegenüber und sah doch nichts. Es wirkte, als wenn er gestorben wäre; kein Atemzug trübte die Luft.
Siegi summte derweil sein neuestes Lied.
Unverwandt blickte Hannes weiterhin zum Gemüseladen; zu den üppigen Auslagen vor der Ladentür, zu Schnittsalaten, Möhren und Lauch. Zu der dicken Gemüsefrau, die beide Arme in die Hüften gestemmt, vor ihrem Laden stand und sich fragte, was wohl dieser Menschenhaufen dort drüben zu bedeuten habe.
Siegi kannte Hannes Art zu arbeiten. Es war immer dieselbe jämmerliche Marter. Nicht, dass es ihm etwas ausgemacht hätte, im Gegenteil, seine besten Liedtexte waren ihm eingefallen, wenn er mit Hannes zusammen war. Irgendwie wirkte diese Art der künstlerischen Trance inspirierend auf ihn.
Während Siegi müde mit den Fingern auf dem Bauch seiner Klampfe herum trommelte, drehte Hannes sich langsam herum und schaute das Bild wieder an. Er begann es zu umkreisen, wie der Löwe seine Beute umkreist, langsam, vorsichtig und leise.
Wie auf samtenen Pfoten drängte Hannes die mittlerweile riesige Menschentraube sanft zurück. Immer ausladender wurden seine Kreise, immer ungestümer seine Bewegungen.
Da, ein erneutes Mischen der Farben, gefolgt von einem schnellen Pinselstrich; dann ein kurzes Innehalten und schon wieder drängte es den Maler seine Beute zu umrunden, wieder und wieder bis zum nächsten Farberguss.
Immer wilder und drängender wurden seine Bewegungen, immer ungestümer und zwingender wirbelte er sich und sein Publikum im Kreis.
Ein Tanz war entstanden, in dessen wildem Rhythmus die Passanten mit dem kreativen Brodem des Meisters mit atmeten, bis hin zum nächsten hingeworfenen Schwung des Handgelenkes, der sich leise huschend auf die borstige Verlängerung seiner Hand übertrug.
Und wieder drängten die Bewegungen des fordernden Dirigenten seinem Publikum den eigenen Odem auf, gewaltig, mächtig, durchdringend, immer weiter und weiter, bis die Farbe förmlich aus Hannes herauszurinnen schien.
Er schrie und die Pein übertrug sich auf seine Zuschauer.
Hannes verrenkte sich, malte und die Passanten malten mit, Pinselstrich für Pinselstrich, tauchten mit ein in das Mysterium dieses nebulösen Schöpfungsakts; nahmen teil an den gewaltigen Gefühlen des Schaffenden und wussten doch, dass das alles echt war, was sie hier geboten bekamen.
Besonders ein junges Mädchen, das dem Treiben schon geraume Zeit zugesehen hatte, erlebte Hannes' jämmerliche Anstrengung am eigenen Körper. Wie eine Bombe drohte ihr Herz bei jeder Regung des Malers, beinahe zu zerspringen.
Plötzlich ein jähes Aufbäumen des Künstlers, eine Eruption hektischer Befreiung, ein gleißender Feuerball des schöpferischen Aktes: Hannes malte sein Bild innerhalb von fünf Minuten und ließ sich dann auf sein Höckerchen fallen, um gleich darauf wie tot in sich zusammenzusinken.
Die feinen Haarpinselarbeiten, das wusste Siegi, würde er erst später ausführen, wenn Hannes mit sich und dem Bild im Reinen war.
Es dauerte eine Weile, bis sich das Publikum wieder gefangen hatte. Neugierig betrachteten die Umstehenden das beinahe fertige Werk.
Zögernd und scheu ging das junge Mädchen auf den zusammengesunkenen Hannes zu. Ihr war, als würde sie ihn schon Jahre kennen und das Bedürfnis, ihn tröstend in die Arme zu nehmen und wie ein Kind zu wiegen, stieg ins Unermessliche. Doch wie konnte sie für einen ihr völlig fremden Menschen derartige Gefühle hegen?
Er hatte ihr Innerstes angerührt und irgendeine weit entfernte Sehnsucht war zum Vorschein gekommen, die einen für das junge Mädchen kaum benennbaren Lebenstraum plötzlich zum Greifen nah erscheinen ließ. Doch wie war das möglich…?
„Geht es ihnen gut?“ Sanft legte das Mädchen seine Hand auf Hannes Schulter.
Statt Hannes antwortete Siegi, während er die wohl gefüllte Mütze mühsam in seine Hosentasche stopfte.
„Nee, nee Fräulein, machen s’ sich mal keene Jedanken, dem fehlt nüscht, wenn der malt, ist der immer so, da kann man nüscht machen, wa!“
Verlegen wagte das Mädchen einen erneuten Versuch: „Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen?“
Wortlos starrte Hannes Löcher ins Kopfsteinpflaster. Plötzlich stand er auf, signierte das Bild gewissenhaft mit Tag, Monat, und Jahr, hob es, ohne es noch eines Blickes zu würdigen von der Staffelei herunter und lehnte es mit der obersten Kante der Rückseite an die Litfaßsäule an.
„Ich werde es erst wieder ansehen, wenn es an der Zeit ist“, murmelte Hannes und wollte wieder zurück zu seinem Hocker gehen. Jetzt erst bemerkte er das Mädchen.
Ein „Hallo“, stolperte scheu aus ihrem sinnlichen Mund.
Hannes stotterte verlegen: „Hallo! Stehst du schon lange da, ähm… ich meine, sind Sie schon lange, ähm …?“
Das Mädchen lachte und nickte bestätigend mit dem Kopf.
„Soll ich sie malen? Oder … ähm …?“
Das Mädchen antwortete spontan: „Ja!“
„Was für ein blödsinniger Vorschlag“, brummelte Hannes, von der Situation völlig überrumpelt zu sich selbst und zu dem Mädchen gewandt stotterte er, während er hilflos mit den Armen ruderte:
„Ich meine… ähm, ich kann das nicht. Jetzt nicht, wenn Sie verstehen, was ich meine? Es ist nämlich so…, ähm, so schnell nicht, ähm, ich meine…“, verlegen brach Hannes ab, kratzte sich am Kopf, startete einen neuen Anlauf und sagte: „Tja dann müssten wir uns wohl noch einmal wieder sehen!“
„Und, wäre das so schlimm?“ Sie lächelte beherzt.
Jetzt erst bemerkte Hannes wie hübsch sie war. Von den niedlichen Backengrübchen zog sich eine leichte Röte bis hinauf zu der niedrigen Stirn, auf welcher der Wind ihre weichen braunen Haare zärtlich zerzauste. Der modische Kurzhaarschnitt und die vorwitzige Stupsnase verstärkten den Liebreiz des Mädchens noch. Hell und luftig wirkte ihre Kleidung; sie war vornehm, aber nicht überkandidelt: ein Mädchen aus gutem Hause, wie Hannes vermutete.
„Schlimm, ach nein, warum denn schlimm“, sagte Hannes und warf Siegi einen verzweifelten Blick zu, der dem eines Verdurstenden in der Wüste glich.
„Hannes meint nur“, erläuterte Siegi, plötzlich in einwandfreiem Hochdeutsch, „dass er Sie gerne malen möchte und sich gerne mit Ihnen träfe, nur dass er auf die Schnelle jetzt eben nicht malen könne, weil er sich eben darauf vorbereiten müsse!“
„Ach so, ja, dann, passt es ihnen morgen um drei?“
Und das Funkeln ihrer Augen war es, das Hannes verzauberte.
„Ja! Und wo?“, fragte Hannes unsicher und fühlte sich plötzlich wie Diogenes ohne Tonne.
„Ich würde sagen, am Reiterstandbild im Innenhof des Alten Schlosses“, antwortete das Mädchen.
Hannes wiederholte die Worte des Mädchens monoton und starrte sie aus betörten Augen an: „Am Reiterstandbild im Innenhof des Alten Schlosses um drei, dann, ja!“
„Tschüss dann ihr beiden!“
„Tschüss du eine“, sagte Siegi und pfiff ein munteres Liedchen durch die Zähne.
Hannes ließ sich auf seinem Höckerchen nieder und starrte vor sich hin. Wie konnte ein Mensch nur so bezaubernd lächeln.
***
Heinrich Gurkenthal trottete durch den Berliner Wedding. Genauer gesagt, er stakste einher; den knorrigen Leib in den einzigen Anzug gestülpt, den er besaß, der eine Fuß auf dem Trottoir und der andere auf dem Bahndamm. Dabei stocherte er, auf der Suche nach etwas Brauchbarem, fortwährend mit dem Knotenstock im Rinnstein herum.
In der anderen Hand trug er ein abgegriffenes braunes Köfferchen.
Ein Handlungsreisender zwischen zwei Terminen, hätte man meinen können. Dennoch sah er irgendwie verwegen aus, dieser Heinrich Gurkenthal, dessen braune, von langen schwarzen Wimpern umrahmten Augen, viel zu dicht beieinander standen.
Ein Eindruck, der durch die ineinander übergehenden buschigen Augenbrauen noch verstärkt wurde.
Auf der Oberlippe klebte ein Schnurrbart. Schmal und direkt unter der wulstigen Nase wirkte er nicht sonderlich kleidsam.
Das energische Kinn mit dem ungeliebten Grübchen stand etwas zu weit vor, was er mit einem kleinen Ziegenbart zu kaschieren suchte, der allerdings so viele haarlose Placken aufwies, dass er ihn immer aufs Neue wieder abrasierte. Am liebsten hätte er Vollbart getragen, doch dazu hätte der löchrige Flaum niemals ausgereicht.
Insgesamt wirkte er leicht gedrungen, dieser Heinrich Gurkenthal; der Berliner hätte gesagt, wie ein „abgebrochener Riese“ und das war er auch, in jeder Hinsicht.
Gurkenthals Mutter hatte ihn, kaum dass er dem Uterus entschlüpft war, in einen Backofen gesteckt, ordentlich Feuerung darunter gegeben, jedoch nach einer halben Minute wieder nach ihm geschaut.
Später hatte sie sich oft gefragt, warum sie nicht länger gewartet habe. „Waren es Gewissensbisse, Ahnungen von Jenseitsstrafen oder sonstige unheilvollen Befürchtungen gewesen?“ Sie vermochte es nicht zu sagen.
Kaum dass die Ofentür geöffnet worden war, schien es der noch von der Geburt Geschwächten und über und über mit ihrem Lebenssaft Beschmierten als grinse ihr der glutrote Säugling aus dem Brodem der Feuersbrunst mit Schmerz verzerrtem Gesicht entgegen.
Nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen, riss sie das angesengte Neugeborene aus dem Ofen heraus, legte es vorsichtig in die abgesprungene Emaille-Schüssel, um es notdürftig zu waschen und rieb es von oben bis unten großzügig mit selbstgemachtem Johanniskrautöl ein.
Von diesem Erlebnis nachhaltig gestählt, schien Heinrich zunächst nur ein angesengtes Ohr und vornehmlich an Bauch und Gesäß einige Hautverbrennungen davongetragen zu haben, gegen die auch das Öl nichts mehr auszurichten vermochte. Das nächtliche Röcheln des Kindes war in Kauf zu nehmen und erst, als er laufen lernen sollte, stellte sich heraus, dass er ein Bein für immer nachziehen würde.
Heinrich war das Ergebnis einer Vergewaltigung gewesen; seine Mutter, eine Dienstmagd in Stellung, war von ihrem Dienstherrn nicht nur gewaltig ausgebeutet, sondern bisweilen auch mit der Ehefrau verwechselt worden. Alle Versuche, sich des Kindes im Mutterleib zu entledigen, waren fehlgeschlagen, so dass sich das Problem leidlich auf nach der Geburt verschob.
Nachdem jedoch auch diese Aktion nicht von Erfolg gekrönt war, regte sich das Gewissen der Missbrauchten und sie ging dazu über, im Überleben ihres Kindes eine Art Gottesurteil zu sehen – eine Feuerprobe sozusagen.
Jedenfalls wagte sie nie wieder, Hand an den Jungen zu legen.
Von ihrem Dienstherrn entlassen, war sie fortan gezwungen gewesen, in einer Wäscherei zu arbeiten, was ihr gar nicht bekam.
Als Heinrich acht Jahre alt war, erkrankte seine Mutter fünfundzwanzigjährig an der Schwindsucht*.
Heinrich wurde an seinen Patenonkel Melchior Gurkenthal weitergereicht, den Inhaber einer Devotionalienhandlung in einer kleinen Stadt im Schlesischen.
Dieser hatte einen Jungen im selben Alter und da seine Frau nach einem Reitunfall keine Kinder mehr bekommen konnte, war er froh, einen Spielkameraden für seinen kleinen Emil gefunden zu haben.
Doch die beiden Jungen verstanden sich nicht, was immer wieder Anlass zu Verdruss und Streit gab.
Als Heinrich zehn Jahre alt war, wurde er in die unlauteren Pläne seines Patenonkels eingeweiht: Um den Umsatz der kleinen Devotionalienhandlung seines Onkels anzukurbeln, musste eine fingierte Marienerscheinung her.
Monatelang hatte sein Onkel ein Madonnenbild in einen nahe gelegenen Baum geschnitzt und einen unterirdischer Tunnel für die Blutröhre gegraben. Diese führte vom Wohnhaus des Onkels bis zum Baum. Und der Plan gelang.
Die Madonna blutete zeitweise aus dem Herzen. Eine Obdachlose hatte das Relief im Baum beim Pinkeln entdeckt und war sofort zum Pfarrer des Örtchens gelaufen.
Fortan war der Absatz von Marienstatuetten, Heiligenbildchen und sonstigem Kram gewaltig gestiegen und hatte so den Pleitegeier, der seit langem über dem Geschäft gekreist war, erfolgreich in die Flucht geschlagen. In solch zwiespältigem Umfeld wuchs der kleine Heinrich unbekümmert, aber behütet auf und begriff früh den Unterschied zwischen Sein und Schein.
Der Eingang des Friedhofs flutete in gleißendem Sonnenlicht, aber die letzten Fetzen einer Nebelbank waren in der Ferne noch sichtbar. Die frühe Trauergemeinde hatte sich Hände gefaltet schon dicht um das Grab gruppiert; er war also gerade noch rechtzeitig gekommen, um den einträglichen Leuten zu kondolieren.
Kurz bevor er bei den Hinterbliebenen eintraf, warf Heinrich Gurkenthal noch einen schnellen Blick auf die Todesanzeige aus dem Berliner Tagblatt.
Zwar hatte er die Namen auswendig gelernt, war sich aber nicht mehr sicher, ob es sich bei dem jungen Mann, der neben der tief verschleierten Witwe stand, um einen Neffen oder gar um den Sohn des Verstorbenen handelte.
Gott sei Dank, in der Anzeige stand nichts von Stammhaltern. Diesbezüglich war Heinrich nämlich ein gebranntes Kind.
Als Heinrich Gurkenthal in der Schlange der Kondolierenden endlich an die Reihe kam, fingerte er eine Visitenkarte aus seinem Jackett. Mit den Worten:
„Mein Beileid, gnädige Frau, ein guter Freund ihres Mannes bietet ihnen seine Hilfe an“, drückte er der, unter dem Schleier kaum sichtbaren Witwe, seine Karte in die behandschuhte Hand und verbeugte sich artig. Schnell empfahl er sich und humpelte in Richtung Ausgang davon, bevor noch jemand unangenehme Fragen an ihn zu richten, im Stande war.
In ein paar Tagen, wenn sich die ersten Trauerflusen gelegt hätten, würde er unerwartet bei der Witwe erscheinen und hoffte sehr, diese allein anzutreffen.
Inzwischen würde er sich soviel Wissen über den Verblichenen zugelegt haben, dass er die Rolle des entfernten Bekannten relativ gut spielen konnte.
Es würde nicht lange dauern und die Witwe trennte sich aus purer Dankbarkeit gerne von dem ein oder anderen mit schmerzlichen Erinnerungen an den lieben Verstorbenen behafteten Möbelstück.
Heinrich hatte auf diese Weise schon das wertvollste Inventar ergattert; er brauchte dann nur noch dem Trödelhändler Rudolf Templin die entsprechenden Anweisungen zu geben und konnte in Ruhe sein Honorar einstreichen.
Obwohl Heinrich Gurkenthal bei seinen Schiebergeschäften recht gut verdiente, versuchte er dennoch, so wenig wie möglich von seinem ergaunerten Vermögen auszugeben; er sparte sich alles vom Munde ab, denn die Zeiten waren hart.
Sein Köfferchen, das er meist mit sich herumtrug, enthielt seine gesamte Habe und er hütete es wie seinen Augapfel.
Besonders stolz war er auf seine Compur-Leica. Er hatte sie vor zwei Jahren als Honorar für einen besonders gelungenen Coup eingestrichen. Die Filme für die Kleinbildkamera kosteten zwar ein kleines Vermögen, Heinrich benutzte sie aber auch nur zu ganz bestimmten Zwecken.
Neben der Kamera befand sich noch Rasierzeug, ein kleiner halbblinder Taschenspiegel, ein Stückchen Seife, ein frisch gebügeltes Oberhemd, ein durchlöchertes, verflecktes, aber in Wirklichkeit gewaschenes Oberhemd, eine zerfledderte Cordhose nebst Rabattentretern* und zwei Sätze Unterwäsche, sowie mehrere Orden, eiserne Kreuze und ein verrosteter Orden in dem Koffer.
Nicht dass Heinrich Gurkenthal im Krieg gewesen wäre; die durch den mütterlichen Anschlag ausgelöste Behinderung hatte das erfolgreich verhindert.
Dennoch war Heinrich im Laufe der Jahre dazu übergegangen, die alles entscheidende preußische Frage: „Ham Se’ jedient?“, mit „Ja“ zu beantworten und sein kaputtes Bein zusammen mit dem Eisernen Kreuz dritter Klasse und dem Orden zu präsentieren.
Er hatte die Ehrenabzeichen kurz vor Kriegsende toten deutschen Soldaten abgenommen.
Nur seine wahren Schätze, die Papiere oder Flebben*, wie die Vagabunden sagen, bewahrte er im Geheimfach des Köfferchens auf.
Die Glocke der Schrippenkirche* war weithin hörbar. Heinrich zählte drei Schläge. Eine Viertelstunde noch bis der Gottesdienst begann. Schnell drückte er sich in den morastigen Hinterhof einer Spelunke. Er kannte das Klohäuschen der Destille genau und stellte sein Köfferchen auf den modderigen Abtritt. Er entkleidete sich und legte alle Kleidungsstücke ordentlich in den Koffer. Doch als er sich das löchrige Unterhemd über den Kopf ziehen wollte, fiel der Koffer herunter und sein Inhalt entleerte sich auf den stinkenden Fußboden.
„Mist verdammter!“, schimpfte er. Das würde ihn wieder ein Stelldichein bei der dicken Schreddern kosten, einer ledigen Nachbarin aus dem Hinterhaus. „Na ja, sei’s drum; Hauptsache, die Kamera war heil geblieben!“, dachte er.
Schnell raffte er die schmutzigen Kleider zusammen, tauschte die blank gewienerten Sonntagsschuhe gegen die ollen Treter aus und beeilte sich, noch einen Platz in der Schrippenkirche zu ergattern, ehe noch der einäugige Eugen das Kirchenportal mit lautem Getöse verrammelte.
Der Gestank, der Heinrich Gurkenthal entgegenschlug, als er das Kirchenschiff betrat, war atemberaubend. Jemand drückte ihm einen Zettel in die Hand: „Hausordnung“, stand da in großen Lettern zu lesen.
Die gesamte Kirche war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Heinrich quetschte sich zwischen zwei völlig heruntergekommene Kleiderbettler, die sich offenbar gut kannten und sich über ihn hinweg dauernd Zoten zuflüsterten.
In der Schrippenkirche war versammelt, was Berlins Straßen so zu bieten hatten: Vagabunden, Walzbrüder*, Speckjäger*, Tippelschicksen*, Freigänger*, Wandervögel*, Kriegsbeschädigte, Entwurzelte aller Schichten, sprich Bettler aller Art und Facon.
Freiwillige Helfer verteilten die Segnungen an die Bedürftigen; pro Person zwei Schrippen*.
Die Brötchen mussten allerdings solange auf der Bank liegen bleiben, bis der Choral gesungen war.
„Da hat sich der Schrippenarchitekt*, Bäcker Plempke, vorgestern aber wieder ordentlich ins Zeug gelegt, dass wer uns jetzt det Gummizeugs in de Futterluke* schieben dürfen, wa Piete?“, geiferte der eine Banknachbar über Gurkenthal hinweg dem andern zu und biss grinsend in sein Brötchen.
Mit einer schnellen Bewegung wischte Gurkenthal über seine Wange hinweg, an der die stinkende Spucke des einen klebte. Dazu gab’s Malzkaffee aus gesprungenen Emailletassen, der wie gebranntes Waschwasser schmeckte; anderthalb Tassen für jeden, immerhin!
Da hockten sie nun in der zugigen Kirche! Das Frühstück schmeckte wie „Fußlappen mit Flöhen drin“ und der Gottesdienst schien kein Ende zu nehmen.
Heinrich hielt Ausschau nach Sonka, Hugo Sonnenschein, ein Tippelpoet, der wie sein Name schon sagte, ein sonniges Gemüt hatte; das allerdings nur, wenn er besoffen war und das war er fast immer.
„Schreiben kann ick nur im „illuminierten* Zustande“, sagte er immer und lachte dabei schallend.
Und er schrieb gut, dieser Sonka: Wunderschöne Gedichte von der Tippelei*, von der schönen Natur im Allgemeinen und von den Unbilden des Landstreicherlebens. Doch auch Schmähschriften waren sein Ding.
Hier ging es eigentlich meist um dasselbe: Der böse ausbeuterische Kapitalist saugt dem armen gebeutelten Arbeiter solange das Blut aus den Adern, bis diese leere duckmäuserische Seele aus dem Joch des schmerbäuchigen Menschenbesitzers herauskatapultiert und mit einem Fußtritt in die Gosse befördert wird.
Fortan ist der für die Gesellschaft nur noch fauler Schmarotzer, der Brotrinden aus Müllkästen fischt und weit weniger wert als ein räudiger Hund. Das Ganze noch schön gespickt mit anarchistischen Parolen und der Aufforderung zur Weltrevolution; ja das konnte er gut, dieser Sonka.
Gurkenthal selbst war ein eher unpolitischer Mensch. Bei weltklugen Diskussionen hielt er sich unauffällig im Hintergrund und verdrückte sich beizeiten, wenn er die Möglichkeit dazu sah.
Ansonsten verwies er, was seine politischen Prämissen betraf, auf seine veröffentlichten Schriften, die in Wirklichkeit Sonka geschrieben hatte, und war damit immer gut gefahren. Im Verlag der Vagabunden waren schon zwei Gedichtbände unter dem Namen Heinrich Gurkenthal erschienen. Viel Geld hatte dabei nicht herausgeschaut, doch es war ein Anfang.
„Wenn man nichts ins Geschäft reinsteckt…!“
Der Gottesdienst war zu Ende. Besonders eilig, dem elenden Gemäuer zu entrinnen schien es die Schrumpelgemeinde* an diesem Morgen nicht zu haben. Nur zäh kleckerten die Obdachlosen auf die sonnenüberflutete Ackerstraße hinaus.
Was sollten sie sich auch beeilen, es wartete ja keiner auf sie! Und vielleicht war ja doch die ein oder andere Schrippe noch übrig geblieben?
Gurkenthal wurde von hinten auf die Schulter getippt; es war der grinsende Sonka. Er schien wieder ordentlich gepichelt zu haben. Seine blau geäderte Säufernase leuchtete im schummrigen Licht der Kirche lila. Sonka hielt ihm einen Stapel dicht beschriebenen Packpapiers unter die Nase, zog den Packen aber gleich darauf wieder zurück, hielt die Hand auf und flüsterte:
„Macht zwanzig Mark!“
„Was?“, schrie Gurkenthal empört auf, schlug sich aber sofort mit der Hand auf den Mund, um in gedämpfterem Ton fortzufahren:„Bei dir piept’s wohl!“
„Jut, denn verpfeif ick mir wieder“, drehte sich Sonka pfeilschnell auf dem Absatz um und setzte sich vorsichtig in Bewegung.
Gurkenthal kriegte ihn gerade noch am Schlafittchen zu fassen, wobei der Kragen von Sonkas zerschlissenem Jackett abriss.
„Macht nu' fünfundzwanzig Mark“, feixte Sonka lapidar und streckte Gurkenthal wieder die offene Hand entgegen.
Gurkenthal schmiss den abgerissenen Kragen wütend auf den Boden und brummte in grollendem Ton: „Erst die Flebberei!“
Sonka gab ihm die eng beschriebenen Seiten, die man auch für Klopapier hätte halten können und Gurkenthal blätterte sie durch, kramte nach eingehender Prüfung dann einen Zwanzigmarkschein aus der Tasche seines Jacketts und hielt ihn Sonka widerwillig hin.
„Fünfundzwanzig“, empörte sich Sonka, deutete auf den Kragen und schnappte den Schein. Gurkenthal kramte in seiner Tasche nach einem Fünf-Mark-Stück und schmiss es wütend auf den Steinfußboden, dass es nur so klingelte. Die Münze rollte unter die Kirchenbank.
Behände bückte sich Sonka und rutschte auf den Knien unter die Bänke; er war gar nicht so besoffen wie Gurkenthal zunächst angenommen hatte.
„Na also, geht doch. Die nächste Lieferung kostet übrigens Fünfzig, nur dass du es weißt!“
„Dann aber auch doppelt so ville von dem Geschreibsel da“, erwiderte Gurkenthal.
„Nichts da! Du kannst froh sein, wenn ich Gregor nicht verrate, wer das alles geschrieben hat. Dann würdest du auf dem Kongress ganz schön dumm dastehen“, griente Sonka und verschwand.
Gurkenthal setzte sich erst mal wieder auf die Bank. Ein saures Gefühl breitete sich in seinem Magen aus. Er bekam immer Sodbrennen, wenn er sich ärgerte. In seinem Gehirn überschlugen sich die Gedanken. Wie ein aufgezogenes Uhrwerk war Gurkenthal plötzlich von einer bohrenden Unruhe ergriffen worden.
Er hätte damit rechnen müssen; lange schon ahnte er, dass es irgendwann so weit sein würde. Doch wer hätte bei dem ewig angezechten Sonka ernsthaft mit einer solchen Kaltschnäuzigkeit gerechnet?
„Ick schließ jetze zu, wills’te hier überwintern oder wat“, rief der einäugige Eugen; Gurkenthal erhob sich langsam. Er zitterte und es war ihm, als hätte er nicht Kaffee, sondern Schnaps getrunken. Geistesabwesend schlurfte er zum Ausgang.
***
Anni saß am Küchentisch und rieb sich die Augen. Hinter ihren Schläfen pochte der Schmerz und gemahnte sie, ihrem Körper nun endlich den Tribut zu zollen, den er nur allzu vehement forderte. Sie fühlte sich abgeschlagen und ausgelaugt.
In der Nacht war ein schreckliches Gewitter niedergegangen. Der tobende Sturm hatte einen der Fensterläden aus dem Riegel gerissen. Jetzt wehte nur noch ein laues Lüftchen, doch der Regen prasselte immer noch ans Küchenfenster.
Anni nahm ihn kaum wahr. Wenn sie arbeitete, hörte die reale Welt um sie herum auf, zu existieren. Erwachte sie aus ihrer Trance, kreisten ihre Gedanken meist um ein und dasselbe Thema, schlief sie, war es genauso. Stets dieselbe stumpfe unerfüllte Sehnsucht, gepaart mit der stummen Anklage des eigenen Körpers.
Anfänglich war noch Hoffnung gewesen, dass sich vielleicht doch endlich etwas in ihr rege. Jedem noch so kleinen Ziehen in der Leiste, jedem noch so winzigen Unwohlsein wurde fiebrig nachgespürt.
Doch jedes Mal, wenn sie glaubte, endlich den ersehnten Zustand erreicht zu haben, offenbarte sich ihr wieder wie Gift die rote Wahrheit.
Gregor hatte keine Ahnung von der tiefen Schwermut seiner Ehefrau, von den hadernden Schlachten, die sie mit dem eigenen Leib austrug.
Wie sollte er auch? Tief unten, in der Senkgrube ihrer Seele, hatte sie ihren Kummer vergraben und dort sollte er vorerst auch bleiben.
Anni zwang sich, wieder an ihre Arbeit zu denken.
Vor ihr lag das Manuskript ihres fünften Kinderbuchs. Es war fast fertig. Liebevoll huschten ihre müden Augen über den kleinen Blätterstapel hinweg. Hoffentlich würde es ein Erfolg werden. Sie brauchten das Geld so dringend!
Die Zeitschrift, die Gregor als Leiter des Verlages der Bruderschaft der Vagabunden* herausgab, brachte eigentlich kein Geld ein, meistens arbeiteten sie kostendeckend, wenn überhaupt.
Zwar wurde die Hälfte der Auflage an feste Abonnenten abgesetzt, die andere Hälfte jedoch an die Landstreicher umsonst abgegeben. Überall in den Pennen und Asylen lagen sie aus, die blassblauen, grünen und roten Heftchen mit dem abgerissenen Tramp auf dem Titelblatt, die in zwangloser Folge erschienen.
Die Landstreicher wiederum zeichneten, malten, dichteten oder berichteten von unterwegs und schickten ihre mehr oder weniger ausgegorenen Ergebnisse an Gregor.
Ungeschminkt, unzensiert, nur manchmal auf ein erträgliches Maß gekürzt, erschienen sie dann im Vagabunden: Gedichte, Zeichnungen, Lebensweisheiten, Sprüche, Ankündigungen, Berichte, Aufrufe, Unerhörtes, Überhörtes, Warnungen, Mitteilungen; allem wurde in diesen Heften Raum gegeben.
Natürlich hatte sich mit der Zeit in der Bruderschaft ein harter Kern herausgebildet. Nicht zuletzt durch die Gründung der Künstlergruppe der Vagabunden.
So war auch Hannes zu ihnen gestoßen.
Die Presse schrieb: Gregor fische Künstlertalente aus dem Rinnstein.
Gregor dementierte: Er stärke nur das Selbstbewusstsein von Menschen, die aus der Gesellschaft herauskatapultiert worden sind – das sei alles. Die Künstler selbst seien, was sie seien, aus sich selbst heraus!
Geld brachte das alles aber keines ein! Erst in der letzten Ausgabe des Vagabunden hatte Gregor noch freundschaftlich appelliert: „Wer nichts hat, bezahlt nach wie vor selbstverständlich nichts für den Bezug des 'Vagabunden'! Hast du aber immer noch Geld zum Besaufen, Freund! Hier: Meine offene Hand! Leg einmal hinein, was du sonst versäufst!“
Neben der Zeitschrift brachte der „Verlag der Vagabunden“ auch Flugblätter, Bücher und Streitschriften heraus. Allerdings auch das nur mit mäßigem finanziellem Erfolg, so dass die Bruderschaft auf Annis Buchhonorare dringend angewiesen blieb.
„Komm rein meine Kleine“, hörte sie Hannes Stimme von draußen her. Anni erhob sich schnell, um Hannes zu begrüßen, der pudelnass und in inniger Umarmung mit einer brünetten Schönheit in der Eingangstür stand.
„Betthäschen“ war das erste Wort, das Anni in den Sinn kam, als sie das hübsche schüchterne Mädchen sah, doch augenblicklich schalt sie sich selbst.
Sie hasste ihr schwäbisches Schubladendenken, das doch so oft schon eines Besseren belehrt worden war.
„Der erste Eindruck zählt, merk dir das, mein Kind!“, hörte Anni ihren Vater in ihrem Kopf sagen, doch gerade Anni hatte diese kolportierte Lebensweisheit schon so oft revidieren müssen.
Anni setzte ihr nettestes Lächeln auf und ging mit geöffneten Händen auf das vom Regen völlig durchnässte Mädchen zu.
Sie half ihr, die Jacke auszuziehen, die schmatzend an ihrem dampfenden schlanken Körper klebte. Alles, was sie darunter trug, war ebenfalls völlig durchweicht. „Ich hole Ihnen rasch trockene Sachen!“ Anni spurtete die Treppe hinauf, als Hannes ihr nachrief::
„Ach, das ist übrigens Carola Prosse!“
„Ich komme gleich“, war Annis Antwort.
Anni gefiel das Mädchen, ohne dass sie hätte sagen können, warum. Wie viele Frauen Hannes hier schon angeschleppt hatte, wenn man von seiner eigenen mal absah. Anni schüttelte mit dem Kopf.
Wie kam es nur, dass Hannes so eine Wirkung auf Frauen hatte? Aber diese Claudia, war es Claudia oder…? - Ihr Namensgedächtnis war denkbar mies. Nein, Carola, Carola Prosse - die war irgendwie etwas Besonderes, das spürte sie. Prosse, Prosse, irgendwie kam ihr der Name bekannt vor.
Anni raffte aus ihrem Schrank schnell ein paar Kleidungsstücke zusammen und rannte nach unten.
Auf der Treppe kam ihr der zehnjährige Gregor Junior entgegen, der von allen nur „Frettchen“ genannt wurde. Er stammte aus Gregors erster Ehe mit einer jüdischen Fabrikantentochter. Annis Stiefsohn hielt etwas in der Hand, das wie eine Angel aussah. Am unteren Ende des Fadens hing etwas Grauschwarzes.
„Hat das Fleckchen im Keller gefunden“, berichtete der Junge stolz von seiner Katze und ließ eine vertrocknete Maus dicht vor Annis Nase hin und her baumeln. Gerade wollte er sich geschäftig an Anni vorbeischieben, als sie fragte: „Wo willst du damit hin?“ „Ich lege sie in meine Schatzkiste, dann kann sich das Fleckchen immer daran freuen.“
„Das lässt du schön bleiben“, bestimmte Anni fest. „Du gehst in den Garten und verbuddelst das Vieh, verstanden?“
„Jetzt im Regen?“
„Auf jeden Fall schaffst du mir das Tier aus dem Haus, ganz gleich wohin!“ Der kleine Gregor nickte und trottete mit hängendem Kopf die Treppe hinunter.
Am Ende des Geländers stand schlotternd das Mädchen. Anni drückte ihr die Kleider in den Arm und führte sie in ein kleines Zimmerchen in der Nähe des Eingangs.
„Hier können Sie sich in Ruhe umziehen!“
Anni ging zurück zu Hannes.
„Und du, soll ich dir ein paar Sachen von Gregor bringen?“
„Nein, nein, ich hab doch meine Tasche noch drüben, da werde ich sicher was finden, danke“, erwiderte Hannes kleinlaut und schaute verlegen zu Boden. Mit drüben meinte er das kleine Sommerhäuschen mit der selbst getischlerten Sitzgruppe, auf der er ab und zu übernachtete.
Eine leichte Röte zog sich über die vorstehenden Wangenknochen, als Hannes leicht den Kopf anhob und fragte:
„Ist doch in Ordnung, oder?“ Mit einer kleinen Bewegung des Kopfes deutete er in Richtung der Tür, hinter der Carola gerade verschwunden war.
„Das musst du Gregor fragen, nicht mich. Er muss jeden Augenblick zurückkommen, er ist nur eben zum Nachbarn rüber, ich hab’ zu arbeiten!“
Anni verschwand in der Küche.
Obwohl Anni eigentlich nichts gesagt hatte, kam sich Hannes irgendwie gemaßregelt vor. Bei Anni wusste er eben nie so recht, wie er sich verhalten sollte.
Der Regen war in ein scheinheiliges Nieseln übergegangen, als Hannes ins Gartenhäuschen hinüber huschte, um sich umzuziehen. Als er wieder ins Haus kam, sah er Gregor, beladen mit einer schweren Holzkiste.
„Hallo Grischa“, rief Hannes erfreut, „was hast du denn da Schönes?“
„Nette Futterage*“, antwortete Gregor und wuchtete die duftende Kiste keuchend auf den pockennarbigen Tisch.
Hannes kiekte vorsichtig über den hohen Rand hinweg. Was er sah, ließ etwas, das man entfernt für ein Grinsen hätte halten können, auf seinem fahlen Totenantlitz aufblitzen:
„Boh, Fettlebe* gibt’s“, orgelte er und holte sofort seinen Zeichenblock heraus. „Euer Fettigkeit“, verbeugte sich Hannes tief vor der Kiste, denn so viele Würste, Schinken, Speck und Fleisch auf einem Haufen würde er doch in seinem ganzen Leben nie wieder so nah zu Gesicht bekommen! Mit schnellen Strichen zeichnete Hannes ein Bild auf seinen abgeschabten Block.
„Hat mir der Nachbar geschenkt! Seine Frau hat ihn samt den fünf Kindern verlassen.
Armer Kerl. Gestern erst hatten sie noch geschlachtet und heute ist sie weg und hat die Kinder mitgenommen.
Soll er nun das ganze Zeug alleine essen? Also hat er es uns einen Großteil davon geschenkt, ist doch nett, nicht wahr?“
Die Tür zum Nebenraum öffnete sich einen Spalt und eine zarte Mädchenstimme rief verzweifelt: „Hannes!“
Hannes rannte sofort zur Tür, nahm das Mädchen am Arm und führte sie zu Gregor.
„Das ist Carola Prosse“, und mit leuchtend stolzen Augen streichelte er fahrig über ihr feuchtes dunkelblondes kurzes Haar.
„Setzen sie sich doch“, nickte Gregor ihr zu. Schüchtern rutschte Carola auf die Eckbank. Hannes schob sich daneben und legte den Arm um sie.
Lange betrachtete Gregor das Mädchen.
Es war einer jener brennenden, beinahe hypnotisierenden Blicke, mit denen er den Menschen, die mit ihren Problemen zu ihm kamen, versuchte in die Seele zu schauen. Äußerlichkeiten interessierten ihn dabei wenig, meist nahm er sie gar nicht wahr; es sei denn sie hatten etwas mit dem inneren Zustand seiner Schützlinge zu tun.
Immer mehr sank Carola in sich zusammen. Beruhigend drang Hannes auf sie ein:
„Hier bist du in Sicherheit. Dein Vater kann dich hier nicht finden!“
Gregor sagte nichts und schaute das Mädchen nur weiter unverwandt an.
Es dauerte eine Weile, bis Carola Mut fasste, aufzublicken. Als sie es endlich tat, da war es ihr, als ob sie eine Woge der Geborgenheit umfange.
Tief lagen Gregors wasserblaue Augen in den Höhlen, über denen sich eine hohe, von zwei tiefen Geheimratsecken gezierte Stirn verbreitete.
Die gepflegte Haarlocke des Stirnwirbels seitlich nach hinten gekämmt, stand ihm eigentlich nicht so recht; genauso wenig wie der kleine struppige Schnurrbart auf der schmalen Oberlippe, das energische Kinn, und die abstehenden Ohren.
Und doch harmonierte alles miteinander, bis hin zur wohlgeformten Nase, von der aus sich zwei tiefe Lachfurchen rechts und links der Mundwinkel eingegraben hatten, ein Gesicht, das man einmal gesehen, so schnell nicht wieder vergaß.
Alles in Gregors Gesicht schien „Willkommen“ zu sagen. Da war kein falsches Verlangen in diesem Blick, kein geringschätziges Abkanzeln ihres Äußeren, nur Neugierde und ein zugewandtes, ehrliches Wesen, das ihr Vertrauen einflößte.
Gregor schwieg noch immer und stopfte lächelnd „sine Pipe“. Fasziniert folgte Carola jeder Bewegung seiner Hände. Das waren keine rissig rauen Arbeiterhände, die den Tabak in die Höhlung stopften, kräftig zwar, aber doch auch zart und die Anmut ihrer Bewegungen wirkte ungeheuer beruhigend auf sie.
Plötzlich hatte Carola das Gefühl, diesen Mann schon eine Ewigkeit zu kennen und dabei hatte sie doch noch kein Wort mit ihm gewechselt.
Im Gegenteil, alles Verbale hätte dieses stille Einvernehmen nur gestört.
Begierig, diese schweigende Übereinkunft noch weiter auszukosten, fühlte Carola sich gestört, als die Küchentür geöffnet wurde und Anni mit einem Wäschekorb unter dem Arm eintrat.
„Nanu, Gregor, du bist zurück, ich habe dich ja gar nicht gehört“, streute Anni im Vorübergehen in die kleine Runde und steuerte auf die Kiste zu, die am Ende des Tisches stand und einen unwiderstehlichen Duft ausströmte.
Direkt daneben lag Hannes Zeichnung.
„Das ist ja wunderbar“, war Annis Kommentar dazu. Allerdings war nicht genau auszumachen, ob sie nun die Zeichnung oder den Inhalt der Holzkiste meinte.
„Wahrscheinlich“, mutmaßte Gregor, „meinte sie die Würste und Schinken.
Sie war immer schon materialistischer gesinnt gewesen als er. Aber vielleicht ganz gut so, denn wäre es in der Vergangenheit immer nach Gregor gegangen, wären sie wahrscheinlich schon längst verhungert.“
Anni holte Carolas nasse Sachen aus dem Nebenzimmer und verschwand wieder in der Küche. Durch die geschlossene Tür rief sie: „Es gibt übrigens gleich Frühstück!“
Carola stand schnell auf und huschte in die Küche.
Kaum war das Mädchen in der Küche verschwunden, fragte Gregor: „Wer ist sie?“
„Carola heißt sie, Carola Prosse.”
“Wie alt?“
“Einundzwanzig Jahre!”
„Hast du was mit ihr?“
Hannes erwiderte trotzig:
„Wenn du’s genau wissen willst? Ich nehme sie mit. Wir machen rüber nach Bremerhaven und von dort… Sie ist von zu Hause weggelaufen! Ihr Vater ist ein Tyrann, er…“
Hannes brach hilflos ab.
Wütend stand er auf und schrie: „Mein Gott, sind wir hier bei der Inquisition oder beim Kommiss?“
Gregor blieb ganz ruhig.
Er kannte Hannes unkontrollierte Anwandlungen nur zu gut. Erst letzte Woche war Hannes wutentbrannt und Türen schlagend mit den Worten:
„Ich komme nie mehr wieder“, aus dem Haus gerannt, aber bereits nach einer Viertelstunde kleinlaut zurückgekehrt.
Gregor stand langsam auf, nahm Hannes Zeichnung in die Hand und betrachtete sie anerkennend; wie beiläufig, als wäre das, was er sagte gar nicht wichtig, ließ Gregor im Vorübergehen fallen:
„Die verdirbst du nicht auch noch. Mein Entschluss steht fest, das Mädchen bleibt hier!“
Hannes kochte und schrie:
„Das kannst du nicht machen!“
Und ohne den Blick von der Zeichnung zu wenden fuhr Gregor fort:
„Und wie ich das kann! Schließlich hast du sie hierher gebracht, also trage ich jetzt die Verantwortung!“
Hannes drohte überzukochen, sein linkes Auge zuckte bedrohlich: „Ich denke nicht dran, auf Caro zu verzichten“, brodelte er weiter.
„Das wirst du wohl müssen, mein Lieber.“
„Das kannst du nicht machen“, wimmerte Hannes hilflos:
„Sie ist volljährig und wir tun was wir wollen!“
Jedoch wusste Hannes genau, dass er gegen Gregor keine Chance hatte.
„Junge, ich rate dir, geh zu deiner Frau und lass dich hier erst mal nicht mehr blicken! Ich will nicht, dass du dem Mädchen noch mehr Hoffnungen machst.
Am besten du verschwindest gleich morgen früh. Um alles andere kümmere ich mich!
Und wie kommst du eigentlich auf die Idee, jetzt so kurz vor dem Vagabundenkongress und der Ausstellung sang und klanglos zu verschwinden? Mensch, ich brauch’ dich doch, Hannes!“
Ein hilfloses Bündel erwiderte kleinlaut:
„Die Liebe halt, aber bitte“, flehte Hannes mit hängenden Schultern, „verrate Gerda nichts davon.“
„Den Teufel werde ich tun“, antwortete Gregor und legte die Zeichnung wieder neben die Kiste.
***
Jo fröstelte in ihrem seltsamen grünen Lodenmantel, den ihr noch die Großmutter zusammen mit dem merkwürdig geschnittenen Sackkleid geschenkt hatte und das mittlerweile so zerschlissen war, dass man an einigen Stellen durchsehen konnte.
Sie zog die Arme näher an den Körper heran, um sich vor dem eisigen Wind zu schützen, der ihr die Tränen in die Augen trieb.
Vor ihr lag der Danziger Hafen und die See glitzerte im Sonnenschein, als bestünde sie aus Milliarden Diamanten.
Den fauligen Fischgeruch, der wie ein modriger Schleier über dem wuseligen Gestade dünstete, nahm Jo schon gar nicht mehr wahr; zu viele Häfen hatte sie bereits abgeklappert.
Zwanzig Schiffe lagen an diesem Vormittag vor Anker; überwiegend deutsche und polnische Handelsschiffe, wenige skandinavische Linienschiffe, doch auch ein polnisches Kriegsschiff lag dort. Draußen in der Bucht schaukelten Fischkutter gemütlich in der Sonne.Jo hielt Ausschau nach dem Blauen Peter*, einer Flagge, die anzeigte, welches Schiff am selben Tag noch auslaufen würde. Bei denen wollte sie anfangen.
Im Näherkommen schlug ihr ein deutsch-polnisches Stimmengewirr entgegen, das an Lautstärke nur noch von den dröhnenden Signalhörnern der Schiffe übertroffen wurde.
Die polnischen Hafenarbeiter sprachen nur mit ihren Landsmännern polnisch; mit den Deutschen hingegen wurde ausschließlich Deutsch gesprochen.
Den umgekehrten Fall gab es eigentlich kaum.
Seit der Zollunion durfte Polen den Hafen für Ein –und Ausfuhren in vollem Umfang nutzen. Ein Umstand, der den meisten Einwohnern dieser „Perle der Ostsee“ piekend im Auge stak.
Jo suchte nach einer Möglichkeit, sich etwas frisch zu machen und fand einen kleinen Brunnen mit einem sabbernden Heiligen. Sie krempelte die Ärmel hoch und genoss das kühle Nass, während ihr Magen ein dunkles Grummeln vernehmen ließ.
Ihr letztes Geld hatte sie schweren Herzens in die Zugfahrkarte gesteckt; doch durch den polnischen Korridor zu tippeln*, wäre nur für Lebensmüde infrage gekommen.
Die andere Möglichkeit, sich wie die amerikanischen Tramps unter den Zug zu hängen, wäre einem Selbstmord gleichgekommen. Die polnischen Grenzer untersuchen die Züge von innen und außen mit Schäferhunden und wen sie zu fassen bekamen, dem gnade Gott.
Jo trocknete sich notdürftig das Gesicht mit dem Ärmel ihres Mantels ab und beschloss, sich schnellstens ans Werk zu machen, denn sie konnte ja nicht wissen, wann die Schiffe auslaufen würden.
Ihr Äußeres war ihr dabei relativ gleichgültig. Hauptsache, sie fühlte sich wohl in ihrer Haut.
Man hätte Jo nun nicht unbedingt als Schönheit bezeichnen können, als attraktive Frau aber allemal.
Eine kurze Stirn über der kleinen knubbeligen Stupsnase gelegen, dazwischen zwei strahlend blaue Augen, in deren Tiefe sich schon so mancher Mann verloren hatte.
Wäre der Mund nicht so breit ausgefallen, wäre sie bestimmt öfter Gefahr gelaufen, auf der Landstraße überfallen und vergewaltigt zu werden.
So aber, beschmierte sie sich einfach die Wangen mit Asche und war, ihrer burschikosen Ausstrahlung wegen, im Dunkeln nicht mehr von einem Jungen zu unterscheiden.
Die kurzen roten Haare, die über der Stirn in einem geraden Pony abbrachen, taten ein Übriges.
Hielt sie sich in Hafenvierteln auf, setzte sie meist noch die Matrosenkappe mit den Mützenbändern auf, so dass sie die meisten für einen Moses* halten mussten. Die Mütze hatte sie während des Krieges in einer Höhle neben einem toten Matrosen gefunden. Wie Wachs, rittlings über einen glatten Findling geschmolzen, war er dagelegen; ähnlich einem Kunstwerk der Anklage, mit weit aufgerissenen panischen Augen in dem schön geschnittenen überdehnten Gesicht. Wahrscheinlich war er desertiert, aufgespürt und erschossen worden.
In so mancher Nacht war sie von seinem toten Antlitz verfolgt worden, wenn er in ihrem Traum zu neuem Leben erstanden war.
Einmal hatte die Leiche sie sogar geküsst; schreiend war sie aufgewacht und hatte sich kaum getraut, wieder einzuschlafen.
Später hatte sie dann das goldene „S.M.S.“, das für „Seiner Majestät Schiff“ stand – die ja nun in Holland weilte, mit einem kleinen Stückchen Stoff überklebt.
Jemand tippte Jo von hinten auf die Schulter. Blitzschnell drehte sie sich um.
Vor ihr stand ein Mann so um die Fünfzig, schütteres, mittelgraues Haar, Stirnglatze. Er trug einen dunkelbraunen Einreiher und führte einen Dackel an der Leine mit sich.
„Elfriede, Elfriede Kurländer?“
Jo stutzte und fühlte sich unangenehm an eine Zeit erinnert, die sie versucht hatte abzustreifen, wie man ein altes ungeliebtes Kleidungsstück abstreift. Dennoch, der Name allein hatte seine eigene Magie. Plötzlich war sie wieder das kleine Mädchen mit den langen fest geflochtenen Zöpfen in dem blau-weißblauen Matrosenkleid auf dem Weg zum Lyzeum.
„Ja“, antwortete sie vorsichtig und versuchte, wie in Trance im Gesicht des Mannes eine Antwort zu finden.
„Ich bin Studienrat Kartovski“, sagte der Mann, griff in sein Jackett und brachte ein abgegriffenes Zigarettenetui zum Vorschein, öffnete es und hielt es ihr vor die Nase, so wie man einem Hund einen Knochen hinhält.
Sie nahm eine Zigarette, nickte und steckte sie in ihre Brusttasche.
„Erkennen Sie mich denn nicht?“
„Nein!“
„Studienrat Kartovski vom Lyzeum in Schneidemühl*! Sie müssen sich doch erinnern!“
„Muss ich das?“
Jo ließ ihren Blick über die Hafenmole schweifen und suchte krampfhaft nach einer Möglichkeit, um diesem Menschen zu entrinnen, der sich allerdings als äußerst hartnäckig erwies.
Als er jedoch vorschlug, sie zum Frühstück einzuladen, war das Loch in ihrem Magen größer als das Ungemach ihrer Seele und nach längerem hin und her, stimmte sie lauernden Blickes zu.
Essen wollte sie, aber reden wollte sie nicht. Was sollte sie diesem Spießer auch erzählen?
Dass sie jetzt schon elf Jahre auf der Landstraße lag, das konnte man ohnehin an ihrer Kleidung erkennen; dass sie sich als Tänzerin im Tingeltangel, im Zirkus und auf der Straße gerade mal so durchschlug und wenn es sein musste, auch betteln ging. Dass ihr Körper sich in Ausdruckstänzen krümmte, denen sie Namen gab wie: „Soldat“ oder „Flächenbrand“, „Blume im Hinterhof“, oder „Talmudschüler“.
Dass sie den Krieg und alles was damit zusammenhing hasste und bekämpfte wie nichts auf der Welt.
Dass sie auf der Suche war…
Ja, wonach suchte sie eigentlich?
Nach Billy? Sicher, das war ihr Ausgangspunkt gewesen, die Sehnsucht nach ihm ihr Antrieb.
Doch irgendwann war aus Billy nur noch eine graue Erinnerung, eine verblasste Fotografie in ihrem Rucksack geworden, die sie herumzeigte, immer in der Hoffnung, dass ihn vielleicht doch irgendjemand irgendwo einmal gesehen haben könnte.
Doch was hätte sie diesem abgetakelten Studienrat erzählen können, was nicht in seinen Augen einer einzigen großen Blamage gleichgekommen wäre? Sie wusste es nicht; also schwieg sie.
Das war aber eigentlich nicht schlimm, denn Studienrat Kartovski, mittlerweile Oberstudienrat, sprudelte dafür wie ein Wasserfall.
Von der haarsträubenden „Polackisierung“ dieser wunderschönen Stadt Danzig schwadronierte er, und dass man durch die Schmach des „Versailler Schanddiktats“ vom geliebten Vaterland völlig abgeschnitten sei; dass ihm das Wort „Freie Stadt Danzig“ wie blanker Hohn erschiene und ihre gemeinsame Heimatstadt „Schneidemühl“ nun beinahe den Polacken in die Hände gefallen wäre.
Allerdings habe Gott noch ein Einsehen gehabt und es habe sich durch die Volksabstimmung eine einvernehmliche Lösung finden lassen.
Nicht erwähnte Kartovski, warum er Schneidemühl so schnell hatte verlassen müssen und wie viel Geld es ihn gekostet hatte, die richtigen Leute zu schmieren, damit die Geschichte mit dem minderjährigen Mädchen nicht dem Direktor zu Ohren kam.
Stattdessen kam er auf sein zweitliebstes Thema zu sprechen: das „Zigeunerpack“ in Schneidemühl.
Jo, die schon geraume Zeit auf dem harten Stuhl unruhig hin und her gerutscht war, wickelte ihr drittes Brötchen, das sie sich gerade dick mit Wurst belegt hatte, in eine Serviette und dachte inbrünstig an Flucht.
Kartovski beachtete sie gar nicht und setzte seinen Redeschwall unvermindert fort:
„Ha, dieses Gesocks bekommt jetzt von den Braunen ganz gewaltig eins oben druff und ich sage ihnen ganz ehrlich, am liebsten würde ich noch mitmachen.
Und was hat diese dreckige Brut auch dort verlo- ren?
Wie die Heuschrecken sind die ja über Schneidemühl hergefallen; nichts arbeiten wollen, klauen wie die Raben, unsere Frauen vergewaltigen und dann auch noch Ansprüche stellen. Ein Bleiberecht wollten die haben – Bleiberecht, wenn ich das schon höre. Aber der Hitler wird da nicht lange fackeln, das kann ich ihnen flüstern. Wenn der erst mal dran kommt, da weht eine andere Brise; Wind von vorn! Ein feiner Mann, dieser Hitler, wirklich ein feiner Mann!“
Jo war mit einem solchen Ruck aufgestanden, dass der Kaffee in Kartovskis Tasse überschwappte. Blitzschnell schnappte sie sich das Brötchen, murmelte etwas von:
„Mir ist schlecht“, und verließ Türen schlagend das Lokal.
Kartovski schaute ihr verdutzt nach.
„Das ist nun der Dank“, murmelte er und wandte sich der Pfütze auf seinem Unterteller zu.
„Sitz Willi, sitz!“, zischte Kartovski und zog seinen Hund, der gerade auf dem Weg zum Nachbartisch war, auf dem es verlockend nach warmen Würstchen duftete, brutal an der Leine zurück.
Schade, und dabei hatte er sich doch gerade erst warm gelaufen.
Kartovski, seiner Ansicht nach ein Philanthrop durch und durch, liebte es ausgesprochen, seinen rhetorischen Ergüssen zu lauschen.
Nur schade, dass man dazu immer ein Gegenüber brauchte. Und diese Elfriede Kurländer? Gut, der Krieg hatte alle verändert, aber eine Frau, die ein bisschen auf sich hielt, lief doch nicht so herum. Und dabei stammte sie doch aus gutem Hause. Gut, eine Künstlerfamilie; Mutter Leiterin einer Musikschule in Berlin, aufgewachsen bei der Großmutter; war der Großvater nicht sogar Hauptmann gewesen oder sonst was Höheres? Immerhin…! Nur dunkel konnte er sich erinnern.
Jo war wieder zum Hafen zurückgegangen.
Zwei der Schiffe mit dem Blauen Peter waren schon ausgelaufen – ausgerechnet die Handelsschiffe.
Musste ihr auch die „Kartoffel“ über den Weg laufen, so hatten sie ihn im Lyzeum immer genannt;
„Die Kartoffel mit den tausend Augen“.
Er unterrichtete die oberen Klassen in Erdkunde und Geschichte. Immer schaute er, wenn er Pausenaufsicht hatte, den Mädchen nach.
Manchmal ließ er die ein oder andere, die ihm gefiel, - es waren meist blonde und blauäugige - aus unerfindlichen Gründen nachsitzen, setzte sie vorne in die erste Reihe, und positionierte sich direkt davor.
Waren die Mädchen dann genügend in ihre Aufgabe vertieft, rutschte er auf seinem Sitz so weit nach unten, dass er ihnen bequem unter die Röcke schauen konnte.“
Jo ärgerte sich grün über sich.
Sie fühlte sich wie Judas, doch statt der dreißig Silberlinge waren es nur drei Wurstbrötchen gewesen, für die sie beinahe ihre Ideale verraten hatte.
Diesmal war es nicht der Hunger, der in ihrem Bauch grummelte, sondern der Ärger.
Warum war sie nicht aufgestanden, hatte der Kartoffel seine Mistbrötchen ins Gesicht geschleudert und gerufen: „Dem Volk der Sinti und Roma kannst du nicht das Wasser reichen, du kriechender kleiner Faschistenwurm!“
Was waren das für Beklemmungen, die da plötzlich in ihr aufstiegen?
Warum wurde sie in seiner Gegenwart wieder die kleine Elfriede mit den Zöpfen, sie, die sich doch sonst so tapfer und unerschrocken durchs Leben schlug.
Was waren da für unsichtbare Mächte am Werk, denen sie sich dermaßen wehrlos ausgeliefert fühlte, dass sie ihr die Sprache verschlugen.
Sie wollte nur noch weg aus Danzig. Raus aus diesem Spießertopf. Sie nahm ihren Rucksack ab, kramte Billys Bild heraus und ging schnurstracks zu dem einzig verbliebenen Handelsschiff, das noch im Hafen lag. Hafenarbeitern, Matrosen, Lagerarbeitern, Handlangern, Kombüsenjungen, allen hielt Jo die vergilbte abgegriffene Fotografie aus dem Jahr 1918 unter die Nase.
Sie zeigte einen jungen Matrosen, hoch aufgeschossen, schlank, mit schmalem Gesicht, Seitenscheitel und in Uniform; die Lippen so schmal wie Hafensaiten, eigentlich ein sehr femininer Mann.
Meistens fragte sie:
„Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen?“, „kennen Sie den“ oder „sind Sie dem schon mal begegnet?“
„Wie soll der heißen?“
„'Billy Bow' ist sein Name, doch die meisten nennen ihn bei seinem Spitznamen, 'Trudchen'“.
Im Allgemeinen folgte dann ein langes und ausgiebiges Hohngelächter und Gepruste hinter vorgehaltener Hand, doch wen sie auch fragte, niemand kannte ihn.
Womöglich war er in diesen letzten Kriegstagen, da seine Briefe ausblieben, ja doch noch gefallen; langsam musste sie sich wohl mit der Möglichkeit abfinden.