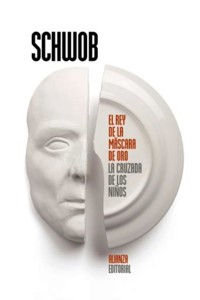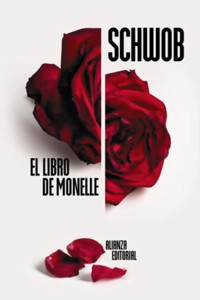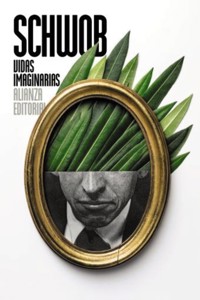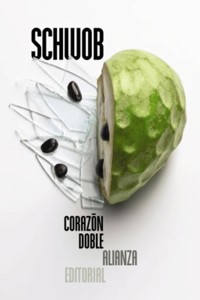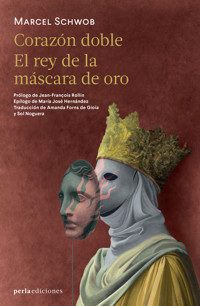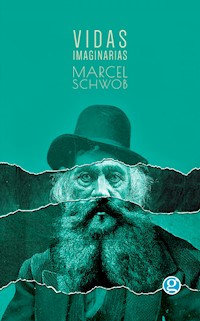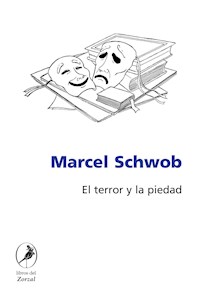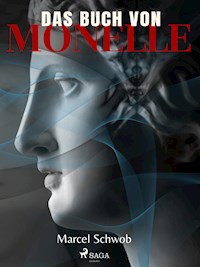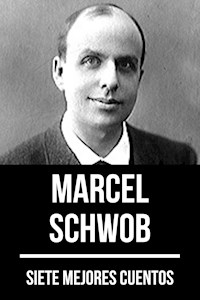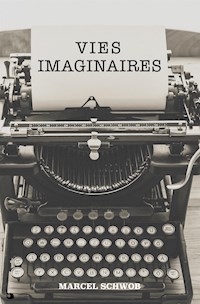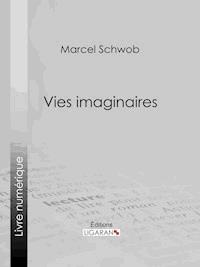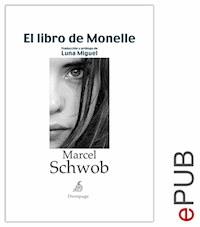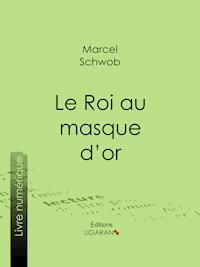Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marcel Schwobs berühmten imaginären Lebensläufe: Das Genre der Biographie damit bis zu seinem Äußersten überdehnend, suchte Schwob sich ihm interessant erscheinende Figuren, wie Lukrez oder Empedokles, und schrieb ihnen neue Lebensläufe. Entstanden ist dabei ein eigenwillig-faszinierendes Werk des französischen Autors.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcel Schwob
Der Roman der zweiundzwanzig Lebensläufe
Saga
Der Roman der zweiundzwanzig Lebensläufe ÜbersetztJakob Hegner Coverbild / Illustration: Shutterstock Copyright © 1896, 2020 Marcel Schwob und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726594430
1. Ebook-Auflage, 2020
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
DER ROMAN DER ZWEI
UND ZWANZIG LEBENSLÄUF
VORWORT
die geschichte als wissenschaft lässt uns über den Einzelmenschen im unklaren. Sie begnügt sich damit, die Umstände aufzuhellen, die ihn mit dem allgemeinen Geschehen verbinden. Sounterrichtet sie uns,daß Napoleon am Tagvon Waterloo unpäßlich war, daß die übermächtige geistige Tatkraft Newtons seiner unerschütterlichen Gefühlskargheit zuzuschreiben ist, daß Alexander betrunken war, als er den Klitus erschlug, und daß das Fistelgeschwür Ludwigs XIV. möglicherweise manche seiner Entscheidungen beeinflußt habe. Auch Pascal stellt seine Betrachtungen über die Nase der Kleopatra nur in einer Richtung an: wenn sie kleiner gewesen wäre, und ebenso über ein Sandkorn in der Harnröhre Cromwells. Alle diese Einzeltatsachen haben so viel Geltung, wie sie Einfluß auf die Ereignisse hatten oder insofern sie deren Gang vielleicht hätten abändern können. Sie sind wirkliche oder mögliche Ursachen. Sie gehören in das Gebiet der Wissenschaft.
Die Kunst widerstrebt den Allgemeinbegriffen, sie stellt nur Einzelwesen dar, will nur das Einmalige. Sie reiht nicht ein; sie reiht aus. Von uns aus gesehn, könnten unsere Allgemeinhegriffe den auf dem Mars üblichen gleichen, drei einander schneidende Gerade ergeben überall im Weltall ein Dreieck. Dagegen ein Baumblatt mit seinem eigenwilligen Nervengewebe, seinem Farbenspiel in Licht und Schatten, mit seiner Schwellung, vielleicht durch einen fallenden Regentropfen hervorgerufen, dem Andenken anden Stich eines Käfers, der silbernen Wegspur einer kleinen Schnecke, der ersten tödlichen Vergoldung, womit es der Herbst gezeichnet hat. Und nun suche man ein ihm völlig gleiches Blatt irgendwo innerhalb aller Wälder auf der Erde: ein unausführbares Unternehmen. Es gibt keine Wissenschaft von der Oberfläche eines Blattes, dem Netzwerk einer Zelle, der Schlängelung einer Ader oder etwa einer verschrobenen Gewohnheit, einer plötzlichen Umkehr des Herzens. Daß einer — und auf seine Weise — eine schiefe Nase hat, ein Auge höher als das andre, ein kräftiges Armgelenk; daß er zu einer bestimmten Stunde zu essen pflegt, und am liebsten Hühnerbrust, daß er Malvasier einem Château-Margaux vorzieht — das ist ohnegleichen in der Welt. Genau so gut wie Sokrates hätte wohl auch Thales TNΩΘΙΣEAϒTON sagen können; aber sein Bein hätte er sich im Gefängnis gewiß auf eine andre Art gekratzt, eh er den Schierlingsbecher leerte. Die Gedanken der großen Männer sind das allgemeine Erbgut der Menschheit: nur ihre Absonderlichkeiten bleiben ihr persönliches Eigentum. Ein Buch, das einen Menschen wiedergäbe mit allem, was an ihm regelwidrig ist, wäre ein Kunstwerk von der Art jener japanischen Holzschnitte, die das Bild eines ein einzigesmal zu einer einzigen Stunde erblickten Räupleins für alle Ewigkeit festhalten.
DieWerke der Geschichtschreibung schweigen über diese Dinge. In der rohen Stoffsammlung geschichtlicher Zeugnisse gibt es nicht viel einzigartige unnachahmliche Züge. Darin sind besonders die Lebensgeschichten der Alten unergiebig. Da sie nur das Gemeinwesen und die Grammatik schätzten, übermittelten sie uns von ihren großen Männern die Staatsreden und die Titel ihrer Bücher. Von keinem andern als von Aristophanes selbst erfahren wir, zu unserer Freude, daß er kahlköpfig war, und hätte die Stumpfnase des Sokrates nicht Anlaß zu literarischen Gleichnissen gegeben und seine Gewohnheit des Barfußgehns nicht zu seinen, alles Leibliche geringschätzenden Anschauungen gehört — wir besäßen auch von ihm einzig seine Untersuchungen über die Sittengesetze. Das Weibergeschwätz des Sueton ist streitsüchtige Gehässigkeit. Den Plutarch hat sein guter Geist mitunter zum Bildner gemacht; jedoch auch er verstand seine Kunst noch schlecht, er wäre sonst nicht auf seine,, vergleichenden Lebensbeschreibungen“ verfallen — als ob zwei in allen ihren Eigentümlichkeiten dargestellte Menschen einander jemals gleichen könnten! Wir sind also auf Athenäus angewiesen, auf Aulus Gellius, auf die Scholiasten und auf Diogenes Laërtius, der der Meinung war, er hätte so etwas wie eine Geschichte der Philosophie verfaßt.
In den neuern Zeiten hat sich das Gefühl für das Persönliche stärker entwickelt. Das Werk eines Boswell wäre vollkommen, hätte er nicht für notwendig erachtet, Johnsons Briefwechsel und etliche Abschweifungen über dessen Bücher darin unterzubringen. Die „Lebensläufe hervorragender Personen“ von Aubrey genügen schon eher. Aubrey hatte einen unverkennbaren Sinn für das Biographische. Es ist nur bedauerlich, daß der Stil dieses ausgezeichneten Geschichtspürers so sehr hinter seiner Auffassung zurückgeblieben ist. Andernfalls wäre sein Werk verwöhnten Leuten dauernd genießbar geblieben. Aubrey fühlt sich nirgends verpflichtet, das Eigentümliche seiner Personen den Allgemeinvorstellungen einzugliedern. Er begnügte sich damit, daß andre die von ihm behandelten Leute berühmt gemacht hatten. So und so oft weiß man lange Zeit nicht, ob er von einem Mathematiker oder einem Staatsmann, einem Dichter oder einem Uhrmacher sprieht. Dafüraber weist jeder von ihnen seine Besonderheit auf, die ihn für alle Zeiten von allen andern Menschen unterscheidet.
Der Maler Hokusai hoffte, als er hundertzehn Jahre alt war, endlich das Hochziel seiner Kunst zu erreichen. Dann, sagte er, würde jeder Punkt von seiner Hand, jede von ihm hingepinselte Linie lebendig sein. Lebendig, das heißt: einmalig. Nichts scheint einander mehr zu gleichen als Punkte und Linien: die Geometrie beruht auf dieser Voraussetzung. Dievollendete Kunst eines Hokusai aber stellt die Forderung auf, sie sollten völlig untereinander verschieden sein. So wäre auch die höchste Aufgabe des Lebensbeschreibers, das Bildnis zweier Philosophen, die ungefähr die gleiche Metaphysik vorgetragen haben, doch unendlich verschiedenartig zu gestalten. Aubrey aber, der einzig an den Menschen haftet, erreicht das Vollkommene trotzdem nicht, weil er die wunderbare Umwandlung des Ähnlichen in das Unterschiedliche, von der Hokusai träumte, nicht zu vollbringen verstand. Allerdings war Aubrey auch nicht hundertzehn Jahre alt geworden. Dabei bleibt er jedoch immer sehr schätzenswert, und er war sich der Bedeutung seines Werkes auch bewußt: „Ich entsinne mich,“ sagt er in seiner Einleitung zu Antony Wood, „eines Ausspruchs des Generals Lambert: ,Die besten Menschen sind bestenfalls nur Menschen‘—wovon man in meiner rohen und eilends geschaffenenSammlung mancherlei absonderliches Beispiel antreffen wird. Darum aber dürfen diese Verborgenheiten auch nicht eher als in etwa dreißig Jahren ans Licht der Öffentlichkeit. Wahrhaftig, der Verfasser wie auch seine Personen sollen nicht anders als wie Mispeln genossen werden, in bereits angefaultem Zustand.“
Bei Aubreys Vorgängern sind schon Spuren seiner Kunst zu entdecken. So erzählt uns zum Beispiel Diogenes Laërtius, Aristoteles habe auf dem Magen einen Lederbeutel warmen Öls getragen, und nach seinem Tode seien in seinem Haus eine Unmenge Tongefäße aufgefunden worden. Wir werden niemals erfahren, was Aristoteles mit all diesen Töpfen eigentlich gewollt hat. Das Rätselhafte daran ist nicht minder anziehend als etwa die Vermutungen, denen uns Boswell überläßt, was wohl Johnson mit den getrockneten Orangenschalen angefangen habe, die er in seinen Taschen zu tragen pflegte. In solchen Fällen übertrifft Diogenes Laërtius den unnachahmlichen Boswell um ein beträchtliches. Doch dergleichen Ergötzlichkeiten finden sich da nur selten, bei Aubrey hingegen in jeder Zeile. Milton, so berichtet er uns, „konnte das R nicht gut aussprechen“. Spenser „war ein kleiner Mann mit kurzgeschornen Haaren, einem schmalen Halskragen und kleinen Handkrausen.“ Barcley „lebte in England irgendwann ,tempore R. Jacobi‘! Er war dazumal schon ein Mann in vorgerücktem Alter, mit einem weißen Bart, und er trug einen Federhut, woran etliche Standespersonen Anstoß nahmen.“ Erasmus „aß nicht gern Fische, obzwar er aus einer Stadt des Fischhandels stammte“. Was den Bacon betrifft, so „wagte keiner der Diener, vor ihm in Stiefeln aus anderm als spanischem Leder zu erscheinen, denn er war sehr empfindlich gegen den Geruch von Kalbleder, das er nicht leiden konnte“. Der Doktor Fuller „hatte den Kopf immer so voll von Gedanken, daß er auf seinem Spazier- und Grübelgang vor dem Mittagessen ein großes Zweigroschenbrot verzehrte, ohne es auch nur zu merken“. Über Sir William Davenant äußert er sich folgendermaßen: „Ich war bei seinem Leichenbegängnis; er hatte einen Sarg aus Nußbaumholz. Sir John Denham versicherte, er habe niemals einen gleich schönen Sarg gesehn.“ Er schreibt über Ben Johnson: „Ich habe von Mister Lang, dem Schauspieler, vernommen, daß Johnson eine Art von seitlich geschlitztem Kutschermantel zu tragen pflegte.“ Das Folgende fällt ihm bei William Prynne auf: „Seine Art zu arbeiten war diese: er setzte sich eine lange spitze Mütze auf, die ihm mindestens drei oder vier Zoll über die Augen fiel und die er als Lichtschirm gebrauchte, um seine Augen gegen das Tageslicht zu schützen, und ungefähr alle drei Stunden mußte ihm sein Diener ein Brot und einen Topf Bier bringen und so seines Herrn Lebensgeister stets aufs neue stärken; derart, daß er arbeitete, trank und sein Brot kaute, und das hielt ihn aufrecht bis in die Nacht hinein, dann erst aß er ein reichliches Mahl.“ Hobbes „bekam in seinem Alter eine große Glatze; trotzdem saß er zu Hause über seinen Büchern immer barhäuptig, und er behauptete, er erkälte sich dabei niemals, bloß eines fiele ihm beschwerlich: von seiner Glatze die Fliegen fernzuhalten“.
Aubrey schweigt uns über die „Oceana“ des John Harrington, er erzählt uns aber, daß der Verfasser anno Domini 1660 als Gefangener in den Tower gebracht wurde, wo man ihn bewachte, und von dort weiterhin nach Portsey Castle. Seine Haft in diesen Verliesen (da er ein hochgemuter Herr und ein Heißsporn war) sei die Gelegenheitsursache seiner Tollheit gewesen oder besser seiner Narrheit, die ja nicht tobend war, denn er plauderte ziemlich vernünftig und war von durchaus angenehmem Umgang; nur kam ihm die Einbildung, daß aus seinem Schweiß Fliegen entstünden und bisweilen Bienen, ,ad cetera sobrius‘; er ließ in Mister Harts Garten (gegenüber von St. James Park) ein bewegliches Gartenhäuschen aus Balken zimmern, um damit seine Versuche anzustellen. Er schob das Häuschen in die Sonne und setzte sich nach vorn; dann ließ er seine Fuchsschwänze holen, um damit alle Fliegen und Bienen, die darin zu entdecken wären, zu verjagen und totzuschlagen; alsdann schloß er die Fenster. Da er nun aber den Versuch nie anders als in der Sonnenglut unternahm, waren dabei natürlich immer etliche Fliegen in den Ritzen und den Falten der Vorhänge verborgen. Nach etwa einer Viertelstunde kamen, von der Hitze getrieben, ein bis zwei Fliegen aus ihrem Versteck hervor, oder gar mehrere. Sogleich rief er seine Leute: „Da seht ihr doch, daß sie von mir stammen!“
Hier, w as wir über Meriton erfahren: „Sein wahrer Name war Head. Mister Bovey kannte ihn gut. Geboren zu ... War Buchhändler in Little Britain. Er hatte bei den Zigeunern gelebt. Mit seinen unersättlichen Augen saher wie ein Spitzbube aus. Er konnte in jeder beliebigen Gestalt auftreten. Zwei- oder dreimal machte er Bankrott. Wurde endlich Buchhändler, oder wurde es gegen sein Ende. Er verdiente sich seinen Unterhalt mit seinen Kritzeleien. Man bezahlte ihm zwanzig Schilling für die Seite. So verfaßte er mehrere Bücher: , The Englisch Rogue‘, , The Art of Wheadling‘ und so weiter. Er ertrank um 1676 auf der Rückfahrt nach Plymouth , auf hoher See, im Alter von ungefähr fünfzig Jahren.“
Zum Schluß sei Auhreys Lebensbeschreibung des Descartes mitgeteilt: „Nobilis Gallus, Perroni Dominus, summus Mathematicus et Philosophus, natus Turonum, pridie Calendas Apriles 1596. Denatus Holmiae, Calendis Februarii, 1650. (Ich finde diese Inschrift unter seinem Bildnis von C. V. Dalen). Wie er seine Jugendzeit verbrachte und auf welche Art er so gelehrt ward, dieses berichtet er selbst aller Welt in seiner Abhandlung mit dem Titel: ,Vom richtigen Vernunftgebrauch.‘ Die Gesellschaft Jesu schreibt sich die Ehre seiner Erziehung zu. Er verlebte etliche Jahre zu Egmont (nächst dem Haag), von dort aus datierte er mehrere seiner Bücher. Er war ein zu weiser Mann, um sich jemals mit einem Weibe zu beschweren; doch da er immerhin ein Mann war, waren ihm auch die Triebe und Begierden des Mannes nicht fremd; darum liebte er und hielt er sich ein schönes Weib aus gutem Stande, vondem er einige Kinder hatte (ich glaube, es waren zwei oder drei). Es wäre zu erstaunlich gewesen, wenn sie, den Lenden eines solchen Vaters entsprossen, nicht eine ausgezeichnete Erziehung genossen hätten. Er war ein so hervorragender Gelehrter, daß alle andem Gelehrten ihn aufsuchten, und viele baten ihn, sie doch mit seinen ... Apparaten bekannt zu machen (zu jener Zeit war die Wissenschaft der Mechanik noch eng verbunden mit dem Verständnis der Apparate und, wie es Sir H. S. ausgedrückt hat, mit Taschenspielerkniffen). Dann pflegte Descartes ein kleines Fach an seinem Tische herauszuziehn und den Fragern eine Magnetnadel vorzuzeigen, an der eine Hälfte des Zeigers abgebrochen war; als Lineal verwendete er übrigens ein gefaltetes Blatt Papier.“ Man sieht, wie Aubrey seinen Gegenstand beherrschte. Man denke nicht, daß er die Bedeutung von Descartes oder von Hobbes geisteswissenschaftlichen Werken verkannt hätte. Doch das lockte ihn gar nicht. Er sagt ganz richtig, daß Descartes seine Lehre schon selbst allerWelt klargelegt hat. Aubrey weiß auch, daß Harvey der Entdecker des Blutkreislaufes ist; er bucht aber lieber, wie dieser große Mann in seinen schlaflosen Nächten im bloßen Hemd in der Stube auf und ab lief, wie schlecht seine Handschrift war und daß die berühmtesten Londoner Ärzte keine sechs Groschen für seine Rezepte gegeben hätten.
Er ist überzeugt, uns über Francis Bacon genügend zu unterrichten, wenn er uns angibt, Bacon habe köstlich lebhafte, haselnußbraune Augen gehabt, aus denen er wie eine Schlange blickte. Aber Aubrey war kein großer Künstler wie etwa Holbein. Es gelingt ihm nicht, einen Menschen mit seinen besonderen Zügen zu einem Gleichnis seines Ur- und Vorbildes zu verewigen. Auge, Nase, Mund, auch das Bein seiner Personen versteht erzu beleben: die ganzeGestalt zu verlebendigen, ist ihm nicht gewährt. Der alte Hokusai sah ein, daß man so weit kommen müsse, auch das Allgemeinste persönlich darzustellen. Aubrey ist nicht entfernt so weit. Bos wells Buch wäre das geforderte Meisterwerk, wenn es höchstens zehn Seiten Umfang hätte. Zugegeben: der gesunde Menschenverstand Doktor Johnsons setzt sich aus den unmöglichsten Gemeinplätzen zusammen; in der phantastisch leidenschaftlichen Ausdrucksweise des Herausgebers Boswell wird er doch zu etwas ganz Einzigartigem. Nur leider aber gleicht der ganze schwere Wälzer allzusehr den Wörterbüchern, wie sie der Doktor selbst verfaßt hat; man müßte ihn zu einer „Scientia Johnsoniana“ verkürzen, mit angefügtem Sachund Namenverzeichnis. Boswell verfügte eben nicht über den schönen Mut zur Auswahl.
Die Kunst des Bildners besteht nun aber gerade in dieser Auswahl. Er hat sich nicht zu bemühen, wahr zu sein; er sei Schöpfer inmitten eines Wirrwarrs menschlicher Züge. Leibniz sagte, Gott habe, als er die Welt schuf, die beste unter allen möglichen gewählt. Der Biograph ist eine Art untergeordnete Gottheit: er wählt aus dem menschlich Möglichen das Einmalige aus. Er täusche sich so wenig über das, was Kunst ist, wie sich Gott nicht getäuscht hat über das, was gut ist. Beider Gefühl hat unfehlbar zu sein. Geldige Untergötter haben für den Bildner eine Menge Ansichten, Gebärden, Gesichtszüge und Ereignisse angesammelt. Ihre Arbeit liegt in den Zeitberichten vol, den Denkwürdigkeiten, den Briefen und den Anmerkungen. Aus diesem ungefügen Haufen nimmt er den Stoff zu einer Gestalt, die keiner andern gleicht. Sie braucht durchaus nicht das Ebenbild der von einer höhem Gottheit geschaffnen zu sein, aber einmalig muß sie sein, wie alles wirklich Geschaffene.
Bedauerlicherweise haben sich die Biographen für Geschichtschreiber gehalten, wodurch sie uns um viele wundervolle Bildnisse betrogen haben. Sie waren der Meinung, wir hätten ganz allein für das Leben der großen Männer etwas übrig. Der Kunst sind solche Wertungen fremd. Der Maler schätzt das Bildnis eines Unbekannten von Holbein ebenso hoch wie das Bildnis des Erasmus. Nicht, weil es den Namen des Erasmus trägt, ist dieses Die Gemälde unnachahmlich. Die Kunst des Beschreibers müßte dem Leben eines armen Schauspielers ebensoviel Gewicht verleihn wie dem eines Shakespeare. Nur aus wenig edeln Gründen betrachten wir mit besonderer Aufmerksamkeit die Verkümmerung des Brustbeins an der Büste Alexanders oder die Stirnlocke eines gemalten Napoleon. Das Lächeln der Monna Lisa, von der wir gar nichts wissen (es ist vielleicht das Gesicht eines Mannes), rührt an reinere Wunder. Auch eine von Hokusai hingebannte Grimasse entführt uns in tiefere Gedankenschichten. Wollte man sich in der Kunst versuchen, in der sich Aubrey und Boswell hervortaten, dann sollte man sich am allerwenigsten den größten Mann seiner Zeit zu genauer Beschreibung aussuchen, noch die Umrisse von Berühmtheiten der Vergangenheit aufzeichnen, nein, mit der gleichen Liebe erzähle man lieber das einmalige Leben irgendwelcher Menschen, ob sie nun göttlich waren, mittelmäßig oder verbrecherisch.
EMPEDOKLES
Ein Mann von göttlicher Natur
niemand weiss etwas über seine geburt , noch wie er auf die Erde kam. Er erschien an den goldenen Ufern des Flusses Akragas, in der schönen Stadt Agrigent, ein wenig nach der Zeit, da Xerxes das Meer mit Ketten hatte züchtigen lassen. Überliefert ist allein der Name seines Stammvaters Empedokles, einer sonst unbekannten Persönlichkeit. Damit sollte wohl bezeugt werden, daß er ein Sohn seiner selbst war, wie es einem Gotte zukommt. Doch seine Jünger belehren uns: ehe der Herrliche die sizilischen Gefilde durchstreifte, hatte er bereits vier Daseinsformen in unserer Welt abgelebt: als Pflanze, als Fisch, dann als Vogel und zuletzt als ein junges Mädchen. Er war in einen Purpurmantel gehüllt, auf den sein Haar frei niederfiel; die Stirn trug er umwunden mit einem Goldreif, an den Füßen eherne Sandalen, und in seinen Händen waren wollene lange Bänder um Lorbeerzweige geschlungen.