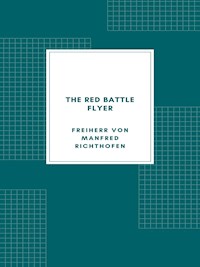0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der legendäre Kampfflieger Manfred von Richthofen, gilt als einer der bekanntesten deutschen Jagdflieger des ersten Weltkriegs. In dieser Autobiografie fasst er seine Erlebnisse zusammen und vermittelt einen Einblick in seine Persönlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der rote Baron
« Diable Rouge »
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenRittmeister Manfred Freiherr v. Richthofen Einiges von meiner Familie
Die Familie Richthofen hat sich in den bisherigen Kriegen an führender Stelle eigentlich verhältnismäßig wenig betätigt, da die Richthofens immer auf ihren Schollen gesessen haben. Einen Richthofen, der nicht angesessen war, gab es kaum. War er’s nicht, so war er meistenteils in Staatsdiensten. Mein Großvater, und von da ab alle meine Vorväter, saßen in der Gegend von Breslau und Striegau auf ihren Gütern. Erst in der Generation meines Großvaters wurde ein Vetter meines Großvaters als erster Richthofen General.
In der Familie meiner Mutter, einer geborenen von Schickfuß und Neudorf, ist es ähnlich wie bei den Richthofens: wenig Soldaten, nur Agrarier. Der Bruder meines Urgroßvaters Schickfuß fiel 1806. In der Revolution 1848 wurde einem Schickfuß eines seiner schönsten Schlösser abgebrannt. Im übrigen haben sie’s alle bloß bis zum Rittmeister der Reserve gebracht.
Auch in der Familie Schickfuß sowohl wie Falckenhausen – meine Großmutter ist eine Falckenhausen – kann man nur zwei Hauptinteressen verfolgen. Das ist Reiten, siehe Falckenhausen, und Jagen, siehe den Bruder meiner Mutter, Onkel Alexander Schickfuß, der sehr viel in Afrika, Ceylon, Norwegen und Ungarn gejagt hat.
Mein alter Herr ist eigentlich der erste in unserem Zweig, der auf den Gedanken kam, aktiver Offizier zu werden. Er kam früh ins Kadettenkorps und trat später von dort bei den 12. Ulanen ein. Er ist der pflichttreueste Soldat, den man sich denken kann. Er wurde schwerhörig und mußte den Abschied nehmen. Seine Schwerhörigkeit holte er sich, wie er einen seiner Leute bei der Pferdeschwemme aus dem Wasser rettete und nachher seinen Dienst beendete, ohne die Kälte und Nässe zu berücksichtigen.
Unter der heutigen Generation sind natürlich sehr viel mehr Soldaten. Im Kriege ist jeder waffenfähige Richthofen bei der Fahne. So verlor ich gleich zu Anfang des Bewegungskrieges sechs Vettern verschiedenen Grades. Alle waren Kavalleristen.
Genannt bin ich nach einem großen Onkel Manfred, in Friedenszeiten Flügeladjutant Seiner Majestät und Kommandeur der Gardedukorps, im Kriege Führer eines Kavalleriekorps.
Nun noch von meiner Jugend. Der alte Herr stand in Breslau bei den Leibkürassieren 1, als ich am 2. Mai 1892 geboren wurde. Wir wohnten in Kleinburg. Ich hatte Privatunterricht bis zu meinem neunten Lebensjahre, dann ein Jahr Schule in Schweidnitz, später wurde ich Kadett in Wahlstatt. Die Schweidnitzer betrachteten mich aber durchaus als ein Schweidnitzer Kind. Im Kadettenkorps für meinen jetzigen Beruf vorbereitet, kam ich dann zum 1. Ulanenregiment.
Was ich selbst erlebte, steht in diesem Buch.
Mein Bruder Lothar ist der andere Flieger Richthofen. Ihn schmückt der Pour le mérite. Mein jüngster Bruder ist noch im Kadettenkorps und wartet sehnsüchtig darauf, sich gleichfalls zu betätigen. Meine Schwester ist, wie alle Damen unseres Familienkreises, in der Pflege der Verwundeten tätig.
Meine Kadettenzeit
(1903-1909 Wahlstatt, 1909-1911 Lichterfelde)
Als kleiner Sextaner kam ich in das Kadettenkorps. Ich war nicht übermäßig gerne Kadett, aber es war der Wunsch meines Vaters, und so wurde ich wenig gefragt.
Die strenge Zucht und Ordnung fiel einem so jungen Dachs besonders schwer. Für den Unterricht hatte ich nicht sonderlich viel übrig. War nie ein großes Lumen. Habe immer so viel geleistet, wie nötig war, um versetzt zu werden. Es war meiner Auffassung nach nicht mehr zu leisten, und ich hätte es für Streberei angesehen, wenn ich eine bessere Klassenarbeit geliefert hätte als »genügend«. Die natürliche Folge davon war, daß mich meine Pauker nicht übermäßig schätzten. Dagegen gefiel mir das Sportliche: Turnen, Fußballspielen usw., ganz ungeheuer. Es gab, glaube ich, keine Welle, die ich am Turnreck nicht machen konnte. So bekam ich bald einige Preise von meinem Kommandeur verliehen.
Alle halsbrecherischen Stücke imponierten mir mächtig. So kroch ich z. B. eines schönen Tages mit meinem Freunde Frankenberg auf den bekannten Kirchturm von Wahlstatt am Blitzableiter herauf und band oben ein Taschentuch an. Genau weiß ich noch, wie schwierig es war, an den Dachrinnen vorbeizukommen. Mein Taschentuch habe ich, wie ich meinen kleinen Bruder einmal besuchte, etwa zehn Jahre später, noch immer oben hängen sehen.
Mein Freund Frankenberg war das erste Opfer des Krieges, das ich zu Gesicht bekam.
In Lichterfelde gefiel es mir schon bedeutend besser. Man war nicht mehr so abgeschnitten von der Welt und fing auch schon an, etwas mehr als Mensch zu leben.
Meine schönsten Erinnerungen aus Lichterfelde sind die großen Korsowettspiele, bei denen ich sehr viel mit und gegen den Prinzen Friedrich Karl gefochten habe. Der Prinz erwarb sich damals so manchen ersten Preis. So im Wettlauf, Fußballspiel usw. gegen mich, der ich meinen Körper doch nicht so in der Vollendung trainiert hatte wie er.
Eintritt in die Armee
(Ostern 1911)
Natürlich konnte ich es kaum erwarten, in die Armee eingestellt zu werden. Ich ging deshalb bereits nach meinem Fähnrichexamen in die Front und kam zum Ulanenregiment Nr. 1 »Kaiser Alexander III.«. Ich hatte mir dieses Regiment ausgesucht; es lag in meinem lieben Schlesien, auch hatte ich da einige Bekannte und Verwandte, die mir sehr dazu rieten.
Der Dienst bei meinem Regiment gefiel mir ganz kolossal. Es ist eben doch das schönste für einen jungen Soldaten, »Kavallerist« zu sein.
Über meine Kriegsschulzeit kann ich eigentlich wenig sagen. Sie erinnerte mich zu sehr an das Kadettenkorps und ist mir infolgedessen in nicht allzu angenehmer Erinnerung.
Eine spaßige Sache erlebte ich. Einer meiner Kriegsschullehrer kaufte sich eine ganz nette dicke Stute. Der einzige Fehler war, sie war schon etwas alt. Er kaufte sie für fünfzehn Jahre. Sie hatte etwas dicke Beine. Sonst aber sprang sie ganz vortrefflich. Ich habe sie oft geritten. Sie ging unter dem Namen »Biffy«.
Etwa ein Jahr später beim Regiment erzählte mir mein Rittmeister v. Tr., der sehr sportliebend war, er habe sich ein ganz klobiges Springpferd gekauft. Wir waren alle sehr gespannt auf den »klobigen Springer«, der den seltenen Namen »Biffy« trug. Ich dachte nicht mehr an die alte Stute meines Kriegsschullehrers. Eines schönen Tages kommt das Wundertier an, und nun soll man sich das Erstaunen vorstellen, daß die gute alte »Biffy« als achtjährig in dem Stall v. Tr.s sich wieder einfand. Sie hatte inzwischen einige Male den Besitzer gewechselt und war im Preise sehr gestiegen. Mein Kriegsschullehrer hatte sie für fünfzehnhundert Mark gekauft, und v. Tr. hatte sie nach einem Jahre als achtjährig für dreitausendfünfhundert Mark erworben. Gewonnen hat sie keine Springkonkurrenz mehr, aber sie hat wieder einen Abnehmer gefunden – – und ist gleich zu Beginn des Krieges gefallen.
Erste Offizierszeit
(Herbst 1912)
Endlich bekam ich die Epaulettes. So ungefähr das stolzeste Gefühl, was ich je gehabt habe, mit einem Male »Herr Leutnant« angeredet zu werden.
Mein Vater kaufte mir eine sehr schöne Stute, »Santuzza« genannt. Sie war das reinste Wundertier und unverwüstlich. Ging vor dem Zuge wie ein Lamm. Allmählich entdeckte ich in ihr ein großes Springvermögen. Sofort war ich dazu entschlossen, aus der guten braven Stute ein Springpferd zu machen. Sie sprang ganz fabelhaft. Ein Koppelrick von einem Meter sechzig Zentimeter habe ich mit ihr selbst gesprungen.
Ich fand große Unterstützung und viel Verständnis bei meinem Kameraden von Wedel, der mit seinem Chargenpferd »Fandango« so manchen schönen Preis davongetragen hatte.
So trainierten wir beide für eine Springkonkurrenz und einen Geländeritt in Breslau. »Fandango« machte sich glänzend, »Santuzza« gab sich große Mühe und leistete auch Gutes. Ich hatte Aussichten, etwas mit ihr zu schaffen. Am Tage, bevor sie verladen wurde, konnte ich es mir nicht verkneifen, nochmals alle Hindernisse in unserem Springgarten mit ihr zu nehmen. Dabei schlitterten wir hin. »Santuzza« quetschte sich etwas ihre Schulter, und ich knaxte mir mein Schlüsselbein an.
Von meiner guten dicken Stute »Santuzza« verlangte ich im Training auch Leistungen auf Geschwindigkeit und war sehr erstaunt, als von Wedels Vollblüter sie schlug.
Ein andermal hatte ich das Glück, bei der Olympiade in Breslau einen sehr schönen Fuchs zu reiten. Der Geländeritt fing an, und mein Wallach war im zweiten Drittel noch ganz und munter, so daß ich Aussichten auf Erfolg hatte. Da kommt das letzte Hindernis. Ich sah schon von weitem, daß dies etwas ganz Besonderes sein mußte, da sich eine Unmenge Volks dort angesammelt hatte. Ich dachte mir: »Nur Mut, die Sache wird schon schief gehen!« und kam in windender Fahrt den Damm heraufgesaust, auf dem ein Koppelrick stand. Das Publikum winkte mir immer zu, ich sollte nicht so schnell reiten, aber ich sah und hörte nichts mehr. Mein Fuchs nimmt das Koppelrick oben auf dem Damm, und zu meinem größten Erstaunen geht’s auf der anderen Seite in die Weistritz. Ehe ich mich versah, springt das Tier in einem Riesensatz den Abhang herunter, und Roß und Reiter verschwinden in den Fluten. Natürlich gingen wir »über Kopf«. »Felix« kam auf dieser Seite raus und Manfred auf der anderen. Beim Zurückwiegen nach Schluß des Geländerittes stellte man mit großem Erstaunen fest, daß ich nicht die üblichen zwei Pfund abgenommen hatte, sondern zehn Pfund schwerer geworden war. Daß ich glitschenaß war, sah man mir Gott sei Dank nicht an.
Ich besaß auch einen sehr guten Charger, und dieses Unglückstier mußte alles machen. Rennen laufen, Geländeritte, Springkonkurrenzen, vor dem Zuge gehen, kurz und gut, es gab keine Übung, in der das gute Tier nicht ausgebildet war. Das war meine brave »Blume«. Auf ihr hatte ich sehr nette Erfolge. Mein letzter ist der im Kaiserpreis-Ritt 1913. Ich war der einzige, der die Geländestrecke ohne Fehler überwunden hatte. Mir passierte dabei eine Sache, die nicht so leicht nachgemacht werden wird. Ich galoppierte über eine Heide und stand plötzlich Kopf. Das Pferd war in ein Karnickelloch getreten, und ich hatte mir beim Sturz das Schlüsselbein gebrochen. Damit war ich noch siebzig Kilometer geritten, hatte dabei keinen Fehler gemacht und die Zeit innegehalten.
Kriegsausbruch
In allen Zeitungen stand weiter nichts als dicke Romane über den Krieg. Aber seit einigen Monaten war man ja schon an das Kriegsgeheul gewöhnt. Wir hatten schon so oft unseren Dienstkoffer gepackt, daß man es schon langweilig fand und nicht mehr an einen Krieg glaubte. Am wenigsten aber glaubten wir an einen Krieg, die wir die ersten an der Grenze waren, das »Auge der Armee«, wie seinerzeit mein Kommandierender uns Kavalleriepatrouillen bezeichnet hatte.
Am Vorabend der erhöhten Kriegsbereitschaft saßen wir bei der detachierten Schwadron, zehn Kilometer von der Grenze entfernt, in unserem Kasino, aßen Austern, tranken Sekt und spielten ein wenig. Wir waren sehr vergnügt. Wie gesagt, an einen Krieg dachte keiner.
Wedels Mutter hatte uns zwar schon einige Tage zuvor etwas stutzig gemacht; sie war nämlich aus Pommern erschienen, um ihren Sohn vor dem Kriege noch einmal zu sehen. Da sie uns in angenehmster Stimmung fand und feststellen mußte, daß wir nicht an Krieg dachten, konnte sie nicht umhin, uns zu einem anständigen Frühstück einzuladen.
Wir waren gerade sehr ausgelassen, als sich plötzlich die Tür öffnete und Graf Kospoth, der Landrat von Öls, auf der Schwelle stand. Der Graf machte ein entgeistertes Gesicht.
Wir begrüßten den alten Bekannten mit einem Hallo! Er erklärte uns den Zweck seiner Reise, nämlich, daß er sich an der Grenze persönlich überzeugen wolle, was von den Gerüchten von dem nahen Weltkrieg stimme. Er nahm ganz richtig an, die an der Grenze müßten es eigentlich am ehesten wissen. Nun war er ob des Friedensbildes nicht wenig erstaunt. Durch ihn erfuhren wir, daß sämtliche Brücken Schlesiens bewacht wurden und man bereits an die Befestigung von einzelnen Plätzen dachte.
Schnell überzeugten wir ihn, daß ein Krieg ausgeschlossen sei, und feierten weiter.
Am nächsten Tage rückten wir ins Feld.
Überschreiten der Grenze
Das Wort »Krieg« war uns Grenzkavalleristen zwar geläufig. Jeder wußte haarklein, was er zu tun und zu lassen hatte. Keiner hatte aber so eine rechte Vorstellung, was sich nun zunächst abspielen würde. Jeder aktive Soldat war selig, nun endlich seine Persönlichkeit und sein Können zeigen zu dürfen.
Uns jungen Kavallerieleutnants war wohl die interessanteste Tätigkeit zugedacht: aufklären, in den Rücken des Feindes gelangen, wichtige Anlagen zerstören; alles Aufgaben, die einen ganzen Kerl verlangen.
Meinen Auftrag in der Tasche, von dessen Wichtigkeit ich mich durch langes Studium schon seit einem Jahre überzeugt hatte, ritt ich nachts um zwölf Uhr an der Spitze meiner Patrouille zum erstenmal gegen den Feind.
Die Grenze bildete ein Fluß, und ich konnte erwarten, daß ich dort zum erstenmal Feuer bekommen würde. Ich war ganz erstaunt, wie ich ohne Zwischenfall die Brücke passieren konnte. Ohne weitere Ereignisse erreichten wir den mir von Grenzritten her wohlbekannten Kirchturm des Dorfes Kielcze am nächsten Morgen.
Ohne von einem Gegner etwas gemerkt zu haben oder vielmehr besser ohne selbst bemerkt [22]worden zu sein, war alles verlaufen. Wie sollte ich es anstellen, daß mich die Dorfbewohner nicht bemerkten? Mein erster Gedanke war, den Popen hinter Schloß und Riegel zu setzen. So holten wir den vollkommen überraschten und höchst verdutzten Mann aus seinem Hause. Ich sperrte ihn zunächst mal auf dem Kirchturm ins Glockenhaus ein, nahm die Leiter weg und ließ ihn oben sitzen. Ich versicherte ihm, daß, wenn auch nur das geringste feindselige Verhalten der Bevölkerung sich bemerkbar machen sollte, er sofort ein Kind des Todes sein würde. Ein Posten hielt Ausschau vom Turm und beobachtete die Gegend.