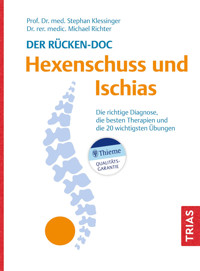
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TRIAS
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: TRIAS Rücken-Doc
- Sprache: Deutsch
Akute Rückenschmerzen endlich in den Griff bekommen
Zieht der Schmerz blitzartig in den unteren Rücken und trifft Sie so stark, dass Sie sich kaum noch bewegen können, haben Sie sich wahrscheinlich einen Hexenschuss zugezogen. Im Fachjargon spricht man auch von „Lumbago“. Auslöser sind oft alltägliche Bewegungen wie Bücken oder Heben von schweren Gegenständen.
Manchmal spricht man aber auch von Ischias, besonders wenn die Schmerzen in das Gesäß, die Hüfte und den Oberschenkel ausstrahlen. Es kann sein, dass beide Probleme miteinander zusammenhängen und nicht leicht voneinander zu trennen sind.
Wenn auch Sie immer wieder an Hexenschuss und Ischias leiden, kann der Rücken-Doc Ihnen helfen.
- Mehr Wissen über Ihre Erkrankung: Was steckt dahinter, welche Therapieoptionen gibt es und was hilft Ihnen bei akuten Schmerzen?
- Selbst aktiv werden: Von Übungen bis Alltagstipps – was können Sie selbst tun, um die Heilung zu unterstützen?
- Geballte Autorenkompetenz: Das Autorenteam – ein Neurochirurg und ein Physiotherapeut – unterstützt Sie empathisch und kompetent.
Rückenprobleme im Griff mit dem Rücken-Doc.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Der Rücken-Doc: Hexenschuss und Ischias
Die richtige Diagnose, die besten Therapien und die 20 wichtigsten Übungen
Prof. Dr. med. Stephan Klessinger, Prof. Dr. Michael Richter
1. Auflage
40 Abbildungen
Liebe Leserin, lieber Leser,wenn es um die eigene Gesundheit geht, darf man nichts dem Zufall überlassen. »Für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben«: So lautet das Qualitätsversprechen der Marke Thieme. Ärztlich Tätige, Pflegekräfte, Physiotherapeuten oder Hebammen – sie alle verlassen sich darauf, dass sie von Thieme, dem führenden Anbieter von medizinischen Fachinformationen und Services, die entscheidenden Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort bekommen. So können sie die Menschen, die sich ihnen anvertrauen, bestmöglich unterstützen. Auch Sie können sich auf die TRIAS Ratgeber mit dem Thieme Qualitätssiegel verlassen! Diese Informationsangebote helfen Ihnen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn es um Ihre Gesundheit geht, selbst daran mitzuwirken, gesund zu werden, sich gesund zu erhalten oder das Fortschreiten einer Erkrankung zu vermeiden. Mit einem TRIAS Titel aus dem Hause Thieme überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall!Ihr TRIAS Team
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Begriffe Ischias und Hexenschuss werden gerne verwendet, um einen akuten Rückenschmerz oder einen Schmerz, der in Richtung Gesäß und Hüfte ausstrahlt, zu beschreiben. Die genaue Bedeutung dieser Wörter ist aber oftmals gar nicht so klar. Was passiert eigentlich bei einem Hexenschuss im Körper? Warum wird dieses Schmerzereignis Hexenschuss genannt? Welche Struktur verursacht die akuten Schmerzen? Ist Ischias eine klare medizinische Diagnose oder mehr eine Beschreibung, wo der Schmerz empfunden wird? Was ist der Unterschied zwischen Ischias, Ischiasnerv und Ischialgie? Ist Ischias das Gleiche wie Bandscheibenvorfall?
Dieses Buch möchte Ihnen die Anatomie und Funktion der Wirbelsäule erklären und erläutern, was genau bei einem Hexenschuss passiert und was mit Ischias gemeint ist. Es ist nicht als wissenschaftliche Abhandlung gedacht, sondern als praxisnaher Ratgeber.
Je besser Sie verstehen, was sich in Ihrem Körper abspielt und was zur Entstehung von Rückenschmerzen beiträgt, desto besser können Sie mit den Beschwerden umgehen. Lernen Sie die unterschiedlichen Ursachen für Schmerzen kennen und finden Sie Übungen, die Ihnen helfen, Ihren Alltag wieder zu bewältigen. Suchen Sie das Gespräch mit Ihren Therapeuten und Ärztinnen, denn gemeinsam lässt sich am besten eine Lösung finden.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
Stephan Klessinger und Michael Richter
(Quelle: © pikovit/stock.adobe.com - edited and composed by Thieme)
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Liebe Leserin, lieber Leser,
Alles über Hexenschuss und Ischias
Aufbau der Lendenwirbelsäule
Aus welchen Strukturen besteht die Wirbelsäule?
Knochen und Gelenke
Bandscheiben
Bänder
Muskeln
Rückenmark und Nerven
Benachbarte Strukturen
Welche Strukturen können wehtun?
Hexenschuss und Ischias – was ist das?
Was bedeutet der Begriff Ischias?
Wo liegt der Ischiasnerv?
Wie kommt es zur Bezeichnung Hexenschuss?
Was passiert bei einem Hexenschuss im Körper?
Muskelverletzungen
Verletzung der Bandscheibe
Eingeklemmter Meniskoid im Facettengelenk
Diagnose und Therapie
Wie wird eine Diagnose gestellt?
Anamnese und Untersuchung
Der Schmerz bei einem Hexenschuss
Körperliche Untersuchung
Was ist, wenn die Beschwerden nicht zu einem Hexenschuss passen?
Kann man einen Hexenschuss sehen?
Röntgenbilder
MRT
Therapie: Was hilft?
Weiterführende Maßnahmen
Wenn die Schmerzen nicht besser werden
Akute und chronische Schmerzen
Bandscheibenvorfall
Zwei Phasen eines Bandscheibenvorfalls
Ausstrahlender oder radikulärer Schmerz?
Nicht spezifischer Kreuzschmerz
Spezifische Kreuzschmerzen
Schmerzen ausgehend von den Facettengelenken
Radiofrequenz-Denervation
Ihr Übungsprogramm
Bewegung gegen den Hexenschuss
Helfen die Übungen immer?
Bewegen oder nicht – das ist keine Frage!
Übungen – warum überhaupt?
Wie werden Muskeln und Gelenke entlastet?
Wie kann die Wirbelsäule stabilisiert werden?
Was kann für Entspannung sorgen?
Was kann ich tun, um erneute Schmerzen zu vermeiden?
Mit den Übungen beginnen – die Basics
Verschiedene Übungsphasen
20 Übungen, die Wunder wirken
Einstufung der Übungen nach Intensität
Akute Phase
Subakute Phase
Stabilisierungsphase
Beckenschaukel
Rotieren
Beine pendeln in Rückenlage
Päckchen
Katze-Kuh
Kobra
Atmen (Zwerchfellatmung)
Dehnung: Rumpf
Dehnung: Hüftbeuger
Dehnung: Gesäßregion
Aushängen – mal so richtig abhängen
Bein rüber in Rückenlage
Brücke
Bauchdiagonale
Tennisballmassage
Crunch
Dynamischer Vierfüßlerstand
Kniebeugen
Schattenboxen
Rückenstrecker
Literatur
Autorenvorstellung
Sachverzeichnis
Impressum
Impressum
Quelle: © pikovit/stock.adobe.com - edited and composed by Thieme |
Alles über Hexenschuss und Ischias
Um die Ursache von Rückenschmerzen zu erkennen und sie bestenfalls zu vermeiden, ist es wichtig, über den Aufbau der Wirbelsäule Bescheid zu wissen.
Aufbau der Lendenwirbelsäule
Die Wirbelsäule ist das zentrale Element unseres Bewegungsapparates und entscheidend für Stabilität und Beweglichkeit, aber auch für den Schutz des Rückenmarks.
Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Schmerzerkrankungen der modernen Gesellschaft. Um sie zu verstehen, ist es wichtig, den Aufbau und die Funktion der Wirbelsäule zu kennen. Dadurch ist es einfacher, Rückenschmerzen vorzubeugen, ein gezieltes Training durchzuführen und im Falle von Beschwerden diese besser zu deuten und zu behandeln.
Wissensvermittlung ist ein zentraler Bestandteil der Rückenschmerztherapie. Daher wollen wir in den ersten Kapiteln dieses Buches den Aufbau und die Funktion der Wirbelsäule erklären. Häufig sind in Klammern die medizinischen Fachbegriffe genannt, die in Arztbriefen und medizinischen Befunden verwendet werden.
Aus welchen Strukturen besteht die Wirbelsäule?
Die Wirbelsäule besteht aus fünf Abschnitten ( ▶ Abbildung ➊):
Die Halswirbelsäule ist der beweglichste Teil und ermöglicht die vielfältigen Bewegungen des Kopfes. Sie setzt sich aus sieben Wirbeln zusammen. Der erste Wirbel (Atlas) trägt den Kopf, der zweite Wirbel (Axis) dient vor allem der Drehbewegung des Kopfes.
Die Brustwirbelsäule besteht in der Regel aus zwölf Wirbeln. Sie ist nur wenig beweglich. Jeder Brustwirbel hat Gelenkflächen zu den Rippen, die den Brustkorb bilden.
Die fünf Lendenwirbel sind deutlich größer als die Halswirbel, weil sie mehr Gewicht tragen müssen. Die Lendenwirbelsäule ermöglicht Bücken, Seitneigung und Drehbewegungen.
Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule bestehen zusammen aus meist 24 beweglichen Wirbeln. Zwischen den Wirbeln liegen die Bandscheiben.
Das Kreuzbein (Os sacrum) befindet sich weiter unten. Es setzt sich aus fünf Wirbeln zusammen, die miteinander verschmolzen sind und sich nicht untereinander bewegen können. Im Kreuzbein gibt es keine Bandscheiben. Das Kreuzbein verbindet die Wirbelsäule mit den Hüftknochen. Noch weiter unten findet sich das Steißbein, das aus verschmolzenen, rudimentären Wirbeln besteht.
Von vorne und hinten betrachtet, ist die Wirbelsäule normalerweise gerade. In der seitlichen Ansicht sind die Abschnitte der Wirbelsäule jedoch unterschiedlich gekrümmt: die Hals- und Lendenwirbelsäule nach vorne (Lordose) und die Brustwirbelsäule und das Kreuzbein nach hinten (Kyphose). So entsteht eine doppelte S-Form, die für eine optimale Verteilung der Last sorgt und die Stabilität und Flexibilität erhöht ( ▶ Abbildung ➊).
Die Begriffe Hexenschuss und Ischias beziehen sich auf Erkrankungen der Lendenwirbelsäule. Deswegen wollen wir diesen Abschnitt der Wirbelsäule genauer betrachten.
Nicht alle Menschen haben gleich viele Wirbel
Meistens besteht die Wirbelsäule aus 24 Wirbeln: sieben Halswirbel, zwölf Brustwirbel und fünf Lendenwirbel. Nicht dazugerechnet sind das Kreuzbein, das durch das Verschmelzen von fünf Wirbeln entsteht, und das Steißbein. Bei etwa acht Prozent der Menschen gibt es aber 23 oder 25 Wirbel. Man spricht dann von einer »Übergangsanomalie«. Variationen treten am häufigsten am Übergang von der Brust- zur Lendenwirbelsäule oder am Übergang von der Lendenwirbelsäule zum Kreuzbein auf. Die Halswirbelsäule besteht nahezu immer aus sieben Wirbeln.
Manchmal hat sich der letzte Brustwirbel so entwickelt wie ein Lendenwirbel, dann existieren sechs statt fünf Lendenwirbel. Es kann aber auch der erste Lendenwirbel Eigenschaften eines Brustwirbels haben. Am Übergang zum Kreuzbein kommt es vor, dass der letzte Lendenwirbel mit dem Kreuzbein verschmolzen ist. Es kann aber auch sein, dass der erste Kreuzbeinwirbel aussieht wie ein Lendenwirbel.
Nur gelegentlich sind diese Veränderungen eine Ursache für Rückenschmerzen. Die Zahl der Wirbel ist aber wichtig, wenn Befunde geschrieben werden oder wenn eine Operation geplant wird. Dann ist es entscheidend, die korrekte Stelle genau zu beschreiben und richtig zu zählen.
➊Seitliche Darstellung der Wirbelsäule. Die doppelte S-Form ist deutlich zu erkennen.
(Quelle: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. PROMETHEUS LernAtlas, Grafiken: Voll M, Wesker K; Stuttgart: Thieme; 2022.)
Knochen und Gelenke
Da die Lendenwirbel mechanisch stark belastet sind, sind sie sehr robust gebaut. Jeder Lendenwirbel besteht aus verschiedenen Strukturelementen ▶ (Abbildung ➋). Der Wirbelkörper ist der größte Teil des Wirbels. Seine Funktion besteht darin, das Körpergewicht zu tragen. Zwischen den Wirbelkörpern liegen die Bandscheiben. Das Gewicht wird von den Wirbeln auf die Bandscheiben übertragen. Der hintere Teil des Wirbels besteht aus einem Wirbelbogen, der die knöcherne Begrenzung des Spinalkanals bildet. Im Spinalkanal verläuft das Rückenmark bzw. unterhalb vom ersten Lendenwirbel die Nervenwurzeln, die aussehen wie ein Pferdeschwanz (Cauda equina). Sie treten seitlich aus dem Rückenmark aus. Dann gibt es noch mehrere knöcherne Fortsätze, die für den Ansatz der Rückenmuskulatur wichtig sind. Zu beiden Seiten sind dies die Querfortsätze (Processus transversus) und zur Mitte des Rückens hin der Dornfortsatz (Processus spinosus), den man häufig gut tasten kann. Auch die Muskulatur links und rechts davon kann man spüren.
➋Darstellung eines Lendenwirbels von oben. Im Spinalkanal sind die Nervenwurzeln erkennbar und seitlich jeweils der Spinalnerv.
(Quelle: nach: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. PROMETHEUS LernAtlas, Grafiken: Voll M, Wesker K; Stuttgart: Thieme; 2022)
Damit die Wirbelsäule beweglich ist, gibt es im hinteren Anteil der Wirbelsäule links und rechts jeweils ein Gelenk, das Facettengelenk genannt wird ( ▶ Abbildung ➌). Diese Gelenke verbinden jeweils zwei benachbarte Wirbel miteinander. Es handelt sich um echte Gelenke, die in ihrem Aufbau anderen Gelenken im Körper (Knie-, Schulter-, Hüftgelenk) ähnlich sind. Es gibt Gelenkflächen, die mit Knorpel überzogen sind. Zwischen den Knorpelflächen liegt der Gelenkspalt, der Gelenkflüssigkeit enthält. Das ganze Gelenk ist von einer Gelenkkapsel umgeben. An den beiden Enden des Gelenkspalts gibt es einen Gelenkkörper, ein Meniskoid ( ▶ Abbildung), der dafür sorgt, dass die Gelenkflächen während der Bewegung reibungslos aufeinander gleiten. Er trägt auch zur Dämpfung und zur Stabilität des Gelenks bei. Er ähnelt dem Meniskus im Knie, ist aber spezifisch an das Facettengelenk angepasst und mit der Gelenkkapsel verwachsen. Die Ausrichtung der Gelenkflächen ist an der Lendenwirbelsäule nahezu vertikal. Dies begünstigt Beugen und Strecken. Rotationsbewegungen sind hingegen eher eingeschränkt.
Facettengelenke können von Abnützung und Verschleiß betroffen sein. Man spricht dann von einer Arthrose. Eine Arthrose der Facettengelenke ist sehr häufig.
➌Seitliche Darstellung zweier Wirbel, die durch ein Facettengelenk beweglich verbunden sind.
(Quelle: nach: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. PROMETHEUS LernAtlas, Grafiken: Voll M, Wesker K; Stuttgart: Thieme; 2022)
Bandscheiben
Zwischen den Wirbelkörpern befindet sich jeweils eine Bandscheibe (Discus intervertebralis), die als Stoßdämpfer, Bewegungselement und Stabilitätsgeber dient. Zusammen mit den Facettengelenken sorgt sie dafür, dass die Wirbelsäule beweglich ist. Zusätzlich verteilt sie die Belastung.
Jede Bandscheibe besteht aus einem festen äußeren Ring (Anulus fibrosus) und einem weicheren inneren Kern (Nucleus pulposus) ( ▶ Abbildung). Der feste Ring (Anulus) besteht vorwiegend aus ringförmig angeordnetem knorpeligem ▶ Bindegewebe. Die Fasern sind immer leicht versetzt angeordnet, wodurch eine hohe Zugfestigkeit erreicht wird. Im hinteren Bereich ist der Faserring dünner, was ihn anfälliger für Verletzungen macht. Seine wichtigsten Aufgaben sind, dem Kern (Nukleus) Halt zu geben und die Wirbelsäule zu stabilisieren, indem Zug-, Druck- und Drehkräfte abgefedert werden. Der weiche Kern im Inneren der Bandscheibe (Nukleus) enthält sehr viel Wasser und dient somit als hydraulischer Stoßdämpfer, indem er den Druck in alle Richtungen verteilt.
Im Laufe des Lebens kommt es zu typischen Veränderungen an der Bandscheibe. Die Fähigkeit, Wasser zu speichern, nimmt ab. Dadurch verringert sich die Elastizität. Häufig führt dies zu einer Höhenminderung der Bandscheibe. Das ist ein Grund, warum Menschen im Laufe des Lebens häufig kleiner werden. Oftmals wölbt sich die Bandscheibe nach hinten in Richtung Spinalkanal (Protrusion). Kommt es zu einem Defekt im Anulus, kann Bandscheibengewebe austreten. Man spricht dann von einem Bandscheibenvorfall (Prolaps, ▶ Abbildung). Dieser kann auf die Nerven im Spinalkanal drücken.
Schematische Darstellung einer in der Mitte aufgeschnittenen Lendenwirbelsäule. Zu erkennen sind die einzelnen Wirbel, die Bandscheiben, die Bänder und die Nerven.
(Quelle: nach: Schünke M, Schulte E, Schumacher U. PROMETHEUS LernAtlas, Grafiken: Voll M, Wesker K; Stuttgart: Thieme; 2022.)
Bänder
Bänder





























