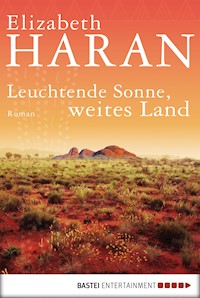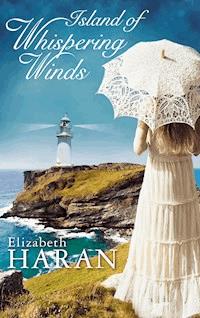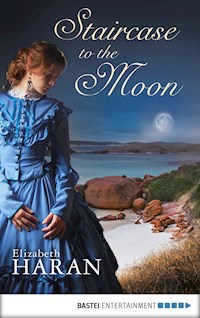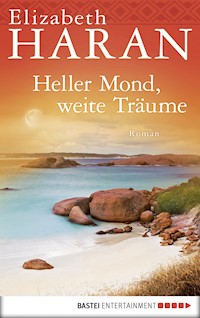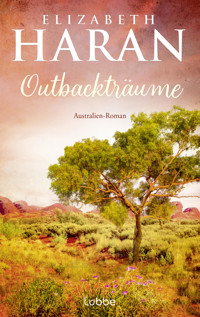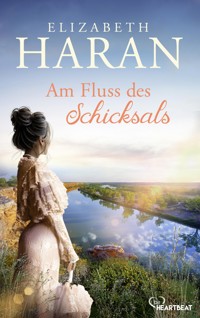7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Emotionen, weites Land - Die Australien-Romane von Elizabeth Haran
- Sprache: Deutsch
Ein farbenprächtiger Australienroman über eine junge Irin und ihre Reise ins Outback
Irland, 1920: Tara möchte ihr altes Leben hinter sich lassen und bricht nach Australien auf, wo ihre Tante eine Farm besitzt. Doch ein Feuer an Bord des Überseedampfers kostet viele Auswanderer das Leben. Tara nimmt sich der zu Waisen gewordenen Geschwister Hannah und Jack an. Als sie endlich die Farm erreichen, finden sie diese am Rande des Ruins vor. Aber Tara ist bereit, für ihr neues Heim und ihre neue Familie zu kämpfen. Mit aller Kraft versucht sie, die Farm vor dem Untergang zu bewahren - wobei ihr Ethan, ein geheimnisvoller Einzelgänger aus dem Outback, zur Seite steht ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1024
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Vorwort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Weitere Titel der Autorin
Am Fluss des Schicksals
Der Duft der Eukalyptusblüte
Der Glanz des Südsterns
Der Himmel über dem Outback
Die Insel der roten Erde
Ein Hoffnungsstern am Himmel
Eine Liebe in Australien
Heller Mond, weite Träume
Im Glanz der roten Sonne
Im Hauch des Abendwindes
Im Land des Eukalyptusbaums
Im Schatten des Teebaums
Im Tal der Eukalyptuswälder
Im Tal der flammenden Sonne
Jenseits der südlichen Sterne
Jenseits des leuchtenden Horizonts
Leuchtende Sonne, weites Land
Träume unter roter Sonne
Weitere Titel in Planung.
Über dieses Buch
Ein farbenprächtiger Australienroman über eine junge Irin und ihre Reise ins Outback
Irland, 1920: Tara möchte ihr altes Leben hinter sich lassen und bricht nach Australien auf, wo ihre Tante eine Farm besitzt. Doch ein Feuer an Bord des Überseedampfers kostet viele Auswanderer das Leben. Tara nimmt sich der zu Waisen gewordenen Geschwister Hannah und Jack an. Als sie endlich die Farm erreichen, finden sie diese am Rande des Ruins vor. Aber Tara ist bereit, für ihr neues Heim und ihre neue Familie zu kämpfen. Mit aller Kraft versucht sie, die Farm vor dem Untergang zu bewahren – wobei ihr Ethan, ein geheimnisvoller Einzelgänger aus dem Outback, zur Seite steht …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Elizabeth Haranwurde in Simbabwe geboren. Schließlich zog ihre Familie nach England und wanderte von dort nach Australien aus. Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen in einem Küstenvorort von Adelaide in Südaustralien. Ihre Leidenschaft für das Schreiben entdeckte sie mit Anfang dreißig, zuvor arbeitete sie als Model, besaß eine Gärtnerei und betreute lernbehinderte Kinder.
Elizabeth Haran
Der Ruf des Abendvogels
Aus dem australischen Englisch von Monika Ohletz
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2000 by Elizabeth Haran
Titel der australischen Originalausgabe: „A Heart of a Sunburned Land“
The author has asserted her Moral Rights.
Published by Arrangement with Elizabeth Haran-Kowalski
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2002/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Hilke Bemm
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Kharchenko_irina7/GettyImages; © David M. Schrader/shutterstock; © ilolab/shutterstock; © kwest/Shutterstock
eBook-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7517-0217-1
be-ebooks.de
lesejury.de
VORWORT
Riordan Magee trat in das feuchte Dunkel des Chelms Wood in der Nähe von Goold’s Cross, Tipperary. Obwohl er die Geschichten über böse Geister in diesem Wald zuvor scheinbar unbeeindruckt als Aberglaube abgetan hatte, überlief ihn nun doch ein kalter Schauder, als er zwischen den hohen, alten, von Flechten überwucherten Bäumen entlangging, und unwillkürlich tastete er nach dem Griff seiner Pistole.
Dieser Wald, so viel hatte die Frau des Gastwirts ihm erzählt, gehörte zum Anwesen von Donaldbain Keefe, ein ewig schlecht gelaunter, stummer Einsiedler, der Eindringlinge oder Wilddiebe gern mit einer Salve aus seiner uralten Donnerbüchse erschreckte.
Dabei dürfte es seit dem Verschwinden des jungen Malachy Finn wohl kaum irgendwelche Eindringlinge gegeben haben. Der kleine Junge war zwei Jahre zuvor, im Bilderbuchsommer von 1920, verschwunden, als er im Chelms Wood gespielt hatte. Seitdem hatte nicht einmal die Aussicht auf einen Fasanenbraten die Anwohner dazu verleiten können, dort zu wildern.
»Die Suchtrupps haben damals merkwürdige Markierungen auf dem Boden gefunden«, hatte die Wirtsfrau in verschwörerischem Ton geflüstert, »und etwas in den Bäumen, was sie für zerstückelte Tiere hielten. Aber nicht eine Spur vom jungen Malachy. Hexenzauber, kein Zweifel!«
»Abergläubiges Gewäsch!«, hatte Riordan erwidert. »Die Zigeuner benutzen solche Tricks, um die Leute abzuschrecken und die Wälder und das Wild für sich zu behalten!«
»Aber was ist dann mit Malachy passiert?«
Darauf hatte Riordan keine Antwort gehabt.
»Denk an meine Worte, Junge«, hatte die Frau gesagt. »Bei Vollmond hört man die wilden Hunde heulen – wenn du in diesen Wald gehst, bist du auf dich allein gestellt!«
Obwohl es dunkel war und man nicht viel sah, wusste Riordan, dass es leichtsinnig gewesen wäre, eine Laterne anzuzünden. So tastete er sich seinen Weg über umgestürzte Stämme und um dornige Zweige herum, die an seine Hosenbeine schlugen und ihm die Beine zerkratzten. Er durchquerte einen kleinen Bachlauf, der im Mondlicht wie flüssiges Silber glänzte, und stieg dann einen rutschigen, moosbewachsenen Hang hinauf.
Oben angekommen, hörte er Musik wie von einem ausschweifenden Fest und lautes Gelächter, Geräusche, die zusammen mit dem Rauch eines Holzfeuers und dem verlockenden Duft gebratenen Fleisches zu ihm herübergetragen wurden. Doch wegen der dunklen Silhouetten der ihn umgebenden, dicht belaubten Bäume gelang es ihm nicht, irgendetwas zu erkennen.
Plötzlich erklang der Ruf einer Nachtigall genau über ihm und ließ ihn so heftig erschrecken, dass er blitzschnell seine Pistole zog. »Gütiger Gott!«, murmelte er, als der Vogel davonflatterte und er sein Herz wild pochen spürte. Mühsam kämpfte er den Gedanken an Malachy Finn nieder und erschauderte im Nachhinein bei dem Gedanken, was geschehen wäre, wenn er wirklich seine Pistole abgefeuert und die Zigeuner dadurch auf sich aufmerksam gemacht hätte.
»Ich muss komplett verrückt sein«, murmelte er im Weitergehen, denn ihm war klar, dass er sterben könnte, wenn er entdeckt würde – die Zigeuner schützten bekanntlich ihre Frauen mit ihrem Leben.
Seit Victoria Millburn ihm ein Bild ihrer Nichte Tara geschickt hatte, die ihrer Ansicht nach von dem fahrenden Volk geraubt worden war, quälte Riordan die Vorstellung, das Mädchen werde vielleicht misshandelt und vergewaltigt. Im Lauf der Zeit hatte ihn eine regelrechte Besessenheit überkommen, Tara aus einem, wie er es sah, erniedrigenden Dasein zu befreien. Seine Geschäfte hatten darunter ebenso gelitten wie sein Privatleben. Selbst seine Freunde zweifelten an seinem Verstand, seit er begonnen hatte, jedem Hinweis über Taras Aufenthaltsort nachzugehen und manchmal tagelang durch die Straßen zu wandern, egal ob in Matsch oder Schnee, und seit er außerdem jeden Schlupfwinkel untersuchte, an dem sich die Zigeuner aufhalten mochten.
Zum Glück war es trotz der drohenden Regenwolken trocken geblieben und der Vollmond schien. Während Riordan weiter auf den Lärm des Zigeunerfestes zuhielt, brachen einzelne Lichtstreifen durch die vorüberziehenden Wolken und die Baumkronen und erhellten kleine Flecke auf dem Waldboden.
Riordans Herz drohte zu zerspringen, als ein Hase direkt neben ihm aufsprang und im Schutz des Gebüschs verschwand. Er war am Ende seiner Nerven, als er schließlich hinter dunklen Bäumen den Schein eines Lagerfeuers entdeckte. Schrilles Frauengelächter, Gitarrenmusik und laute Männerstimmen drangen an sein Ohr.
Bunte Wohnwagen standen im Kreis am Rand der Lichtung, in deren Mitte ein Feuer brannte, das die Gesichter in der Runde mit seinem warmen Schein erhellte.
Die Augen der Zigeuner glänzten wie schwarze Opale und bildeten einen lebhaften Kontrast zum strahlenden Weiß ihrer Zähne und dem metallenen Glitzern ihrer Messer. Die Wärme der Nacht und die Hitze des Feuers verliehen ihrer Haut einen bronzenen Schimmer.
Riordan versteckte sich vorsichtig zwischen den Pferden der Zigeuner, und als er sicher sein konnte, nicht beobachtet zu werden, rannte er zu den Wohnwagen hinüber und versteckte sich zwischen den Rädern.
Er fand sich neben schlafenden Welpen wieder, die reichlich von Flöhen besiedelt zu sein schienen. Es stank nach Hundekot, altem Urin und faulenden Essensresten, doch Riordan wagte nicht, sich zu bewegen, weil er fürchtete, sonst entdeckt zu werden.
Über sich hörte er das Geräusch polternder Schritte und eine wütende Männerstimme, das Schreien eines Babys und das leise Summen einer Mutter, die versuchte, ihr Kind zu beruhigen.
Riordan ließ seinen Blick über das Lager wandern. Die Schatten auf den Gesichtern der Männer wirkten im Feuerschein düster und verzerrt. Er konnte den Schweiß auf ihren Körpern riechen und die säuerlichen Ausdünstungen der Überreste des Festes. Ihre Hemden lagen eng an ihren schlanken Körpern an, und die meisten trugen schwarze Hosen mit breiten, nietenbeschlagenen Gürteln.
Fast alle hatten sie lange, ölig wirkende Haare, und einige trugen Tätowierungen an den Oberarmen. Als Riordan sich vorstellte, wie sie Tara berührten, stieg kalte Wut in ihm auf und lag ihm wie ein schwerer Stein im Magen.
Ihm wurde bewusst, dass er nicht einmal einen Plan hatte, wie er vorgehen sollte. Blind und töricht war er seinen Gefühlen gefolgt.
Abrupt brach die Gitarrenmusik ab. Mit großer Spannung wartete Riordan auf das, was nun geschehen würde.
Ein paar Augenblicke später durchbrach das leise Schellen von Tambouringlöckchen die Stille, die sich über das Lager gelegt hatte. Er hörte die Anfeuerungsrufe der Männer, als eine Frau langsam mit schwingenden Hüften in den freien Raum am Feuer trat und das Tambourin, das sie hoch über ihrem Kopf hielt, mit aufreizenden Bewegungen zum Klingen brachte.
Riordan konnte nur ab und zu einen Blick auf die Frau erhaschen, weil die zusammenströmende Menge ihm teilweise die Sicht versperrte. Er kroch vorwärts, bis er das Geschehen wieder besser sehen konnte, und starrte erschrocken auf die langen, kupferfarbenen Haare der Frau, die ihr bis über die Taille reichten.
Auch Taras Haare waren von der Farbe polierten Kupfers, aber sie hätte doch sicher niemals für ihre barbarischen Entführer getanzt!
Die Frau bewegte sich weiter um das Feuer herum. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt. Ihr Rock hing in bunten Streifen von den Hüften herab und ließ ihre langen, gebräunten Beine sehen. Ihre enge, rote Bauernbluse spannte sich über ihren Brüsten, und goldrote, im Feuerschein glänzende Haarsträhnen fielen ihr über die nackten Arme.
Nach allem zu urteilen, was Riordan von ihr sah, war sie eine Schönheit.
Als die Frau sich umwandte und er zum ersten Mal ihr Gesicht sah, erstickte er fast bei dem Versuch, den Ausruf des Erschreckens zu unterdrücken, der in ihm aufstieg. Denn was er am allerwenigsten zu sehen erwartet hatte, war der Anblick von Tara als Tänzerin vor den Menschen, die sie angeblich gefangen hielten. Man hatte ihn doch glauben gemacht, die Zigeuner hätten sie im Dunkel der Nacht aus der Geborgenheit ihres Elternhauses verschleppt.
Er kam zu dem Schluss, dass man sie wahrscheinlich zwang zu tanzen. Sein Zorn wuchs, als er an die Demütigung dachte, die Tara fühlen musste, während sie wie ein dressiertes Tier vorgeführt wurde.
Vollkommen gebannt beobachtete er, wie sie mit aufreizenden Bewegungen hin und her wirbelte. Sie schien wie hypnotisiert, und er fragte sich, ob sie vielleicht mit einem Zaubertrank gefügig gemacht worden war. Doch dann sah er ihr strahlendes Lächeln, als sie mit rhythmischen Schritten um das Feuer tänzelte.
Sie machte absolut nicht den Eindruck, als zwinge man sie zu dem, was sie tat. Obwohl jede Faser in Riordan sich dagegen sträubte, musste er zugeben, dass ihre erotische Ausstrahlung ihr offensichtlich angeboren war.
Doch wer hatte sie gelehrt, so aufreizend zu tanzen, wer hatte ihr beigebracht, ihren Körper so verführerisch einzusetzen? Sicherlich niemand aus ihrer strengen Familie. Victoria wurde von dem Gedanken gequält, Tara sei eine Gefangene der Zigeuner – doch die Wahrheit schien Riordan noch viel schlimmer. Victoria darf das nie erfahren, schwor er sich selbst – niemals!
Als die Musik schneller wurde, folgten Taras Bewegungen dem rascheren Rhythmus. Ihre nackten Füße wirbelten Staub auf, und sie warf den Kopf zurück, während sie ihren wohlgeformten Hals nach hinten bog und die langen Haare ihr als leuchtende Flut über die Schultern fielen.
Die Männer starrten sie mit unverhohlenem Begehren an, als ihre Bewegungen immer sinnlicher und erregender wurden. Riordan wurde wieder wütend – wütender als jemals vorher in seinem Leben. Er dachte an all die Tage und Wochen, die er mit der Suche nach ihr verschwendet hatte. Er hatte seine Geschäfte vernachlässigt und ebenso sein Privatleben. Wie unendlich töricht von ihm, jemals geglaubt zu haben, dass sie auf Rettung wartete! Tara war genau dort, wo sie sein wollte.
Plötzlich konnte er sich nicht länger zurückhalten; er kroch aus seinem Versteck und drängte sich durch die Menge nach vorn.
»Tara!«, schrie er. »Wie konnten Sie … das tun?«
Jemand packte ihn am Kragen, und er fühlte sich zu Boden gedrückt und von Männern umringt. Abrupt verstummte die Musik. Er griff nach seiner Pistole, doch die Zigeuner waren schneller. Hasserfüllte Blicke aus dunklen Augen durchbohrten ihn; das Letzte, das er bewusst wahrnahm, nachdem mehrere Faustschläge sein Gesicht und Fußtritte seinen Körper getroffen hatten, war Tara, die mit vor Schreck weit aufgerissenen Augen auf ihn herabblickte. Danach überkam ihn gnädiges Vergessen.
Fröhliches Vogelgezwitscher war die erste Wahrnehmung, die in Riordans Bewusstsein drang. Dann spürte er ein schmerzhaftes Pochen in seiner Schulter und hörte seltsame, halb erstickte Grunzlaute, die etwas Tierisches hatten.
Mit größter Anstrengung öffnete er eines seiner fast zugeschwollenen Augen und blinzelte ins Sonnenlicht. Ein hünenhafter, bärtiger Mann stand über ihn gebeugt und zielte mit einem alten Gewehr genau auf seinen Kopf. Riordan versuchte, seine Beine zu bewegen, und eine Woge der Panik überkam ihn, als er meinte, von der Taille abwärts gelähmt zu sein. Doch dann stellte er rasch fest, dass die untere Hälfte seines Körpers in einer grabähnlichen Vertiefung steckte und mit Erde bedeckt war.
Jeder Zentimeter seines Oberkörpers schmerzte höllisch, und sein Gesicht war geschwollen und blutverkrustet. Riordan wusste, es war ein Wunder, dass er überhaupt noch lebte. Doch er vermochte keine Erleichterung darüber zu verspüren, und noch weniger Freude. Als die Erinnerung an die nur wenige Stunden zurückliegenden Ereignisse in sein Bewusstsein drang, fühlte er nichts als tiefe Resignation. Die Zigeuner waren fort.
1
Sieben Jahre später
Als sich die Frau, die sich Lady Morna Bowers nannte, ihrem Ziel näherte, überprüfte sie nervös ihre äußere Erscheinung. Sie zupfte an ihrem Schleier, bis sie sicher war, dass er ihr Gesicht verbarg, und vergewisserte sich, ob sie nicht schon wieder einen der kleinen Zierknöpfe auf der Vorderseite ihres Witwenkleides verloren hatte.
Beim Anblick der Knöpfe musste sie unvermittelt an den letzten Abend denken, den sie mit ihrer Familie verbracht hatte. Es hatte ein festlicher Abend voller Fröhlichkeit werden sollen, doch die Erinnerung daran war furchtbar, die Ereignisse von damals genau der Grund, warum sie nun gezwungen war, harmlose Menschen zu betrügen, um an die Mittel zu gelangen, die sie zum Leben brauchte.
Lady Bowers umfasste ihr flaches, aber sperriges Paket mit festem Griff, was in den vornehmen Spitzenhandschuhen nicht eben einfach war. Dann blickte sie über die Grafton Street, eine der geschäftigsten Straßen von Dublin, hinweg in die Darby Lane, wo sie schon ihr Ziel erkennen konnte, die Harcourt Gallery. Nach einem tiefen Atemzug trat sie vom Gehweg auf die Straße.
»Vorsicht!«, rief jemand.
Zwei Kutschpferde scheuten vor der Hupe eines Automobils, gingen durch und preschten in hohem Tempo an ihr vorüber. Die Räder der Kutsche rollten durch eine Pfütze, und schmutziges Wasser spritzte an den Straßenrand.
»Sie ungeschickter Trottel!«, rief Lady Bowers dem Fahrer des Automobils zu. Sie war so außer sich, dass ihr das Paket entglitt.
»Diese verdammten Handschuhe!«, murmelte sie aufgebracht. »Nicht mal so ein verflixtes Ding kann ich halten. Und zur Hölle mit dem lächerlichen Schleier! Ich sehe ja kaum, wohin ich gehe!«
Sie hob den störenden Tüll, um das Paket zu begutachten, das zum Glück unbeschädigt schien, musste aber feststellen, dass der Saum ihres Kleides von übel riechendem Schlamm bedeckt war.
»Heiliger Moses«, stieß sie unterdrückt hervor, »ich hätte nicht gedacht, dass heute noch mehr schief gehen kann.«
An dem eleganten schwarzen Kleid, das sie günstig bei einem Wohltätigkeitsbasar erstanden hatte, waren zwei Knöpfe lose gewesen, sodass es über dem Busen nicht richtig schloss – was sie in letzter Minute behoben hatte. Ihre Schuhe waren nur geliehen und eine Nummer zu groß, weshalb sie Zeitungspapier in die Spitzen hatte stopfen müssen. Dann hatte ihr Pferd ein Hufeisen verloren, sie war in einen Wolkenbruch geraten …
Plötzlich bemerkte sie, dass jemand einen stützenden Arm um ihre schmale Taille gelegt hatte. »Lassen Sie mich sofort los!«, stieß sie ärgerlich hervor, den Blick noch immer auf den schmutzbedeckten Saum ihres Kleides gerichtet. »Das hat mir gerade noch gefehlt – jetzt stinke ich wie ein wandelnder Misthaufen!« Dann wandte sie sich halb um, bereit, den unverschämten Kerl zu tadeln, der es wagte, sie anzufassen. Doch ein amüsierter Blick aus graublauen Augen ließ sie sofort verstummen. Hastig bedeckte sie ihr Gesicht, jedoch nicht, ohne vorher festzustellen, dass die schönen Augen zu einem sehr gut aussehenden Mann gehörten. Er war vermutlich nur wenige Jahre älter als sie selbst und trug einen maßgeschneiderten Mantel aus sehr teurem, feinen Stoff.
»Oh, entschuldigen Sie bitte!« Erschrocken schlug sie die Hand vor den Mund, als ihr bewusst wurde, dass er jetzt sehr schlecht von ihr denken musste.
Er nahm seinen schwarzen Hut ab, unter dem dichte, blonde, gelockte Haare zum Vorschein kamen. Sein Schnurrbart war leicht rötlich und wohlgepflegt. Inmitten der vielen Arbeitslosen, die in schäbiger Kleidung vorübertrotteten, fiel seine Erscheinung umso mehr auf.
Der Mann maß sie mit einem fast unverschämten Blick von oben bis unten; ihre Aufmachung wirkte ein wenig altmodisch, sodass er eigentlich eine sehr viel ältere Frau zu sehen erwartet hatte. Ihre angenehme Stimme, ihr Auftreten und vor allem ihre sehr direkte Ausdrucksweise hatten ihn deshalb sehr überrascht. Zum Glück hatte er noch einen kurzen Blick auf ihr Gesicht werfen können, bevor sie diesen lächerlichen Schleier darüber gezogen hatte – sie war wirklich hübsch.
»Ich denke, Sie werden mir darin zustimmen, dass Pferdekutschen und Motorfahrzeuge nicht auf derselben Straße fahren sollten«, sagte er freundlich und zog ein schneeweißes Taschentuch mit Monogramm hervor. Ungläubig sah Lady Bowers zu, wie er begann, damit den Schmutz vom Saum ihres Kleides abzuwischen.
»Oh ja«, erwiderte sie leidenschaftlich. »Die Fahrer dieser Motorungeheuer scheren sich den Teufel um Fußgänger und noch weniger um die Pferde. Heute Morgen wäre ich beinahe im Straßengraben gelandet …« Sie verstummte jäh, als ihr klar wurde, dass er eher für die Automobile gesprochen hatte und dass sie sich besser wie eine Dame benehmen sollte – zwar in finanzieller Notlage, aber nichtsdestotrotz eine wirkliche Lady!
»Ich wollte sagen, ich musste auf meine Kutsche zurückgreifen, denn wie alles andere ist auch Benzin im Moment schwierig zu bekommen …«
Er blickte kurz auf, während er fortfuhr, am Saum ihres Kleides herumzuwischen, womit er allerdings den Schmutz nur weiter verschmierte. »Man kommt an alles heran, wenn man nur die richtigen Kontakte hat!«
Lady Bowers blickte auf seinen Kopf hinab und schnaubte leise. Wenn man nach seiner Kleidung urteilte, konnte er sich alles leisten! Jetzt richtete er sich auf, und sie zwang sich zu einem dankbaren Lächeln.
»Sind Sie wirklich nicht verletzt?«, forschte er, und trotz ihres leisen Ärgers fand sie den Klang seiner Stimme irgendwie faszinierend.
»Wirklich nicht«, erwidert sie und sah zu, wie er sich bückte, um ihr Paket aufzuheben. Plötzlich fühlte sie angesichts des zerknitterten braunen Papiers und der offensichtlich schon häufiger benutzten Schnur leise Scham in sich aufsteigen. »Ich hätte aufpassen müssen, als ich auf die Straße trat. Ich war wohl in Gedanken – das passiert mir sonst selten …« Sie schenkte ihm einen eindringlichen Blick unter ihren langen Wimpern, um den Eindruck wieder auszugleichen, den ihr ungeschicktes Benehmen bei ihm hinterlassen haben mochte.
»Sie sind ganz einfach das Opfer eines Zusammentreffens zwischen Vergangenheit und Zukunft geworden«, erwiderte er. »Würden Sie mir erlauben, Ihnen beim Überqueren der Straße beizustehen?«
Einen flüchtigen Augenblick lang genoss Lady Bowers das Gefühl, so respektvoll behandelt zu werden, doch dann rief sie sich zur Ordnung: Sie musste vor allem ihr Ziel im Auge behalten.
»Das wird nicht nötig sein«, gab sie spröde zurück und hoffte, er würde sich nun wieder seinen eigenen Angelegenheiten widmen. Genau das hatte sie ebenfalls vor, bevor sie völlig die Nerven verlor.
»Es ist viel Verkehr – und Ihr … Ihr Gemälde sieht ziemlich schwer aus.«
»Ich komme schon zurecht!«
»Aber es wäre mir ein Vergnügen!«
Da war es wieder, dieses verheerende Lächeln! Schon sah sie ihren ausgefeilten Plan in sich zusammenstürzen, doch sie musste sich zusammennehmen. Ihr Leben stand kurz davor, eine fatale Wendung zu nehmen, und sie musste schnell handeln, um nicht in eine schreckliche Situation zu geraten. Schließlich war sie auf sich allein gestellt und ohne jegliche finanzielle Mittel.
»Nein, danke. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden …«
»Sind das Ihr Wagen und Ihr Fahrer?« Er blickte zu einer glänzenden schwarzen Kutsche, die nur ein paar Schritte hinter ihr stand und die sie sich nicht einmal in ihren kühnsten Träumen hätte leisten können. Ihre Wangen überzogen sich mit tiefer Röte, und wieder war sie froh, einen Schleier zu tragen.
»Ja – aber ich habe meinem … Diener gesagt, dass ich durchaus imstande bin, allein über die Straße zu gehen!« Sie versuchte, ihr Gemälde an sich zu nehmen, doch er hielt es weiter fest. Sie war sich nicht sicher, ob er nun ein unerschütterliches Selbstbewusstsein besaß oder einfach nur schrecklich hartnäckig war. Jedenfalls stellte er ihre Geduld auf eine harte Probe!
»Diese mutige Selbstständigkeit ist eine bewundernswerte Eigenschaft, Madam«, sagte er, »besonders in der Situation, in der Sie sich bedauernswerterweise befinden – aber ich bestehe darauf, Ihnen zu helfen. Außerdem verfüge ich zufällig über einigen Einfluss in der Galerie. Es wäre mir eine Ehre, Sie persönlich dorthin zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Sie mit äußerster Höflichkeit und Rücksicht behandelt werden.« Er war sicher, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmte, und wild entschlossen herauszufinden, was es war.
Lady Bowers bedachte ihn mit einem zweifelnden Blick. »Auch wenn Sie anscheinend noble Absichten haben, Sir, kann ich nicht glauben, dass Sie in der angesehenen Harcourt Gallery wirklich über einen derartigen Einfluss verfügen!«
Jetzt wirkte er überrascht und irgendwie verwirrt, doch Lady Bowers fuhr unerbittlich fort: »Ich habe meinen eigenen Plan, um sicherzustellen, dass ich gerecht behandelt werde.« Sie hatte zunächst überlegt, sich ein Kissen unter das Kleid zu stecken, damit es aussähe, als sei sie schwanger, doch schließlich hatte sie ihre Meinung geändert.
»Wirklich? Ich bin gespannt«, erwiderte er, und sein Ton machte ihr schlagartig bewusst, dass sie nicht gerade wie eine trauernde Witwe klang.
»Ich meine, ich hoffe natürlich, dass man mir dort wegen meiner persönlichen Situation Mitgefühl entgegenbringt.«
»Unglücklicherweise, Madam, sind Mitgefühl und Geschäfte für gewöhnlich unvereinbar, besonders jetzt, seit dem Börsenkrach. Wenn Sie aber jemanden dort kennen würden, also Beziehungen hätten, könnte das eine große Hilfe sein. Darf ich fragen, ob Sie mit irgendjemandem in der Galerie bekannt sind?«
»Nun … nein.«
Er lächelte. »Erlauben Sie mir, mich vorzustellen: Riordan Magee, zu Ihren Diensten.«
»Ta…« Sie räusperte sich, um ihren Schnitzer als Hustenanfall zu tarnen, doch Riordan hatte es trotzdem bemerkt. »Lady Morna Bowers, Sir.« Sie erinnerte sich an ihre Benimmstunden und streckte ihm zögernd eine behandschuhte Hand entgegen. Er bemerkte sofort die gebräunte Haut zwischen dem Rand ihres Handschuhs und dem Ärmel ihres Kleides. Eine wirkliche Lady hätte sicher nicht so viel Zeit im Freien verbracht!
»Sehr erfreut, Lady Bowers.« Er beugte sich über ihre Hand. »Ich zweifle nicht daran, dass Ihr Plan wohl durchdacht ist, aber ich glaube trotzdem, es wäre von Vorteil, wenn ich Sie begleite. In diesem Unternehmen ist man ein wenig altmodisch und auf Etikette bedacht, und unglücklicherweise wird auf Trauernde dabei keine Rücksicht genommen. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mir die Erlaubnis geben würden.«
Sie maß ihn mit einem langen Blick und gestand sich schließlich ein, dass sie jede Hilfe brauchen konnte.
»Gut«, erklärte sie, »solange Sie sich nicht in meine Geschäfte einmischen. Auch wenn es vielleicht dramatisch klingt, aber von dem Verkauf dieses Bildes hängt sehr viel für mich ab. Ich kann es mir nicht leisten, dass dabei etwas schief geht.« Sie sah Riordans neugierigen Blick, hätte sich jedoch lieber die Zunge abgebissen als zuzugeben, dass sie kurz davor stand, obdachlos und allein zu sein – nur weil sie ihrem oft abwesenden Ehemann kein Kind hatte gebären können. Stattdessen besann sie sich wieder auf ihre Rolle als trauernde Witwe. »Seit ich meinen Mann … verloren habe …«, sie schluchzte theatralisch in ihr Taschentuch, »muss ich für mich selbst sorgen; ich hoffe, Sie verstehen?«
»Natürlich, Lady Bowers. Es ist wirklich sehr bedauerlich, dass Ihr Mann nicht ausreichend für Sie vorgesorgt hat!«
Morna riss die Augen auf und unterdrückte nur mühsam ein hysterisches Lachen. Es war fast unmöglich, für eine Frau zu sorgen, während man in einer Gefängniszelle festsaß – und genau dort befand sich ihr wahrer Ehemann nur allzu oft.
»Auch wenn ich Lord Bowers nicht persönlich kannte«, fügte Riordan hinzu, »so habe ich doch gehört, dass er ein sehr wohlhabender Mann gewesen sein soll.«
Seine Worte brachten die angebliche Lady Bowers für einen Augenblick aus dem Gleichgewicht. Sie hatte nicht erwartet, dass Riordan irgendetwas über ihren vorgeblichen Ehemann Lord Bowers wusste, und rief sich hastig in Erinnerung, was sie sich zurechtgelegt hatte. »Das ist lange her, Mr. Magee. Seine Leidenschaft für Kartenspiele, vor allem für ›Black Jack‹, war sehr viel größer als sein Geschick in dieser Hinsicht. Wir mussten fast unseren gesamten Besitz verkaufen. An diesem Bild hier hänge ich sehr, aber ich habe eine Verantwortung für meine Bediensteten und bringe es nicht übers Herz, sie einfach auf die Straße zu setzen …«
Riordan war jetzt so gut wie überzeugt, dass ihre Geschichte erfunden war, doch ihre Schauspielerei bereitete ihm großes Vergnügen. Er beschloss, sie weiter zu verunsichern. »Ich verstehe – und vielleicht darf ich hinzufügen, ich bin zutiefst erleichtert, dass die Gerüchte um Ihren Mann nicht der Wahrheit entsprechen!«
Sie starrte ihn verwundert an. »Gerüchte? Was für Gerüchte?«
»Also, ich weiß nicht, ob ich sie Ihnen …«
»Erzählen Sie mir davon, Mr. Magee! Ich habe ein Recht darauf zu wissen, was die Leute über meinen … meinen lieben verblichenen Devlin reden.«
Riordan brachte es nur mit Mühe fertig, ein Lächeln zu unterdrücken. »Ich bin sicher, es ist kein Körnchen Wahrheit daran …«
»Natürlich nicht. Aber trotzdem sollte ich wissen, was hinter meinem Rücken geredet wird!«
»Also gut, Lady Bowers! Es wurde erzählt, Lord Bowers hätte mehrere Geliebte gehabt.«
Obwohl es sie kaum hätte berühren dürfen, fühlte sie sich in ihrem Stolz getroffen, und echte Empörung stieg in ihr auf. »Das stimmt natürlich nicht!«, stieß sie wütend hervor.
»Bitte entschuldigen Sie meine Unverblümtheit! Jetzt, da wir uns kennen, würde ich niemals glauben, dass diese Gerüchte zutreffen könnten. Darf ich fragen, wie Lord Bowers … so bedauerlich früh sein Ende gefunden hat? Auch darüber gingen zwar Geschichten um, aber wie ich soeben auf so plumpe Weise bewiesen habe, können solche Berichte sehr ungenau sein!«
»Er … er … war eine Zeit lang krank, und irgendwann hat sein Herz nicht mehr standgehalten …« Sie hoffte, die vage Formulierung würde auch fast alle anderen Krankheiten abdecken, an denen Lord Bowers gelitten haben könnte. Riordan hob erstaunt die Brauen.
»Wirklich? Wie gut zu hören, dass er nicht an Syphilis gestorben ist! Gerüchte können so grausam sein!«
Lady Bowers war sprachlos vor Entsetzen. Wie hatte sie sich nur jemand derart Verdorbenen als Scheinehemann aussuchen können? Sie war eben im Begriff, Riordans Andeutungen empört zurückzuweisen, als sie seinem Blick begegnete und das mutwillige Zwinkern darin sah. Ihr Verdacht, er wisse, dass sie nicht wirklich Lady Bowers war, erhärtete sich, aber sie hoffte, er werde Gentleman genug sein, sie nicht allzu offen des Betrugs zu beschuldigen. Außerdem hatte er offensichtlich Devlin Bowers nicht persönlich gekannt, sodass er ihr ihre Lügen nicht würde beweisen können, zumindest nicht, ohne vorher einige Nachforschungen anzustellen.
Wieder zwinkerte er ihr zu, und seine Lippen verzogen sich zu einem verschwörerischen Lächeln.
»Ich hege den Verdacht, Mr. Magee«, sagte sie, »dass bei Ihnen unter der glatten Fassade eines Gentleman das Herz eines Schurken schlägt. Ich muss Sie warnen: Man hält mich nicht ungestraft zum Narren!«
Riordan setzte eine gekränkte Miene auf, um dann zu erklären: »Bitte nehmen Sie es sich nicht zu Herzen, Lady Bowers, aber ich habe den Eindruck, dass ich es bin, der heute von Ihnen in der Kunst der Verstellung etwas lernen kann!« Ein weiteres verschmitztes Lächeln nahm seinen Worten die Schärfe.
Das Schellen einer Messingglocke ertönte, als Riordan Magee Lady Bowers an der Eingangstür der Harcourt Gallery den Vortritt ließ. Nach einem tiefen Atemzug gegen die plötzlich aufsteigende Nervosität ging sie hinein und fühlte sich augenblicklich eingeschüchtert angesichts der gediegenen Atmosphäre in Irlands berühmtester Kunstgalerie.
Ölgemälde und Aquarelle, manche davon in wertvollen Rahmen, schmückten die Wände, Skulpturen aus Bronze und Stein standen neben reich verzierten Säulen und Bögen. Die angebliche Lady Bowers fühlte sich sehr verunsichert; unter normalen Umständen hätte sie niemals gewagt, ein solches Gebäude zu betreten.
Da Riordan Magee an der Tür von einem Bekannten aufgehalten wurde, ging sie ohne ihn weiter auf einen gut gekleideten Gentleman im hinteren Teil der Galerie zu. Er beobachtete sie von seinem riesigen Sessel aus, während seine Miene mäßige Neugier und Herablassung spiegelte. Sie schluckte den Kloß in ihrer Kehle hinunter, als sie seinen Blick auf das in zerknittertes braunes Papier gewickelte Bild gerichtet sah, das Riordan im Flur abgestellt hatte, und auf den schmutzigen Saum ihres Kleides.
Der fremde Mann erhob sich, bevor Lady Bowers ihn erreicht hatte, und sie stellte fest, dass sein Sessel gar keine so riesigen Ausmaße besaß, wie es zuerst den Anschein gehabt hatte. Der Mann war nur sehr klein. Er wirkte unsympathisch und abweisend, und seine Worte bestätigten diesen Eindruck voll und ganz.
»Wenn Sie verkaufen wollen, Madam: Wir machen keine Geschäfte mit Kunden, die uns nicht persönlich empfohlen worden sind.« Seine Worte schienen in der Stille der Galerie nachzuklingen wie ein Echo und verstärkten die Woge der Scham, die in Morna aufstieg.
Ihr Kopf war plötzlich ganz leer, und es verstrichen einige seltsame Momente, bevor es ihr gelang, ihre Gedanken zu ordnen. Als sie schließlich sprechen konnte, klang ihre Stimme zaghaft. »Würden Sie mir bitte einige Minuten Ihrer Zeit schenken? Ich verspreche Ihnen, dass es lohnend für Sie sein wird.« Sie schluchzte in ihr Taschentuch, doch ihre offensichtliche Verzweiflung schien den Mann nicht zu rühren.
»Es tut mir Leid, Madam. Wir machen absolut keine Ausnahmen.« Seine Worte klangen nicht im Mindesten mitfühlend, und er entließ Lady Bowers durch einen Wink seiner kurzfingrigen Hand.
Lady Bowers fühlte sich zutiefst gedemütigt. All die Stunden, in denen sie für diesen Moment geprobt hatte, fielen ihr ein, und sie wollte nicht glauben, dass alles umsonst gewesen sein sollte. Obwohl ihr häufig mit Verachtung begegnet wurde, hatte sie sich nie daran gewöhnt. Hinzu kam, dass sie sich vor Riordan Magee ausgesprochen blamiert fühlte. Wenigstens war er nicht direkt Zeuge der erniedrigenden Abfuhr geworden!
»Es tut mir Leid, dass ich Sie warten ließ, Lady Bowers!«, sagte er in diesem Moment genau hinter ihr, und sie zuckte erschrocken zusammen. Zögernd wandte sie sich um, fieberhaft nach Worten ringend, um ihre Demütigung vor ihm zu verbergen. Doch ihr fiel absolut nichts ein. Um die ganze Sache noch schlimmer zu machen, fühlte sie, wie ihr die Tränen kamen.
»Was für ein herzloser Mensch …«, stammelte sie. Das Mindeste, worauf sie hoffen konnte, war ein wenig Mitgefühl. »Er ist anscheinend zu beschäftigt, um mir einen kurzen Moment seiner Zeit zu gewähren, nachdem ich stundenlang unterwegs war, um hierher zu gelangen! Mein lieber Devlin würde sich im Grabe umdrehen …«
Riordan hatte schnell erfasst, dass Lady Bowers wohl eher verlegen als enttäuscht war. Der Geschäftsführer hatte sich ihr gegenüber wohl recht brüsk verhalten.
»Lady Bowers«, meinte Riordan beschwörend, »so schnell werden Sie doch wohl nicht aufgeben! Ich hatte mich so darauf gefreut, die Ausführung ihres Plans mitzuerleben!«
Sie zögerte. Ihre missliche Lage rührte Riordan. Er war wirklich so enttäuscht darüber, ihre Vorstellung nun vielleicht doch nicht erleben zu können, dass er beschloss, ihr zu helfen. Mit einem Blick auf den Mann hinter dem Schreibtisch flüsterte er: »Vielleicht müsste er nur noch einmal darauf hingewiesen werden, wer Sie sind?«
Lady Bowers starrte den Mann an, der sie soeben wie einen Niemand hinausgewunken hatte. »Sie haben Recht!«, erwiderte sie, und ihre Entschlossenheit kehrte zurück. Sie hob den Kopf und straffte die Schultern, um dann wieder auf den Tisch zuzugehen. Dort blickte sie auf den Mann herab, der ganz auf einige Schriftstücke konzentriert zu sein schien.
»Ich bin Lady Morna Bowers«, sagte sie so eindringlich, dass der Mann überrascht aufblickte. »Darf ich Sie um Ihren Namen und Ihren Titel bitten?«
Sekunden lang wirkte der Mann verärgert, doch als Riordan hinter Morna auftauchte, malte sich Verwirrung auf seinen Zügen.
»Ich bin … Kelvin Kendrick, der Geschäftsführer der Galerie, Madam. Ich muss mich wohl für meine Unhöflichkeit entschuldigen … Ich wusste nicht, dass Sie …« Er räusperte sich nervös. Sein Blick ging einige Male zwischen Riordan und ihr hin und her. »Ich habe nicht einen Augenblick lang angenommen …« Sein Gesicht überzog sich mit tiefer Röte. »Bitte vergeben Sie mir meine unentschuldbare Anmaßung!«
Lady Bowers Lebensgeister kehrten zurück. »Wenn Sie die Freundlichkeit hätten, den Besitzer der Galerie zu verständigen, werde ich ihre Unhöflichkeit nicht erwähnen.«
Kelvin Kendricks Miene wirkte absolut ausdruckslos. Er starrte wieder an ihr vorbei. »Ich … ich bin nicht ganz sicher, ob der Besitzer zurzeit … verfügbar ist.«
»Dann versuchen Sie bitte, das herauszufinden. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumstehen!«
»Wenn ich kurz unterbrechen dürfte, Lady Bowers«, meinte Riordan, »würde ich vorschlagen, dass Mr. Kendrick Sie in ein Büro führt, wo Sie in Ruhe auf den Besitzer warten können.«
Sie wandte sich zu ihm um. »Vielen Dank, Riordan! Wie Sie sehen, habe ich die Situation unter Kontrolle.«
Kelvin hatte ihre Worte mitgehört und war so verlegen, dass sein Gesicht fast dunkelrot anlief. Lady Bowers wandte sich ihm wieder zu, während Riordan mit dem Lachen kämpfte. »Wenn Sie ein ruhiges Büro haben, dann führen Sie mich bitte dorthin«, kommandierte sie.
Kelvin zögerte nur einen winzigen Augenblick. »Sehr gern, Madam. Wenn Sie mir bitte folgen würden? Ich werde sehen, ob ich den Besitzer … finden kann.«
»Bitte teilen Sie ihm mit, dass ich über gute Beziehungen zur europäischen Kunstszene verfüge und nicht zögern würde, sie zu nutzen.«
Die Röte in Kelvins Gesicht breitete sich bis zu seinem Hals hin aus.
Morna drehte sich noch einmal zu Riordan um. »Sie können jetzt gehen, Mr. Magee. Ich habe wirklich alles unter Kontrolle.«
»Das sehe ich«, erklärte er. »Auf Wiedersehen, und viel Glück. Ich hoffe, wir begegnen uns bald wieder.«
Sein graublauen Augen zwinkerten amüsiert. »Vielen Dank, dass Sie mich hierher begleitet haben«, sagte sie. Dann nahm sie ihr Gemälde und folgte Kelvin Kendrick den Flur hinunter in ein großzügiges Büro. Er führte sie hinein und ging wieder fort.
Die Einrichtung des Privatbüros war schlicht, aber elegant. Ein antiker Tisch und zwei bequeme Ledersessel waren außer einem schmalen Bücherregal und einer Marmorbüste das einzige Mobiliar. Der Boden war mit geschmackvollen Teppichen ausgelegt, die den Raum gemütlicher wirken ließen. Wertvolle Kunstwerke zierten die Wände, die meisten davon Impressionisten und zu ausgefallen für ihren Geschmack.
In der Ecke hinter der Tür standen einige weitere Bilder, die teilweise mit einem Tuch verhängt waren. Neugierig zog sie das Tuch fort und schaute sich die Gemälde an. Bei den meisten Bildern handelte es sich um Landschaften und Porträtstudien … Plötzlich jedoch hielt Morna inne – und stutzte: Sie starrte auf ein Porträt, das sie selbst an einem Lagerfeuer zeigte, bekleidet mit einer sehr freizügigen ärmellosen Bluse und einem Seidenrock, der die ganze Länge ihrer wohlgeformten Beine sehen ließ. Der Feuerschein ließ ihr kupferfarbenes Haar schimmern und spiegelte sich in ihren großen, goldenen Ohrringen. Das blasse Oliv ihrer Haut schien förmlich zu glühen, und in ihrem Blick stand sehnsuchtsvolles Begehren. Das war eine kurze, sehr glückliche Zeit in ihrem Leben gewesen, doch dann hatte sich alles so schnell verändert …
Morna überlegte, wie das Bild wohl in die Galerie gekommen war. Es war ein Geschenk an ihre Tante gewesen, die geschworen hatte, sich niemals davon zu trennen. Allerdings war diese Tante einige Jahre zuvor angeblich nach Übersee ausgewandert. Ein Geräusch hinter ihr ließ sie zusammenfahren.
»Der Besitzer ist zurzeit nicht zu sprechen«, erklärte Kelvin Kendrick kühl. »Vielleicht kann ich Ihnen helfen?«
Sein Angebot klang gezwungen, aber im Grunde genommen war es ihr so eigentlich lieber, denn sie ahnte instinktiv, dass Kelvin Kendrick leichter zu manipulieren sein würde.
Lady Bowers stellte das eben entdeckte Bild vor die übrigen. »Könnten Sie mir sagen, wie der Galeriebesitzer an dieses Porträt gekommen ist?«, fragte sie, um einen sachlichen Ton bemüht.
Kelvin wirkte überrascht. Er hatte das Bild nie sehr gemocht. »Ich weiß nicht – ich glaube, er hat es in Übersee erstanden, Madam.«
Also musste ihrer Tante etwas zugestoßen sein! Sie beschloss, später noch einmal in die Galerie zu kommen, um mit dem Besitzer zu sprechen.
»Mr …« Kelvin hüstelte statt zu sagen, was er eigentlich hatte sagen wollen. »Entschuldigen Sie. Ich weiß zufällig, dass es nicht zu verkaufen ist«, fuhr er fort. Die Verachtung in seiner Stimme war nicht zu verkennen. »Meiner Meinung nach ist es technisch nicht besonders gut, aber ich glaube, der Besitzer hat persönliche Gründe dafür, das Bild zu behalten. Normalerweise führen wir solche … Arbeiten nicht in der Galerie.«
Sie wusste genau, was er meinte: Das Porträt einer Zigeunerin wurde nicht für würdig befunden, einen Platz in der Harcourt Gallery einzunehmen.
»Aus einem mir unbekannten Grund hat der Besitzer allerdings nach dem Künstler suchen lassen, um mehr von ihm anzukaufen«, fügte Kelvin hinzu.
»Tatsächlich?« Lady Bowers lächelte hocherfreut.
2
Die Dunkelheit brach schon herein, und die Straßenlaternen brannten bereits, als Lady Bowers und Mr. Kendrick ihr Geschäft abgeschlossen hatten. Er geleitete sie zur Tür der Galerie, an der gerade eine Zigeunerfamilie vorüberging.
»Diebisches Gesindel!«, murmelte Kelvin. »Warten Sie am besten hier drinnen, bis die vorbei sind, Lady Bowers, sonst werden Sie am Ende noch um die hübsche Geldbörse erleichtert, die Sie bei sich tragen!«
Morna erkannte die Zigeuner sofort. Rosa und Jasper hatten fünf Kinder zu ernähren. Wie viele andere, litten auch sie unter der allgemeinen Wirtschaftskrise, aber sie waren bemüht, alles zu tun, um irgendwie für die Kleinen zu sorgen.
»Die Zigeuner sind nicht so schlecht, wie die Leute glauben«, hörte sie sich plötzlich sagen. »Sie leben nach ihren eigenen Gesetzen, die vielleicht anders sind als Ihre und meine – aber ich glaube, die meisten von ihnen sind durchaus ehrenwerte Menschen.«
Erstaunt starrte Kelvin sie an. »Aber Sie kennen doch sicher keinen Zigeuner persönlich, Lady Bowers? Ansonsten würden Sie ganz gewiss nicht so großmütig über sie denken.«
»Mein Vater und mein verstorbener Onkel erlaubten den Zigeunern, auf ihrem Land zu lagern. Mein Onkel hatte ein gewisses künstlerisches Talent, und man sagte mir, dass ihm die Zigeunerfrauen Modell gestanden hätten. Da ich seine Werke nie sehen durfte, kann ich nur annehmen, dass die Bilder eher … gewagt gewesen sind.«
Kelvin Kendrick war völlig konsterniert, wie Lady Bowers zufrieden bemerkte. »Der Besitzer der Galerie muss das Gemälde in seinem Büro schon mögen«, fügte sie hinzu, »sonst würde er Sie doch wohl kaum beauftragt haben, andere Werke desselben Künstlers anzukaufen!«
Kelvins abweisender Blick sprach dafür, dass die Vorliebe des Besitzers für das Zigeunerbild ihm vollkommen unverständlich war. Oft schon hatte er seinen Arbeitgeber dazu bewegen wollen, es abzugeben, doch dieser hatte nichts davon hören wollen. Allerdings hatte er das Gemälde auch niemals aufhängen lassen, nicht einmal in seinem Büro. Es war, als hasse er es, könne sich aber trotzdem nicht davon trennen, und dieser Widerspruch verblüffte Kelvin.
»Dann auf Wiedersehen, Mr. Kendrick«, sagte Lady Bowers, als die Zigeunerfamilie vorüber war. »Es ist mir ein Vergnügen gewesen, mit Ihnen Geschäfte zu machen.« Diese Bemerkung war eine glatte Lüge. Ihre Dankbarkeit hatte nichts mit dem unfreundlichen Geschäftsführer zu tun, sondern entsprang einzig ihrer Zufriedenheit über das erfolgreiche Täuschungsmanöver.
Dass Kelvin Kendrick bereit gewesen war, so viel Geld für ein Bild zu bezahlen, dass ihm nicht gefiel und dem er jeden technischen Vorzug absprach, verwirrte sie, doch sie beschloss, nicht länger über den Grund für sein Handeln – oder ihr Glück – nachzugrübeln. Sie würde es eben einfach als lange überfällige Wiedergutmachung des Schicksals sehen!
Nachdem sie die Galerie verlassen hatte, wandte sich Lady Bowers ab und eilte die Straße hinunter. »Engstirniger kleiner Mann«, murmelte sie ärgerlich.
»So unzufrieden, Lady Bowers?«
Morna fuhr herum, überrascht, Riordan Magee hinter sich zu sehen.
»Konnten Sie Ihr Geschäft nicht zu Ihrer Zufriedenheit beenden?«, fragte er scheinheilig.
»Im Gegenteil – es ist sehr gut verlaufen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden …!« Sie wandte sich zum Gehen.
Es gab eine ganze Menge Dinge, die Riordan an dieser Lady Bowers faszinierten, doch im Augenblick interessierte ihn vor allem das Bild, das sie in der Galerie verkauft hatte. »Das freut mich für Sie«, fuhr er beharrlich fort »aber dafür, dass Sie so viel Glück hatten, wirken Sie reichlich verärgert. Stimmt irgendetwas nicht?«
Morna blieb stehen, wandte sich um und sah ihm gerade in die Augen. »Ich hasse jede Form von Engstirnigkeit«, stieß sie wütend hervor, um dann hastig zu verstummen. Was tat sie eigentlich? Wollte sie unbedingt seinen Verdacht erregen?
Riordan hatte den Eingang der Galerie beobachtet, als die Zigeuner daran vorbeigelaufen waren, und den Ausdruck der Verachtung auf Kelvins Gesicht gesehen, als dieser Morna zurückhielt.
»Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen …« Wieder wandte sie sich ab, doch sie spürte den Druck seiner Hand auf ihrem Arm.
»Darf ich Sie mitnehmen, Lady Bowers? Ihre Kutsche scheint Sie im Stich gelassen zu haben, und um diese Zeit weiß man nie, wer sich auf den Straßen herumtreibt!«
Lady Bowers’ Ungeduld wuchs, doch plötzlich sah sie einen Constable, der auf sie zukam. Ihre Augen weiteten sich vor Schrecken, als sie gleich hinter dem Polizisten Jake entdeckte. Er war der Anführer der Zigeunergruppe, die am Ufer des Liffey lagerte. Ihr waren Gerüchte zu Ohren gekommen, ihr Ehemann schulde Jake Geld, und ihr war klar, dass er nicht ruhen würde, bis er alles bekommen hatte, was sie besaß. Wenn er sie nun mit einem wohlhabenden Gentleman sprechen sah – oder Wind vom Verkauf des Bildes bekam!
»Vielleicht haben Sie Recht«, sagte sie deshalb. »Wo ist Ihre Kutsche?«
Riordan Magee deutete auf einen Ford Modell T, der ein paar Schritte vor ihnen am Straßenrand stand. Morna bekam große Augen. Sie hatte noch niemals in irgendeinem Fahrzeug gesessen, das mit diesem luxuriösen Wagen vergleichbar gewesen wäre. Trotz ihrer Ungeduld fühlte sie sich plötzlich von fast kindlicher Vorfreude erfüllt. Eilig lief sie zur Wagentür und rief dem Fahrer bereits durch das offene Fenster hindurch zu: »Zum Merrion Square, bitte!«
Während Riordan ihr folgte, bemerkte er den Constable und lächelte in sich hinein. Diese Lady Bowers war wirklich eine ungewöhnlich interessante Frau! Plötzlich wurde ihm bewusst, dass es viele Jahre her sein musste, seit er von einem weiblichen Wesen so angetan gewesen war.
Als der Wagen sich in den Verkehr einreihte, bat Riordan: »Würden Sie mir jetzt, wo wir unter uns sind, Ihren richtigen Namen verraten?«
Sie hatte nicht erwartet, dass er sie so unverblümt darauf ansprechen würde. »Ich verstehe nicht ganz«, erwiderte sie in der Hoffnung, Zeit zu gewinnen. »Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, und außerdem sind wir nicht ganz allein!« Sie warf einen viel sagenden Blick auf seinen Fahrer.
»Sykes ist überaus diskret. Ich versichere Ihnen, Sie können offen sprechen.« Als sie nicht antwortete, fuhr er fort: »Sie können Ihre Verkleidung fallen lassen, denn wie auch immer Ihr Name lautet, Morna Bowers ist es auf keinen Fall. Ich kenne zufällig die echte Lady Bowers, und wenn sie auch ein sehr liebenswerter Mensch ist, so lässt sich ihre Größe allenfalls mit dem Attribut ›winzig‹ beschreiben, und dabei ist sie von beträchtlichem Umfang.«
Obwohl es sie verlegen machte, ertappt worden zu sein, musste sie beinahe lächeln. Riordan war offensichtlich zu sehr Gentleman, um Morna Bowers klein und dick zu nennen!
»Diese Beschreibung passt nun wirklich nicht auf Sie«, sagte er. »Ich würde Sie eher als schlank und wohlgeformt bezeichnen.«
Einen Augenblick lang fühlte sie sich geschmeichelt. Ihre Vorsicht schwand dahin, vor allem, weil sein Blick eher amüsiert als ärgerlich wirkte. Doch sie beschloss, zumindest so lange wachsam zu bleiben, bis sie herausgefunden hatte, was er von ihr wollte.
»Mornas Mann, der übrigens weder ein Spieler noch ein Don Juan war, ist vor vielen Jahren gestorben, und zwar auf sehr dramatische Art: Sie befanden sich auf ihrer Silberhochzeitsreise, als er vor der Küste Südafrikas vom Deck eines Kreuzfahrtschiffs ins Meer fiel. Ich nehme an, sein Herz hat versagt.« Seine Lippen formten sich zu einem leichten Lächeln. »Meins würde dasselbe tun, wenn ich einen Hai auf mich zuschwimmen sähe! Ich habe den Eindruck, dass Lord Bowers Morna in sehr guten Verhältnissen zurückließ. Wussten Sie, dass sie auf dem Kontinent lebt?«
Als seine Frage ignoriert wurde, fuhr er ungerührt fort: »Angeblich hat sie sich unsterblich in einen wohlhabenden Grafen verliebt. Ich mache mir sogar Hoffnungen, zu den Hochzeitsfeierlichkeiten eingeladen zu werden!«
»Ihre gesellschaftlichen Perspektiven interessieren mich nicht, Mr. Magee. Bitte, kommen Sie zur Sache und sagen Sie mir, weshalb Sie auf mich gewartet haben – denn jetzt bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass meine Sicherheit das Letzte ist, was Sie interessiert!« Sie warf einen Blick aus dem Fenster. Vom Liffey stieg Nebel auf und hüllte die Straßen ein, sodass Morna kaum erkennen konnte, wo sie sich gerade befanden. Sobald der Wagen den Merrion Square erreichte, wollte sie sich davonmachen.
»Werden Sie mir denn sagen, aus welchem Grund Sie sich für Morna Bowers ausgeben? Man könnte Sie immerhin sogar deswegen verhaften!«
»Ich habe kein Verbrechen begangen – aber falls Sie die Absicht haben, mich der Polizei zu übergeben, werde ich behaupten, Sie seien mein Komplize. Der Geschäftsführer der Galerie ist mein Zeuge.«
Riordan lächelte. Wenn sie nur wüsste!, dachte er. »Wenn Sie wirklich so unschuldig sind, warum wollten Sie dann dem Constable auf der Straße vor der Galerie aus dem Weg gehen?«
Jetzt wirkte sie doch ein wenig verunsichert. »Ich kann Ihnen versichern, dass ich keinem Constable aus dem Weg gegangen bin. Sie hatten mir angeboten, mich mitzunehmen, und ich habe dummerweise angenommen, weil die Straßen um diese Zeit, wie Sie schon sagten, wirklich von unangenehmen Subjekten bevölkert sind. Ich spreche zum Beispiel von diesem grobschlächtigen Kerl, der vor der Galerie auf uns zukam.«
Riordan erinnerte sich, einen Mann von unangenehmem Äußeren gesehen zu haben, der hinter dem Constable gegangen war. Ein Zigeuner! Jetzt begriff er: Der Zigeuner hätte die Maskerade der angeblichen Lady Bowers vielleicht auffliegen lassen können, weil er sie wahrscheinlich kannte!
»Sie haben mein Wort als Gentleman, dass ich nicht beabsichtige, Sie in Schwierigkeiten zu bringen. Ich bin einfach ungemein neugierig. Eine schöne Frau und ein großes Geheimnis bilden für mich eine unwiderstehliche Kombination.« Wieder glitzerte Mutwillen in seinem Blick, der Morna seinen Spaß an der ganzen Sache verriet. Und doch fühlte sie instinktiv, dass sie ihm trauen konnte – zumindest bis zu einem gewissen Grad.
»Ich muss Sie ja für einen Schuft halten, Mr. Magee! Würden Sie mir sagen, wovon Sie leben?«
Riordan setzte eine gekränkte Miene auf, während er fieberhaft nach einer Formulierung suchte, die ihr nicht zu viel über ihn verriet. Er amüsierte sich zu gut, um ihr jetzt die Wahrheit zu sagen. »Ach, ich kaufe und verkaufe … wertvolle Dinge«, meinte er unbestimmt. »Und ich glaube nicht, dass mich das schon zu einem Schurken macht. Ich selbst sehe mich eher als so etwas wie einen Opportunisten.«
»Dann muss man als Opportunist gut verdienen: Ihr Mantel ist aus sehr feinem Stoff, Ihre Taschentücher tragen Ihr Monogramm und dieses Automobil muss Sie ein Vermögen gekostet haben. Wenn ich mich nicht irre, gibt es in Dublin nicht sehr viele davon, besonders seit Beginn der Depression!« Ihr Scharfsinn überraschte Riordan. »Die meisten Menschen haben nicht einmal genug zu essen, Sie dagegen scheinen überhaupt keine Probleme zu kennen«, fuhr sie fort.
»Ich komme aus einer wohlhabenden Familie«, räumte er ein, auch wenn er mit seiner Familie im Moment kaum Kontakt hatte.
»Ihr Geld wäre an anderer Stelle sicher besser angelegt, aber ich bin erleichtert, dass Sie sich nicht in einer Notlage befinden, Mr. Magee. Wenn Sie mir nämlich aufgelauert hätten, um mich um Geld zu bitten … ich hätte Ihnen nicht einen Penny meines Erlöses gegeben.«
Fast hätte er laut gelacht. »Ich will Sie nicht kränken, Madam, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich Ihr Geld nicht benötige. Ich will nur die Geschichte, die hinter ihrer Verkleidung steckt. Ich habe den Eindruck, dass sie sehr unterhaltsam sein muss, und bei meinem eintönigen Leben wäre ich für etwas Spannung und Aufregung sehr dankbar.«
Morna hob ihre dunklen, schön geschwungenen Augenbrauen und überlegte sichtlich, warum sein Leben eintönig sein sollte.
»Bitte, sagen Sie mir doch, wie kann der Verkauf dieses einen Bildes Ihr Leben verändern?«, bat er.
Morna hob den Kopf und starrte aus dem Fenster, innerlich betend, dass sie bald am Merrion Square sein würden. »Ich sehe keinen Grund dafür, Ihnen überhaupt irgendetwas zu erzählen!«
»In diesem Fall werde ich Ihnen sagen, was ich zu wissen glaube.« Riordan hatte in Gedanken alles zu einem Ganzen zusammengefügt. Seine Beobachtungen ebenso wie das, was sie ihm erzählt hatte, und seine Vermutungen über das, was sie ihm verschwieg.
»Ihre Haut ist nicht so makellos weiß wie die von bestimmten Ladys, die sich zum Teetrinken und Bridgespielen in ihren Häusern verstecken; deshalb nehme ich an, dass Sie viel Zeit im Freien verbringen. Das wiederum führt mich zu dem Schluss, dass Sie Ihre Handschuhe nicht ausziehen, weil Ihre Hände nicht so zart sind wie die einer Lady, deren Haut regelmäßig gepflegt wird. Wie mache ich mich bisher?«
Ihr Tonfall verriet ihr Erstaunen, als sie antwortete: »Fahren Sie fort, Mr. Magee!« Trotzdem glaubte sie fest daran, dass er die Wahrheit niemals erraten würde.
»Sie können fluchen wie ein Mann, obwohl auch irgendetwas Vornehmes in ihrem Benehmen ist. Ich glaube … Sie haben bei den Zigeunern gelebt. Vielleicht sind Sie als Kind aus ihrem Wagen geraubt worden?«
Morna war jetzt ehrlich beeindruckt. »Sehr scharfsinnig, Mr. Magee. Ich stamme wirklich aus einer vornehmen Familie«, erklärte sie. »Und ich habe tatsächlich mit den Zigeunern gelebt. Aber es stimmt nicht, dass sie Kinder rauben – davon haben sie selbst genug!« Diese Worte erinnerten sie daran, dass nicht einmal die Zaubertränke und Sprüche der fahrenden Leute ihr hatten helfen können, ein Kind zu empfangen. »Nein, ich bin als junges Mädchen mit den Zigeunern fortgelaufen.« Sie hatte keine andere Möglichkeit gesehen, doch sie wollte jetzt nicht über ihre Gründe sprechen. »Ich hatte mich in einen ihrer Männer verliebt«, sagte sie mit einer Spur von Traurigkeit in der Stimme. Es hatte ein ganzes Jahr gedauert, bevor sie vor sich selbst zugegeben hatte, dass sie Garvie Flynn liebte, auch wenn es nicht die leidenschaftliche Liebe gewesen war, von der sie immer geträumt hatte. Und erst nach einem weiteren Jahr hatte sie zugestimmt, ihn zu heiraten, nachdem eine der Zigeunerinnen sie davon überzeugen konnte, dass kein anderer Mann sie nehmen würde. Morna erwartete Hass oder Abneigung in Riordans Miene zu lesen, doch stattdessen wirkte er nur ehrlich erschrocken.
In Gedanken war er plötzlich wieder in jener Nacht, die viele Jahre zurücklag und in der er sein Leben riskiert hatte, um eine junge Frau zu finden, die von den Zigeunern entführt worden war.
Er hatte sie tatsächlich gefunden und dann feststellen müssen, dass sie sich überhaupt nicht in Gefahr befand. Sie war nicht einmal gefangen gehalten worden, sondern hatte im Gegenteil eher selbst die Zigeuner durch ihre Reize gefesselt.
»Wusste Ihre Familie, dass Sie mit dem fahrenden Volk gegangen waren?«, fragte er.
»Ich … bin sicher, dass sie es wussten. Ich habe sie seit damals nicht mehr gesehen, und das ist viele Jahre her.«
»Ihr Fortgehen hat sie gewiss sehr geschmerzt«, erwiderte Riordan, und seine Gesichtsausdruck wurde härter. Er kannte diesen Mark zerfressenden Schmerz nur zu gut und hatte Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen.
Morna wandte sich ab und starrte wieder aus dem Fester. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich dieses Thema jetzt gern beenden.«
»Wie Sie wünschen.« Erleichtert wandte Riordan seine Aufmerksamkeit wieder dem Geheimnis zu, das diese aufregende Dame umgab. »Und woher haben Sie nun dieses Bild, Zigeunerlady? Ist es gestohlen?«
Sie fuhr ärgerlich auf: »Warum glauben Sie, dass ich eine Diebin bin? Nur weil ich das Leben einer Zigeunerin geführt habe?«
»Beruhigen Sie sich, Zigeunerlady! Ich habe doch gar nicht behauptet, dass Sie das Bild gestohlen hätten!«
»Das habe ich auch nicht, ebenso wenig wie irgendjemand anders. Und nennen Sie mich nicht immer ›Zigeunerlady‹!«, zischte sie ihn an.
Riordan wirkte verblüfft über ihren hitzigen Ton. »Es tut mir Leid. Ich wollte keinesfalls andeuten, dass Sie eine Diebin seien. Ich kann Sie mir nur sehr schwer als Künstlerin vorstellen, aber vielleicht irre ich mich auch. Bisher haben Sie schon viele verschiedene Talente bewiesen – sind Sie vielleicht auch die Malerin des Bildes, das Sie in der Galerie verkauft haben?«
Ihr Zorn fiel rasch in sich zusammen. Riordan besaß so angenehm höfliche Umgangsformen! »Nein. Ich war das Modell.« Sie sah die Betroffenheit in seinem gut geschnittenen Gesicht und fand es schwer zu verstehen, dass er bei der Vorstellung, sie habe einem Künstler Modell gestanden, so erschrocken war.
»Glauben Sie mir etwa nicht?«, fragte sie.
Er antwortete nicht; seine Gedanken zogen ihn mit unwiderstehlicher Macht in die Vergangenheit …
»Das Gemälde, das ich heute Abend verkauft habe, ist sehr gut«, sagte sie leise. »Der Besitzer der Galerie hat ein ganz ähnliches Bild in seinem Büro.« Es tat ihr gut, ihm das zu sagen. »Er hat anscheinend schon lange nach anderen Werken desselben Künstlers gesucht. Das war für mich sehr günstig.« Sie hatte es nicht einmal nötig gehabt, die trauernde Witwe zu spielen – es war alles überraschend leicht gegangen.
Riordan starrte sie ungläubig an und beugte sich leicht vor. Sein Herz hämmerte so heftig gegen seine Rippen, dass er kaum sprechen konnte. Er musste ganz sichergehen, dass er sie richtig verstanden hatte.
»Wollen Sie behaupten … es gäbe ein Bild von Ihnen in der Harcourt Gallery, im Privatbüro des Besitzers?«
»Schauen Sie mich nicht so erstaunt an!«, erwiderte sie, zutiefst gekränkt durch seine offensichtlichen Zweifel.
»Merrion Square, Sir!«, rief der Fahrer in diesem Moment, und nach einer Fehlzündung, die sie beide zusammenzucken ließ, blieb der Wagen abrupt stehen.
Bevor Riordan noch ein weiteres Wort herausbrachte, war sie ausgestiegen. Völlig verwirrt rief er ihr nach: »Warten Sie doch!« Ihm wurde klar, dass er keine Ahnung hatte, wie er sie erreichen konnte. Sie eilte in Richtung des St.-Stephen’s-Green-Parks, wo sie ihr Pferd angebunden hatte.
»Tara!«, rief Riordan, der inzwischen ebenfalls ausgestiegen war, und hob den Schleier auf, den sie verloren hatte. Es kam keine Antwort. Sie war im nebligen Dunkel der Nacht verschwunden.
Er starrte ihr nach, ohne recht zu begreifen, was soeben geschehen war. Die ganze Zeit über war er in Gesellschaft ebenjener Frau gewesen, die seine Träume beherrschte. Jene Frau, die ihn seinem Gefühl nach betrogen hatte, und er hatte es nicht einmal geahnt!
»Was hat sie sich nur dabei gedacht, einfach so durch den Park davonzurennen? Alle möglichen Personen treiben sich dort herum, und erst letzte Woche ist eine Frau ermordet worden … Das ist kein Ort für eine Lady!«
»Soll ich eine Lampe anzünden, Sir?«, fragte der Fahrer.
»Es hat keinen Sinn, Sykes. Sie ist längst fort, und wir würden sie ohnehin nicht mehr finden. Ich habe das Gefühl, sie kennt sich im Park sehr viel besser aus als wir.«
Er hielt ihren Schleier in den Lichtstrahl der Frontscheinwerfer seines Wagens. Sichtlich befremdet, beobachtet Sykes, wie Riordan einige lange, rötliche Haarsträhnen von dem Tüll zupfte und diese dann eingehend betrachtete.
»Sie ist wirklich Tara Killain! Nach all dieser Zeit muss sie förmlich wieder in mein Leben stolpern!« Riordan lächelte wehmütig, als ihm die Ironie der ganzen Sache aufging: Die einzige Frau, die ihn seit dem Zusammentreffen mit Tara, der Zigeunerin, vor so vielen Jahren hatte fesseln können, war ebendiese Frau: Tara Killain!
3
Der Himmel war an diesem frühen Morgen bleigrau, und ein Grollen aus schweren, dunkeln Wolken kündete ein Gewitter an, als Tara leise das Zigeunerlager am Ufer des Liffey verließ.
Das Lager war noch nicht zum Leben erwacht, doch in der frischen Morgenluft nahm Tara all jene Gerüche wahr, die ihr mittlerweile so vertraut geworden waren: den warmen Dampf der Pferdeleiber, frisches Heu und Lederseife, die Überreste der Fleischspieße, abgestandener Wein und nicht zuletzt der betörende Duft der Öle, mit denen die Zigeunerinnen ihre Körper einrieben.
Auf dem Weg zu ihrem Ziel, dem Mountjoy-Gefängnis, war Tara von einer seltsamen Vorahnung erfüllt. Alles, was ihr während der vergangenen Jahre so vertraut geworden war, würde für sie bald Vergangenheit sein. Obwohl ihr das Herz bei dem Gedanken daran schwer wurde und sie versucht hatte, das Unvermeidliche zu verdrängen, wusste sie doch, es war an der Zeit, weiterzuziehen.
Während der letzten beiden Wochen zuvor hatte sie unter den Zigeunern eine wachsende Spannung gespürt. Viele, besonders die Männer, verhielten sich ihr gegenüber plötzlich kühler, und sie hatte schon des Öfteren feindselige Blicke bemerkt und gesehen, dass hinter ihrem Rücken über sie getuschelt wurde. Auch die Frauen, mit denen sie normalerweise recht gut auskam, waren ihr gegenüber plötzlich verschlossen und hielten Abstand.
Tara war sich immer bewusst gewesen, dass der Zusammenhalt der Zigeuner untereinander unverbrüchlich war. Trotz ihrer Heirat mit Garvie Flynn hatten sie sie nur allzu deutlich spüren lassen, dass sie nicht von ihrem Blut war. Aber am meisten störte die Gruppe, vor allem in solch harten Zeiten wie dieser, dass sie ihnen kein Geld einbrachte.
Jetzt, wo Garvie wieder einmal im Gefängnis saß, war Tara für die anderen zu einer Last geworden. Und genau das war der Grund dafür, dass es sie forttrieb. Jake, der die Sippe anführte, seit Rory krank war, hatte Zwietracht gesät. Rory war älter und weiser, und bei ihm konnte man sich immer darauf verlassen, dass er in Entscheidungen, die die Gruppe betrafen, Gerechtigkeit walten ließ. Jake dagegen war anders: körperlich sehr stark und ebenso stur. In Rorys Abwesenheit wagte ihm niemand die Stirn zu bieten.
Am vorangegangenen Abend, als alle anderen schon geschlafen hatten, hatte Jake Tara vor ihrem Wohnwagen abgefangen. Sie glaubte, dass er sie beobachtet und dort erwartet hatte. Sie hegte sogar den Verdacht, dass er sie in der Grafton Street erkannt hatte. Die bloße Erinnerung an die Begegnung ließ sie erschaudern.
Auf dem Weg in die Stadt dachte sie noch einmal über das Gespräch mit ihm nach. Jake hatte sie in der Dunkelheit zu Tode erschreckt, als sie gerade einen Eimer neben ihrem Wohnwagen ausleerte.
»Dein Mann steht in meiner Schuld, und ich will mein Geld«, hatte er aus dem Dunkel heraus plötzlich gesagt. Tara hatte sich ihren Schrecken nicht anmerken lassen. Sie hatte sich langsam aufgerichtet und ihm so ruhig wie möglich entgegnet: »Er hat dir schon öfter Geld geschuldet. Du weißt, dass du es bekommst.«
Jake hatte einen Schritt auf sie zu getan und war aus dem Dunkel zu ihr ins Mondlicht getreten. Seine dunklen Augen waren schmal geworden, und er hatte seinen Blick langsam an ihrem Körper hinunterwandern lassen. Sie hatte die Art, wie er sie anstarrte, immer gehasst. Es war der gleiche Blick, mit dem man auf einem Viehmarkt Pferde taxierte, so taktlos und erniedrigend, dass er ihr eine Gänsehaut verursachte.
Die Tatsache, dass Garvie Jake angeblich Geld schuldete, war keine Überraschung für sie. Es hatte im Lager Gerüchte darüber gegeben, und ihr Mann hatte schon öfter etwas von Jake geliehen. Doch Tara fragte sich, warum Jake diesmal nicht warten konnte, bis Garvie zurückkam, wie er es sonst tat. Sie spürte seine fast mit Händen zu greifende Ungeduld, und das beunruhigte sie. Schließlich zahlte ihr Mann seine Schulden immer zurück, sobald er aus dem Gefängnis heraus war und Arbeit gefunden hatte – warum sollte das dieses Mal anders sein?
»Du kannst nächste Woche auf dem Pferdemarkt in Cork für mich tanzen«, schlug Jake in kühlem Ton vor. »Und auf allen anderen Märkten auch, bis die Schuld bezahlt ist.«
Seine Arroganz machte Tara zornig. Sie spürte, dass er die Gelegenheit nutzen wollte, Macht über sie zu gewinnen, etwas, was sie niemals zulassen würde. »Ich tanze nicht für Geld«, gab sie entschlossen zurück. »Und ich werde Dublin nicht verlassen, bevor Garvie nicht wieder frei ist.«
Jake wandte sich für einen Augenblick ab, die Kiefer fest aufeinander gepresst, als grüble er über etwas nach. Als er sie wieder ansah, war er sehr wütend. »Du wirst mich irgendwie bezahlen, Mädchen. Ich schlage vor, du überlegst dir, wie, bevor ich es tue!«