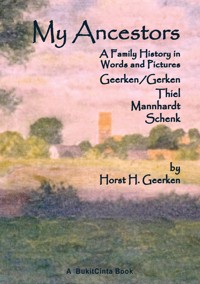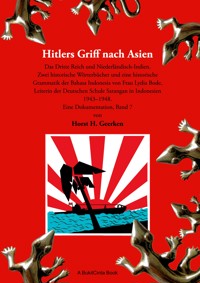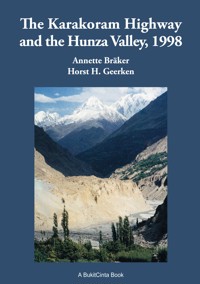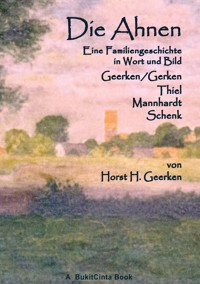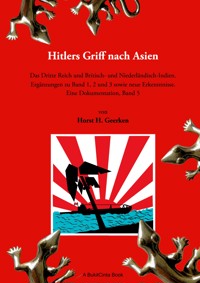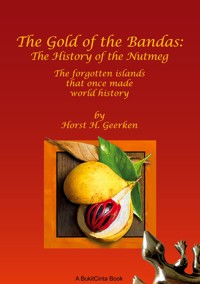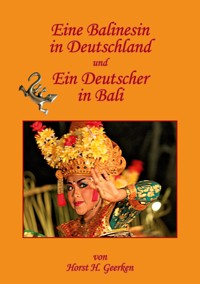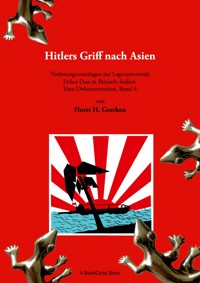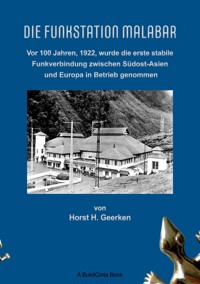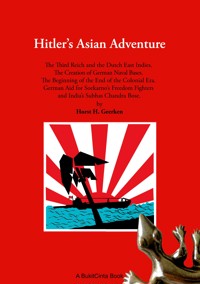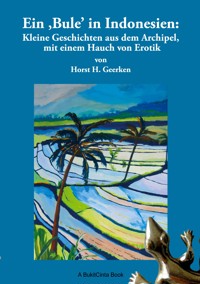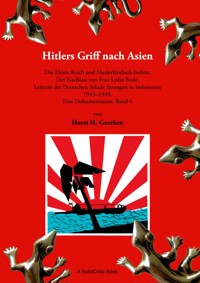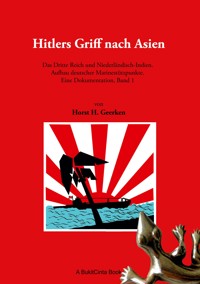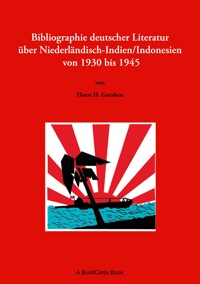Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Rufe des großen Mauergeckos, Tokek, sind den Indonesiern bedeutungsvoll. Wenn das "Toké" durch die Nacht hallt, wird in der Stadt und auf dem Dorf gezählt, wie oft sein Ruf erklingt. Eine ungerade Anzahl ist glückverheißend, sieben Rufe bedeuten schon viel Glück, aber der neunmalige Ruf des Tokeks verheißt den Gipfel an Erfolg und Glück. Der Autor hat 18 Jahre in Indonesien am Aufbau des jungen, unabhängigen Landes auf den Gebieten der Telekommunikation, Elektrotechnik und Solarenergie mitgewirkt. Er läßt uns teilhaben an vielen Erlebnissen, Begebenheiten und Erinnerungen, beruflich und privat. Viele Fakten und amüsante Begebenheiten aus seinem Werdegang, über den Befreiungskampf der Indonesier aus der kolonialen Umklammerung sowie die politischen Wirren und den miterlebten Putsch zum Sturz des 1. Präsidenten Sukarno sind in seinem Buch beschrieben. Sowohl zu Hause in Jakarta wie auch im Wochenendhaus in Carita waren Tokeks zu hören. Oft hallte der neunmalige Ruf, und die Verheißung erfüllte sich. Indonesien hat dem Autor Glück gebracht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Annette
Inhalt
Dank
Vorbemerkung
Übersichtskarte Indonesien
Entscheidung für Indonesien
Vorbereitung
Ausreise mit der MS VICTORIA
Erste Eindrücke und erste Bekanntschaften
Kontakte und Manieren
Anfangszeit und erste Dienstreise
Ungewohnte Lebensumstände
Java und Bali
— Reise durch Java
— Bali
— Cilacap und Dieng Plateau auf Java
Holländische Vergangenheit
Walter Spies, Untergang der Van Imhoff und Ehrungen
— Walter Spies
— Der Untergang der Van Imhoff.
— Ehrungen
Unabhängigkeit, ein blutiger Weg – 2. Weltkrieg bis Dezember 1949
Ganyang Malaysia und CONEFO – Projekte und ihre Durchführung...
— Ganyang Malaysia
— CONEFO
— Djatiluhur
Hotel Indonesia
Sukarno, der erste Präsident
Singapur und Sumatra
Bandung – eine Stadt mit Pariser Charme
Verständigung
Unruhige Zeit, politische Wirren
Umzug in unser erstes Haus
Putsch und Machenschaften der CIA
Neue Ordnung und neue Projekte
Heimaturlaub
Wieder zurück in Indonesien – Aktivitäten und Gefahren
Javasee und Tropenschicksale
Unser zweites Haus und Amateurfunk-Erlebnisse
„Guna Guna“ und Magie
Straßenhändler und Antiquitäten
Carita, ein Paradies an der Sundastraße
Pak Sakip und die Baduis
— Pak Sakip
— Die Baduis
Ujung Kulon, Krakatau und Gunung Bromo
— Ujung Kulon
— Krakatau
— Gunung Bromo
Die Insel Sumba
Typen wie bei Joseph Conrad – eine aussterbende Spezies
Diplomaten und weniger diplomatische Politiker
Artja, Emil Helfferich und EKONID
Ausklang
Glossar
Namensregister
Sachregister
Bibliographische Hinweise und Empfehlungen
Dank
Die Recherchen zu diesem Buch wären ohne die Unterstützung von Frau Annette Bräker nicht möglich gewesen. Sie hat mich immer wieder dazu ermutigt, meine Erlebnisse der achtzehn Jahre in Indonesien aufzuzeichnen und hat auch an der Entstehung dieses Buches, mit vielen geduldigen Ratschlägen über Aufbau und Stil, intensiven Anteil genommen. Als Tochter eines Orientalisten, die selbst Malaiologie, Vergleichende Religionswissenschaft und Orientalische Kunstgeschichte studiert hat, hat sie mich nicht nur zum Schreiben dieses Buches angeregt, sondern mir auch als Lektorin mit ihren scharfsinnigen und humorvollen Kommentaren große Dienste geleistet. Meine besondere Zuneigung und mein besonderer und tief empfundener Dank gilt ihr.
Mein Dank gilt auch Herrn Fried Strässer, den ich schon in den 1960er Jahren in Indonesien kennen- und schätzengelernt habe. Mit dem liebenswerten Ehepaar Strässer, das einige während ihres Aufenthaltes in Bandung selbst erlebte Begebenheiten beigesteuert hat, bin ich bis heute freundschaftlich verbunden und wir genießen manchen humorvollen Abend, an dem wir alte Geschichten aus unserer „Pionierzeit“ auffrischen.
Mein Dank gilt auch Herrn Wilfried Spöhring, Frau Susi Möller und Frau Linde May, die mit Anekdoten zu diesem Buch beigetragen haben, sowie Frau Ilse Bräker, die mir viele hilfreiche Ratschläge gegeben hat. Dank sage ich auch zahlreichen Menschen in Indonesien, die mir ihre Geschichten erzählt haben. Deren Namen kann ich allerdings nicht alle aufführen, oft habe ich diese nie erfahren. Hervorheben möchte ich hier allerdings Herrn Ir. Pandu Purwohardono, mein früherer Kollege und damals Direktor für Telekommunikation bei der PT. Guna Elektro in Jakarta, der mir bei Rückfragen nach Namen oder neuer Schreibweise indonesischer Wörter immer umgehend geholfen hat und der mich bis heute auch laufend über neue Entwicklungen in diesem Lande informiert.
Herrn Horst Jordt, der Präsident der Walter Spies-Gesellschaft Deutschland, hat mir mit vielen Hinweisen und produktiven Vorschlägen beim Kapitel über Walter Spies sehr weitergeholfen. Ihm gilt mein besonderer Dank.
Horst H. Geerken Im Frühjahr 2009
Vorbemerkung
Wenn man seine berufliche Tätigkeit in einem fremden Land ausübt, verbringt man oft nur einige Jahre in diesem Land. Auch bei mir sollten es nur drei bis maximal vier Jahre sein, die ich beruflich in Indonesien bleiben wollte, schließlich wurden es aber achtzehn Jahre – von 1963 bis 1981 –, die ich in diesem wunderschönen Archipel verbrachte. Durch häufige geschäftliche und private Reisen lernte ich Indonesien und seine Menschen durch viele persönliche Kontakte, die sich oft auch aus den geschäftlichen entwickelt hatten, ganz besonders schätzen. Ich möchte hier meine persönlichen Erlebnisse in diesem Land zu einer Zeit der politischen Wirren und des wirtschaftlichen Aufbaus darlegen sowie auch Erzählungen von Einheimischen, die mir historisch interessant und wichtig zum Verständnis des Landes und seiner Menschen erscheinen.
Es sind schon viele Bücher über Indonesien, besonders über Bali geschrieben worden. Aber die Schönheit seiner Landschaft und den Liebreizseiner Menschen kann man nicht in Worte fassen. Man muss es erlebt haben. Diese Aufzeichnungen sollen eine Mischung aus Unterhaltung, aber auch aus Informationen sein, die ich zum größten Teil damals, aber auch noch in neuerer Zeit, über den letzten Unabhängigkeitskampf der Indonesier gegen die Kolonialmacht Niederlande, sammeln konnte. Dieser Unabhängigkeitskampf, der letztendlich zum Erfolg führte, dauerte fast fünf Jahre lang, von 1945 bis Ende 1949. Natürlich haben die Unabhängigkeitsbestrebungen durch die Organisationen Budi Utomo, Muhamadia oder Sarekat Islam schon in früheren Jahren begonnen. Hans Bräker beschreibt diese ausführlich in seinem Buch „Kommunismus und Weltreligionen Asiens“. Da ich jedoch Anfang der 1960er Jahre noch tagtäglich mit Erzählungen aus diesem schrecklichen Krieg konfrontiert wurde, kann ich über diese letzten fünf Jahre des Unabhängigkeitskampfes bis Ende 1949 authentisch berichtet. Über diesen Themenkomplex habe ich viele glaubwürdige Zeitzeugen, die zum großen Teil noch selbst am Unabhängigkeitskampf teilgenommen hatten und die aus allen Schichten der Bevölkerung kamen, befragt. Zu meiner Zeit in Indonesien gab es noch über eine halbe Million ehemaliger Freiheitskämpfer, die sich in verschiedenen Veteranenverbänden zusammengeschlossen hatten. Es gab also noch genügend Gesprächspartner, die Zeitzeugen waren und durch die ich von dem nicht mehr einzudämmenden und zu eliminierenden Freiheitswillen der Indonesier erfuhr. Da dieses Buch nicht den Anspruch erheben will, ein historisches Werk zu sein, habe ich den fast fünfjährigen Unabhängigkeitskampf der Indonesier nur in groben Zügen dargestellt, basierend auf den Informationen der Zeitzeugen. Ausführlich bis in alle Einzelheiten wurden diese Ereignisse von Louis Fischer in seinem Werk „Indonesien“ erläutert.
Das Ausmaß der durch die Kolonialmacht begangenen Gräueltaten, von denen dieser Unabhängigkeitskampf begleitet wurde, ist bei uns kaum bekannt geworden. Hier möchte ich einige historische Begebenheiten aus Sicht der Indonesier darstellen, die aus diesem Blickwinkel natürlich eine ganz andere Färbung erhalten, als sie von der ehemaligen niederländischen Kolonialmacht in ihrer Vergangenheitsbewältigung bis heute dargestellt werden. Mir gegenüber haben die Indonesier die Gräueltaten ungeschönt und ohne die ihnen angeborene höfliche Zurückhaltung erzählt, wie sie es gegenüber einem Holländer in dieser Deutlichkeit nie tun würden. Die indonesische Sichtweise ist somit eine völlig andere als die holländische und je mehr man mit indonesischen Zeitzeugen redet, je tiefer das Vertrauensverhältnis ist, desto klarer wird, dass es für die Indonesier während der fast 350jährigen Kolonialzeit wenig Gutes und viel Schlechtes gab. Keine Frage, alle Kolonialmächte haben Schuld auf sich geladen, aber in den Nachwehen des Zweiten Weltkrieges sind viele Gräueltaten unter den Teppich gekehrt worden, die während der holländischen Herrschaft in Indonesien und beim Versuch der Fortsetzung ihrer Herrschaft begangen worden sind. Aber im Gegensatz zu den Engländern haben die Holländer den Erhalt ihrer Herrschaft gegen alle weltpolitischen Vereinbarungen durchzusetzen versucht und dabei weiteres unerhörtes Leid unter der einheimischen Bevölkerung verbreitet.
Meine Erlebnisse fallen besonders in den ersten Jahren in eine Zeit, in der man noch fast wie ein Einheimischer leben musste. Für unser Leben und Überleben und damit für das Nachgehen der täglichen Pflichten bestanden ganz andere Prioritäten, die aus heutiger Sicht manchen Lesern sicher bedeutungslos erscheinen. Aber mir hinterließen sie einen tiefen und bleibenden Eindruck. Zum Beispiel löste ein kleines Stückchen Schwarzbrot oder eine schon halb verdorbene Dose Rollmöpse aus der Heimat bereits große Glücksgefühle aus. Was ich berichte entspricht der damaligen Wirklichkeit.
Um den Bericht nicht allzu technisch und langatmig werden zu lassen, habe ich aus der Vielzahl von Projekten, die während meiner Tätigkeit als Resident Engineer für AEG-TELEFUNKEN in Indonesien abgewickelt wurden, nur einige besonders interessante herausgegriffen.
Die Hintergründe des Putsches vom 30. September 1965 sind bis heute nie ganz aufgeklärt worden. Aber es gibt viele Theorien. Ich schließe mich keiner an und berichte nur meine eigenen Erlebnisse. Dies soll also kein historisches Dokument sein. Allerdings wurde durch die im Laufe der vergangenen Jahre veröffentlichen Dokumente über den Putsch immer klarer, dass der Einfluss der kommunistische Partei PKI doch erheblich geringer gewesen ist, der Einfluss des amerikanischen Geheimdienstes CIA dagegen erheblich größer, als ursprünglich angenommen.
Reisen, die man in jungen Jahren gemacht hat, erscheinen in der Erinnerung immer etwas verändert. Aber ich versuche, mich so gut wie möglich, an die tatsächlichen und erlebten Ereignisse zu halten. Ich habe die Briefe meiner Frau und mir aus diesen Jahren an unsere Eltern in Deutschland, mit unseren aktuellen Eindrücken und Erlebnissen, nochmals gelesen. Diese Briefe haben viele Umzüge mitgemacht, aber sie wurden bis heute in Ehren gehalten und gut aufbewahrt. Neben meinem Gedächtnis waren diese Briefe, sowie auch dienstliche Berichte an mein Stammhaus, eine gute Stütze, um mich an die Tempo Dulu, die gute alte Zeit und mein Leben in Indonesien zurück zu erinnern.
Die Provinzen Nord- und Südholland sind ein Teil des Königreichs der Niederlande, in denen sich die großen Städte wie Den Haag, Rotterdam und Amsterdam befinden. Holland war schon immer der kulturelle, politische und gesellschaftliche Schwerpunkt der Niederlande. Daher wird im umgangssprachlichen Gebrauch, seit dem 16. Jahrhundert bis heute, der Begriff „Holland“ für den ganzen Staat der Niederlande verallgemeinert, wie zum Beispiel beim Fußball, bei dem immer gegen Holland und nicht gegen die Niederlande gespielt wird. Ebenso in Indonesien wird auf Bahasa Indonesia der Begriff Negri Belanda (= holländisches Land) für die Niederlande verwendet. Der Einfachheit halber bleibe auch ich, wenn ich die Kolonialherrschaft der Niederländer und den Unabhängigkeitskampf der Indonesier beschreibe – wenn möglich – bei der Bezeichnung Holland.
Das heutige Indonesien wurde während der holländischen Kolonialzeit als „Niederländisch-Indien“, „Ostindien“, auch „Holländisch-Indien“ und auf Englisch „Dutch-East-Indies“ bezeichnet. Ende des 19. Jahrhunderts prägte der deutsche Arzt, Zoologe, Biologe, Philosoph und Maler Ernst Haeckel anlässlich seiner Reisen auf Java und Sumatra den Begriff „Insulinde“. In allen seinen Büchern benutzt er dieses schöne Wort für den indonesischen Archipel. Leider hat sich dieser Begriff international nicht durchsetzen können. Die Holländer selbst nannten ihr Kolonialreich, in der damaligen Literatur und umgangssprachlich bis heute meist nur „Indien“, was oft zu Verwechslungen mit dem indischen Subkontinent, damals „Britisch-Indien“ genannt, führte. Ich bleibe, wenn ich Begebenheiten aus der Kolonialzeit beschreibe, bei dem während der Kolonialzeit von den Holländern verbotenen Begriff „Indonesien“. Dieser Begriff wurde ursprünglich von Adolf Bastian (einem Deutschen) kreiert, auf den ich an späterer Stelle zurück kommen werde.
Der erste Präsident Indonesiens, Sukarno, wird in westlichen Medien oft mit dem Namen Ahmed Sukarno bezeichnet, manchmal auch mit Ahmad. Beide Vornamen sind falsch! Er hatte, wie viele Javaner, nur einen Namen, nämlich Sukarno. Eine amerikanische Redaktion hatte, trotz des Widerstandes ihres Korrespondenten in Jakarta, diesen im islamischen Indonesien geläufigen Vornamen „Achmed“ einfach erfunden, da nach den Regeln dieser Agentur ein Name prinzipiell nur mit Vornamen gedruckt werden durfte. Bis heute hat sich dieser Fehler in der westlichen Presse gehalten. In Indonesien ist der Vorname Achmed in Verbindung mit Sukarno allerdings vollkommen unbekannt. Ich bleibe also bei der korrekten Schreibweise und dem einen Namen Sukarno.
Im Zuge einer großen Rechtschreibreform der Bahasa Indonesia, der indonesischen Sprache, in den 1960er Jahren, wurde das „oe“ der alten Schreibweise in „u“ umgewandelt. Aus Gründen der Tradition blieben aber viele Indonesier, wie auch Sukarno und Suharto, beim „oe“, wenn sie ihren Namen schrieben. Ich blieb, wo es ging, bei der neuen Schreibweise, bei der auch zum Beispiel „dj“ zu „j“ oder „tj“ zu „c“ wurden.
Mit dem Titel für dieses Buch „Der Ruf des Geckos“ hat es folgende Bewandtnis: Der große Mauergecko, Tokek genannt, ist für Indonesier ein Glücksbringer. Wenn sein „Toké“ durch die Nacht hallt, wird in der Stadt wie auch auf dem Dorf gezählt, wie oft er ruft. Davon hängt ab, wie glückverheißend sein Ruf ist. Nur eine ungerade Zahl ist glückverheißend: sieben Rufe bedeuten schon viel, aber der neunmalige Ruf des Tokeks verheißt den Gipfel an Erfolg und Glück. Sowohl in unserem Haus in Jakarta wie auch in unserem Wochenendhaus in Carita hatten wir Tokeks. Oft hörten wir den 9-maligen Ruf und die Verheißung erfüllte sich. Uns hat Indonesien Glück gebracht.
Übersichtskarte Indonesien Die Niederlande im Größenvergleich: (keine detailgetreue und nicht streng maßstäbliche Zeichnung)
Vorbereitung
In Deutschland begann eine fast zweijährige Informationszeit und Vorbereitung auf meine neue Aufgabe in Indonesien. Ich war viel unterwegs, in Ulm an der Donau, in Backnang, Essen, München, Hamburg und auch sechs Monate in Berlin, um die gesamte Produktpalette der Telekommunikation von TELEFUNKEN kennen zu lernen. Es wurde alles gebaut, von einem Kleinstsender in Form einer Medikamentenkapsel, der „Heidelberger Kapsel“, die man zur Untersuchung des Magen-Darmtraktes verschluckte, von Kleinfunkgeräten für Polizei, Militär und private Anwender angefangen, über Richtfunkgeräte, Nachrichtensender in allen Leistungsstärken, kommerzielle Empfangsanlagen, Radaranlagen, Fernsehsender bis zu Rundfunk Großsendeanlagen. TELEFUNKEN produzierte damals die gesamte Bandbreite der drahtlosen Kommunikation. Mit der sogenannten „Braunen Ware“, d. h. Rundfunk-, Fernseh-, Tonbandgeräten etc. hatte ich nichts zu tun. Intern nannten wir das etwas herablassend unsere „Spielzeugabteilung“!
Der Markenname TELEFUNKEN war allerdings vor meiner Ankunft in Indonesien schon weithin bekannt. In Semarang, auf der Insel Java, war schon vor meiner Zeit eine Radiofabrik, die TELEFUNKEN-Rundfunkgeräte assemblierte und auch herstellte. Diese Geräte waren in ganz Indonesien weit verbreitet und galten als die Nummer Eins. Gesprochen hießen die Geräte allerdings „TELEPUNKEN“ und die Fabrik in Semarang „Pabrik Telepunken“, da die Indonesier kein „F“ aussprechen können. Daher gibt es auch nur ganz wenige Wörter, die in der Bahasa Indonesia ein F enthalten. Diese wenigen Wörter sind alles Fremdwörter, meist aus dem Arabischen oder aus dem medizinischen Bereich. Jeder Indonesier kannte in den 1960er Jahren die Marke „TELEPUNKEN“ für Rundfunkempfänger, so wie auch deutsche Messer und Scheren aus Solingen mit der Marke „Tjap Mata“, mit einem Auge als Markenzeichen, als deutsche Qualitätsprodukte bekannt waren. Leider ist heute nichts mehr davon übriggeblieben. Japanische und chinesische Produkte beherrschen den Markt.
Auch schon während der holländischen Kolonialzeit waren AEG und TELEFUNKEN sehr aktiv in Indonesien. Um 1900 lieferte die AEG über ihre Niederlassung auf Java, die „Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteits-Maatschappij“, die erste elektrische Straßenbahn für Batavia, dem heutigen Jakarta. Auf alten Postkarten von Batavia ist diese Straßenbahn als Attraktion der damaligen Zeit noch sehr oft abgebildet. 1905 installierte TELEFUNKEN Knallfunken- und HochfrequenzmaschinenSender für die ersten drahtlosen Telegrafie-Verbindungen innerhalb des Archipels. 1910 baute AEG Trafostationen und die Energieverteilung für die Städte Surabaya, Malang und Semarang auf. TELEFUNKEN hatte 1912 mit der „Deutsch-Niederländischen Telegraphen-Gesellschaft“ die „Deutsche Südseegesellschaft für drahtlose Telegraphie" gegründet, die ein sogenanntes Südseenetz aufbaute. Hauptziel war, drahtlose Telegrafie- Verbindungen zwischen den deutschen Südseebesitzungen von Samoa bis Neuguinea zu ermöglichen. Die Gesellschaft war auch in Niederländischindien aktiv und hatte hier bis 1913 schon 7 Landstationen aufgebaut (TELEFUNKEN-Zeitung Nr. 12 vom Juni 1913). Zwischen 1917 und 1922 wurde die Sende-Großstation Malabar auf Java, in der Nähe von Bandung, mit einem 400 Kilowatt-TELEFUNKEN-Hochfrequenz-Maschinen-Sender aufgebaut. Über diesen Sender wurde die erste drahtlose Funkverbindung zwischen Ostasien und Europa hergestellt. Diese Station wurde erst im letzten Weltkrieg von den Japanern zerstört. Viele holländische Handels- und Passagierschiffe, die zwischen ihrem Heimatland an der Nordsee und ihrer Kolonie in Südost-Asien verkehrten, waren schon damals mit TELEFUNKEN Schiffs-Sende- und Empfangsanlagen ausgestattet. Um 1920 lieferte die AEG die ersten elektrischen Lokomotiven nach Indonesien für die Bahnverbindung von Batavia nach Buitenzorg, Städte, die nach der Kolonialzeit Jakarta und Bogor heissen. Ich hatte also schon eine gute Basis, auf die ich aufbauen konnte.
Ich beschäftigte mich nun täglich mit Literatur über Indonesien. Dabei stellte ich fest, dass Indonesien viel größer und bedeutender war, als ich zunächst angenommen hatte. Indonesien ist nicht nur das größte islamische Land der Welt, es hat auch weltweit nach China, Indien und den USA die viertgrößte Bevölkerung und ist das volkswirtschaftlich, flächen- und bevölkerungsmäßig größte Land Südost-Asiens. Nach Indien und den USA ist Indonesien die drittgrößte Demokratie der Welt. Alle diese Fakten waren mir zuvor nicht bekannt.
Zwischendurch musste ich in Deutschland immer wieder Kunden aus dem zivilen und militärischen Sektor, die aus Indonesien angereist waren, betreuen. Dabei konnte ich mich schon recht gut in die Mentalität und das Geschäftsgebaren der Indonesier einleben. Da die Betreuung oft über das Wochenende ging, ich mit den Gästen Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten unternahm und sie mit orientalischer Opulenz bewirtete, war das nicht immer ganz billig. Einmal habe ich es vermutlich doch zu weit getrieben, denn als die Geschäftsleitung meine Abrechnung sah, wurde ich vorgeladen und recht rüde gefragt, ob ich den Indonesiern „die Langusten in den Hintern geblasen“ hätte!
Auf Einladung von TELEFUNKEN waren zwei junge Offiziere der indonesischen Marine/ALRI für einige Monate zum Deutschkurs im Goethe- Institut in Blaubeuren. Auch sie habe ich immer wieder betreut. Zum Beispiel gingen diese beiden jungen Offiziere (wie auch viele andere Indonesier) bei meinen Eltern, die in Tübingen immer ein offenes Haus für ausländische Besucher hatten, ein und aus. Einige von ihnen erlangten später ganz wichtige Positionen bei der Armee, der Marine und in Ministerien. Diese intensive und auch kostspielige Betreuung hatte sich wirklich gelohnt, denn mit fast allen hatte ich später einen sehr guten Kontakt.
Die beiden jungen Offiziere der indonesischen Marine hatten meine Eltern besonders ins Herz geschlossen, da es für beide der erste Aufenthalt außerhalb Indonesiens war. Meine Eltern wollten ihnen daher so viel wie möglich vom Leben einer deutschen Familie zeigen und nahmen sie an Wochenenden überallhin mit. Das führte zu manchen lustigen Schlussfolgerungen der jungen Offiziere:
Meine Eltern waren sehr naturverbunden und gingen auch gerne mit den indonesischen Gästen zum Pilze suchen in den Wald, aus dem sie auch ab und zu einige Stücke Holz für den Kachelofen mitbrachten. Ein Freund meines Vaters, der Jäger war, nahm die beiden auch mit zur Jagd, bei der manchmal ein Reh erlegt wurde, wovon meine Eltern dann immer ein schönes Stück abbekamen. Die beiden jungen Indonesier waren begeistert und fasziniert.
Viele Jahre später in Indonesien, als ich schon mit den Eltern des einen Offiziers gut befreundet war, nahm mich der Vater zur Seite und sagte belustigt, nun müsse er mir aber zeigen, was sein Sohn damals aus Tübingen berichtet hat. Er zeigte mir den Brief seines Sohnes, in dem dieser damals nach Indonesien geschrieben hatte: „Die Eltern und Geschwister von Herrn Geerken sind alle sehr gastfreundlich und höflich. Für den Winter holt die Familie Holz im Wald, der Vater sucht Pilze und Beeren, ein Freund der Familie schießt im Wald Rehe und bringt Fleisch. Aber einen elektrischen Herd und einen Fernseher haben sie schon!“
Im Jahre 1963 war es dann soweit. Kurz vor meiner Abreise nach Indonesien heiratete ich noch meine Freundin Hannelore, die ebenfalls bei AEGTELEFUNKEN beschäftigt war. Da es zur damaligen Zeit für gefährlich gehalten wurde, Junggesellen nach Indonesien zu entsenden – das galt vermutlich genauso für jedes andere exotische Land –, wurde mein Entschluss von der Geschäftsleitung sehr wohlwollend registriert, zumal meine Frau als Sekretärin des Leiters der Exportabteilung sich in der Firma auch sehr gut auskannte. Mit ihren Fremdsprachenkenntnissen, ihrer Lust zu Reisen und vielen gleichen Interessen, waren wir ein gutes Team für den Auslandseinsatz.
Zur holländischen Kolonialzeit waren die Bedingungen allerdings anders, man wollte sparen und Ehepaare waren nicht erwünscht. Besonders für untergeordnete Positionen in den Plantagen wurden ausschließlich Junggesellen entsandt, die sich in ihren Kontrakten sogar verpflichten mussten, mindestens fünf Jahre unverheiratet zu bleiben. Es herrschte die Meinung, als Alleinstehende würden sie sich schneller in ihre neue Arbeit einarbeiten. Mit Hilfe ihrer einheimischen „Haushälterin“ lernten sie auch automatisch die malaiische Sprache schneller.
Nach der Hochzeit liefen die Vorbereitungen für die Ausreise auf Hochtouren. Ich hatte bei der Geschäftsleitung durchsetzen können, dass wir auf dem Seewege nach Jakarta reisen durften. Das war ein wunderschöner Ersatz für eine Hochzeitsreise! Da ich in Jakarta bei Null anfangen musste, kam ungeheuer viel Gepäck für eine Büroausstattung und den persönlichen Bedarf zusammen. Das war für mich ein gutes Argument, eine Reise mit dem Schiff machen zu dürfen. Wie mir immer wieder gesagt wurde, war dies das erste und einzige Mal, dass bei AEG-TELEFUNKEN eine Dienstreise per Schiff genehmigt wurde. Auch mit den Propellermaschinen wären wir damals, mit Übernachtungen in Kairo, Karachi und Bangkok, mindestens vier Tage unterwegs gewesen. Bei einer späteren Gelegenheit habe ich diese Strecke noch mit der legendären Super Constellation und der DC-6 zurückgelegt und auch noch in dem berühmt und aufgrund der kleinen Holzverschläge als Zimmer und gleichzeitig für Schmutz und Lärm berüchtigten „Midway Hotel“ übernachtet, das direkt neben der Start- und Landebahn des Flughafens von Karachi lag. Wenn eines der damals noch wenigen Flugzeuge bis in die Abendstunden verspätet war, wurde die Landebahn mit Petroleumlampen beleuchtet. Karachi war eine wichtige Zwischenstation auf dem Flug nach Fernost. Da die Fluggesellschaften auf dieser Strecke noch keine Nachtflüge hatten, wurden die Fluggäste abends in diese primitive Herberge gebracht, und beim ersten Morgengrauen ging es schon wieder weiter. Die Flüge dauerten lange, waren aber abwechselungsreich und spannend. Da die langsamen Propellermaschinen nur selten höher als 2.000 m flogen, sahen die Passagiere die Landschaft mit Dörfern, Feldern, Verkehrswegen etc. unter sich wie eine Landkarte vorbeiziehen. Selbst Karawanen in der Wüste oder Bauern auf den Feldern konnte man erkennen.
Wenig später hat dann die BOAC mit dem ersten Passagierjet den Liniendienst nach Südost-Asien aufgenommen. Es war die COMET IV für 36 Passagiere der Firma „de Havilland“. Es schien, als ob nun die Bedeutung des Midway Hotels am Karachi Flughafen nachlassen würde. Aber nachdem die COMET IV laufend technische Probleme und Abstürze in Ankara, Kairo, Karachi, Calcutta, Singapur und Bangkok hatte, ließ das Interesse an dieser schnellen Verbindung nach und die Langstreckenflüge mit diesem ersten Düsen-Verkehrsflugzeug wurden wieder eingestellt. Man konnte somit den „Luxus“ des Midway Hotels noch bis Ende der 1960er Jahre genießen. Weltweit entwickelte sich der Luftverkehr rasant. Nur gut zehn Jahre später, 1972, waren auf der Fernost-Route schon die ersten Jumbo-Jets auf der Route über Bangkok in Einsatz.
In der Versandabteilung der Firma stapelten sich die Kisten, nicht nur die dienstlichen, auch die privaten, denn wir mussten einiges einkaufen: Möbel, Geschirr, Kühlschrank, Küchenausstattung, Klimaanlage, Waschmaschine, Wäschetrockner, Notstromaggregat und vieles mehr. Ein Auto als Privatwagen für meine Frau war auch dabei, denn ein Dienstwagen wurde mir in Jakarta zur Verfügung gestellt. In Jakarta erregte der Wäschetrockner zunächst größte Erheiterung bei der dort bereits ansässigen westlichen Gemeinschaft. Aber später, während der Regenzeit, wurden wir allgemein beneidet, weil unsere Wäsche bereits nach einer Stunde trocken war und die Wäsche anderer nach drei Tagen stinkend und muffig und immer noch feucht von der Leine genommen werden musste.
Um in den Tropen allzeit korrekt gekleidet zu sein, wollte ich beim Tropenausstatter in Hamburg noch einen Tropenhelm erstehen, wurde allerdings dort von einem Verkäufer, der zwar nie in den Tropen gewesen war, aber das gesamte Wissen der Tropengebräuche zu verkörpern schien, sehr herablassend darauf hingewiesen, dass ein Tropenhelm nicht nur ein sehr englisches Kleidungsstück sei (also seiner Meinung nach für Indonesien mit seiner holländischen Vergangenheit völlig unangebracht), sondern gleichzeitig mit dem Verlust der Kolonien völlig aus der Mode gekommen sei. Derart gemaßregelt, nahm ich natürlich schweren Herzens Abstand vom Kauf dieser exotischen Kopfbedeckung.
Auf dem Speicher bei meinen Eltern stand schon seit Jahrzehnten ein schwarzer großer, damals sogenannter Überseekoffer von meinem reisefreudigen Großvater mütterlicherseits. Dieses überdimensionale Gebilde, auch „Steamers Trunk“ genannt, war ein handgefertigter Koffer aus Eichenholzspanten und genarbtem Leder mit Messingbeschlägen. Es gab unzählige Staumöglichkeiten. Dieses im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts für Seereisen übliche Reisegepäckstück war ein schrankartiges Monstrum. Man klappte es, auf die Schmalseite gestellt, wie ein Buch auf. Auf der einen Seite waren Schubladen für Kleinigkeiten und Fächer für Wäsche, Schuhe und Ähnliches, die andere Seite war vorgesehen, um Hosen und Anzüge aufzuhängen. Selbst ein Fach für eine Flasche mit dem gewohnten Drink für unterwegs fehlte nicht. Mit den statusbildenden bunten Aufklebern aus Amerika und vielen Ländern Europas sah er richtig weltmännisch aus. Wenn alles gefüllt war, konnte er nur von zwei starken Männern transportiert werden. Dieser alte Überseekoffer hatte mich schon auf meiner Schiffsreise in die USA begleitet. Nun wurde er nochmals beladen für die noch viel weitere Seereise nach Indonesien. Es sollte seine letzte Reise werden. In dem feuchtwarmen Klima am Äquator ging er endgültig aus dem Leim und er fand dann seine letzte Ruhestätte – seinem Namen entsprechend – in „Übersee".
1963 war Indonesien für die Deutschen noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Wenn ich erzählte, dass ich für einige Jahre auf die Insel Java gehe, erhielt ich meistens die Antwort: „Ach Jaffa, das ist doch dort wo die Orangen herkommen!“ Das junge Land Indonesien schien im Allgemeinwissen der Deutschen noch gar nicht zu existieren, obwohl es ein riesiges Inselreich ist, das sich von West nach Ost über eine Länge von fast 5.500 Kilometern erstreckt, einer Entfernung von Berlin bis in die östliche Mongolei. Aber auch ich hatte meine bestimmten Klischees: Vorstellungen aus Jugendbüchern und Abenteuerheftchen, in denen damals immer wieder die Tigerjagd im Dschungel von Sumatra verherrlicht wurde. Durch meinen netten und geistreichen Geographie-Lehrer im Parler-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd, Herrn Dr. Schurr, wusste ich aber doch schon einiges über den Indonesischen Archipel. In seinen spannenden Unterrichtsstunden kam er immer wieder auf die Insel Celebes, heute Sulawesi, zu sprechen. Die Insel Celebes schiebt in Form einer Orchidee ihre vier Arme weit ins Meer hinaus nach Osten. Auch von der Plantagenwirtschaft auf Sumatra und den von ihm so geliebten Sumatra-Zigarren mit dem weltbekannten Sumatra-Deckblatt erzählte er uns. Er schien auf den indonesischen Archipel fixiert gewesen zu sein und erweckte schon damals mein Interesse für diese Region der Erde. Während meines ersten Urlaubs in Deutschland wollte ich ihn – mit einem Kistchen Sumatra-Zigarren in der Tasche – besuchen, um herauszufinden, wie sein besonderes Interesse für diesen Archipel zustande kam. Vielleicht war er sogar selbst einmal dort. Leider war er in der Zwischenzeit verstorben und ich konnte das Rätsel nicht mehr lösen. Aber bis heute erinnere ich mich ganz klar und deutlich an seinen, für mich wirklich spannenden Geographie-Unterricht.
Obwohl die deutsch-indonesischen Beziehungen viele Jahrhunderte zurückgehen, war dieses Land Anfang der 1960er Jahre nur wenigen bekannt. Bereits im 16. Jahrhundert kamen die ersten deutschen Forscher nach Niederländisch-Indien. Im 17. Jahrhundert traten viele tausende abenteuerlustige deutschsprachige junge Männer die Reise nach Niederländisch-Indien an, um als Matrosen, Handwerker, Kaufleute oder Beamte für die Holländer tätig zu werden. Ende des 18. Jahrhunderts sandte der Herzog Carl Eugen von Württemberg für 300.000 Gulden ein Söldnerheer mit 2.000 Soldaten und Offizieren zur Unterstützung der „Vereinigten Niederländisch Ostindischen Compagnie“ in die niederländische Kolonie. Vertragsgemäß wurden laufend Ersatzmannschaften nachgeschickt. Die meisten dieser Söldner haben sich mit Javanerinnen verheiratet und blieben dort. Selbst seine eigenen Söhne verschacherte der Herzog von Württemberg an die Holländer, allerdings als Offiziere. Keiner kam zurück. Ob sie bei einem Kampf auf Java gefallen sind, oder ob sie es sich – wie die meisten der einfachen Soldaten – mit einer hübschen Javanerin häuslich niedergelassen haben, haben die Chronisten nicht vermerkt. Es gibt Historiker, die behaupten, dass durch die privaten Aktivitäten dieser Söldner mindestens fünf Prozent aller Indonesier württembergisches Blut in den Adern hätten. Das wären heute immerhin 12 Millionen! Der Gewinn für den Herzog von Württemberg war auf jeden Fall gewaltig: durch den Verkauf der Söldner, durch das Kopfgeld für die Gefallenen und durch die Einsparung der Rente für diese.
Es war sogar ein Deutscher, der Schiffsarzt und Wissenschaftler Adolf Bastian – unter anderem hat er auch das 5-bändige Werk „Indonesien oder die Inseln des malaysischen Archipels“ verfasst –, der Ende des 19. Jahrhunderts den Namen „Indonesia“ oder auf Deutsch „Indonesien“ geprägt und durchgesetzt hat. Wegen der Nähe zu Indien, hat er dem Archipel den Namen „Inseln bei Indien“ gegeben. Zusammen mit dem lateinischen Worten indus für Indien und dem griechischen Wort nessos für Inseln wurden aus Indonesos dann Indonesia. Diese Bezeichnung, die den gesamten Archipel umfasste, wurde von der indonesischen Unabhängigkeitsbewegung aufgegriffen. Das Wort Indonesien war allerdings während der holländischen Kolonialzeit strengstens verboten und durfte öffentlich nicht ausgesprochen werden, da die Holländer darin einen Angriff auf ihren Machtanspruch sahen. Jede Bestrebung für eine Vereinigung der Einwohner des Archipels, über die Grenzen von Stammeszugehörigkeit, Rasse, Religion und Sprache hinweg, wurde von der Kolonialregierung mit allen Machtmitteln verhindert. Für sie war „teilen und herrschen“ wichtig für den Machterhalt. Im Gegensatz zu Malaya, der ein gebräuchlicher völkerkundlicher Begriff für den gesamten Raum ist und die Menschen darin als Malaien bezeichnet, ist Indonesien ein nationaler kulturpolitischer Begriff. Das Wort Indonesien stärkte somit das Nationalbewusstsein.
Selbst eine ganze Reihe von deutschen Schriftstellern und Dichtern wie zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Adalbert von Chamisso, Friedrich Gerstäcker, Theodor Fontane, Ernst Haeckel, Heinrich von Kleist, Christian F. D. Schubart (der u. a. ein wunderschönes und trauriges Gedicht anlässlich der Entsendung der 2.000 Söldner durch Herzog Karl Eugen von Württemberg nach Java schrieb), Karl Helbig, Vicki Baum und viele andere mehr, haben über das Inselreich und seine Jahrtausende Jahre alte Kultur berichtet. Besonders hervorzuheben ist dabei Walter Spies, der 1923 nach Java kam und sich 1927 auf Bali niederließ. Er gründete eine Vereinigung von Malern und scharte damit eine Kolonie von einheimischen Künstlern und zivilisationsmüden europäischen Bohemiens um sich. Daher ist es verwunderlich, dass Anfang der 1960er Jahre über Indonesien in Deutschland noch relativ wenig bekannt war. Verantwortlich ist hierfür auch, dass die Indonesier dazu neigen, ihre Geschichte erst nach dem blutigen Kampf gegen die Niederlande und nach der Erklärung der Unabhängigkeit im Jahre 1945 beginnen zu lassen und ihre Geschichte vor der Unabhängigkeit auszuklammern.
Über deutsche Spuren in Indonesien und die frühen deutsch-indonesischen Beziehungen hat der ehemalige Deutsche Botschafter in Indonesien, Heinrich Seemann, ein hervorragender Kenner Indonesiens, ein sehr empfehlenswertes Werk mit dem Titel „Von Goethe bis Emil Nolde, Indonesien in der deutschen Geisteswelt“ geschrieben.
Ausreise mit der MS VICTORIA
Nachdem alle Vorbereitungen für unsere Ausreise getroffen waren und Listen für das Umzugsgut, für die Transportversicherung und für den indonesischen Zoll erstellt worden waren, als die polizeilichen Führungszeugnisse und Visa vorlagen, die Tropentauglichkeits-Untersuchungen in Tübingen erfolgreich abgeschlossen waren und wir alle Impfungen erhalten hatten, wurde ein Güterwagen bei der Bahn bestellt, der bis unters Dach voll beladen wurde. Im Schlafwagen ging es nach Genua, hinten am Zug war angekoppelt unser Güterwagen und auf einem zweiten Wagen unser Auto. Im Oktober 1963 schifften wir uns in Genua auf der „MS VICTORIA“ der Lloyd Triestino nach Jakarta ein. Die Schiffssirenen dröhnten und die Leinen wurden losgemacht. Vier Wochen Meer und unbekannte Länder lagen vor uns. Ein neues großes Abenteuer begann!
Es wurde eine herrliche Seereise! Die MS VICTORIA war noch ein echtes Linienschiff mit 11.700 Tonnen und drei Klassen, das regelmäßig auf der Route von Genua bis Hongkong und zurück fuhr. Dank AEGTELEFUNKEN reisten wir in der 1. Klasse und waren dort nur eine kleine Gemeinschaft von 60 Personen mit eigenem Deck, eigenem Pool und eigener Fünf-Mann-Kapelle. Wir fühlten uns richtig privilegiert und genossen jeden Tag. Zudem war es ja auch unsere verspätete Hochzeitsreise. Gleich hatte sich eine kleine Clique gebildet mit einem australischen und einem deutschen Diplomaten-Ehepaar, einigen Franzosen und Italienern und noch einem deutschen Ehepaar aus Offenbach, das jedes Jahr diese Reise machte, um deutsche Lederwaren in Asien zu verkaufen. Vor jedem Hafen wurden die Muster in der Lounge aufgebaut und die Kunden kamen an Bord, um zu bestellen. Einige Monate später machten sie nochmals dieselbe Route und lieferten dann die bestellte Ware aus. Ein beneidenswerter Job und auch wir hatten etwas davon: denn wenn das Lederwarengeschäft gut lief, gab es Freibier an der Bar.
Unsere Reise ging zunächst nach Neapel, vorbei an dem aktiven Vulkan Stromboli. Als wir bei strahlendem Sonnenlicht die Straße von Messina passierten, kam der mit Schnee bedeckte Ätna in Sicht. Es war der letzte Schnee, den wir für viele Jahre sahen. Weiter ging es durch das spiegelglatte Mittelmeer nach Port Said.
Gleich in den ersten Tagen auf See fielen uns zwei Männer auf, die sich an einem Zweiertisch gegenüber saßen und außer der Begrüßung nie ein Wort miteinander redeten. Der ältere Herr war Franzose und der andere ein Deutscher namens Ackermann. Beide sprachen nur ihre Muttersprache. Die morgendliche Begrüßung beim Frühstück war immer dieselbe. Der Franzose kam an den Tisch und begrüßte Herrn Ackermann mit „Bonjour“, Herr Ackermann erhob sich vom Stuhl und stellte sich mit „Ackermann“ und einem Kopfnicken vor. Diese Prozedur wiederholte sich die nächsten paar Tage beim Frühstück, beim Mittag- und beim Abendessen, bis wir Herrn Ackermann bei einer günstigen Gelegenheit aufklärten, dass Bonjour „Guten Tag“ heißt und keine Vorstellung sei. Herr Ackermann bedankte sich für den guten Rat und zog stolz von dannen. Am nächsten Morgen warteten wir schon gespannt, wie die Begrüßung der beiden Herren diesmal vonstatten gehen würde. Der Franzose war zuerst am Tisch. Herr Ackermann kam etwas später und verkündete mit Hilfe seiner neu dazu gewonnenen Sprachkenntnisse stolz „Bonjour“. Der Franzose erhob sich vom Tisch, verneigte sich und erwiderte „Ackermann“. Nun war es mit dem Ernst vorbei. Wir und die anderen unserer kleinen Gruppe platzten vor Heiterkeit.
Weiter ging es durch den Suezkanal und die Bitterseen nach Suez. Suez war in der Frage der Abendgarderobe ein Wendepunkt. In Deutschland hatten wir uns schon entsprechend darauf vorbereitet und ich hatte einen schwarzen Gesellschaftsanzug, sowie ein weißes Dinnerjacket dabei, und meine Frau hatte eine schöne Auswahl Abendgarderobe. Es ist bis heute eine alte britische Tradition aus der Kolonialzeit, dass in Suez die Tropen beginnen und „East of Suez“ nur noch Weiß getragen werden darf. Die gesamte Mannschaft bis hoch zum Kapitän, die bis hierher schwarze Uniformen trug, kleidete sich ab hier nur noch weiß. Auch die männlichen Passagiere trugen von hier an abends nur noch weiße Dinnerjackets. Auf den Linienschiffen herrschten noch strenge Regeln! Nur ein paar ehemalige, sehr konservative und sehr britische Kolonialbeamte trugen von Suez an auch das sogenannte „Red-Sea-Rig“, eine Kombination aus Smokinghose mit Smokinghemd, roter Fliege und rotem Kummerbund. Es sah etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber die Briten fühlten sich wohl darin. Dieses Kleidungsstück für Herren wurde um 1800 von der British Royal Navy für offizielle Anlässe in den Tropen eingeführt. Später übernahmen es die Amerikaner als „Gulf-Rig“, allerdings mit schwarzer Fliege und schwarzem Kummerbund. Heutzutage, im Zeitalter der Klimatisierung, sieht man diese Kombination kaum noch.
Aus der Linienschifffahrt während der Kolonialzeit kommt auch noch das englische Wort „posh“, was soviel wie „chic“ oder „fesch“ bedeutet. Wenn man mit den P&O-Linienschiffen der „Peninsular and Oriental Steamship Company“ in die Kolonie nach Indien fuhr, oder von dort zurück in die Heimat, war man privilegiert, wenn man aufgrund der kühlenden Brise und der Schattenseite die Kabine während des heißesten Teils der Reise durch das Rote Meer und den Suezkanal auf der richtigen Seite des Schiffes buchen konnte. Damals gab es ja noch keine Klimaanlagen. Also reiste man POSH, Portside Outward (also nach Britisch-Indien) und Starboard Home (zurück nach Hause). Dies waren die besten und teuersten Kabinen, die für die „Upper Class“ reserviert waren. Es wurde erzählt, dass diese Tickets mit einem Stempel „POSH“ versehen wurden, um den höheren Status anzuzeigen. Heutzutage, mit den vollklimatisierten Schiffen, muss man darauf nicht mehr achten, aber das Wort „posh“ hat sich bis heute in der englischen Sprache erhalten.
Auf der MS VICTORIA genossen wir das Bordleben, das tagtäglich seinen gewohnten Gang ging: Tage und Nächte, Schlemmen und Trinken, Tanzen und Spiele, Sonne und Seeligkeit. Die Sonne und der Mond stiegen aus dem Meer auf und gingen darin wieder unter. Fremde Landschaften glitten beruhigend langsam vorüber.
Durch das Rote Meer ging es geruhsam weiter nach Aden. Hier hatten wir einen halben Tag Aufenthalt, den ich nutzen wollte, um mir zollfrei eine Filmkamera zu kaufen. Damals war noch die Normal-8mm-Filmkamera der Hit, Super 8 war noch in weiter Ferne. In einem der Geschäfte suchte ich mir eine gute Kamera aus, bezahlte und ließ mir die verpackte Kamera aushändigen. Irgendwie schöpften meine Frau und ich Verdacht und wir packten die Kamera nochmals im Laden aus. Und wir taten gut daran, denn der Händler wollte uns eine einfache und viel billigere Kamera unterschieben. Schnell hatten wir uns geeinigt und wir zogen mit der richtigen Kamera ab. Abends, kurz vor dem Auslaufen der MS VICTORIA, wurden die Waren angeliefert, die einige Passagiere eingekauft hatten und sich aus Gründen der Bequemlichkeit auf das Schiff bringen ließen. Und siehe da: viele wurden betrogen. Es waren teilweise nur wertlose Sachen oder sogar Steine in den Paketen.
Weiter ging die Reise nach Karachi, wo wir den AEG-Vertreter für Pakistan kennen lernten. In Bombay hatten wir zwei Tage Aufenthalt, genügend Zeit für ein paar Ausflüge in die nähere Umgebung. Dann nahm die MS VICTORIA wieder Kurs nach Süden, entlang der Pfefferküste, wie die Westküste Indiens früher genannt wurde. Auch in Colombo auf Ceylon hatten wir genügend Zeit, um in den berühmten Hotels aus der Kolonialzeit „Mount Lavinia“ und „Galle Face“ einen Cocktail zu trinken.
Durch das hervorragende italienische Essen auf der MS VICTORIA mit fünf Mahlzeiten am Tag hatten fast alle Passagiere gewaltig an Gewicht zugelegt. Nur ein österreichischer Diplomat auf dem Weg zu seiner neuen Dienststelle in Singapur aß immer nur allerkleinste Portionen und blieb rank und schlank. Als wir ihn darauf ansprachen, sagte er: „Schauen Sie sich doch im Speisesaal um. Sie alle begehen Selbstmord mit Messer und Gabel!“
Auf unserem Weg nach Jakarta hatten wir nun tropische Gewässer erreicht. Es war eine Wonne, im Schiffspool zu baden, der jeden Morgen mit dem warmen Meereswasser gefüllt wurde. Als der Neumond im Meer versank und nur noch die Sterne am Himmel strahlten, konnte man die phosphoreszierende Spur des aufgewühlten Planktons noch viele Kilometer hinter dem Schiff im dunklen Meer verfolgen. Wie hypnotisiert habe ich dieses Naturwunder, das ich hier zum ersten Mal erleben durfte, stundenlang verfolgt.
Vor Jakarta überquerten wir den Äquator. Jeder der Passagiere, der zum ersten Mal den Äquator überquerte, musste an dem Ritual einer Äquatortaufe teilnehmen. So natürlich auch wir. Neptun zerschlug mir ein Hühnerei auf dem Kopf, beschmierte mich mit Tomatenketchup, Mehlbrei und Spaghettis und tauchte mich im Schwimmbecken unter. Dann durfte ich mit meinem neu angetauften Namen „Marconi“ die Reise fortsetzen. Marconi (1909 Physik-Nobelpreisträger und Funktechniker) deshalb, weil ich mich mit dem Funkoffizier des Schiffes angefreundet hatte und als Funkamateur ab und zu auch die Funkanlage benutzen durfte.
Am 22. November 1963, dem Tag des tödlichen Attentats auf Präsident John F. Kennedy, passierten wir am frühen Morgen in der Sundastraße den mächtigen, noch aktiven und gefährlich aussehenden Vulkan Krakatau. An Steuerbord kamen an der Nordküste Javas im fernen Dunst Palmenhaine und Mangrovenwälder in Sicht. Die Reise neigte sich dem Ende zu, viel zu schnell! Wir hatten uns an die angenehmen Seiten einer Seefahrt gewöhnt.
Um die Mittagszeit erreichten wir Jakarta und wir meldeten uns mit unseren laut heulenden Schiffssirenen im Hafen Tanjung Priok an, jedoch mussten wir noch stundenlang auf Reede liegen bleiben und der Dinge harren, die kommen sollten. Die Immigrationsbeamten und die Gesundheitsbehörde kamen an Bord und prüften zuerst die Pässe mit Visa und die Impfzeugnisse. Obwohl nur wenige Passagiere in Jakarta aussteigen wollten, dauerte es Stunden, bis das Schiff endlich freigegeben war und anlegen durfte. Die Zeit wurde uns vertrieben durch viele Fischer und Händler, die auf ihren kleinen schmalen Ruderbooten rund um das Schiff fuhren und lautstark ihre Waren feilboten. Es gab alles: Schnitzereien, Lederarbeiten, Obst. Ein Javaner mit zwei Papageien und ein kleiner Junge mit tropischen Früchten schafften es bis auf das Promenadedeck. Kinder in den Booten schauten erwartungsvoll zu uns Passagieren an der Reling hinauf und warteten, bis wir in weitem Bogen eine Münze in das ölige Hafenwasser warfen. Mit ruhiger Sicherheit tauchten sie nach dem Stück und zeigten dann lachend ihre Beute. Bunt bemalte Lastensegler, Bugis-Schoner, trieben langsam mit schlaffen Segeln durch die ölige See an uns vorbei. Es war eine andere, exotische Welt die mich empfing. Ich kam mir vor wie ein zweiter Humboldt, und es war genau so, wie ich es mir in meinen kühnen Jugendträumen vorgestellt hatte. Mit einem Gefühl von Wehmut ging ich von Bord.
Erste Eindrücke und erste Bekanntschaften
Inzwischen hatte schon die Dämmerung eingesetzt. Die glühende tropische Luft Jakartas empfing uns, als wenn man ein feuchtes, heißes Tuch um uns geschlungen habe. Wir wurden von zwei Herren der PT Guna Elektro, der Vertretung von AEG und TELEFUNKEN, abgeholt. Während meiner gesamten Zeit in Indonesien habe ich mit dieser Firma immer gut zusammengearbeitet. Zum Glück wussten die beiden einheimischen Herren, wie die Prozedur beim Zoll war, denn unser Gepäck, das wir mit in der Kabine hatten, wurde ziemlich schnell freigegeben. Auf der Pier und im Hafengelände drängten sich Einheimische in bunten Sarongs und Europäer in weißer Kleidung. Schon hier fiel mir ein schwerer süßlich-würziger Duft auf, der typisch für ganz Indonesien ist. Es war der Geruch der Kretek-Zigaretten, eine bei Indonesiern beliebte Spezialität, die es nur in diesem Lande gibt. Der Tabak der Kretek-Zigaretten wird mit Gewürznelken vermischt, und da Indonesier starke Raucher sind, liegt dieser süßliche Duft von verbrannten Nelken über jeder Ansammlung von Menschen. Dieser für Indonesien typische Geruch bleibt bis heute in meiner Erinnerung haften.
Bei Dunkelheit ging es durch die Straßen von Jakarta, entlang der Kanäle. Es sah zauberhaft aus. Der große Mond mit einem gelben Schimmer schwamm fast waagrecht, wie ein Boot, am dunklen Himmel. Frauen saßen am Straßenrand und verkauften in den offenen Läden Obst, Getränke, Süßigkeiten und Töpferwaren. Die vielen kleinen Essstände mit ihren mobilen Kochstellen, die fahrenden Händler mit ihren Rufen und das alles beleuchtet vom flackernden Licht unzähliger kleiner Petroleumlämpchen. Mit schweren Lasten bepackte, bis zum Gürtel nackte und vom Schweiß glänzende Kulis liefen durch das Gewirr. Bunte Pferdedroschken bahnten sich mit Rufen, die neben den klappernden Huftritten der kleinen Pferdchen und dem Gebimmel der an den Droschken hängenden Glöckchen fast untergingen, ihren Weg entlang der Straße durch den Verkehr. Halbnackte Kinder rannten vorbei, Bettler baten um ein Almosen. Händler tänzelten leichtfüßig mit ihren wippenden Pikuls, je ein Korb mit ihren Waren vorne und hinten an einer Bambus-Tragestange über der Schulter, vor unserem Auto über die Straße. Ich fühlte mich wie in einem wimmelnden Ameisenhaufen.
Schwaden der für indonesische Städte typischen Duftmischungaus Kretek-Zigaretten, in Kokosöl Gebratenem, von scharfen Gewürzen, Knoblauch und Trockenfisch, drangen auf einer Woge feuchter Schwüle durch die offenen Fenster ins Auto. Es war eine aufregende Mischung von Gerüchen, die aus einem früheren Jahrhundert zu kommen schien. Auch viele ungewohnte Geräusche drangen an mein Ohr. Ein Gamelan-Orchester spielte in der Ferne, der Muezzin rief zum Gebet, Händler und Köche priesen mit lauten Rufen ihre Waren an, Holzkarren krächzten, Becaks, die typischen Fahrradrikschas, und Fahrräder klingelten warnend, Autos hupten aufdringlich. Es lag aber auch eine Glocke von die Lungen reizendem Rauch über Jakarta. Überall am Straßenrand wurde Müll verbrannt, dessen Gestank immer wieder die Wohlgerüche übertönte. Trotzdem war der erste Eindruck märchenhaft: wie 1001 Nacht!
Wir passierten auf der neuen sechsspurigen Autobahn das erst teilweise fertig gestellte Kaufhaus Sarinah. Die Indonesier waren stolz auf das erste Kaufhaus Indonesiens, aber das Angebot war begrenzt: Batikstoffe und indonesisches Kunsthandwerk. Die Fahrbahnmarkierungen auf der Autobahn schienen reine Zierde zu sein, da sich keiner der Fahrer an die vorgeschriebene Spur hielt. Neben dem Welcome-Monument inmitten eines großen runden Teiches steht das Hotel Indonesia, dem damals neuen und einzigen Luxushotel Jakartas. Es wurde erst wenige Monate zuvor eröffnet und war eines der besten in Südost-Asien. Ein einfacher Bürger musste dort für ein einziges Mahl ein ganzes Monatsgehalt ausgeben. Wie man mir gleich erzählte, klappte aber dort noch nicht alles. Bei der Installation wurden heißes und kaltes Wasser vertauscht, so dass zum Beispiel die Toiletten mit heißem Wasser gespült wurden. Es waren ganz moderne Toiletten mit integriertem Bidet, das heißt mit einem zusätzlichen Wasserstrahl von unten. Nur waren die Druckknöpfe für die Bedienung vertauscht. Ein neuer Gast, der mit den Gegebenheiten noch nicht vertraut war, bediente nach abgeschlossenem Geschäft den – wie er dachte – Knopf für die Toilettenspülung, bekam aber dann den vollen Strahl des Bidets ins Gesicht. Mancher Besucher musste anschließend unter die Dusche.
Weiter ging die Fahrt zum Vorort Kebayoran, vorbei am neuen Senayan-Sport-Komplex mit dem Paradestück der sowjetischen Entwicklungshilfe an Indonesien, einem ringsum überdachten Stadion für über hunderttausend Menschen. Entlang der Straßen war alles wunderbar beflaggt. So sehr es uns geehrt hätte, dachten wir gleich, dass dies nichts mit unserer Ankunft in Indonesien zu tun haben könne. Die IV. Asiatischen Spiele und die GANEFO-Spiele gingen gerade zu Ende. Die „Games of the New Emerging Forces“ sollten die in indonesischen Augen wegen der Kommerzialisierung und Politisierung dekadenten Olympischen Spiele ablösen. 51 Entwicklungsländer nahmen daran teil. Sportler die hier mitmachten, wurden vom Olympischen Komitee (IOC) von der Teilnahme an der darauf folgenden Olympiade ausgeschlossen. Weiter ging es direkt zu dem Kollegen der AEG in Kebayoran Baru, wo eine Willkommens-Party für uns gerade begonnen hatte. Wir hatten nicht einmal Zeit uns umzuziehen, bevor wir uns in die Partyrunde begaben und vielen neuen Gesichtern begegneten. Das war unser erster Auftritt in Jakarta.
Hier lernte ich unter anderem Herrn Dr. Westrick kennen, den ich einige Tage später bei einem Essen im Hause des Kollegen wieder treffen sollte. Er war der Sohn eines Staatssekretärs unter Ludwig Erhard. In dieser Familie war der Spross in Jakarta das „schwarze Schaff, das merkte man auch sehr schnell an seinen undurchsichtigen Geschäften. Keiner wusste, was er wirklich tat, aber er hatte immer viel Geld, Berge von Rupiahs. Bei ihm konnte man immer Deutsche Mark zu einem guten Schwarzkurs in Indonesische Rupiahs umtauschen. Sein kleines Haus war einfach eingerichtet, aber alles war aus dem neu eröffneten Hotel Indonesia gestohlen: Bettwäsche, Handtücher, Teller, Tassen, Gläser, das Besteck und sogar die hübschen kleinen Tischlampen mit Zinnfuß und konischem roten Glasschirm, die ein romantisches Kerzenlicht verströmten. Er brüstete sich regelmäßig, wie einfach es sei, gefüllte Taschen an den Boys und den Sicherheitsbeamten des Hotels vorbeizuschleppen und ins Auto zu tragen. Es war damals noch die von den Holländern den Indonesiern über Jahrhunderte eingebläute Mischung aus Unterwürfigkeit und Angst, die sie hinderte, den „weißen Mann“ zu kontrollieren. Darüberhinaus durfte während der Kolonialzeit ein Holländer nicht von einem Indonesier angesprochen werden. Er durfte nur Antwort geben! Nur eine Badewanne fehlte noch in Dr. Westricks Hause, aber das war ihm dann doch zu aufwändig, diese im Hotel Indonesia auszubauen.