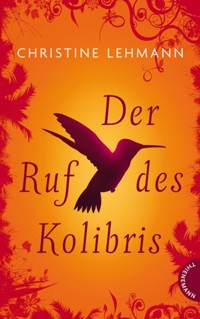
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet!
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Jahr Kolumbien. Noch ahnt Jasmin nicht, was sie erwartet. Dass sie Verzweiflung kennenlernt. Sich sich von der Magie des Landes verzaubern lässt, Gewalt begegnet, den Duft der Freiheit schmeckt, an die Grenzen des Möglichen kommt. Vor allem aber trifft sie Damiàn. Damiàn, den gut aussehenden Indio, der ein dunkles Geheimnis hütet. Tief im kolumbianischen Urwald und den nebligen Bergen der Anden findet Jasmin Antworten. Und ist doch längst rettungslos in ihrer Liebe zu Damiàn verfangen. Packende Liebesgeschichte, geheimnisvoller Abenteuerroman und fesselnder Politthriller in einem.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Autorenvita
© Thienemann Verlag GmbH
Christine Lehmann, 1958 in Genf geboren, wollte bereits mit 14 Jahren Schriftstellerin werden. Nach dem Abitur studierte sie Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin arbeitet als Nachrichten-Redakteurin beim SWR. Darüber hinaus schreibt sie seit fast 20 Jahren Krimis und Liebesromane (Knaur, z.B. »Der Bernsteinfischer«, verfilmt mit Heiner Lauterbach, oder »Die Liebesdiebin«), Essays, Kurzgeschichten für Anthologien und Kriminalhörspiele fürs Radio. Unter ihrem Pseudonym Madeleine Harstall erscheinen ihre historischen Romane. Christine Lehmann lebt mit ihrem Mann in Stuttgart.
www.lehmann-christine.de
Buchinfo
Ein Jahr Kolumbien. Noch ahnt Jasmin nicht, was sie erwartet. Dass sie Verzweiflung kennenlernt. Sich von der Magie des Landes verzaubern lässt, Gewalt begegnet, den Duft der Freiheit schmeckt, an die Grenzen des Möglichen kommt. Vor allem aber trifft sie Damiàn. Damiàn, den gut aussehenden Indio, der ein dunkles Geheimnis hütet. Tief im kolumbianischen Urwald und den nebligen Bergen der Anden findet Jasmin Antworten. Und ist doch längst rettungslos in ihrer Liebe zu Damiàn verfangen.
Sein Blick hielt mich umschlungen. »Kolibris sind die Juwelen der Nebelberge«, sagte er mit einer leisen Zärtlichkeit in der Stimme, als meinte er mich.
– 1 –
Mein Koffer ist gepackt. Der Flug geht am späten Abend. Ich habe meine Eltern noch mal besucht. Tante Valentina hat mich mächtig an sich gedrückt. Sie hofft, dass ich mein Studium bald abschließe, damit ich für sie arbeiten kann. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Abstecher nach Kolumbien machen werde. Es tut immer noch zu weh.
Auch nach acht Jahren.
Hätte mir damals nicht der Affe die Uhr geklaut! Und so weit wäre es gar nicht erst gekommen, wären meine Eltern nicht solche hoffnungslosen Romantiker gewesen. Plötzlich hatte mein Vater den Wunsch verspürt, als Arzt das Elend in der Dritten Welt zu lindern, und meine Mutter mit der Idee infiziert, ihrem Leben noch mal einen neuen Sinn zu geben. Deshalb gingen wir, als ich gerade sechzehn Jahre alt geworden war, für ein Jahr nach Kolumbien. Total der Schwachsinn, zwei Jahre vor meinem Abitur. Aber ich hatte vergeblich diskutiert.
»In Bogotá gibt es eine vorzügliche deutsche Schule!«, erklärte meine Mutter. »Und du kannst dein Spanisch vervollkommnen.«
Ich hatte in Deutschland seit drei Jahren Spanischunterricht.
»Und ein Jahr im Ausland tut dir auch ganz gut«, behauptete mein Vater. »Dann siehst du mal, wie andere Menschen leben.«
Wenn Eltern ihr letztes Abenteuer im Leben suchen, hat die Tochter nichts mehr zu melden. Da stecken ganz tiefe Sehnsüchte dahinter oder Lebenskrisen, die ich mit sechzehn nicht verstehen konnte. Das glaubten zumindest meine Eltern, weshalb sie mir eine echte Begründung für diesen Irrsinn nicht geben wollten.
Als wir auf dem Flughafen El Dorado landeten, legte ich die Hand auf die Uhr an meinem Handgelenk. Ich hatte sie während der ganzen Reise immer wieder angefasst. Simon hatte sie mir zum Abschied gegeben. »Bring sie mir zurück«, hatte er gesagt und gelächelt. »Sie ist nur geliehen. Damit du in einem Jahr wiederkommst, Jasmin. Damit du dich nicht etwa verliebst und uns vergisst.«
Simon hatte die Uhr von seinem Vater bekommen, als er vierzehn war, einen Tag, bevor sein Vater zu einer Tour in den Himalaja aufbrach, von der er nicht mehr zurückkehrte. Simons Vater wiederum hatte die Uhr auf einer früheren Reise von einem Mann in Tibet geschenkt bekommen, einem Missionar, der dort buddhistischer Mönch geworden war. Es war eine altmodische goldene Uhr mit buckelrundem Glas, zum Aufziehen noch, mit speckigem Lederarmband, das sich warm an meinem Handgelenk anfühlte.
Simon hatte sie mir ans Handgelenk geschnallt und mich danach zum ersten Mal auf die Lippen geküsst. Es war ein trockener zarter Kuss gewesen, in Simons Rastalocken hatte ich für einen Moment den Duft von Zigaretten wahrgenommen.
Keine vierundzwanzig Stunden später landeten wir auf dem Flughafen von Bogotá. Es regnete. Von den Bergen, welche die Hochebene flankierten, waren nur vernebelte blaue Wände zu erkennen. Ein gelblich grauer Schleier hing über der unüberschaubar riesigen Stadt.
In der Ankunftshalle waberten und plapperten spanische Stimmen. Sie verbreiteten sofort eine gewisse Hektik. Die Menschen balgten sich förmlich um die Koffer am Gepäckband, als ginge es um Leben und Tod. Eine Frau sackte halb ohnmächtig zusammen und wurde von zwei Männern auf einen Kofferwagen gesetzt. Sie schnappte nach Luft wie ein Fisch und fächelte sich mit einem Fächer Kühlung zu.
Auch Papa keuchte wie nach einem Sprint, als er unsere Koffer vom Gepäckband hob. Mama rieb sich die Schläfen. Ein sicheres Zeichen, dass sie Kopfweh bekam. Die Hauptstadt von Kolumbien lag immerhin gut zweieinhalbtausend Meter hoch. Bei jedem Atemzug, den ich tat, hatte ich das Gefühl, Wasserdampf einzuatmen, und zwar ohne Sauerstoff.
»Man gewöhnt sich an die Höhenluft«, bemerkte mein Vater und küsste meine Mutter. »Wir haben es geschafft, Schatz! Schau, was für ein Himmel! Diese Wolken! Was für ein grandioses Land!«
Wenigstens er war glücklich.
Ich für meinen Teil war entschlossen, nichts schön zu finden. Ich war nur unter Protest mitgegangen, ich befand mich unter Zwang hier. Ich war praktisch die Geisel meiner Eltern. Solange ich noch nicht volljährig war, musste ich dort leben, wo meine Eltern leben wollten. Dabei hätte Tante Valentina mich für das Jahr genommen. Sie besaß jede Menge Zimmer in ihrer Wohnung in Konstanz mit Blick über den Bodensee in die Schweizer Berge. »Das können wir Valentina nicht zumuten«, hatte meine Mutter erklärt. »Was ist daran denn eine Zumutung?«, hatte ich gefragt, aber keine Antwort bekommen außer: »Schlag dir das aus dem Kopf, Jasmin.«
Mit einem gelben Taxi rollten wir auf einer Autobahn ins Zentrum. Die Straße bestand aus vier Spuren in jede Richtung. Für die roten Busse des TransMilenio gab es noch einmal zwei Extraspuren. Alles an Bogotá war gigantisch, wenn man wie ich nur Konstanz und Stuttgart kannte und von einem Schullandheimaufenthalt gerade mal noch Berlin. Aber das waren Kuhdörfer verglichen mit der kolumbianischen Hauptstadt. Sieben Millionen Menschen wohnten hier. Im Süden herrschte Mord und Totschlag in den Slums, im Norden hauste in Wolkenkratzern das Geld.
»Es ist doch alles recht sauber«, bemerkte meine Mutter, als hätte sie Ratten und Müllberge erwartet. »Und so grün!«
Kunststück, es regnete ja auch ständig.
»Guck mal!«, rief mein Vater, als wir an einer Ampel hielten. »Hier gibt es noch diese Schilder für Parkverbot, die wir früher auch hatten. Die mit dem durchgestrichenen P.«
Ich schaute aus dem Fenster. Hätte ich das nur nicht getan. Statt des nostalgischen Schilds, das mein Vater entdeckt hatte, sah ich den Bettler, der am Mäuerchen einer kleinen Grünanlage lehnte. Ein junger Mann in Regenjacke ging an ihm vorbei und warf ihm einen angebissenen Hamburger zu, aber nicht weit genug. Das Brötchen knallte auf den Gehweg und fiel auseinander. Ehe der Bettler hinkam, war ein bis aufs Skelett abgemagerter Hund aus der Grünanlage hervorgestürzt und hatte sich den Fleischklops geschnappt. Ich sah, wie der Bettler den Mund zu einem Schrei aufriss und dem Hund eine Eisenstange, die dort herumlag, über den Schädel schlug. Der Hund brach zusammen. Unser Taxi fuhr los, und ich sah gerade noch, wie der Bettler dem wie tot daliegenden Hund den Fleischklops aus den Zähnen klaubte und sich selbst in den Mund steckte.
Ich hätte beinahe gekotzt.
Usaquén lautete der Name des Stadtteils, San Patricio hieß das Viertel und Residencia El Rubí die von Kameras und Pförtner bewachte Anlage, in der wir wohnen sollten. Das Krankenhaus, in dem Papa arbeiten würde, hatte die Wohnung ausgesucht. Die roten zehnstöckigen Klinkerblocks umschlossen wie Festungsmauern einen grünen Rasen mit Bananenstauden und Papageien in den Bäumen.
Unsere Wohnung befand sich im zweiten Stock. Sie hatte vier Schlafzimmer, zwei Bäder und einen Tanzsaal von Wohn- und Esszimmer, in dem schwarze Holzkommoden und steile Stühle im spanischen Kolonialstil herumstanden. Und sie war kalt wie eine Gruft.
»Heizung?« Estrellecita zog die Brauen hoch und lächelte. »Es liegen Decken in den Schränken.«
Estrellecita war unsere Haushälterin, die das Krankenhaus vermutlich gleich mitgemietet hatte. Und sie hatte von Heizungen offensichtlich noch nie etwas gehört.
In Bogotá wurden Häuser und Wohnungen für tropische Wärme gebaut, schließlich befand man sich am Äquator, nur dass es tropische Wärme hoch oben in den Anden nicht gab, was man ja eigentlich seit Gründung der Stadt vor fünfhundert Jahren wusste. Es wurde, so hatten die Reiseführer gedroht, die meine Eltern gelesen hatten, selten wärmer als 15 Grad und nachts schnell kälter als 5 Grad.
Die ganze Stadt war eine Fehlkonstruktion. Und deshalb aß man heiße Suppen. Estrellecita empfing uns jedenfalls mit einem Ajiaco Santafereño, einer Kartoffelpampe mit Hühnerfleisch, in der sich ein Stück Maiskolben verbarg. Dazu gab es ein Schälchen Grünzeug, das mein Vater Franzosenkraut nannte und das nach rohen Erbsen schmeckte, außerdem Kapern, Sahne und eine halbe Avocado in weiteren Schälchen. Und natürlich Brot.
»Wir müssen uns mit dem Brot zurückhalten, Markus!«, ermahnte meine Mutter meinen Vater schon mal. Für Mama war Brot eine totale Katastrophe, denn es machte dick.
So begann also meine Zeit der Regenjacke.
– 2 –
Mein erster Schultag verlief typisch Jasmin Auweiler. Ich ging alleine. Meine Mutter lag mit Migräne im abgedunkelten Schlafzimmer, mein Vater operierte. Schon an meinem ersten Schultag in meinem Leben war ich alleine mit der Schultüte losgezogen, weil meine Eltern irgendwie nicht abkömmlich gewesen waren.
Der Schulbus fuhr zwanzig Minuten gen Norden aus der Stadt heraus ins Grüne. An der Pforte musste ich meinen Ausweis zeigen. Außerdem wollte der Pförtner ein Papier von mir, das ich nicht dabeihatte. Eine Autorisation, wie er das nannte. Meine Erklärung, dass ich ab heute hier Schülerin sei, genügte ihm nicht. Er telefonierte erst mit der Verwaltung, ließ sich bestätigen, dass man auf eine Jasmin Auweiler wartete, und winkte mich dann durch. In einer Stadt, in der die Bushaltestellen des TransMilenio bewacht wurden wie bei uns in Flughäfen der Übergang zu den Gates, war das eine fast harmlose Sicherheitsmaßnahme.
Die roten Ziegelgebäude des Colegio Bogotano lagen weit verstreut in einer parkähnlichen Anlage. Überall standen Schülerinnen und Schüler in Gruppen herum, und ich hatte gleich Gelegenheit, die Schuluniform fürchten zu lernen. Die meisten Jungs und viel zu viele von den Mädchen trugen den hellblauen Trainingsanzug mit grünen Streifen. Der Schottenrock war auch nicht schöner. Aber immer noch besser als diese Hosen aus einem hellblauen Stoff, der auf grauenvoll großräumige Weise Jeans imitierte, ohne Jeans zu sein. Dazu gab es blaue Pullover mit Schulemblem, weiße Poloshirts mit grünen Streifen und hellblaue Regenjacken. In der Verwaltung bekam ich als Erstes einen Stapel dieser Kleider des Schreckens überreicht und musste auch gleich Hosen und Pullover anziehen. Da war man streng im Colegio.
Immerhin würde ich so morgens viel Zeit sparen, die ich in Deutschland mit der Frage verbracht hatte, was ich anziehen sollte.
Ich war nicht gerade hübsch. Da machte es nicht wirklich Spaß sich anzuziehen. Meine Freundin Vanessa konnte bauchfrei tragen und Hüftjeans und Piercing im Bauchnabel. Abgesehen davon, dass mir meine Eltern das Piercing verboten hatten – sie waren Ärzte und dachten immer gleich an Infekte und die Übertragung tödlicher Krankheiten durch unsaubere Instrumente –, war mein Bauch auch nicht wirklich flach.
Tante Valentina meinte zwar immer: »Du bist so ein hübsches Mädchen, du siehst wenigstens nach was aus.« Aber das sagten die Erwachsenen immer. Die hatten keinen Blick dafür, wie ein Mädchen mit sechzehn aussehen musste. Sie fanden Hosen total kleidsam, die an den falschen Stellen Falten warfen.
In Uniform betrat ich das Rektorat. Die Rektorin des Colegio Bogotano hieß Claudia Aldana, war einen Kopf kleiner als ich, geschminkt und blond gefärbt und sprach perfekt Deutsch und Spanisch, wenn auch beides mit bayrischem Akzent.
»Und Ihre Eltern?«, fragte sie, irritiert an mir vorbeiblickend, als müsse noch jemand durch die Tür treten.
»Meine Mutter ist krank und mein Vater musste zu einem Notfall ins Krankenhaus«, erklärte ich.
»Na dann, herzlich willkommen«, sagte sie. »Ihre Noten sind gut, wie ich sehe. Sie kommen sicher gut zurecht hier. Es wird Sie gleich jemand in Ihre Klasse bringen. Scheuen Sie sich nicht, sich bei Problemen sofort vertrauensvoll an mich zu wenden. Viel Erfolg.«
Und – wusch – war sie weg.
Eine junge Frau brachte mich ins nächste Gebäude und übergab mich einer Lehrerin, die mich in die 11C einführte und ans Fenster neben Elena Perea platzierte. Elena war eine kleine, knubbelige Person mit schwarzen Haaren und einem südländisch dunklen Teint. Ihre Mutter sei Deutsche, erklärte sie mir sofort flüsternd. Ihr Vater war der berühmte schwerreiche Smaragdminenbesitzer Leandro Perea. Von dem hatte ich bis dahin nie gehört.
»Ich habe einen Leibwächter«, flüsterte Elena. Sie sprach Spanisch. »Ich werde mit dem Auto in die Schule gebracht und abgeholt.«
Ihre Schuluniform peppte sie mit Halstuch, Uhr, iPod-Kopfhörern und Sonnenbrille auf. Und sie musste am Morgen bestimmt eine Stunde vor dem Spiegel verbracht haben.
»Ich bin das geborene Entführungsopfer«, wisperte sie von der Seite auf mich ein. »Natürlich würde mein Vater sofort zahlen. Für mich würde er jede Summe zahlen. Ich bin doch sein Juwel, sein Smaragd, seine Esmeralda! Wenn die FARC mich entführen würde, würde er alles zahlen. Er ist in seinem Herzen ein Sozialist! Du weißt, was die FARC ist? Die Revolutionäre Volksarmee Kolumbiens. Sie entführen Leute und ...«
Ich nickte. »Ich weiß!«
»Aber leider ist nicht nur die FARC das Problem«, fuhr Elena unerschrocken fort. »Auf mich hat es praktisch jeder Kriminelle abgesehen. Ich kann jederzeit auf offener Straße gekidnappt werden. Du solltest auch aufpassen. Sie kommen von hinten auf Motorrädern und schnappen dir die Handtasche weg. Ein lahmer Bettler greift sich deine Geldbörse und rennt davon. Und die Imbissverkäufer tun dir K.-o.-Tropfen in die Cola und dann wachst du zwischen Mülltonnen wieder auf und bist geschändet und ausgeraubt und solche Sachen. Und nimm dich vor den Affen in Acht!«
»Den Affen?« Ich musste lachen. »Hier in der Stadt?«
»Ich spreche von den gezähmten Affen. Man findet sie süß und niedlich und will sie streicheln und währenddessen reißen sie dir die Ohrringe aus den Ohren und klauen dir das Handy aus der Tasche. Meine Landsleute sind leider alle Diebe, weißt du! Sie sind ungebildet und faul. Sie wollen alle das schnelle Geld und Party und Marlboro-rote Autos.«
»Ruhe, bitte!«, sagte die Lehrerin.
Elena war immerhin bis zur Pause halbwegs still. Dann fuhr sie fort, mich vor dem gefährlichen Pflaster zu warnen, das Bogotá darstellte. Aber eigentlich war sie ganz in Ordnung. Irgendwie bewunderte sie mich sogar. Das kannte ich von Vanessa gar nicht. Für Vanessa war ich immer die kleine Schwester gewesen, die man mal mitnahm, aber auch mal einfach sitzen ließ. Elena dagegen erklärte mir alles, zeigte mir die Mensa, die Bibliothek und ihre Computerräume. Außerdem stellte sie mich ihrer Clique vor und lud mich ein, mit ihnen allen zusammen am Wochenende ins Kino zu gehen, wenn es meine Eltern erlaubten. Schon nach einer Woche nahm sie mich mit zu sich nach Hause. Und als sie hörte, dass ich daheim geritten war, lud sie mich ein, sie in den Reitstall zu begleiten und auf einem von den fünf Pferden zu reiten, die ihrem Vater gehörten.
Ich musste zugeben, dass die Schule total okay war.
Inzwischen trat meine Mutter auch ihre Stelle im Labor der Privatklinik an, in der mein Vater arbeitete. Sie war eigentlich Fachärztin für Labormedizin und Mikrobiologie. Für die Laborstelle im San Vicente war meine Mutter zwar überqualifiziert, aber »besser als daheim herumsitzen«, wie sie meinte. »Vielleicht findet sich ja bald etwas Interessanteres. Und soll ich den ganzen Tag mit den Engländerinnen Tee trinken? Jasmin ist ja den ganzen Tag in der Schule.«
Genauer, bis vier Uhr nachmittags. Bis ich an der Haltestelle Pepe Sierra aus dem Schulbus gestiegen und nach San Patricio hineingelaufen war, war es halb fünf. Dann dauerte der Tag noch anderthalb Stunden. Denn in dieser Gegend am Äquator gibt es keine Jahreszeiten. Die Sonne scheint immer nur zwölf Stunden. Sie geht um sechs auf und um sechs unter. So gingen die ersten Wochen dahin.
– 3 –
Dann kam der Tag, an dem der Affe Simons Uhr stahl. Es war ein Sonntagmorgen, noch vor dem Frühstück. Ich hatte mich gerade angezogen. In der Nacht hatte es wüst geregnet, aber jetzt schien die Sonne. In den Bäumen der Grünanlage, die von jungen Kolumbianern peinlich genau gepflegt wurde, schnatterten die Papageien und pfiffen die Vögel. Der Rasen dampfte, wie so oft, und der Fleck blauer Himmel wurde schon wieder bedrängt von dunklen Wolken.
Da erschien auf einmal ein Äffchen auf dem Balkongeländer. Es hatte ein seidiges Fell und ein rotes Halsband und gab zirpende Laute von sich. Seine Augen waren groß und schauten mich unverwandt durch die Scheibe der Balkontür an. Es wirkte erschreckt, aber diese kleinen Seidenäffchen sahen immer so aus.
Vielleicht hat es Hunger, dachte ich.
Auf dem Balkon standen die Pfützen, und das Äffchen turnte zwitschernd auf dem Stuhl herum. Ich öffnete die Balkontür. Kühle, feuchte Luft fiel herein. Das Äffchen sprang mir sofort auf den Arm. Es war federleicht und quicklebendig. Seine Finger, die sich in die Falten meines Shirts krallten, waren winzig. Einen Augenblick später sprang es von meinem Arm herunter, lief ins Zimmer, hüpfte über die Bettkante auf meinen Nachttisch, schnappte sich meine oder vielmehr Simons Armbanduhr und war mit zwei Sprüngen wieder federleicht über meinen Arm hinweg hinaus auf den Balkon gesprungen, ehe ich kapierte, was geschah. Und schon war es über das Balkongeländer verschwunden.
Scheiße!
Immerhin hatte es meinen iPod nicht genommen mit all den Songs von Juanes und meinen gesamten CDs, die ich draufgeladen hatte. Ich dachte an Elena und ihre Schauergeschichten von Dieben und diebischen Affen. Man fand sie niedlich und streichelte sie ...
Ich sprang auf den Balkon, um zu sehen, wohin das Äffchen verschwand, und sah, wie es auf drei Beinen zwischen den Bananenstauden hindurch quer über den Rasen hüpfte.
Vom anderen Ende betrat einer der Gärtner die Anlage. Es war der junge Kerl, den ich schon ein paarmal am Wochenende gesehen hatte. Er schnitt Bäume und mähte den Rasen. An ihm hangelte sich das Äffchen jetzt hinauf. Er griff nach ihm, aber es sprang von seiner Schulter sofort in den nächsten Baum. Soviel ich von oben erkennen konnte, steckte er sich dann etwas in die Tasche.
Er trug eine weite khakifarbene Hose und an den Füßen Gummistiefel, was bei dem nassen Rasen das Beste war. Über der Hose, die mit einem Gürtel auf den schmalen Hüften gehalten wurde, trug er, obwohl es in Bogotá nie wirklich sommerlich warm wurde, nur ein graugrünes Unterhemd, das einen muskulösen Oberkörper und breite Schultern zur Geltung brachte. Sein Alter war schwer zu schätzen, vermutlich war er kaum zwanzig Jahre alt. Seine glatte Haut schimmerte bronzefarben, sein Haar war rabenschwarz, die Augen schmal und dunkel. Er gehörte eindeutig zu den indianischen Ureinwohnern, die man Indígenas nannte.
In Kolumbien mischten sich viele Volksgruppen, Weiße spanischer Herkunft, ehemalige schwarze Sklaven, Indianer unterschiedlicher Stämme. Es gab im Land mehr Kinder und Jugendliche als Erwachsene. Viele von ihnen verdienten sich irgendwie ihren Lebensunterhalt auf der Straße, in Cafés, als Boten, als Straßenverkäufer. Elena wurde nie müde, mich vor ihnen zu warnen. Sie wechselte sogar die Straßenseite, wenn sie einen Bettler sah oder ein Kind mit Bauchladen.
Ich zögerte. Mein erster Impuls war es gewesen, sofort runterzurennen und diesen Indio zur Rede zu stellen. »Gib die Uhr wieder her oder ich hole die Polizei!«
Und dann? Wenn er mich auslachte? »Welche Uhr?« Wenn er den zu Tode Gekränkten spielte? »Glaubst du, nur weil du weiß bist, kannst du behaupten, ich sei ein Dieb?« Und welche Polizei sollte ich holen? Bis ich hinaufgegangen und die Polizei angerufen hätte und bis die erschienen wäre, wäre der Kerl längst über alle Berge gewesen. Er hätte damit zwar seine Arbeit verloren, denn hier konnte er sich nicht wieder blicken lassen, aber meine oder vielmehr Simons Uhr hätte ich trotzdem nicht wiederbekommen.
Was konnte ich ihm also anhaben? Ich, ein aufgeregtes Mädchen aus Europa? Er würde sich über mich lustig machen. »Wo soll ich die Uhr haben? In der Tasche? Möchtest du mich durchsuchen?«
Ich konnte ihm unmöglich in die Hosentasche fassen. Nicht einem jungen kolumbianischen Mann, der in der anderen Hosentasche vielleicht ein Messer stecken hatte. Und dieser Gärtner strotzte nur so vor männlichem Selbstbewusstsein. Jeder seiner ruhigen und flüssigen Schritte forderte die Luft, den Wind, die Sonne heraus, ihn zu streicheln, ihm zu schmeicheln, ihn zur Krone der Schöpfung zu erheben.
Nein, er würde mich auslachen, ohne Zweifel. Und was stellte ich mich so an wegen einer Uhr, die für ihn vermutlich ein Vermögen wert war und für mich so gut wie gar nichts? Fast schämte ich mich jetzt schon. Aber durfte ich es ihm einfach so durchgehen lassen? Nur weil ich unermesslich reich war, verglichen mit einem Gärtnerjungen?
Und schließlich war die Uhr sehr wohl etwas wert. Wenn auch nur ideell. Sie war die Uhr von Simons totem Vater, das Pfand meiner Wiederkehr. »Damit du in einem Jahr wiederkommst«, hatte Simon zum Abschied gesagt. »Damit du dich nicht etwa verliebst und uns vergisst.«
Dazu muss ich allerdings sagen, dass Simon und ich nie miteinander gegangen waren – nicht, dass da Irrtümer aufkommen! Er war nämlich eigentlich in Vanessa verliebt. Aber sie nicht in ihn. So hatten wir beiden Überbleibsel aus Vanessas Anhang uns eines Abends bei einer Party verbündet, bei der Vanessa mich und ihn in einer Ecke hatte sitzen lassen. Wir hatten angefangen uns zu unterhalten, über alles Mögliche. Simon war ziemlich belesen, nicht so oberflächlich wie die anderen Jungs. Er wollte so wie ich Medizin studieren und dann Arzt werden und den Krebs besiegen. Wir hatten beschlossen, dass wir zusammen Medizin studieren würden, und zwar in Berlin. Im Grunde hatte ich da erst entschieden, das Gleiche zu studieren wie meine Eltern. Bis dahin hatte ich es immer abgelehnt, das zu sagen, wenn Onkel und Tanten und allerlei Freunde und Bekannte meiner Eltern mich danach fragten. Anscheinend gab es keine andere Frage als diese, um ein Gespräch mit einer Minderjährigen anzufangen. »Na, was willst du denn mal werden?«
»Gar nichts!«, hatte ich früher gesagt. »Ich bin schon was. Ich bin Jasmin Auweiler.« Das hatte tantenhaftes Gelächter ausgelöst. Ihr wisst alle, wie tantenhaftes Gelächter klingt? Laut, leicht entrüstet und ziemlich hochnäsig. Ich hasste das. Als ich anfing zu sagen, dass ich Ärztin werden würde, waren alle plötzlich ganz zufrieden.
Simons Uhr mit ihrem alten Lederarmband und der glatten Unterseite aus Stahl hatte sich die letzten Wochen sehr gut angefühlt an meinem Handgelenk. Und immer wieder hatte ich mich gefragt, warum er sie mir gegeben hatte. Warum war es Simon so wichtig, dass ich mich in Kolumbien nicht verliebte? Irgendwas musste ihm ja wohl an mir liegen. Vielleicht war mir da was entgangen. Andererseits, ein Jahr war lang, und er würde, wenn ich wiederkam, sicherlich eine Freundin haben. Vielleicht sogar endlich Vanessa. Dann war es ihm vermutlich egal, wer ihm das Erbstück seines Vaters zurückbrachte, Hauptsache, er bekam die Uhr überhaupt wieder.
Und nun hatte ich sie verbaselt, verloren, hatte sie mir von einem Seidenäffchen klauen lassen und besaß nicht den Mut, den Dieb zur Rede zu stellen.
Und ob ich den Mut besaß! Ich musste es ja nur nicht überstürzen. Der Indio würde noch ein paar Stunden da unten in der Anlage zubringen. Und wenn ich ihn heute nicht kriegte, dann irgendwann sonst. Es war bestimmt nicht das erste und letzte Mal, dass er sein Äffchen auf Beutezug durch die Zimmer schickte.
Große Dinge konnte so ein Äffchen nicht mitnehmen, aber die kleinen teuren: einen Ring, eine Kette, einen iPod, ein Handy. Wenn es den Besitzern auffiel, würde man die Haushaltshilfe beschuldigen. »Dienstpersonal klaut immer.« Diesen Satz kannte ich seit meiner ersten Grillparty bei den neuen Kollegen meines Vaters, er fiel auf jedem Kaffeeklatsch. Sie klauten Besteck, Nahrungsmittel, Geld. Man musste sie hin und wieder entlassen.
Aber beweisen musste man es ihnen schon.
Hätte ich nicht beobachtet, wie der Affe Simons Uhr klaute, sondern erst später bemerkt, dass sie nicht mehr auf meinem Nachttisch lag, dann hätte ich vermutlich unsere Estrellecita beschuldigt. Oder wenn nicht ich, dann hätte meine Mutter es getan. Sie regte sich immer gleich auf. Und dann bekam sie Kopfschmerzen.
Deshalb beschloss ich, meinen Eltern erst einmal nichts von dem zu sagen, was ich an diesem Morgen beobachtet hatte. Sie saßen schon beim Frühstück, als ich in den Salon kam. Sonntags kam Estrellecita nicht, deshalb gab es nur Kaffee und Brot.
»Heute ist es so weit«, sagte mein Vater vergnügt. »Wir wollen endlich unsere Fahrradtour auf der Ciclovía machen.«
Jeden Sonntag wurden in Bogotá 120 Kilometer Straßen in achtzehn der zwanzig Stadtteile für den Autoverkehr gesperrt und zu Fahrradwegen erklärt und dann schwärmten die Radler aus wie die Fliegen.
»Ich kann nicht mit«, stellte ich gleich klar. »Ich bin mit Elena zum Reiten verabredet.«
Mein Vater machte traurige Augen. »Ausgerechnet wenn ich mal am Sonntag freihabe. Wir sehen uns so selten.«
»Praktisch täglich«, sagte ich.
»Aber immer nur zwischen Tür und Angel.«
Seit meiner Kindheit ging das so. Als Arzt war Papa oft nicht zu Hause gewesen. So manchen Sonntag, den er freihatte, war ich dazu verdonnert worden, daheim zu bleiben, mit den Eltern auf dem Bodensee zu segeln, in den Schweizer Bergen zu wandern oder bei Regen Gesellschaftsspiele zu spielen. »Beschäftigungstherapie für Eltern«, hatte ich das immer genannt. Logisch, dass ich dabei nicht vor guter Laune gesprüht hatte. Was mir keinen Spaß machte, sollte ihnen auch keinen machen. Aber bislang hatten sie noch nicht eingesehen, dass sie nichts davon hatten.
»Willst du dir nicht auch mal mit uns zusammen ein bisschen was von der Stadt anschauen?«, fragte Mama mit diesem vorwurfsvollen Timbre in der Stimme, als dürfte ich nichts Schöneres kennen, als mit den Eltern loszuziehen.
»Ich komme mehr herum als ihr«, antwortete ich. »Und ich würde noch mehr sehen, wenn ihr mir nicht alles verbieten würdet.«
»Fang nicht wieder damit an!«, mahnte Mama. »Das haben wir doch ausdiskutiert.«
Der Punkt war der: Elena hatte mich eingeladen, Anfang der Sommerferien mit ihr und ihrem Vater für ein paar Tage ins Gebirge zu einer Smaragdmine zu fliegen. »Viel zu gefährlich«, hatte meine Mutter sofort befunden.
»Aber wir werden mit dem Hubschrauber fliegen«, erklärte ich noch einmal. Vielleicht sah mein Vater es ja weniger eng. »Was soll da passieren?«
Papa hob interessiert den Kopf.
»Ich habe mir das auf der Karte angesehen«, erklärte meine Mutter, mehr ihm als mir. »Genau dort in der Gegend ist diese deutsche Lehrerin Susanne Schuster entführt worden.«
Diese deutsche Lehrerin war neben klauenden Dienstboten das zweite Thema, das aufkam, sobald man sich in der ausländischen Gemeinde traf. Susanne Schuster war vor gut drei Jahren in den Anden verschleppt worden und bis heute Geisel der FARC. Derzeit gingen Gerüchte um, sie sei schwer krank und werde sterben, wenn sie nicht bald in ärztliche Behandlung komme. Aber Genaues wusste man nicht.
»Aber Mama«, hatte ich argumentiert, »ich kenne niemanden, der mehr Schiss hat als Elena. Und wenn die es für sicher hält, dann ist es sicher. Ihr Vater hat Bodyguards für die ganze Familie, wir wären keine Sekunde ohne Schutz.«
»Ich habe Nein gesagt, Jasmin!«, sagte Mama. Es klang, als würde sie gleich Migräne kriegen.
»Für einen Arzt sind die Smaragdminen ein wichtiges Thema«, überlegte mein Vater jetzt plötzlich laut. »Die Arbeitsbedingungen dort sind hart, in den Slums an der Mine leben Zehntausende von Schatzgräbern, die im Minenschlamm nach Steinen suchen. Da gibt es sicher viel zu tun.«
»Dann komm doch einfach mit!«, schlug ich vor. »Elena und ihr Vater haben sicher nichts dagegen. Ich frage sie gleich nachher, wenn wir uns zum Reiten treffen.«
»Ja, frag sie mal«, antwortete Papa.
Mama seufzte. Wieder mal hatte ich Papa auf meine Seite gezogen und gewonnen: Sie machten ihre Fahrradtour und ich musste nicht mit.
Doch kaum waren sie weg, rief Elena an und sagte unseren Ausritt ab, weil sie mit ihren Eltern Verwandte besuchen musste. Aber natürlich könne ich mir eines ihrer Pferde nehmen und alleine ausreiten. Dazu hatte ich jedoch keine Lust.
Ich surfte ein bisschen im Internet und schrieb eine E-Mail an Vanessa. In Deutschland war es jetzt bereits Nachmittag. Vanessa war auf einem Stadtfest, wie sie mir letztes Mal geschrieben hatte. Ich hatte schon halb erzählt, wie das Seidenäffchen Simons Uhr geklaut hatte, als mir einfiel, dass Vanessa nichts von Simons Pfand meiner Wiederkehr wusste, denn das war eine Sache nur zwischen ihm und mir, und dass womöglich Simon meine E-Mail an sie lesen würde. Es war nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich. Also löschte ich alles wieder. Statt E-Mails zu schreiben, sollte ich überhaupt besser versuchen, die Uhr zurückzubekommen.
Jetzt wünschte ich mir, ich hätte es doch meinen Eltern erzählt oder Elena, auch wenn ihre Ratschläge mir meistens nicht wirklich weiterhalfen.
Vielleicht hätte mein Vater den Gärtner zur Rede gestellt, auch wenn sein Spanisch noch etwas unbeholfen war. Andererseits war so ein Konflikt für Männer gefährlicher, denn die Messer saßen hier locker und Auseinandersetzungen verliefen schnell blutig. Wenn meinem Vater etwas passiert wäre, wäre ich mit schuld daran gewesen, und das hätte ich nicht ausgehalten. Meine Mutter hätte wahrscheinlich vorgeschlagen, dass wir zur Polizei gehen. Und dann hätten wir den Sonntagvormittag auf der Polizeistation verbracht. Vielleicht hätten sie uns gefragt, ob wir mit dem Gärtner gesprochen und unser Eigentum zurückgefordert hätten. Es wäre total peinlich gewesen: Ausländer, die sich reinlegen lassen, mein Vater, der nicht Manns genug ist, sich einen Gärtner zur Brust zu nehmen, und ich, ein deutsches Mädchen, das so bescheuert ist, die Tür zu öffnen, wenn ein Affe auf dem Balkon herumturnt, weil es glaubt, das Tierchen habe Hunger. Nein, das wäre wirklich zu peinlich gewesen.
Aber irgendwie musste ich Simons Pfand meiner Wiederkehr zurückbekommen. Ich war es ihm schuldig, dass ich etwas unternahm. Ich musste ihm wenigstens etwas erzählen können: »Du, ich habe alles Mögliche versucht! Alles! Aber der Gärtner hat geleugnet, das Äffchen war über alle Berge und die Polizei hat dann auch nur mit den Schultern gezuckt.«
Nichts von dem hatte ich bisher in Angriff genommen.
Also stand ich auf und ging noch mal auf den Balkon meines Zimmers, um hinunterzuschauen. Der Indio war in dem Teil der Anlage, den ich überblicken konnte, nicht mehr zu sehen. Na gut, dann eben nicht.
Nur, was fing ich jetzt mit dem Sonntag an? Meine Eltern würden nicht vor dem Nachmittag zurückkommen. Der Himmel war ausnahmsweise mal blau. Spazieren gehen?
Sonntage waren nicht meine Tage. Echt nicht. Meine Eltern hatten nie Lust, Leute zu treffen. Sie trafen schon die Woche über so viele, da wollten sie den Sonntag für sich und mit mir alle Gespräche führen, die sie die Woche über nicht führten. Die Grillnachmittage, die in unserer Siedlung El Rubí am Wochenende stattfanden, hatten sie bereits für langweilig befunden. Und auf den Diplomatenball am kommenden Samstag hatten sie natürlich auch keine Lust. Glücklicherweise fand Papa ihn aber aus beruflichen Gründen interessant. Er wollte wichtige Leute kennenlernen und ihnen seine Ideen für eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung erläutern. Also gab es eine realistische Chance, dass wir hingehen würden. Elena redete seit Tagen von nichts anderem als dem Ball.
Aber das löste jetzt mein Problem nicht. Ich präparierte mich für einen Spaziergang: iPod, Regenjacke, Handy, Plastikschuhe. Mit den Kopfhörern im Ohr verließ ich die Wohnung. Das Treppenhaus war kalt, vor der Tür knallte die Sonne.
Mit Juanes – alias Juan Esteban Aristizábal Vázquez aus Medellín – auf den Ohren ging ich den Weg zum Siedlungstor entlang. »A Dios le pido«, sang Juanes, »Ich bitte Gott ... que mi pueblo no derrame tanta sangre, y se levante mi gente ... dass in meinem Volk nicht so viel Blut vergossen wird und dass meine Leute sich erheben ...« Dabei war es eigentlich ein Liebeslied. Aber in Kolumbien lagen Liebe und rote Revolution immer nahe beieinander.
Ich weiß nicht, was mich bewog, mich umzudrehen, vielleicht eine Ahnung, denn gehört haben konnte ich ihn nicht.
Der Gärtner kam mit großen Schritten über die Wiese heran. Mein Herz begann zu pochen. Er kam direkt auf mich zu, mit einer großen Gartenschere in der Hand, einer mit langen Teleskopgriffen, mit der man Zweige weit oben abschneiden konnte. In seiner Hand schien das Gerät nichts zu wiegen. Die Sonne stand hinter ihm, sein Gesicht lag im Schatten. Ich sah die hohen Wangenknochen, die schmalen pechschwarzen Augen, die scharf gezeichneten vollen Lippen, zusammengepresst und gezeichnet von der Härte des Lebens, die das Schicksal den Familien und Kindern der Indios, Mestizen und den Abkömmlingen der Sklaven oft schon früh bescherte. Es war ein ernstes, gleichmäßiges Gesicht, jung und dennoch reif und erwachsen. Vermutlich war er kaum älter als ich, doch für ihn hatte der Ernst des Lebens längst begonnen. Womöglich schlug er sich seit seinem dreizehnten Lebensjahr mit Jobs durch, ernährte seine Familie, Schwestern mit Kindern, seine Mutter, einen Vater, der Alkoholiker war. Wahrscheinlich war es ein enormer Glücksfall, dass ihn die Verwaltungsgesellschaft der Siedlung El Rubí angestellt hatte, damit er die Grünanlagen in Ordnung hielt. So was war wie ein Sechser im Lotto.
Wenn ich ihn des Diebstahls bezichtigte, verlor er nicht nur seinen Job, sondern die Chance seines Lebens. Und sicher würde er sich verteidigen, mit allen Mitteln. Für ihn ging es um alles, für mich nur um eine alte Uhr von geringem materiellen Wert. Wenn ich es Simon erklärte, würde er es wahrscheinlich verstehen. Aber andererseits: Konnte man es dem Indio einfach so durchgehen lassen? Ich meine, wenn er schon hier bei uns die Chance seines Lebens bekommen hatte, warum musste er dann seinen Affen auf Diebestour schicken?
Das alles ging mir blitzschnell durch den Kopf, als er ohne sichtbare Anstrengung, leicht und kraftvoll ein Mäuerchen übersprang, das den Rasen von einem Blumenbeet trennte.
Die Art, wie er sich bewegte, faszinierte mich wider Willen. Sie hatte mich schon früher fasziniert, wenn ich ihn von meinem Balkon aus in der Ferne auf dem Rasen werkeln gesehen hatte. Und es war schwer zu beschreiben, wie ich dabei auf den Gedanken kam: Armut macht glücklich. Die Nähe zur Natur, das In-der-Natur-Sein, Selbst-Natur-Sein, das er verkörperte, lebendig, kraftvoll wie der schwarze Jaguar, der in den Urwäldern jagte. Es war albern. Aber daran musste ich auch jetzt wieder denken: Wie ein Jaguar, der den Wald beherrschte. Und wenn er satt war, dann tötete er nicht.
Mit leisem Schritt eroberte er den Weg.
Unwillkürlich trat ich zurück, obwohl mir hier in der Anlage nichts passieren konnte. Absolut gar nichts. Hoffentlich! Doch was wollte er von mir mit dieser schweren Gartenschere in der Hand?
Er steckte die andere Hand in die Tasche seiner weiten Hose, zog sie wieder heraus und streckte sie mir hin. Auf seiner nicht wirklich sauberen Handfläche lag Simons Uhr.
»This is yours!«, sagte er.
Im nächsten Moment hatte ich die Uhr in meiner Hand und er hatte sich umgedreht und ging mit langen Schritten davon. Erst im zweiten Moment fiel mir auf, dass er mich auf Englisch angesprochen hatte, nicht auf Spanisch. Und dann dachte ich: »He, warte mal!« Aber falls ich es sagte, dann nur ganz leise, und da war er auch schon in einem Durchgang zwischen den Häuserblocks verschwunden.
Ich hätte ihm hinterherlaufen müssen. Aber mir klopfte das Herz im Hals. Die Luft war einfach zu dünn hier, ich geriet immer noch schnell außer Atem. Und was hätte ich, wenn ich ihm hinterhergelaufen wäre und ihn eingeholt hätte, sagen sollen? Ich hatte meine Uhr ja wieder. Er hatte sie mir nicht gestohlen. Er hatte sie dem Äffchen abgenommen. Er hatte sich gemerkt, von welchem Balkon es heruntergesprungen war. Womöglich hatte er mich an anderen Sonntagen bereits dort oben gesehen. Warum auch nicht? Kein Grund, mich aufzuregen. Es war das Normalste von der Welt. Er hatte mich nicht beobachtet, er hatte mich nur gesehen. So wie ich ihn. Man sah sich eben, man kannte sich mit der Zeit in so einer Siedlung. Die Witwe aus der Schweiz sprach sogar hin und wieder mit ihm und anderen Angestellten. Sie war eine Dame mit vom Bräunen gegerbter Haut, Brille, rotem Lippenstift und vielen Goldketten um den Hals, eine von denen, die sich für knackige junge Männer interessierten, wie Papa einmal spöttisch bemerkt hatte.
Ich würde bestimmt keinem kolumbianischen Gärtner hinterherlaufen. Das war schon mal klar. So was hatte ich nicht nötig. Auch wenn er total gut aussah, sich bewegte wie ein schwarzer Jaguar und sein Englisch besser geklungen hatte als das, was die Bettler auf der Straße einem an kaum verständlichen Worten hinterherriefen.
Ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf die Straße hinauskam. Da fehlt mir ein Stück in der Erinnerung. Ich erlangte gewissermaßen das Bewusstsein erst wieder, als ich auf dem Gehweg stand, mit dem Fuß auf den Boden stampfte und vor mich hin sagte: »So was Albernes! Bist du bescheuert oder was?«
Ich hatte mich benommen wie eine Zwölfjährige, total kopflos: Ich hatte nicht gewusst, was ich sagen sollte, ich hatte einfach die Uhr eingesteckt und die Anlage verlassen, so als ob nichts geschehen wäre. Ich hatte nicht mal Danke gesagt. Das wäre doch das Mindeste gewesen. Irgendeine Äußerung, wie man sie unter vernünftigen, sprachbegabten Wesen tat: »Vielen Dank! Ich bin ja so froh, dass du dem Affen die Uhr abgenommen hast. Sie bedeutet mir viel. Sie ist ein Geschenk von meinem Freund!«
Damit hätte ich auch gleich klargestellt, dass zwischen dem Burschen und mir nichts laufen konnte, absolut gar nichts.
»Mann, bist du bescheuert!« Ich ertappte mich dabei, wie ich schon wieder mit dem Fuß auf die Gehwegplatten stampfte. Was für Überlegungen stellte ich denn da an? Das war doch gar nicht die Frage, ob zwischen dem Indio und mir was lief oder jemals laufen würde. Ich wusste nicht einmal, wie er hieß. Wir hatten keine drei Worte gewechselt – ich überhaupt keins und er drei, um genau zu sein –, und ich dachte schon daran klarzustellen, dass ich einen Freund hatte ...
Dabei hatte ich keinen Freund. Es wäre eine Lüge gewesen. Na ja, so halb, denn Freund konnte man ja immer sagen, und wenn ein anderer dachte, ich meinte einen festen Freund, dann musste ich das nicht so gemeint haben. Auf jeden Fall war all das, was ich da gerade dachte, sowieso total daneben.
Ich versuchte ruhig auszuatmen. Wieso nur hatte ich mich so aufgeregt? Wieso hatte ich eigentlich solche Angst gehabt? Elena hatte mich schon ganz blöd im Kopf gemacht mit ihren Schauergeschichten von Räubern, Entführern und Mördern. Ich hatte gleich sonst was gedacht. An Diebesbanden, an Messer in der Tasche, an Blut und Tod. Himmel! Dabei war alles ganz harmlos gewesen. Er hatte einfach nur gesehen, dass ein Äffchen etwas aus einem Zimmer geholt hatte. Vielleicht kannte er das Äffchen sogar. Es musste ja irgendwohin gehören mit seinem Halsband. Vielleicht wusste er sogar, dass es immer mal wieder etwas mitnahm, und hatte es deshalb angelockt und ihm die Uhr abgenommen. Dabei hatte er sich gemerkt, wo sie hingehörte.
Hätte er nicht klingeln können?, fragte ich mich. Aber dann hätte er wissen müssen, welches Klingelschild an dem zehnstöckigen Häuserblock zu dem Balkon im zweiten Stock gehörte, auf dem er mich schon gesehen hatte. Oder er hätte meinen Namen wissen müssen. Und dazu hätte er sich mehr für die Bewohner der Anlage interessieren müssen, als es einem Gärtner vermutlich zustand.
Also hatte er keine andere Wahl gehabt, als zu warten, bis ich erschien, und mir die Uhr dann zu geben. Und offenbar hatte er keine Lust gehabt, näher mit mir in Kontakt zu treten. Oder es war ihm verboten, die Töchter der Siedlungsbewohner anzusprechen. Vermutlich sogar. Wir Weißen könnten uns belästigt fühlen. Wahrscheinlich war das wirklich so.
Etwas ruhiger setzte ich meinen Weg fort. Schlüssige Erklärungen waren immer beruhigend, stellte ich fest. Der Tag war schön. Ich hatte meine Uhr wieder. Ich musste Simon nicht enttäuschen. Alles war gut. Die Straße dampfte. Der Himmel war ungewöhnlich blau, fast fleckenlos zwischen den Hochhäusern. Kirchenglocken läuteten. Ich war froh, dass meine Eltern von dem Drama meines Sonntagmorgens nichts mitbekommen hatten. Zum Glück hatte ich ihnen nichts erzählt und zum Glück hatte ich auch Elena am Telefon nichts gesagt. Sie hätte mich spätestens morgen in der Schule gelöchert. Ich hätte ihr alles haarklein erzählen müssen, auch von seinen drei englischen Worten und meiner kompletten Sprachlosigkeit.
Ich schaute mich um. Ich war bis zur Hacienda Santa Bárbara, einem Einkaufszentrum im Kolonialstil, gekommen. Ziemlich weit schon. Mir war heiß, ich zog die Jacke aus. Die Sonne schien. In Bogotá herrschte Dauerfrühling von der schwülen Sorte. In der Sonne war es sofort warm, aber wenn sie hinter düsteren Wolken verschwand, dann pfiff einem der Wind durch die Knochen.
Bogotá war eine total krasse Stadt. Sonne und Regen lagen eng beieinander, Armut und Reichtum, Frieden und Verbrechen. Ich fühlte es immer wieder körperlich. Seit sechs Wochen lebte ich jetzt hier mit einem Knoten hinterm Brustbein. Nie durfte man sich entspannen, nie unaufmerksam, nie sorglos sein. Wenn ein Auto am Straßenrand hielt – das hatte Elena mir beigebracht –, schaute man, wer ausstieg, und machte einen Bogen. Noch besser, man betrat sofort einen Laden oder ein Restaurant. Sonst wurde man plötzlich ins Auto gezerrt und entführt. Bogotá sei vergleichsweise sicher, sagten die Leute, und im nächsten Atemzug erzählten sie von einer Freundin, die vor ihrer Haustür überfallen worden sei. Es gab reichlich Parks mit Teichen und Grillplätzen, doch immer standen dort auch Leute mit Plastiktüten und hatten irgendwas auf dem Pflaster zum Verkauf ausgelegt. Männer guckten mir hinterher, und ich durfte nicht zurückgucken, sonst fühlten sie sich gleich animiert, mich anzusprechen.
Nicht viel anders verhielten sich die Rucksacktouristen aus Amerika und Europa. Sie fragten nach dem Weg und bettelten im selben Atemzug um Geld oder um einen Schlafplatz. Sie schienen zu meinen, dass sie Anspruch auf Gastfreundschaft und kostenlose warme Mahlzeiten hätten, nur weil sie einen Rucksack auf dem Rücken trugen.
Was zum Teufel machte ich hier nur? Seit sechs Wochen trugen wir jetzt Regenjacken, und von der Armut und dem Elend, die mein Vater bekämpfen wollte, hatten wir nicht wirklich etwas gesehen. Mein Vater operierte in einem privaten Krankenhaus Leute mit ordentlicher Krankenversicherung und meine Mutter testete im Labor Blutwerte. Was war daran anders als zu Hause? Hätten wir nicht wenigstens nach Cartagena gehen können? Das lag an der Karibikküste und ich hätte jeden Tag im Meer baden oder tauchen lernen können.
Vermutlich grollte ich so vor mich hin, weil ich eigentlich mit mir selbst nicht zufrieden war. Wahrscheinlich sogar. Dabei gefiel es mir doch immerhin in der Schule. Ich war Klassenbeste und niemand fand das schlimm. Der Abstand von Vanessa tat mir auch gut. Das merkte ich erst jetzt. Sie hatte bestimmt, was wir machten und auf welche Partys wir gingen. Meine Vorschläge waren nie was wert gewesen. Ich war mir immer dumm und hässlich vorgekommen. Und es war mir nie egal gewesen, was sie von mir dachte. Eigentlich war es total der Stress gewesen. Das war am Colegio Bogotano ganz anders. Elena hörte zu, wenn ich was sagte. Niemand lehnte meine Vorschläge gleich ab, niemand lächelte verächtlich, wenn ich eine Meinung äußerte. Zum ersten Mal war ich ein angesehenes Mitglied einer Clique.
Ein kalter Hauch streifte plötzlich meine nackten Arme. Ich schreckte aus meinen Grübeleien und guckte hoch zum Himmel. Er war immer noch sonnig und blau. Die Kälte kam aus dem Wald auf der anderen Straßenseite. Es war ein dichter grüner Wald an einem steilen Berghang. In dieser Stadt war die Grenze zwischen Stadt und Urwald scharf und undurchlässig.
Auch der Fußweg hatte sich verändert. Er war brüchig und schmal geworden. Die Bordsteine waren gekippt, in den Asphalt versunken oder sie fehlten ganz. Die Häuser auf der anderen Straßenseite waren niedrig geworden, rot und gelb gestrichen mit Satellitenschüsseln auf den Balkonen.
In dieser Gegend war ich noch nie gewesen. Doch in Bogotá konnte man sich eigentlich nicht verlaufen. Alle Straßen waren nummeriert. Diejenigen, die von Nord nach Süd verliefen, hießen Carrera, und alle, die von Westen nach Osten gingen, hießen Calle. Ich war aus meinem Viertel San Patricio weit nach Osten geraten und befand mich nun in der Calle 110.
Aus dem Wald sickerte feuchte Kälte. Grüne Frösche hüpften vom Fußweg. Diese Frösche fanden sich auch gern bei uns in der Dusche ein und klebten an der Wand. Mama hatte ziemlich gekreischt am ersten Morgen. Aber inzwischen hatte auch sie sich daran gewöhnt, dass in Kolumbien Sauberkeit und Ungezieferstatus einer Wohnung mit anderen Maßstäben zu messen waren. Die Frösche hüpften auch nicht herum, sie guckten nur, wenn man sich duschte, und sie fingen die Fliegen, Motten und sonstiges Insektenzeugs weg, von dem ich lieber nicht wissen wollte, wie es hieß.
Ich dachte daran, umzukehren, da fiel mir im Grün des Waldrands ein blau gestrichenes Törchen zwischen zwei weißen Pfosten auf. Auf die Pfosten waren mit roter Farbe Gesichter einer alten indianischen Kultur gemalt. Sie hatten die Formen von Dreiecken oder Kreisen. Oben auf den Pfosten saßen in Stein geschlagene würfelförmige Köpfe. Der eine davon grinste, der andere heulte und zeigte Eckzähne.
Und siehe da: Auf dem Grinsekopf turnte zirpend ein Seidenäffchen mit rotem Halsband herum. Es blickte mich mit verschreckten nussbraunen Augen an, stieß plötzlich einen spitzen Schrei aus, wobei ich seine nadelscharfen Eckzähnchen sehen konnte, und sprang in den nächsten Baum davon.
Ich ging ans Tor und spähte in den Garten, konnte aber das Äffchen nicht mehr sehen. Ein schmaler, von Pfützen durchwebter Pfad führte bergan ins dunkle Grün. An den matschigsten Stellen lagen Holzbohlen. Am Ende einer Biegung ahnte ich ein kleines Haus, eine Hütte eher.
Als ob der Affe oben Bescheid gesagt hätte, dass unten jemand war, kam jetzt ein kleiner Hund den Weg herabgekläfft. Er hatte wilde, lange braune Haare. Im Grunde sah er aus wie ein Seidenäffchen auf vier Pfoten. Er verschluckte sich fast vor Zorn. Oben am Ende des Wegs erschien außerdem eine alte Frau in bunten Kleidern, wie ich sie aus meinem Spanischunterricht in Deutschland von Fotos aus südamerikanischen Städten kannte: eine krasse Mischung aus Rot, Gelb, Violett und Blau. Es waren Farben, die sogar im Schatten leuchteten.
Die Alte rief etwas, das ich nicht verstand, was aber den Hund zum Schweigen brachte, und kam den Weg herab. Sie ging ein wenig hüftlahm und schief auf ausgelatschten Plastikschlappen. Routiniert setzte sie die Füße auf die Steine und die Bohlen zwischen den Pfützen. Es wirkte leichtfüßig, obwohl sie dick und rund war und, wie gesagt, links immer ein wenig einknickte.
Ihr Gesicht war rund, faltig und bronzefarben. Darin blitzten schwarze Augen aus schmalen Schlitzen. Ihr zu Zöpfen geflochtenes, schweres schwarzes Haar hatte silberne Strähnen. Sie war eine ungewöhnlich folkloristische Erscheinung in dieser so europäischen Stadt, wie aus Urzeiten hierhergezaubert. Vielleicht blieb ich deshalb wie gebannt stehen, statt einfach weiterzugehen. Die Alte hob die Hand und rief erneut etwas. Es klang wie: »Hola, Jasmin!«
Meinte sie mich? Das konnte nicht sein.
Sie lächelte breit und winkte. Zwischen ihren scharf gezeichneten Lippen blitzten zwei Goldzähne. Ich wollte mich nun doch abwenden, da rief sie noch einmal, und diesmal war kein Irrtum möglich.
»Hallo, Jasmin!«
Ich blieb stehen, wie gebannt, wie hypnotisiert, wie verzaubert. Vielleicht war sie eine Hexe. Ich wollte innerlich lachen: Das war total bescheuert. Es gab keine Hexen. Wirklich nicht? In Südamerika mit seinen alten Göttern, Medizinmännern und heilenden Frauen war alles anders. Wir hatten in der Schule García Márquez gelesen, Hundert Jahre Einsamkeit. Eine Geschichte von Ameisen, die die Macht übernahmen, Vorahnungen und Magie. Ich hatte das nicht so ernst genommen. Das war dichterische Freiheit. Kolumbianische Schriftsteller glaubten an Zauberei, aber ich nicht. Ich war Jasmin Auweiler aus Konstanz, sechzehn Jahre, und glaubte nicht an Zeichen, Vorahnungen und Flüche.
Doch plötzlich war ich mir da nicht mehr so sicher. Wieso war ich hierhergegangen, wie war ich in diese Gegend gekommen? Was für ein seltsamer Zufall, dass ich hier das Äffchen wiedersah, das mir vor drei Stunden mindestens drei Kilometer weg von hier eine Uhr gestohlen hatte, die ich von einem indianischen Gärtner zurückbekommen hatte ... Oder hatte ich mir das Äffchen nur eingebildet? Und wieso wusste die Alte meinen Namen?
Ich stand da, als wären meine Schuhe festgeklebt, und schaute der Alten entgegen, die mit sicherem, aber schiefem Schritt über die Pfützen hüpfte, dass ihre Röcke schaukelten; als ob sie mich verzaubert hätte. Und wenn sie mir mit dem Daumennagel ein Kreuz auf die Stirn geritzt hätte, ich hätte es geschehen lassen wie ein Opferlamm.
Etwas außer Atem langte die Alte am Tor an. In ihren schwarzen Augen funkelten unheimliche Geschichten von Opfern und Heldentaten, von Liebe und Tod, die Mythen alter Kulturen aus den Zeiten vor der blutigen Eroberung durch die Spanier. Sie lächelte und wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. So alt, wie ich erst gedacht hatte, war sie wohl doch nicht. Jedenfalls nicht hundert Jahre oder so, sondern vielleicht siebzig oder vielleicht auch nur fünfzig? Hierzulande wurde eine Frau schnell Großmutter, denn viele Mädchen brachten mit vierzehn ihr erstes Kind auf die Welt.
Sie zog von innen den Riegel der blauen Gartentür zurück und sagte: »Pasa, Jasmin! Komm rein.«
»Sie kennen mich?«, fragte ich ziemlich blöde. »Woher denn? Ich kenne Sie nicht. Wir sind uns nirgendwo begegnet. Sie können mich nicht kennen!«
Sie lachte meckernd. »Die blauäugige Jungfrau von El Rubí, wie sollte ich dich nicht kennen?«
Ich erschrak. Sie hatte »virgen« gesagt, Jungfrau. Wie kam sie dazu? Sah man mir das etwa an? Und woran sah man das? Es war total peinlich! Es war das Schlimmste, was mir an diesem Scheißsonntagmorgen noch hatte passieren können. Nicht einmal meiner Tante Valentina hatte ich gestanden, dass ich noch nie was mit einem Jungen gehabt hatte. Auch wenn sie wahrscheinlich ahnte, dass sich hinter meinen Besuchen bei Simon nicht unbedingt das verbarg, von dem ich gerne wollte, dass sie es glaubte. Und die anderen Jungs auch.
Wenn mich die Erwachsenen fragten, ob ich denn »schon einen Freund hätte«, dann pflegte ich zu antworten: »Momentan nicht.« Dann dachten sie, ich hätte mich getrennt oder so. Allein ihr »schon« war eine Unverschämtheit. Ich fragte die Freunde und Bekannten meiner Eltern, etwa die Frau vom Professor, doch auch nicht, ob sie schon mal geschieden worden seien oder einen Geliebten hätten. Aber mich fragten sie, ob ich »schon einen Freund« hätte. Und was ich denn mal werden wollte und so weiter.
Und jetzt die Alte. Jungfrau! Ja gut, ich war sechzehn und noch Jungfrau, aber wen ging das was an? Stolz war ich bestimmt nicht darauf. Ich hatte nicht vor, meine Jungfräulichkeit mit in irgendeine Ehe zu bringen. Im Gegenteil. Dem Jungen, mit dem ich eines Tages zum ersten Mal schlafen würde, dem würde ich gar nicht sagen, dass ich noch nie vorher mit einem anderen was gehabt hatte. Er sollte sich nichts darauf einbilden, dass er der Erste war. Ich würde einfach sagen, dass ich gerade meine Tage bekommen hätte.
»Woher kennen Sie mich?«, fragte ich noch einmal und reichlich verärgert.
Die Alte lächelte mit blitzenden Goldzähnen. »Ich bin Mama Lula Juanita. K’lum und Cuene erzählen mir alles.«
»Wer?«
»Der Kobold und der Gott des Blitzes.«
»An so was glaube ich nicht! Lassen Sie mich in Ruhe, ja? Und wenn ich den diebischen Affen noch einmal bei mir sehe, dann gehe ich zur Polizei! Jetzt weiß ich ja, wo er hingehört.«
Die Alte wurde schlagartig ernst.
Jetzt wird sie mich gleich verfluchen, dachte ich. Das musste ich mir nicht anhören. Ich drehte mich einfach um und rannte los. Ein Donnerschlag dröhnte über der Stadt. Irgendwo ging gerade ein Gewitterregen nieder. Bogotá war so riesig, dass immer irgendwo anderes Wetter herrschte als dort, wo man selbst gerade war.
Ich lief direkt nach Hause und verbrachte den Rest des Tages mit Musikhören und meinen Schulbüchern, in denen ich kaum las. Am Nachmittag kamen meine Eltern wieder. Papa war fröhlich, Mama hatte Migräne und legte sich ins Bett. Ich erzählte ihnen nichts von dem, was ich erlebt hatte.
– 4 –
Was hat die Alte gesagt?«, fragte Elena, als ich in der Mittagspause Zeit fand, ihr ausführlich von meinen Sonntagsabenteuern zu erzählen.
»Es klang wie Lula und Klumm. Und dann sagte sie was von Cuene, das soll ein Gott des Blitzes sein. Und dann hat es auch noch gedonnert.«
Elena blinzelte nachdenklich. »Irgendeine Indianersprache. Ich kenne mich da nicht aus. Auch wenn mein Papa seit Neuestem stolz verkündet, er sei selber ein halber Indianer. Das sagt er nur, weil er es zu was gebracht hat. Inzwischen ist das ein großes Thema hier, die Indianersprachen und die Kultur und all das. Und die Indígenas streiten untereinander darüber, ob man die Indianersprachen überhaupt aufschreiben darf. Wenn die Kinder die Sprache der Großväter lesen und schreiben könnten, dann könnte das die Autorität der Alten und Schamanen untergraben. Stell dir das vor!«
Das half mir nicht wirklich weiter.
Wir standen an der Essensausgabe in der Mensa. Elena entschied sich für Sauerbraten mit Kartoffelpüree. Sie liebte deutsches Essen, nur beim Nachtisch war sie konservativ und wählte Churros, ein knallsüßes spanisches Spritzgebäck, das in Fett ausgebacken wird. Ich suchte mir im Gegenzug das einheimische Gericht aus, Pollo a la Cazadora, Jägerinnenhuhn mit Reis.
»Aber das mit dem Affen, das musst du anzeigen!«, sagte Elena, als wir uns mit unseren Tabletts einen freien Tisch suchten. »Wenn der in eurer Anlage klaut, dann bist du es deinen Nachbarn schuldig, finde ich. Vielleicht vermissen sie auch schon Schmuckstücke. Und eine Haushaltshilfe hat es abbekommen.«
»Und wenn das Ganze keine Absicht war?«, gab ich zu bedenken. Ich musste schreien, so laut war es hier. »Er hat mir doch die Uhr sofort zurückgegeben, kaum dass er mich gesehen hat.«
Elena zog die Stirn kraus. »Das gefällt mir gar nicht, Jasmin. Du bist zu vertrauensselig. Was, wenn er dich einfach nur auf den Balkon hat treten sehen, als der Affe ihm die Beute brachte? Da hat er gewusst, dass du ihn gesehen hast. Er war entlarvt. Also hat er gedacht, er gibt dir die Uhr besser gleich zurück. Dann kannst du ihn nicht wegen Diebstahls anzeigen.«
»Aber er hat gar nicht viel zu mir gesagt.«
Elena blickte mich fragend an. »Was hätte er denn sagen sollen?«
»Er hätte irgendwas erklären können. Dass er das Äffchen gesehen hätte, dass es nicht seines wäre. Dass er auch nicht wüsste, wo es hingehört, dass es aber wohl was mitgenommen hätte aus meiner Wohnung und dass er selbst es ihm weggenommen hätte und mir jetzt zurückgeben wollte. So die Art. Wer einen Diebstahl vertuschen will, der gibt Erklärungen ab. Der versucht alles, damit man nicht denkt, es sei ein geplanter Diebstahl gewesen. Der muss reden, verstehst du, Elena?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wenn du meinst.«
Ein paar aus unserer Klasse kamen und setzten sich zu uns an den Tisch. Wir redeten über den Diplomatenball am kommenden Samstag. Er versprach eine altmodische britische Veranstaltung zu werden, mit Smoking, langem Kleid und »Etikette«. Wie üblich hatte sich Präsident Uribe angesagt. Aber wahrscheinlich würde mein Vater im letzten Moment einen Dienst im Krankenhaus vortäuschen, nur um nicht hinzumüssen. Deshalb brauchte ich mir über mein Kleid nicht wirklich Gedanken zu machen.
Ich beschloss, nach dem Sportunterricht in die Bibliothek zu gehen, um herauszufinden, was Mama Lula hieß und wer Cuene war. Dort gab es massenhaft Bücher über die Kulturen der alten indigenen Stämme. Vielleicht erkannte ich sogar die Fratzen wieder, die auf die Torpfosten gemalt worden waren, und fand heraus, zu welchem Stamm die geheimnisvolle Alte vom Waldhaus gehörte.
Montags stand Schwimmen auf dem Stundenplan. Das lag mir. Ich war größer als die meisten und etwas kräftiger, was beim Schwimmen gut war, und darum sogar schneller als die älteren Mädchen. Im Colegio wurde ziemlich viel Sport getrieben. Ich hatte mich für Schwimmen eingetragen und für Feldhockey.
Gegen vier Uhr steckte ich wieder in meiner blauen Uniform – es wurde streng darauf geachtet, dass man sie nach dem Sport wieder anzog – und machte mich auf den Weg zur Bibliothek. Wieder einmal genoss ich es, dass die Schule so groß war, dass ich nicht alle nasenlang »Hallo« sagen musste. Nicht, dass ich was gegen das Hallo-Sagen hatte, das nicht, aber ich hatte zuletzt in meiner Schule in Konstanz zu viele schnippische Gegengrüße bekommen, und manche hatten mich gar nicht gegrüßt. Ich weiß nicht, was ich denen getan hatte, dass sie mich schnitten. Das weiß man meistens nicht, hatte mir Papa erklärt. Offenbar war es bei ihm im Krankenhaus auch so. Zu viel Neid und Missgunst. »Wenn einer was besser kann als andere«, hatte Papa gemeint, »dann wird er zur Zielscheibe von Hetze und Intrigen, und dann kann er machen, was er will, er allein kann das Klima nicht verbessern.«
Der Lesesaal war ziemlich leer. Die meisten saßen in den Computerräumen.
Ich überlegte, statt in Büchern doch auch erst mal im Internet nachzugucken. An den Computern waren leider alle Plätze belegt. Aber einer erhob sich gerade und drehte sich um.
Ich erschrak bis in die Kniekehlen. Es war der Gärtner. Er steckte im Anzug der Angestellten des Colegio Bogotano. Sein Blick streifte mich nur kurz, aber ich war mir sicher, dass auch er mich wiedererkannt hatte. Ich wollte etwas sagen, aber mir fiel buchstäblich nichts ein, vielleicht auch, weil ich mich nicht entscheiden konnte, in welcher Sprache ich ihn ansprechen sollte: Deutsch, Spanisch oder Englisch. Ehe ich auch nur den Mund aufbekam, war er an mir vorbei hinausgegangen. Rasch und leise, fast fluchtartig.
Mein Herz klopfte völlig unangemessen heftig. Mit zittrigen Knien setzte ich mich an den Computerplatz, den er eben verlassen hatte, und mit fahrigen Händen klickte ich mich rein. Was hatte er hier gemacht? Die Bibliothek stand zwar den Angestellten offen, aber es waren meist die von der Verwaltung, die man hier traf, nicht die Gärtner oder Reinigungskräfte. Andererseits, wer sagte, dass er auch hier der Gärtner war? Wer war er überhaupt?
Ich wandte mich an das Mädchen, das neben mir saß und in einem Musikportal surfte, und fragte: »Weißt du, wer das gerade eben war?«
»Wer?«
»Der hier saß?«
»Ach, das war Damián von der Hausmeisterei.«
»Ah.«
»Er ist ein ehemaliger Schüler, glaube ich.«
Ein ehemaliger Schüler! Ich staunte. Wenn er in der Hausmeisterei einen bestimmt ordentlich bezahlten Job hatte, wieso arbeitete er dann noch als Gärtner bei uns in der Anlage? Hatte er eine so große Familie zu ernähren? Andererseits, wenn seine Eltern sich diese Schule hatten leisten können, dann gehörten sie zur Oberschicht. Dann konnte er nicht ihr Alleinernährer sein. Und er konnte auch nicht aus den Slums der Südstadt stammen.
Ich versuchte krampfhaft, mich an das zu erinnern, was ich heute Nachmittag hatte nachgucken wollen, aber mir fiel von den Worten, die die Alte am Waldhaus zu mir gesagt hatte, nur »Klumm« ein. Die Alte hatte das Wort irgendwie kompliziert ausgesprochen. »Klumm« würde mich sicher nicht zu geheimnisvollen indianischen Kobolden und Göttern führen. Eine Weile saß ich stier vor dem Bildschirm, dann gestand ich mir ein, dass ich immer noch mit dem Gärtner beschäftigt war, mit Damián.
Damián! Ein seltsamer Name für einen Lateinamerikaner! So katholisch wie Kolumbien war, wurden Kinder zwar nach Heiligen benannt. Aber Damian, so nannte man bei uns den Schutzpatron der Ärzte. War Damiáns Vater womöglich auch Arzt, so wie meiner? Doch dann stellte sich einmal mehr die Frage, warum er als Gärtner und Hausmeister arbeitete, statt zu studieren, und zwar Medizin.
Ich rief die Colegio-Seite auf, die nur für Interne zugänglich war, und schaute in der Liste der Angestellten nach. Da war er aufgeführt als Gehilfe des Hausmeisters: »Damián Dagua. Cl. 110, 45B, Santa Ana, Distrito Capital, Bogotá.«
War ich nicht gestern genau dort herumgelaufen, in der Calle 110? War am Ende die Hausnummer genau die der Hütte mit den bemalten Pfosten?
Mein Herz begann erneut, heftig zu schlagen. Verdammtes Herz! Warum reagierte es so hektisch? Das war total peinlich! Aber was ich eben entdeckt hatte, war auch ein Hammer. Wenn Damián bei der alten indianischen Hexe wohnte, dann war es sein Affe gewesen, der mich gestern früh beklaut hatte. Denselben Affen mit dem roten Halsband hatte ich auf dem Törchen zum Hexenhaus wiedergesehen. Wenn Damián in dem Haus mit dem Affen wohnte, wenn der Affe also womöglich ihm gehörte, dann war er am Ende doch ein Dieb. Dann hatte Elena recht, wenn sie meinte, er habe mir die Uhr nur zurückgegeben, weil ich zufällig vom Balkon hinabgeschaut hatte, als er sie sich von dem diebischen Äffchen hatte geben lassen. Und wenn das so war, dann hatte das Colegio Bogotano einen Dieb als Hausmeistergehilfen angestellt.





























