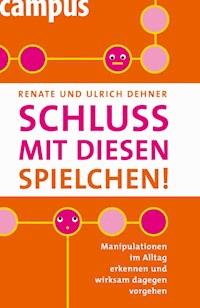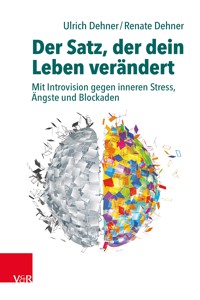
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer kennt es nicht: Das Problem im eigenen Verhalten ist erkannt, analysiert und bis zur Wurzel ergründet. Auch was man verändern muss, ist klar und deutlich, Schritt-für-Schritt herausgearbeitet. Doch in den entscheidenden Situationen gelingt es dennoch häufig genug nicht, das Erkannte umzusetzen. Warum nicht? Weil sich nur die wenigsten Prozesse in unserem Gehirn bewusst abspielen. Für die Fragen der persönlichen Entwicklung, um die es etwa bei Ängsten, Stress und Blockaden geht, ist die Amygdala von größter Bedeutung: Sie reagiert und steuert das menschliche Verhalten. Und der Amygdala ist vollkommen egal, was das Bewusstsein verstanden hat. Wie können wir trotzdem in die nachhaltige Veränderung unserer Emotionen kommen? Mit Hilfe der Introvision. Die Introvision ist ein neuropsychologischer Ansatz, der in Verbindung mit Transaktionsanalyse in der Lage ist, in sehr kurzer Zeit Stress, innere Blockaden, Ängste bis hin zu Panikreaktionen und andere Schwierigkeiten nachhaltig aufzulösen. Wie das genau funktioniert, was der eine, dein Leben verändernde Satz damit zu tun hat, und welche Übungen es dafür braucht, erklären Ulrich und Renate Dehner in ihrem Buch. Niedrigschwellig und auch ohne Vorwissen leicht verständlich erfahren Leserinnen und Leser, was sie tun können, um endlich in die Veränderung zu kommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Dehner / Renate Dehner
Der Satz, der dein Leben verändert
Mit Introvision gegen inneren Stress, Ängste und Blockaden
VANDENHOECK & RUPRECHT
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2025 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: lefthanderman/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
E-Mail: [email protected]
ISBN 978-3-525-40068-5 (print)
ISBN 978-3-647-99237-2 (digital) | 978-3-666-40068-1 (E-Library)
Inhalt
Vorwortvon Claudia Christ
Einleitung
Aufbruch in eine angstfreie Zukunft
Kapitel 1
Veränderung braucht mehr als den Willen oder die Einsicht zur Veränderung
Kapitel 2
Warum Eingreifen emotionale Veränderung verhindert
Kapitel 3
Wie negative oder destruktive Glaubenssätze entstehen
Kapitel 4
Was innere Alarme sind und was sie bewirken
Kapitel 5
Was innere Imperative sind
Kapitel 6
Warum wir von manchen Problemen nicht lassen können: Das Lebensskript
Kapitel 7
Die Antreiber ergänzen das Lebensskript
Kapitel 8
Wie innere Imperative immer wieder unser Leben bestimmen
Kapitel 9
Wie Introvision durchgeführt wird
Kapitel 10
Bei welchen Schwierigkeiten sich Introvision empfiehlt
Kapitel 11
Wie Introvision eingesetzt wird: Fallbeispiele
Schluss
Literatur
Übungen
Vorwort
Introvision ist eine Methode, die es Menschen ermöglicht, 1) tief verankerte Muster in sich zu erkennen, 2) zu benennen und 3) auf ihre Auslöser – mit einer gewissen Übung – nicht mehr mit einem festgelegen Handlungsimpuls zu reagieren. »Sei nicht wichtig« könnte beispielsweise ein Leit- und Glaubenssatz sein, der für jemanden zu einem tief verankerten Verhaltens- und Gefühlsmuster geworden ist und in ihm bei bestimmten Auslösern immer wieder auf- und abgerufen wird. Es ist extrem entlastend, dieses Muster zu durchbrechen, indem es gelingt, die eigene Reaktion zu verzögern, auch wenn jemand gerade meine ängstlichsten und unangenehmsten »Wunden« berührt.
»Ich muss gerade nichts tun« ist in der Introvision ein heilender Satz. »Ich muss gerade nichts tun« und »Ich darf mit allem, was diesen Moment ausmacht, da sein« sind die Schlüssel, sofort aufkommende Impulse, schnelle Emotionen und körperliche Reaktionen zu entdecken und nach und nach kommen und gehen zu sehen – wie eine Welle, die langsam auf den Strand zurollt und versickert. Nur zu beobachten und die eigene Reaktion auszusetzen, ist das entscheidende Drehmoment: Ich mache etwas anders. Ich bewege mich angesichts eines Auslösers, einer Welle, in eine andere Richtung, wodurch sich für mich neue Türen öffnen. Diese neue Drehrichtung der Introvision bringt eine starke Entlastung in die tief verankerten emotionalen Spuren unseres limbischen Systems.
Angst, Panik, Hilflosigkeit und Wut münden in Stresserleben und zwingen uns zu schnellen Reaktionen. Gemeinsam mit verinnerlichten Antreiberslogans, wie zum Beispiel »Du sollst lieb sein«, lassen uns Angst, Panik, Hilflosigkeit und Wut im Stresserleben wie eine Marionette tanzen. Wie ist es, zu erkennen, dass ich genau dies gar nicht muss? Ich muss gerade nicht »hampeln«, um dem Betrachter zu gefallen.
Doch einen Moment, so einfach ist das Erkennen und Verzögern der eigenen Reaktionen leider nicht. »Hampeln« bindet unsere Ängste und verfestigt unsere Bewertungen und unsere Slogans – und alle drei sind sehr mächtig. Introvision gibt einen Rahmen, panische oder lähmende Emotionen zu erforschen, zu benennen, nicht zu bewerten und auf dem Strand versanden zu lassen.
Die Methode der Introvision kann in wenigen Stunden helfen, die Wahrnehmung zu erweitern, eigene Gefahren zu entdecken, diese mit eigenen Worten zu formulieren und die immer wieder eingeübten Abwehrimpulse schwächer werden zu lassen.
In vielen Coaching- und therapeutischen Ansätzen werden rationales Verstehen, besseres Handeln, Rückblicke in die Kindheit und Stressreduktion als heilend für psychische Belastungen angesehen. Die Methode der Introvision kann ergänzend sehr hilfreich sein, die verankerten emotionalen Spuren zu entschärfen und Gefahren nicht mehr als solche zu bewerten. Es geht nicht darum, alles rational bestens zu verstehen und dennoch auf den Emotionen und der inneren Bewertungen sitzen zu bleiben, sondern genau diese neugierig zu entdecken: Vielleicht ist die lang geglaubte Gefahr gar keine.
Prof. Dr. Claudia Christ, MPH – ärztliche Psychotherapeutin (TP), Introvisionscoach und Coach der Internationalen Coaching Federation (ICF), Supervisorin, Balintgruppenleiterin, Dozentin, Master of Public Health
Einleitung
Aufbruch in eine angstfreie Zukunft
Persönlichkeitsentwicklung ist ein großes Stichwort unserer Zeit. In ihm steckt gleichermaßen viel Hoffnung und Druck: die Hoffnung auf eine positive Veränderung, die man selbst in der Hand hat, und der Druck, diese positive Veränderung selbst herbeiführen zu müssen. Welches Modell der Persönlichkeitsentwicklung man dabei zugrunde legt, ist fast schon egal, ausschlaggebend ist, dass man (hart) an sich arbeitet. In den vergangenen Jahren war etwa sehr viel die Rede davon, wie wichtig es ist, alle seine Persönlichkeitsanteile zu integrieren, auch die, die man nicht so gern mag, sich selbst anzunehmen, gut mit sich selbst umzugehen oder, gerade was etwa den Umgang mit Stress betrifft, die Dinge nicht so nah an sich herankommen zu lassen, nicht so streng mit sich selbst zu sein, den Anspruch an Perfektion fallen zu lassen, überhaupt loszulassen und was der guten Hinweise noch mehr sind. Mancher dieser Tipps mag der einen oder dem anderen helfen – meistens aber helfen sie nicht wirklich, und vor allem: nicht nachhaltig.
Dass das so ist, hat auch einen Grund: Veränderungen auf der emotionalen Ebene geschehen nicht per Beschluss! Wir können mehr oder weniger leicht etwas verändern, wenn es um rationale Erkenntnisse, um rationale Einsichten geht. Schwierigkeiten jedoch, die ihren Ursprung im emotionalen Bereich haben – und das sind in der Regel jene, die uns am stärksten und nachdrücklichsten belasten –, lassen sich auf der rationalen Ebene selten lösen. Um auf die Ebene zu gelangen, auf der sich die tief liegenden und immer wiederkehrenden Probleme befinden, muss ein radikal anderer Weg beschritten werden, als ihn übliche Bewältigungsstrategien, sei es in Ratgebern, im Coaching oder in der Therapie, gehen. Weshalb das so ist, und welche Vorgänge in unserem Gehirn ablaufen und dabei eine Rolle spielen, legen wir in diesem Buch ausführlich dar. Und wir zeigen einen Weg auf, mit dem nachhaltige emotionale Veränderung möglich wird: die Introvision.
Während es bei den meisten herkömmlichen Therapie- und Beratungsansätzen vornehmlich um Bewusstmachung geht – das heißt über das bewusste Verständnis, weshalb es zu den eigenen Schwierigkeiten gekommen ist, welche Reaktions- und Verhaltensweisen zu verändern sind –, legt Introvision die Grundvoraussetzung dafür, dass Veränderung auf der emotionalen Ebene überhaupt geschehen kann. Von allen Prozessen, die in unserem Wunderwerk Gehirn vonstattengehen, sind die bewussten nämlich in der Minderzahl. In unserem Gehirn läuft viel mehr ab, von dem wir bewusst gar nichts mitbekommen. Ein Teil dieser unbewussten Prozesse spielt sich nicht im präfrontalen Neocortex in der Großhirnrinde ab, der für unsere bewussten Aktionen zuständig ist, sondern in einem entwicklungsgeschichtlich älteren Hirnareal: dem subkortikalen limbischen System. Dieses ist maßgeblich an der Steuerung von emotionalen Verhaltensweisen, Orientierungs- und Aufmerksamkeitsreaktionen sowie Lernprozessen beteiligt. Für die Fragen der persönlichen Entwicklung, um die es uns hier geht, ist die Amygdala von größter Bedeutung.
Die Amygdala ist der sogenannte Mandelkern im subkortikalen limbischen System. Und ihr ist vollkommen egal, was das Bewusstsein verstanden hat. Sie reagiert und steuert das menschliche Verhalten, wenn es um Stress, Furcht oder Ängste geht – die bewusste Erkenntnis, dass das Verhalten eventuell »unnötig«, »unangemessen«, »unreif«, »destruktiv« oder was auch immer war, hinkt zeitlich immer hinterher. Die Amygdala fungiert als Sicherheitszentrum, welches das Ausschütten von Stresshormonen wie etwa Adrenalin veranlasst, um den Menschen zur Abwehr von Gefahr zu erhöhter Leistungsfähigkeit zu befähigen. Deshalb reagiert die Amygdala um ein Vielfaches schneller auf eine tatsächliche oder vermeintliche Gefahr als etwa der präfrontale Cortex, der für die Ratio, also unser Denken und unsere bewussten Entscheidungen, zuständig ist.
Jeder hat vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass man sich ganz fest vorgenommen hat, auf eine bestimmte Situation nicht ängstlich oder auf einen bestimmten Menschen nicht gereizt oder ärgerlich zu reagieren. Man denkt ganz vernünftig darüber nach, überlegt genau, wie man reagieren will, und dann ereignet sich alles ganz genauso wieder, wie man es unbedingt vermeiden wollte. »Das darf doch nicht wahr sein!«, denkt man sich dann. »Wie konnte ich nur wieder so blöd sein?« Doch man ist nicht »blöd«, das ist der springende Punkt: Die getriggerten Gefühle sind nur sehr viel schneller als der klare Verstand.
Da die Amygdala, die für das unbewusste Entstehen von hauptsächlich negativen Emotionen zuständig ist, schneller ist, als es unser bewusstes Denken und Handeln jemals sein kann, »bewertet« sie im Bruchteil von Sekunden, ob eine Gefahr für den Menschen besteht oder nicht. Die Großhirnrinde, in der die Ratio beheimatet ist, hinkt immer hinterher. Deshalb nützen alle Erkenntnisse nichts, die man in der Analyse der Schwierigkeiten, des eigenen unangemessenen Verhaltens, der »Überflüssigkeit« der eigenen Reaktionen, im Nachhinein gewinnt. Alle zum x-ten Mal getroffenen Entschlüsse, es beim nächsten Mal aber wirklich anders zu machen, verpuffen. Schrillen die inneren Alarmglocken erst einmal, setzen sofort die alten Gefühle ein mit allen unangenehmen Begleiterscheinungen, und schon folgt man dem altbekannten Handlungsmuster.
Innere Alarme springen an, wenn wir extremen Stress erleben, getriggert durch tatsächliche oder vermeintliche äußere Einflüsse. Solche inneren Alarme warnen uns: »Achtung, gleich wird es sehr unangenehm! Es muss dringend etwas passieren!« Weil diese Alarme im Gehirn von der Amygdala ausgehen, verspüren wir innere Alarme oft, obwohl wir verstanden haben, dass sie »eigentlich« überflüssig sind. Nur bei weniger schwerwiegenden Alarmen kann es gelegentlich gelingen, sich selbst rechtzeitig »Stopp!« zu sagen.
Die Introvision ist ein Verfahren, das diese Alarme löscht. Über die entsprechenden Mechanismen werden wir im Buch ausführlich sprechen. Zunächst wollen wir uns aber der Antwort auf die Frage widmen, was Introvision überhaupt ist.
Introvision ist die radikalste Form der Selbstannahme.
Wie erklärt sich diese überraschende Aussage? In anderen Therapie- und Beratungsformen steckt implizit die Botschaft, dass man anders zu sein habe, als es gerade der Fall ist. Na klar, ist man nun vielleicht versucht einzuwenden, genau deshalb nimmt man doch die Hilfe von Therapie oder Coaching in Anspruch, weil man unzufrieden ist, weil etwas schmerzhaft ist, weil einen etwas beeinträchtigt oder behindert, weil man das Problem loswerden will, kurz: weil man sich selbst verändern will. Das ist ein legitimes Anliegen, und natürlich will auch die Introvision, dass allen Menschen mit diesen Anliegen geholfen wird. Introvision schlägt aber einen anderen Weg ein, um zu diesem Ziel zu kommen.
Im Coaching und in der Therapie geht es zumeist um Interventionen, die das Ziel haben, die Situation der Betroffenen zu verbessern. Diese Interventionen haben den entscheidenden Nachteil, dass sie implizit die Botschaft vermitteln: »Du bist nicht in Ordnung, so wie du bist! Du solltest nicht in dem Zustand sein, in dem du dich befindest, deshalb tun wir jetzt etwas, damit du da rauskommst.« Das bedeutet indirekt: Der problematische Zustand, in dem man sich befindet, wird nicht akzeptiert. Trauer, Angst, Panik, Unterlegenheitsgefühle, Prüfungsangst, Versagensangst, Sich-ungeliebt-Fühlen, Sich-wertlos-Fühlen, Mangel an Selbstvertrauen, Nicht-weiter-Wissen und so weiter, all das wird nicht akzeptiert. Im Klartext heißt das, einen im Moment gerade wichtigen Anteil der eigenen Persönlichkeit nicht anzunehmen. Die Auswirkungen dieser meist unbewussten inneren Haltung führen aber nicht zu dem gewünschten Ziel, dass dieser Persönlichkeitsanteil verschwindet. Vielmehr verfestigt er sich, sobald die alten problematischen Gefühle durch eine Situation, eine Person oder eine Herausforderung wieder getriggert werden.
Das Nicht-Akzeptieren dieser ungeliebten, ungewünschten Persönlichkeitsanteile lässt sich mit folgender Analogie illustrieren: Ein kleines Kind fällt hin und weint heftig. Die Eltern wollen es beruhigen und sagen: »Ach komm, ist doch nicht so schlimm, es tut doch schon gar nicht mehr weh!« Das ist eine typische Intervention von Elternseite mit dem guten und vermeintlich hilfreichen Ziel, dass es dem Kind wieder gut geht. Doch was passiert tatsächlich? Die Eltern negieren das Gefühl des Kindes, sie akzeptieren nicht, dass es dem Kind in diesem Moment nicht gut geht. Jede Intervention birgt diese implizite Botschaft: Ich akzeptiere dieses Gefühl nicht, es muss weg!
Bei der Introvision werden die inneren Anteile, die von den Betreffenden als problematisch angesehen werden, absichtlich aktiviert. Doch man gibt ihnen einen geschützten Raum: Man will sie nicht weghaben, sondern lässt ihnen Zeit und Raum, sich zu äußern, man beobachtet, was mit einem selbst dabei geschieht, ohne einzugreifen oder etwas verändern zu wollen. Was auf mentaler, emotionaler und körperlicher Ebene geschieht, wird einfach nur wahrgenommen. Es wird kein Impuls gegeben, dass sich irgendetwas verändern muss. Sie dürfen einfach so sein, wie Sie sind. Und genau das ebnet den Weg zur Veränderung. Das ist eine Paradoxie, die man vergleichen kann mit der Paradoxie des Einschlafens. Wenn man unbedingt einschlafen will und sich deshalb unter Druck setzt: »Denk daran, was für ein anstrengender Tag dir morgen bevorsteht, wie müde du morgen sein wirst, wenn du jetzt nicht bald schläfst!«, wälzt man sich wahrscheinlich länger schlaflos im Bett. Einschlafen kann man erst, sofern man den Wunsch, einschlafen zu wollen, loslässt.
Lassen Sie uns mit einem weiteren Bild deutlich machen, weshalb Introvision als Verfahren so hilfreich ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Wunde, auf der sich Schorf bildet. Sollten Sie immerzu an dieser Wunde herumkratzen, also beständig intervenieren, kann die Wunde nicht abheilen. Erst wenn Sie die Wunde in Ruhe lassen, hat die Haut eine Chance, sich zu erholen und zu erneuern. Introvision ist die Salbe und das Pflaster, die diesen Heilungsprozess unterstützen.
Die Introvision wurde ursprünglich an der Universität Hamburg im Fachbereich Pädagogische Psychologie unter Federführung von Angelika Wagner (2021) entwickelt, um den Stress bei Lehrkräften zu reduzieren. Diesem Ansatz wurden Jahrzehnte der Forschung gewidmet, weshalb es solide wissenschaftliche Daten zu seiner Wirksamkeit gibt. Wir verwenden ein Format, das unter Einbeziehung von Elementen der Transaktionsanalyse und Achtsamkeitstechniken aus der Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) nach Jon Kabat-Zinn (2013) hervorragend nutzbar ist, weil es schnelle Erfolge zeitigt. In unserer über zehnjährigen Praxis mit Introvision, Ulrich Dehner arbeitet seit 2012 mit diesem Verfahren, hat sich immer wieder in der direkten Arbeit mit Klientinnen und Klienten gezeigt, dass sich in extrem kurzer Zeit dauerhafte Veränderungen erzielen lassen, die den Betroffenen ihre Handlungsfähigkeit, innere Ruhe und Ausgeglichenheit zurückgeben. Das Verfahren kann innere Blockaden und inneren Druck auflösen. Es lässt sich sehr gut bei unterschiedlichen Ängsten einsetzen, etwa Versagensangst, Angst vor dem Verlassenwerden, Angst vor Veränderungen, Prüfungsangst, Lampenfieber, Auftrittsängsten, Angst, sich abzugrenzen oder durchzusetzen, sowie Stress und beginnendem Burn-out.
Wenn Sie sich jetzt fragen: »Liebe Güte, was um alles in der Welt ist Transaktionsanalyse und Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)?« – Bleiben Sie dran, das erfahren Sie alles in diesem Buch. Die sperrigen Bezeichnungen sollen Sie nicht davon abhalten, die Introvision kennenzulernen. Dabei sollten Sie allerdings das Folgende beachten:
Sollte jemand beruhigende Medikamente oder Psychopharmaka wie Antidepressiva einnehmen, um mit seinem Stress klarzukommen, ist Arbeit mit Introvision nicht möglich. Die Wirksamkeit von Introvision beruht darauf, sich seinen inneren Alarmen zu stellen und sie durch konstatierendes, wertfreies Beobachten leerlaufen zu lassen. Viele Psychopharmaka unterdrücken aber alle mentalen und körperlichen Unruheempfindungen. Das heißt, sobald man sie einnimmt, können die Alarme mit all ihren Reaktionen auf der emotionalen, mentalen und körperlichen Ebene weder ausgelöst noch wahrgenommen werden. Introvision wird deshalb erst möglich, wenn die Psychopharmaka, die die Angst kappen, abgesetzt sind, was aber unbedingt in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin geschehen sollte!
Kapitel 1
Veränderung braucht mehr als den Willen oder die Einsicht zur Veränderung
Fallbeispiel 1: Nie gut genug
Von außen betrachtet gab es keinerlei Grund zur Beunruhigung. Miriams Lebenslauf wies keine Brüche auf. In der Schule eine Überfliegerin, war sie immer gut gewesen, obwohl sie vor Prüfungen regelmäßig Angst hatte, sie nicht zu schaffen. Im Studium zeigte sich das gleiche Muster: Trotz ihrer Prüfungsängste verließ sie die Uni mit einem guten Abschluss, und nach ihrem Eintritt in die Firma war sie bei Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzten beliebt und anerkannt. Zwar fiel auf, dass sie sehr ungern größere Präsentationen abhielt, doch an ihrer fachlichen Kompetenz bestand kein Zweifel.
Was Team und Führungskräfte jedoch nicht wussten: Mit welchem Ausmaß an Nervosität und innerer Unruhe Miriam zu kämpfen hatte. Bereits Tage vor einer Präsentation bekam sie Herzklopfen, wenn sie daran dachte, und schlief nachts sehr schlecht. Tagsüber hatte sie Konzentrationsprobleme, weil sie gedanklich dauernd mit dem bevorstehenden Auftritt beschäftigt war. Nach zwei, drei Jahren, als sich auch durch mehr Übung und Routine nichts besserte, war Miriam von diesen Zuständen so genervt, dass sie beschloss, eine Verhaltenstherapie zu machen.
In der Therapie schilderte sie ihre Ängste, die zunächst darauf schließen ließen, dass sie im Job einen unsicheren Stand hatte. Doch auf Nachfrage stellte sich heraus, dass sie in den jährlichen Beurteilungsgesprächen immer sehr gute Bewertungen erhielt und man ihr in der Firma zu verstehen gab, dass sie als Potenzialträgerin betrachtet wurde und ihre Leistungen enorm geschätzt wurden. All das änderte jedoch nichts daran, dass sie immer wieder von Zweifeln geplagt wurde, ob sie wirklich in der Lage sei, den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. Niemals konnte sie sich nach einem guten Beurteilungsgespräch über die erhaltene Anerkennung freuen oder sich einen Moment des Ausruhens nach einer gelungenen Leistung gönnen. Im Gegenteil: Lob befeuerte nur Miriams Angst, dass die anderen einfach noch nicht gemerkt hätten, was für eine Niete sie in Wirklichkeit sei. Deshalb durfte sie auf keinen Fall nachlassen. Nur so könne sie eine Aufdeckung ihrer vermeintlichen Inkompetenz verhindern. Miriam erzählte in der Therapie, dass sich das so auch schon in der Schulzeit und im Studium abgespielt hatte, diese Sorgen und Ängste also kein neues Phänomen für sie waren.
Als die Therapeutin von ihr wissen wollte, wie es denn in ihrer Kindheit war, wie die Eltern zum Beispiel auf ihre schulischen Leistungen reagiert hatten, kam sehr schnell zutage, dass Miriams Vater mit den Noten seiner Tochter niemals zufrieden war. Er ließ nur Einsen gelten, alle anderen Zensuren waren für ihn schlecht. Er ritt auf Miriams Fehlern herum und machte deutlich, dass er sehr an den Fähigkeiten seiner Tochter zweifelte. Durch augenscheinlich besorgte Nachfragen schon während der Grundschulzeit, ob sie denn wohl den Übertritt ins Gymnasium schaffen würde, gab Miriams Vater ihr unterschwellig zu verstehen, dass er daran nicht glaubte. Das Gleiche spielte sich im Gymnasium ab, als er sich in jedem einzelnen Schuljahr laut und anhaltend immer wieder darum sorgte, ob Miriam tatsächlich versetzt würde. Das ging bis zum Abitur so weiter, als er ihr während ihrer Vorbereitungen dauernd zu verstehen gab, dass es ihn eher überraschen würde, wenn sie es schaffen sollte.
Dass Miriam unter solchen Umständen überhaupt einen guten Studienabschluss zustande brachte, gleicht einem Wunder. Während sie in der Therapie über ihre Erfahrungen mit den väterlichen Auslassungen sprach, wurde Miriam immer deutlicher, in welchem Ausmaß Zweifel an ihrer Leistungsfähigkeit von Kindesbeinen an gesät wurden. Da ihr erfolgreicher Vater eine wichtige Person für sie war, den sie bewunderte und dem sie auch nacheiferte, nahm sie seinen Zweifel an ihr unhinterfragt an. Dabei setzte sich in Miriam das Gefühl fest, dass sie einfach niemals gut genug wäre, egal, wie sehr sie sich anstrengte.
In der Therapie ganz klar zu erkennen und auszusprechen, woher ihre ständigen Zweifel rührten, erleichterte Miriam zunächst sehr. Zu verstehen, woher ihre Ängste, Sorgen, ihre Nervosität und Aufgeregtheit rührten, war ein wichtiger Schritt für sie. In der Therapie begriff sie auch, dass es einen verletzten Kind-Anteil in ihr gab, der nie gesehen und gewürdigt wurde. Miriam realisierte, dass es ein kleines Mädchen in ihr gab, dem man all die väterlichen Zweifel und Ängste eingeimpft hatte, sodass es sofort in Panik geriet, sobald es sich in irgendeiner Art beweisen musste. Durch die Hinweise, die sie während der Therapie erhielt, wurde ihr auch klar, wie wichtig es ist, Verständnis für diese verletzten Kind-Anteile zu entwickeln, und dass es jetzt darum gehen musste, gut mit diesen verletzten Anteilen umzugehen und sie zu integrieren.
Doch was genau bedeutet das? Dazu bekam sie einige Verhaltenshinweise, zum Beispiel, dass sie ihre eigenen Erfolge mehr anerkennen sollte. Oder dass sie sich mehr über das, was sie bereits alles erreicht hatte, freuen sollte. Oder dass sie sich selbst realistisch einschätzen sollte und sich dazu entsprechende Botschaften mitgeben sollte wie »Ich kann das, ich bin gut, ich schaffe das« etc., dass sie sich auch belohnen sollte für kleinere Erfolge und Ähnliches.
Miriam gab ihr Bestes. Sie versuchte, all diese Ratschläge für Verhaltensweisen, die ja auch ihre Berechtigung besaßen, in die Tat umzusetzen. Allerdings machte sie im Laufe der Zeit die Erfahrung, dass all diese Maßnahmen ihr nur bedingt weiterhalfen. Wenn sie es schaffte, gleich zu Beginn, sobald sie anfing, ängstliche Gedanken zu entwickeln, ihre positiven Botschaften an sich selbst zu richten, konnte sie sich selbst etwas beruhigen und es half ihr hinterher, sich nervlich wieder aufzubauen. Es konnte aber keine Rede davon sein, dass die Angst gar nicht mehr auftauchte. Eine echte Veränderung fand nicht statt, obwohl sie weiterhin in Therapie war. So kam Miriam nach einiger Zeit zu der Einsicht, dass die vielen Gespräche und auch das Verstehen des Mechanismus, wie es zu ihren Schwierigkeiten gekommen war, nicht dazu führte, dass sich an ihrem Problem etwas änderte.
Miriam überlegte, dass sie vielleicht doch die falsche therapeutische Methode oder den falschen Therapeuten erwischt hatte, beendete die eine Therapie und begann eine andere. So wiederholte sich der Prozess des Redens, der Erkenntnisse und Einsichten, es kam zu ähnlichen Ergebnissen, wie sie gegen ihre Ängste vorgehen könnte, es wurde ihr wieder gesagt, dass sie den verletzten Kind-Ich-Anteil integrieren müsse – und letzten Endes war auch das Ergebnis dasselbe wie beim ersten Mal; es änderte sich in ihrem Alltag und Berufsleben nichts Entscheidendes zum Positiven. Im Gegenteil: Es wurde sogar schlimmer für sie, denn jetzt bezogen sich Miriams Selbstzweifel auch noch darauf, dass sie offenbar noch nicht einmal in der Lage war, etwas, das ja wohl Hunderttausenden schon geholfen hatte, erfolgreich anzuwenden. Einigermaßen verzweifelt haderte sie mit sich: »Ich weiß doch jetzt alles, ich weiß, wo es herkommt, ich weiß, was ich tun soll – was stimmt nicht mit mir, dass ich immer alles falsch mache?« Um es doch noch zu »schaffen«, setzte sie sich selbst immer mehr unter Druck. Sie wollte die Ängste weghaben, sie wollte den verletzten Kind-Ich-Anteil integrieren – aber im Grunde genommen hatte sie keine Ahnung, was das heißen sollte, und es hatte ihr auch keiner erklärt.
Mit sich selbst gut umgehen, das ist in Wirklichkeit eine Leerformel.
Was soll das denn sein, »mit sich gut umgehen«? Geht man gut mit sich um, wenn man sich Schokolade schenkt, ein paar neue Schuhe, einen Abend im Kino, ein Wellness-Wochenende? Sich angesichts seines Spiegelbilds erklärt, dass man sich mag? Oder sich positive Botschaften vorbetet? Ja, wahrscheinlich ist das alles schon eine Art, gut mit sich umzugehen. Aber am Montag bei der Präsentation vor dem Vorstand ist man dennoch genauso ängstlich wie vorher!
Genau diese Erfahrung machte Miriam auch. Sie konnte jetzt zwar wahrnehmen, dass es diesen ängstlichen Teil in ihr gab, der am liebsten immer abhauen würde, weil er alles viel zu bedrohlich fand. Doch zum Schweigen brachte sie diesen Teil nicht. Sie versuchte, anders mit ihren Ängsten umzugehen, indem sie sich entweder positive Botschaften vorgab oder indem sie versuchte, ihre Ängste zu ignorieren, und nach außen hin funktionierte sie weiterhin so gut wie immer. Doch all ihre Versuche, die Angst zum Verschwinden zu bringen, führten zu keinem dauerhaften Erfolg.
Leider ist dies etwas, das in Therapien recht häufig passiert. Therapien werden beendet, weil die Klienten und Klientinnen das Gefühl haben, dass dieses ewige Darüber-Reden nichts bringt. Oder sie machen die Erfahrung, dass sich ihre Symptome zwar bessern, aber nicht verschwinden. Genügte vor der Therapie ein relativ geringer Reiz, um ihr Problem zu erzeugen, braucht es nach der Therapie vielleicht einen doppelt so starken, um auf die alte Art und Weise zu reagieren, aber im Grunde genommen hat sich nichts verändert. Man stelle sich einmal vor, das geschähe so in der Zahnarztpraxis! Man geht dorthin, weil man Zahnschmerzen hat, und nach einer langwierigen Behandlung ist man so weit, dass die Zahnschmerzen nur noch in Situationen auftauchen, in denen man etwas besonders Hartes kaut. Niemand würde das als Behandlungserfolg betrachten, denn ganz offensichtlich wurde das Problem nicht gelöst. Das Problem ist erst dann gelöst, wenn die Symptome in jeder Situation verschwunden sind, vorher nicht!
Einsicht allein genügt nicht.
Seit den Anfängen der Psychotherapie und bis heute besteht das gängigste Verfahren aller auf Gesprächen basierenden Therapieformen darin, bei den Klienten eine verstandesmäßige Durchdringung ihrer Schwierigkeiten zu erzielen. Therapeutinnen und Therapeuten sprechen mit ihren Klientinnen deren Erlebnisse und Erfahrungen durch, versuchen, die Verbindung zur Kindheit herzustellen, wenn es naheliegt, dass die Probleme aus dieser Zeit herrühren. Man eruiert nach Möglichkeit die auftauchenden Gedanken, analysiert ihren Gehalt, stellt sie infrage, versucht, neue Verhaltensmuster einzuüben und die Klienten zu befähigen, sich von einschränkenden Glaubenssätzen zu lösen. In sehr vielen auf Gesprächen basierenden Therapieformen herrscht noch immer die Überzeugung vor, dass das rationale Verständnis dessen, was Klienten zugestoßen ist – sei es in der Kindheit, sei es später –, die Voraussetzung dafür ist, dass sie ihre Schwierigkeiten beheben können.
Auch die meisten Ratgeberbücher zu psychologischen Themen zielen darauf ab, den Lesern und Leserinnen nahezubringen, wie