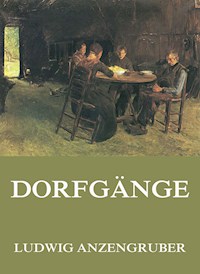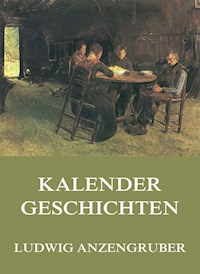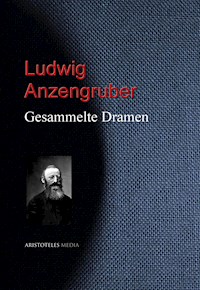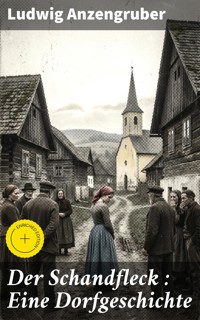
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In "Der Schandfleck: Eine Dorfgeschichte" entwirft Ludwig Anzengruber ein eindringliches Porträt des ländlichen Lebens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Erzählung spielt in einem kleinen Dorf, in dem soziale Spannungen, Vorurteile und die Suche nach Sühne in den Mittelpunkt rücken. Anzengruber verwendet einen realistischen, oft schonungslos direkten Stil, um die menschlichen Konflikte und die vermeintlichen moralischen Werte, die das dörfliche Leben prägen, zu beleuchten. Durch vielschichtige Charaktere und feinsinnige Dialoge offenbart der Text die fragilen Strukturen der Gemeinschaft und die individuellen Tragödien, die sich im Schatten des "Schandflecks" entfalten. Ludwig Anzengruber, ein bedeutender österreichischer Dramatiker und Romanautor des 19. Jahrhunderts, wuchs in einem kleinen Dorf auf, was seine Perspektive auf ländliche Themen und soziale Probleme prägte. Seine persönliche Erfahrung mit Verurteilung und dem Streben nach sozialer Gerechtigkeit spiegelt sich in der emotionalen Tiefe seiner Werke wider. Anzengruber war bestrebt, die Abgründe der menschlichen Natur und die Dynamiken innerhalb der ländlichen Gesellschaft zu ergründen. Für Leser, die an zeitgenössischen sozialkritischen Themen und der literarischen Analyse des Landlebens interessiert sind, ist "Der Schandfleck" eine unverzichtbare Lektüre. Anzengrubers Fähigkeit, komplexe menschliche Emotionen und gesellschaftliche Konflikte zu erfassen, lädt zur Reflexion über die Macht von Vorurteilen und die Suche nach Identität ein. Dieses Buch ist nicht nur eine historische Erzählung, sondern auch ein zeitloses Plädoyer für Menschlichkeit und Verständnis. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor. - Interaktive Fußnoten erklären ungewöhnliche Referenzen, historische Anspielungen und veraltete Ausdrücke für eine mühelose, besser informierte Lektüre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Schandfleck : Eine Dorfgeschichte
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Zwischen dem beharrlichen Urteil der Dorfgemeinschaft und dem stillen Anspruch des Einzelnen auf Würde spannt sich in Der Schandfleck jene zähe, allgegenwärtige Spannung auf, in der ein einmal gesetzter Makel als sichtbares und unsichtbares Zeichen zugleich über Gesichtern, Häusern und Lebenswegen liegt, Gerüchte zu Regeln und Gewohnheiten zu Gesetzen verhärtet, Hoffnung und Eigenverantwortung auf die Probe stellt, die Sprache der Moral gegen die Bedürftigkeit des Alltags antreten lässt und so die Frage zuspitzt, ob der Mensch mehr sein darf als die Geschichten, die andere über ihn erzählen, und was es kostet, diese Antwort einzufordern.
Das Werk, verfasst von Ludwig Anzengruber, gehört zur Tradition der Dorfgeschichte und verortet seine Handlung in einem österreichischen Landgemeindemilieu, dessen soziale Netze eng und normativ gefestigt sind. Entstanden im späten 19. Jahrhundert, verbindet Der Schandfleck realistische Beobachtung mit scharfem Sinn für soziale Mechanismen, wie sie die Literatur dieser Zeit vielfach auslotete. Anzengruber, bekannt für seine volkstümlich-realistischen Bühnenstücke und Prosatexte, nutzt das Dorf nicht als Idylle, sondern als Brennspiegel gesellschaftlicher Kräfte. Die Erzählung führt Leserinnen und Leser in einen Raum, in dem Herkunft, Besitzverhältnisse und moralische Zuschreibungen sichtbar in Entscheidungen und Lebensentwürfe hineinregieren.
Am Anfang steht kein spektakuläres Ereignis, sondern ein Zeichen, das schon länger kursiert: der sprichwörtliche Fleck auf einem Namen, einer Biografie, einer Familiengeschichte. Im Dorf wird er gesehen, besprochen und mit Bedeutungen aufgeladen, die über das Persönliche hinausweisen. Eine zentrale Figur sieht sich dadurch in ihrem Handlungsspielraum begrenzt; alltägliche Vorhaben, von Arbeit bis zu Bindungen, stoßen auf sichtbare oder stille Widerstände. Der Text interessiert sich weniger für den Skandalwert als für die feinen Verschiebungen, die ein Stigma erzeugt: Blicke, Andeutungen, kleine Entscheidungen, die sich summieren und allmählich zu Schicksalsschrauben werden.
Anzengrubers Erzählen ist nüchtern, genau und von einer leisen, nie herablassenden Ironie durchzogen. Die Sprache bleibt klar und ohne Zierrat, sodass soziale Beobachtung, psychologische Feinheiten und situativer Humor unangestrengt ineinandergreifen. Dialoge tragen die Atmosphäre des Dorfes, ohne zum folkloristischen Effekt zu werden; die Erzählstimme wahrt Distanz, um Empathie gerade dadurch zu ermöglichen. Der Ton ist ernst, aber nicht düster; er gönnt seinen Figuren Augenblicke von Würde und Selbstbehauptung, selbst wenn Umstände sie bedrängen. So entsteht ein Leseerlebnis, das zugleich unter die Haut geht und gedankliche Klarheit über Mechanismen des Zusammenlebens schafft.
Im Zentrum stehen die Themen Ehre und Schande, Gemeinschaftsdruck und individuelle Verantwortung. Der Roman zeigt, wie Gerüchte als soziale Währung funktionieren, die Zugang verschaffen oder versperren, und wie ungleiche Besitz- und Machtverhältnisse moralische Urteile verstärken. Auch religiöse Autorität und rechtliche Rahmen spielen eine Rolle, wenn Normen verhandelt und durchgesetzt werden. Geschlechterrollen, Erwartungen an Konformität und die Verletzlichkeit ökonomisch Abhängiger treten deutlich hervor. Zugleich stellt Der Schandfleck die Frage nach Gerechtigkeit jenseits von Straflogik: Was bedeutet Wiedergutmachung, was Anerkennung, und wie kann Gemeinschaft Solidarität üben, ohne in Blindheit gegenüber Fehlverhalten zu verfallen?
Für heutige Leserinnen und Leser bleibt das Buch aktuell, weil es die Dynamik sozialer Zuschreibung erhellt: wie rasch sich ein Urteil verfestigt, wie schwer es zu korrigieren ist und wie sehr es Biografien lenkt. In Zeiten digitaler Öffentlichkeit, in denen Sichtbarkeit, Kommentare und Gerüchte neue Reichweiten erhalten, wirkt Anzengrubers Analyse verblüffend zeitnah. Zugleich thematisiert die Erzählung Fragen der Herkunft, der sozialen Mobilität und des fairen Zugangs zu Chancen, die längst nicht erledigt sind. Sie lädt dazu ein, über Verantwortung im Kollektiv nachzudenken: über Grenzen von Prangerpraktiken und die Bedingungen gelingender Wiedereinschlussprozesse.
Wer Der Schandfleck heute liest, begegnet keiner musealen Dorfidylle, sondern einem präzisen Modell gesellschaftlicher Prozesse, das in konzentrierter Form zeigt, wie moralische Sprache, ökonomische Zwänge und intime Hoffnungen miteinander ringen. Anzengruber erzählt ohne Zynismus und ohne Beschönigung; gerade diese Mischung schafft jene produktive Unruhe, die zur eigenen Stellungnahme drängt. Das Buch kann als literarisches Labor gelesen werden: Es prüft Haltungen, testet Möglichkeiten der Versöhnung und beharrt auf der Würde von Menschen, deren Leben von Urteilen anderer durchkreuzt wird. Damit eröffnet es eine reflektierte, anrührende und bis heute erhellende Lektüreerfahrung und bleibt damit mehr als ein historisches Dokument.
Synopsis
Der Schandfleck: Eine Dorfgeschichte von Ludwig Anzengruber, einem österreichischen Autor des 19. Jahrhunderts, entwirft das Bild einer ländlichen Gemeinde, in der Ansehen und überlieferte Sitten das Zusammenleben regeln. Im Mittelpunkt steht ein Hof, dem ein Schandfleck anhaftet: eine alte, nie ganz vergessene Verfehlung, die die Nachkommen in Mitleidenschaft zieht. Anzengruber beginnt ruhig, mit Beobachtungen des Alltags, der Arbeit auf den Feldern und der dichten sozialen Kontrolle, die jedes Wort und jeden Blick registriert. Aus dieser Atmosphäre der Wachsamkeit entsteht ein stilles Spannungsfeld, in dem das Bedürfnis nach Zugehörigkeit mit der drohenden Ausgrenzung kollidiert.
Früh wird deutlich, wie hartnäckig das Stigma die Lebenswege begrenzt. Ein Mitglied der betroffenen Familie versucht, eine geachtete Stellung zu erlangen, sei es durch Arbeit, Pacht oder eine Verbindung, die gesellschaftlich aufwerten könnte. Doch jede Annäherung stößt auf misstrauische Blicke und kleinliche Demütigungen. Gerüchte verdichten sich, wenn Hilfe angeboten oder Nähe gewährt wird, und die Nachbarschaft fürchtet um das eigene Ansehen. Der erste Wendepunkt zeichnet sich ab, als ein persönlicher Plan öffentlich wird und plötzlich die still geduldete Toleranz endet. Aus unterschwelliger Spannung wird offener Widerstand, der das private Anliegen in ein gemeinschaftliches Thema verwandelt.
Anzengruber zeigt daraufhin die Mechanismen des Dorfes: Amt und Kirche, Pachtgeber und Nachbarn formen ein Geflecht aus Abhängigkeiten, in dem moralische Urteile wirtschaftliche Folgen haben. Eine ältere Begebenheit, nur bruchstückhaft erinnert, wird zur Folie, auf der man aktuelle Ansprüche abweist. Ein Fest, eine Versammlung oder der Kirchgang liefern den Anlass, die Zurücksetzung öffentlich sichtbar zu machen. Daraus entsteht der zweite markante Einschnitt: Nicht mehr nur getuschelte Geringschätzung, sondern ein kollektives Signal der Distanzierung, das Verpflichtungen löst und Unterstützung entzieht. Die Betroffenen stehen vor der Frage, ob sie weichen, nachgeben oder ihre Würde offensiv behaupten.
Parallel dazu verdichtet sich eine persönliche Bindung, die sowohl Hoffnung als auch Angriffsfläche bietet. Nähe und Vertrauen eröffnen eine mögliche Rückkehr zur Anerkennung, doch die Verbindung provoziert jene, die ihre Ordnung gewahrt sehen wollen. Ein Gegner mit Einfluss kanalisiert den Unmut in vermeintliche Prinzipien und in die Sprache der Sitte. Aus Gefälligkeiten werden Hebel, aus Gepflogenheiten Druckmittel. Der nächste Wendepunkt kündigt sich an, als ein Anspruch vor Zeugen verhandelt wird und die Angelegenheit vom leisen Gerede in ein öffentliches Aushandeln kippt. Eine Entscheidung rückt näher, die Liebe, Lebensunterhalt und Ruf gleichermaßen betreffen könnte.
Im weiteren Verlauf treten Erinnerungen, Zeugnisse und Andeutungen zutage, die die Grenzen zwischen überlieferter Schuld und tatsächlicher Verantwortlichkeit verschieben. Nicht nur die Betroffenen, auch bislang neutrale Figuren müssen Position beziehen. Ein Aufeinandertreffen, zu dem man geladen oder gedrängt wird, bündelt die Erwartungen: Es verspricht Klärung, droht aber zugleich mit endgültiger Beschämung. Anzengruber nutzt die Szene, um das Spannungsfeld aus Recht, Brauch und Gewissen sichtbar zu machen. Dabei entstehen Momente, in denen das Urteil der Menge wankt und persönliche Integrität gegen bequeme Konformität abgewogen wird, ohne dass der Autor die letzte Konsequenz vorwegnimmt.
Die Zuspitzung führt zu einer Konfrontation, in der die vermeintlich Schwachen Haltung beweisen müssen und die Stärkeren ihre Motive offenbaren. Ein Wort, eine Geste, eine unerwartete Parteinahme verschieben die Gewichte und lassen Möglichkeiten aufscheinen, die zuvor verdeckt waren. Aus der Scham wird die Frage nach Gerechtigkeit, aus dem Stigma ein Prüfstein der Gemeinschaft. Selbst wenn manche Folgen unmittelbar spürbar werden, bleibt der endgültige Ausgang in der Schwebe. Vieles steht auf dem Spiel. Entscheidend ist, dass die handelnden Personen Verantwortung übernehmen oder verweigern und dadurch sichtbar machen, worauf ihr Begriff von Ehre tatsächlich gründet.
Am Ende bleibt Der Schandfleck als präzise Studie über Macht und Moral im Mikrokosmos des Dorfes in Erinnerung. Anzengruber zeigt, wie lange nachwirkende Zuschreibungen Biografien formen und wie fragil jene Ordnung ist, die sich auf Ruf und Hörensagen stützt. Die Erzählung legt nahe, dass Würde aus Haltung statt Herkunft erwächst und dass Gemeinschaft nur dort trägt, wo sie das Persönliche nicht der bloßen Gewohnheit opfert. Gerade durch die Zurückhaltung in der Auflösung wirkt die Geschichte über den Rahmen ihrer Zeit hinaus und lädt dazu ein, kollektive Urteile kritisch zu prüfen.
Historischer Kontext
Der Schandfleck: Eine Dorfgeschichte erschien 1876 und ist in einem ländlichen Milieu der österreichischen Alpen- und Voralpenregion verortet, das zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn (Cisleithanien) gehörte. Prägende Institutionen des Dorflebens waren die katholische Pfarrgemeinde, die kommunale Selbstverwaltung nach den Gemeindegesetzen der 1860er Jahre, die Bezirkshauptmannschaft als staatliche Mittelbehörde sowie die seit 1849 aufgebaute Gendarmerie. Zentrale normative Rahmen bildeten das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811, die Pfarrmatriken für Personenstandsfälle und – nach 1869 – die allgemeinen Volksschulgesetze. In diesem Gefüge verbanden sich kirchliche Moral, bäuerliche Gewohnheitsrechte und die zunehmend durchgesetzte staatliche Rechtsordnung.
Ludwig Anzengruber (1839–1889) schrieb im Umfeld des poetischen Realismus, der in den deutschsprachigen Ländern zwischen etwa 1850 und 1890 alltägliche Lebenswelten sachlich-nüchtern darstellte. Der Schandfleck steht in der Tradition der Dorfgeschichte, die seit Berthold Auerbachs Erzählungen populär war, und zugleich im Kontext des österreichischen Volksstücks, das soziale Spannungen in verständlicher Sprache zeigte. Anzengruber nutzte dialektnahe Redeweisen, ohne auf dokumentarische Präzision zu verzichten. Das Buch erschien 1876 in Buchform und traf auf ein Publikum, das durch wachsende Alphabetisierung, liberalisierte Presseverhältnisse und ein dichtes Verlagswesen zunehmend an realistischen Gesellschaftsbildern interessiert war.
Politisch war die Entstehungszeit vom Ausgleich von 1867 geprägt, der die Habsburgermonarchie in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn überführte. In Cisleithanien gewährte die Dezemberverfassung von 1867 bürgerliche Grundrechte wie Vereins- und Pressefreiheit. Zugleich verschärfte sich der Konflikt zwischen liberalem Staat und katholischer Kirche: Die sogenannten Maigesetze von 1868 regelten das Verhältnis von Kirche und Staat neu, und 1870 wurde das Konkordat von 1855 weitgehend aufgehoben. Auf dem Land blieb die Kirche moralisch prägend, doch Schulwesen, Eherecht und Verwaltung wurden stärker staatlich beeinflusst – Spannungsfelder, die in ländlichen Erzählwelten greifbar werden.
Die soziale Ordnung der Dörfer war seit den Revolutionen von 1848 im Wandel. Mit der Aufhebung der Grundherrschaft wurden Bauern formal frei und vielfach Eigentümer, doch Abgabenablösungen und Schulden lasteten oft auf Höfen. In vielen Alpenregionen sicherte das Anerbenrecht die Weitergabe des Hofes an einen Erben; Geschwister wurden abgefunden, was soziale Asymmetrien schuf. Das Heimatrecht, geregelt durch Gesetzgebung der 1860er Jahre, band Armenfürsorge und Aufenthaltsrecht an die Gemeinde. Wer kein Heimatrecht besaß oder es durch Wegzug verlor, war besonders verletzlich gegenüber Ausschlussmechanismen – eine Realität, die ländliche Gemeinschaften rechtlich wie sozial strukturierte.
Moralische Normen und Ehrvorstellungen hatten im katholisch geprägten Dorf hohe Bindekraft. Das ABGB unterschied rechtlich zwischen ehelichen und unehelichen Kindern, was Erb- und Statusfragen betraf und Stigmatisierung verstärken konnte. Pfarrliche Eheschließungen, Aufgebote und Taufregister fixierten Lebensläufe öffentlich sichtbar. Obwohl extramaritale Geburten in manchen Alpenregionen statistisch häufiger vorkamen als in Städten, galten sie vielerorts als Makel, der über Familien hinaus auf Höfe und Heiratschancen wirkte. Solche sozial anerkannten Sanktionen – vom Gerede bis zu handfesten Benachteiligungen – bildeten einen Rahmen, in dem individuelle Verfehlung als „Schandfleck“ kollektiv verhandelt wurde.
Ökonomisch wirkte in den 1870er Jahren der Gründerkrach von 1873 nach, der eine langanhaltende Depression auslöste. Kreditknappheit, verschlechterte Absatzmöglichkeiten und verschuldete Landwirtschaft trafen auch ländliche Räume, wenn auch regional unterschiedlich. Zugleich förderten Eisenbahnbau und Marktintegration neue Abhängigkeiten von Preisen und Zwischenhandel. Saisonale Abwanderung und Auswanderung aus Teilen der Monarchie stiegen an und wurden zu Ventilen sozialer Spannung. Frühgenossenschaftliche Ideen zirkulierten, doch stabile ländliche Kreditnetze etablierten sich vielerorts erst später. In dieser Gemengelage wurden Besitz, Reputation und Zugang zu Hilfeleistungen noch stärker über gemeinschaftliche Anerkennung reguliert.
Die Verwaltung verdichtete sich seit der Neoabsolutismus-Ära der 1850er Jahre und blieb auch nach 1867 wirksam: Bezirkshauptmannschaften, Bezirksgerichte und Gendarmerie strukturierten Konfliktlösung und Ordnung. Ehrenbeleidigung, Eigentumsfragen und Vormundschaften gelangten in das formale Rechtssystem, gleichwohl hielten sich Gewohnheitsrecht und dörfliche Schlichtungspraxis. Lokale Eliten – Pfarrer, Lehrer, Bürgermeister – vermittelten zwischen staatlichem Recht und Dorfnormen. Die seit 1867 erweiterte Pressefreiheit und Vereinskultur schufen neue Öffentlichkeiten, erreichten das Land jedoch ungleich. Diese Verschränkung von amtlicher Justiz, öffentlicher Meinung und sozialer Kontrolle bildet einen zentralen Bezugsrahmen für realistische Dorfprosa der Zeit.
Der Schandfleck fungiert vor diesem Hintergrund als literarischer Kommentar zu einer Übergangsepoche, in der liberale Rechtsgarantien auf tradierte Ehrbegriffe und kirchlich geprägte Moral trafen. Anzengruber zeigt – ohne Moritatenton, aber mit realistischer Genauigkeit –, wie Gemeinschaften Zugehörigkeit, Schuld und Wiedergutmachung definieren. Das Werk knüpft an zeitgenössische Debatten über Kirche und Staat, Schulreform, Gemeinderecht und soziale Fürsorge an, ohne auf programmatische Thesen reduziert zu sein. In der Rezeption festigte es Anzengrubers Ruf als kritischer Beobachter des ländlichen Österreich und als Vertreter eines Realismus, der gesellschaftliche Bruchlinien im Kleinen sichtbar macht.
Der Schandfleck : Eine Dorfgeschichte
Einleitung
Ein Menschenalter ist hingeflossen, seit man in Wien (am 12. Dezember 1889) den fünfzigjährigen Anzengruber zu Grabe trug. Im kommenden Jahr also wird, was er schrieb, nun Gemeingut des Volkes — gesetzlich frei zur Vervielfältigung und Verbreitung für jedermann.
Es sind nur vereinzelte deutsche Dichter, die aus dieser schönen Gesetzesbestimmung Gewinn für ihr Lebenswerk ziehen; wenige nur werden auserwählt von den vielen Berufenen. Das Urteil der Mitwelt hält nicht immer stand vor dem unparteiischen Richterspruch der Geschichte, die alles abzieht, was die Gunst des Augenblicks einem Dichter an Kränzen gewunden. Bei Anzengruber jedoch hat es stand gehalten. Er hat seinen gesicherten Platz in der Literaturgeschichte, die seinen Namen mit Ehrfurcht ausspricht, und seinen nicht weniger sicheren Platz in den Herzen des Volkes. Und das ist bei ihm das Entscheidende.
„Ich sah dem Volke nackten Unsinn bieten, oft mit krausester Tendenz verquickt, Handlung, Charaktere, alles unwahrscheinlich, unwahr, nicht überzeugend, so daß der guten Sache der Volksaufklärung mehr geschadet als genützt wurde. Und rings lagen doch so goldreine, so prächtige und mächtige Gedankenschätze, ausgestreut von den Geistesheroen aller Zeiten und Völker. Alles das mußte sich in kleiner Münze unter das Volk bringen lassen, von der Bühne herab, aus dem Buche heraus. Ein anderer wollte sich nicht finden, welcher der Zeit das Wort redete, also mußte ich es sein.“ In diesen Sätzen aus einem Briefe an Julius Duboc hat er sein Ziel und den Weg dazu leise angedeutet: der Zeit das Wort reden, das war’s, was er wollte. Und wenn wir sein Werk daraufhin überprüfen, so müssen wir ihm schon die Auszeichnung lassen, daß er wie wenige vor ihm und nach ihm das Zeug dazu hatte.
Am liebsten sprach er zum Volk von der Bühne herunter, nach der sich schon früh seine Kräfte spannten und der er als wandernder Thespiskärrner beinahe ein volles Jahrzehnt hindurch angehörte. Die lange Reihe seiner Bühnenwerke, vom weit und breit bekannten „Pfarrer von Kirchfeld“ (1870), der seine erste, bis zu dem „Fleck auf der Ehr“ (1889), dessen erfolgreiche Aufführung seine letzte große Lebensfreude bedeutete, legt Zeugnis ab für den heiligen Ernst, der sein Schaffen im Dienste der Volksaufklärung und Volkserziehung beseelte. Es steckt ein Stück Kulturgeschichte in diesen Werken, im gewaltigsten Drama wie in der ausgelassensten Komödie; sie sind wie ein Spiegel der mancherlei sittlich-religiösen Tendenzen, die seine Zeit bewegten und erschütterten. Wie er im „Pfarrer von Kirchfeld“ das wahrhafte Christentum ausspielt gegen den Geist des Zelotentums und der Unduldsamkeit, so ist im „Meineidbauer“ die fromme Gewissenssophistik des Titelhelden, die selbst das Verbrechen zur göttlichen Schickung umlügt, der Angelpunkt des Geschehens. In „Hand und Herz“ ist es die Unlösbarkeit der katholischen Ehe, die er an einem herben Einzelfall als menschlich und sittlich verwerflich erweist; im „Vierten Gebot“, seinem wuchtigsten Drama, schärft er mit Nachdruck den Eltern ein: Seid eingedenk euerer Verantwortlichkeit! Der Zeit das Wort reden, das war’s, was er wollte. Der Widerspruch gegen Aberglauben und fromme Duckmäuserei, gegen kirchlichen Zwang, gegen alle geistigen und sozialen Ungerechtigkeiten lag ihm im Blute, so wenig der tiefe Menschenkenner und große Gestalter deshalb zum „Tendenzdichter“ wurde. Wahrheit verlangte und bot er, Wahrheit und Ehrlichkeit der Gesinnung, und seine höchste Moral war auf Mitleid gegründet. Die seine Sache zu führen haben, sind immer die Ärmsten und Letzten in der Gemeinde, die „Leidensfiguren aus dem Volke“, die Wurzelsepp oder Steinklopferhanns, und immer lautet die Anklage dann auf zu wenig Mitleid und Nächstenliebe. Für unsere Zeit kann es keinen moderneren Dichter geben als Ludwig Anzengruber. Ihn, den bei Lebzeiten nach seinen eigenen Worten die Mode versinken und darben ließ, muß die Gegenwart zwiefach verehren und lieben, als Schutzgeist der Gewissensfreiheit und Anwalt aller Bedrückten.
Er war aber nicht bloß Dramatiker, er war auch Erzähler, und wiederum einer von großem Format und von eigener Prägung. Nicht alles, was er geschrieben hat, läßt das erkennen; zu oft zwangen Sorge und Not ihn zu billiger Tagesleistung. Schriftsteller, „die nur tun müssen, was sie nicht lassen können, aber was sie lassen wollen nicht tun müssen“, hat er sein Lebtag beneidet. Wem seine „Dorfgänge“ aber vertraut sind, die er noch selber für die Gesamtausgabe seiner Werke zusammengestellt hat, die tiefschürfenden Charakterstudien vom „gottüberlegenen Jakob“ und „Hartingers alter Sixtin“, vom „Sündkind“, vom „Sinnierer“ oder vom „Mann, den Gott lieb hat“; wer seine erschütternde Novelle „Der Einsam“, vor allem jedoch seine großen Romane „Der Sternsteinhof“ und „Der Schandfleck“ kennt, der weiß, daß sie kräftig vom Leben durchglüht und mit der Gestaltungs- und Erfindungsgabe des echten Künstlers entwickelt sind.
Auch dem Erzähler blickt meist der Dramatiker über die Schulter. Die Charaktere so sicher wie möglich zu erfassen und aus ihrem Wesen und Wirken, ihren Gesinnungen und Leidenschaften naturnotwendig ihr Schicksal hervorwachsen zu lassen, das lockt ihn am meisten. Die breite, behagliche Freude am Ausmalen und am Beschreiben, das liebevolle Sicheinfühlen in die Umgebung, das Gottfried Keller als Epiker groß und bedeutend macht, ist ihm fremd. Nicht wenige seiner Erzählungen sind überhaupt echte Dramenstoffe, die nur aus begründeter Furcht vor der Wiener Zensur nicht die Bühne erreichten.
Zu dieser letzteren Gattung gehört auch der „Schandfleck“, der erste große Roman Ludwig Anzengrubers, der Weihnachten 1876 als Buch herauskam, nachdem er zuvor in der österreichischen Familienzeitschrift „Die Heimat“ veröffentlicht worden. Der Dichter stand auf der Höhe des Ruhmes. Der „Pfarrer von Kirchfeld“, der „Meineidbauer“ und die drei Meisterkomödien „Kreuzelschreiber“, „Gewissenswurm“ und „Doppelselbstmord“ hatten die Probe im Rampenlicht glänzend bestanden, dagegen war der Erzähler Anzengruber bisher nur mit kurzen Geschichten und Märchen hervorgetreten. Würde der große Roman den Vergleich mit den Dramen vertragen?
Die Frage war nicht unbedingt zu bejahen. Während der erste, im Dorfleben wurzelnde Teil der Erzählung vortrefflich geglückt war, fiel die Geschichte im zweiten Teil — Schauplatz Wien — merklich ab. So ungleichwertig waren die beiden Hälften, daß Geibel beim Lesen den Eindruck gewann, als ob eine fremde Hand den Roman von der Mitte ab fortgeführt habe, und Berthold Auerbach schlechthin erklärte, so kraftvoll und plastisch der erste Teil sei, so „unbegreiflich abgeschmackt“ sei der zweite. Wir wissen heute, worauf das beruhte: der Dichter gab leider der Einwirkung nach, zugunsten der Zeitschrift und ihres Leserkreises den Schauplatz vom Dorf in die Stadt zu verlegen. Die Stadt aber, wenn sie auch Wien heißen mochte, blieb stets seiner Muse ein fremdes Gebiet.
Die heutige reife Gestalt des Romans ist das Werk einer späteren Umarbeitung, und daß sich der Dichter dazu bereit fand, bereit finden konnte in seiner Lage, die ständig ein Kampf um das tägliche Brot war — das ist das Verdienst eines trefflichen Mannes, der Anzengruber die Möglichkeit schenkte, eine Weile dem drängenden Tageserwerb zu entrinnen. Ohne sich selbst zu erkennen zu geben, ließ er dem Dichter im Herbst 1879 von Hamburg aus „als die Spende ungenannter Freunde seines Talents“ die Summe von tausend Gulden[1] zur Verfügung stellen und daran den Wunsch der Verehrer knüpfen, es möge der „Schandfleck“ die Fassung erhalten, die dessen ursprünglichem Anlageplane entspräche.
Anzengruber hat lange gezögert, das Angebot sich zu eigen zu machen. Wohl kannte er selbst die Achillesferse, doch bangte ihm nicht allein vor dem harten Stück Arbeit einer tiefgreifenden Umgestaltung des „Schandfleck“, die für beträchtliche Zeit alle anderen Pläne zurückdrängen mußte, er glaubte auch hinter dem Angebot jenen selbstlosen „allerentferntesten“ Freund zu erkennen, der wiederholt seine lebhafte Teilnahme an dem Roman schon betätigt hatte: den feinsinnigen Ästhetiker Wilhelm Bolin, der als Professor und Bibliothekar an der Universität Helsingfors wirkte. Durfte er aus dieses Freundes Hand solch ein Geldopfer hinnehmen? „Ein Anbot, wie es mir gemacht wird, kommt nicht ohne irgendeinen Anstoß,“ schrieb er am 9. November 1879 dem Hamburger Mittelsmann, „das kommt nicht von einer Anzahl Leser, die bloß an dem Autor teilnehmen, das kommt von einer auch dem Menschen befreundeten Seite; ich denke nun — ich weiß es allerdings nicht, aber ich halte mich für berechtigt, es zu denken — daß ich keinen Freund habe, dem in der fraglichen Angelegenheit selbst nur durch die Ergreifung der Initiative nicht ein Opfer auferlegt wäre, und ein solches anzunehmen, dazu halte ich mich nicht berechtigt.“ Erst als die ungenannten Freunde seine Bedenken zerstreut und ihm ausdrücklich versichert hatten, daß keinerlei Opfer vorwalte, nahm Anzengruber die Geldspende an. Sobald er einigermaßen die Hände frei habe, werde er sich an die Neuschöpfung machen, die eine gewisse Feiertagsstimmung bedinge; Werkeltagsarbeit vertrüge die Sache nicht.
Es war, wie der Dichter ganz richtig vermutete, wirklich Bolin, der ihm über Hamburg hinweg die gefüllte Freundeshand reichte, doch hat er zeitlebens den Sachverhalt nicht erfahren. Erst 1890 lüftete Wilhelm Bolin sein Inkognito durch die Erklärung, er habe das Honorar für seine schwedische Bühnenbearbeitung Shakespeares nicht besser verwenden zu können geglaubt, als zur Erlösung des Schandfleck-Romans aus der ihm durch redaktionelle Willkür aufgezwungenen bösen Entstellung.
Für Anzengruber bedeutete damals die Spende nicht wenig. Viel größer jedoch ist der Dauergewinn, den sein schwedischer Freund unserer deutschen Literatur dadurch sicherte.
Leipzig, Dezember 1919.
Carl W. Neumann.
Der Schandfleck
1.
Zu beiden Seiten der Straße erhoben sich Hügel, dehnten sich mählich hinan und machten den Versuch, eine Gebirgskette aufzubauen, welche aber etwas nieder ausfiel. Es war eine vornehme Straße, sie erlaubte den Häusern nur rechts und links Spalier zu machen und bewilligte der Ortschaft nur eine einzige Gasse. Ab und zu verzweigte sich auch ein Fahrweg und wand sich zwischen den Hügeln hindurch. Wer sich dort angesiedelt hatte, in den vereinzelten, verstreuten Gehöften, der gehörte wohl zur Gemeinde, aber ein Ortskind war er nimmer, er wohnte — wie sollte man es heißen, in der Schlucht, im Hohlwege? Das hieße den sanftansteigenden Hügeln doch zu viel romantische Ehre antun, der Volksmund traf auch hier das Richtige und nannte diese Wegstrecken „Gräben“, und so wohnte ein und der andere Bauer im „mittleren“, im „Heu-“, „Wasser-“ oder sonst irgendeinem Graben.
Im „mittleren“ Graben, nahezu eine halbe Stunde vom Orte, befand sich ein Häuschen, über dem Hügel vor demselben stand die Sonne und spiegelte sich in den Fensterscheiben, diese gaben für diesmal das Bild in scharfen Umrissen wieder, denn sie waren dicht verhangen. Im ganzen Gehöfte ist alles still und ruhig, nur in der Küche, gerade vor der Stube mit den verhängten Fenstern, da brodelt manchmal vorlaut das Wasser in einem Topfe, oder es tropft von einem Deckel und verzischt auf der heißen Herdplatte; eine stämmige Dirne, die da herumhantiert, ruft dann immer ein strafendes „Pscht“, nach einer Weile aber beginnt sie einen Ländler vor sich hinzusummen, bis sie ein Schmerzenslaut aus der Stube vermahnt, daß sich das doch auch nicht recht schicken will, und dann läuft sie geschäftig nach der Tür derselben und guckt hinein und nickt den beiden Weibern zu, die da drinnen um die in Kindesnöten liegende Reindorferin geschäftig sind; geschäftig wohl nur die eine, die künftige Gevatterin[2], die andere, ein altes, zusammengeschrumpftes Mütterchen, blickt aus großen nichtssagenden Augen, als ob sie sich über alles höchlich verwundern würde, sitzt aber eigentlich ganz ruhig nebenbei und wartet, bis die Pflicht sie ruft.
Draußen im Hofe steht ein alter Mann, er mag sich immerhin auf seinen Taufschein berufen, der ausweist, daß er noch nicht die erste Hälfte der Fünfziger überschritten hat, er ist aber von der Zeit so übel mitgenommen, daß ihm diese Berufung wenig nützen wird, er denkt wohl auch nicht daran, und was den Taufschein anlangt, wäre ihm wohl lieber, der Pfarrer hätte nie die Mühe gehabt, einen Joseph Reindorfer in das Kirchenbuch einzutragen.
Also der Bauer war es, der Herr der Liegenschaft, der Joseph Reindorfer, der da draußen im Hofe vor einem Leiterwagen stand, dem ein magerer Braun vorgespannt war; auf dem Sitzbrette saßen ein vierschrötiger Bursche, etwa sechzehn Jahre alt, und ein Mädchen, das vierzehn zählen mochte, die Kinder des Bauers.
Reindorfer nahm die Peitsche, die an der Deichsel lehnte, und langte sie dem Jungen zu. „Nun macht, daß ihr fortkommt, grüßt mir meinen Bruder und fahrt fein gescheit, es hat keine Eile, ihr braucht mir“ — setzte er verlegen hüstelnd hinzu — „nicht vor Abend heimzukommen.“
Der Bursche lachte. „Tut doch der Vater gerade, als wüßte man von nichts!“
Das Mädchen wurde rot, blickte zur anderen Seite des Wagens nieder und stupfte den Bruder leise mit dem Ellbogen.
„Was wirst auch viel wissen,“ brummte der Bauer.
„Für seine alten Tage,“ sagte der Bursche keck, „hätte der Vater auch gescheiter sein können.“
Der Alte riß eine Mistgabel an sich und holte damit aus, aber er besann sich, sah den Buben giftig an und schlug nach dem Pferde, das erschreckt zum Hoftor hinausjagte und den Wagen hinter sich her riß.
Das Mädchen kreischte, der Junge fluchte und als er den Wagen in ruhigen Gang gebracht hatte, sagte er zur Schwester: „Der Hof ernährt ohnedem kaum eines, bist du schon zu viel, weil du ja auch ausgesteuert werden sollst, nun soll gar noch ein drittes davon fressen und zehren und beteilt werden.“
Er machte durch einen Peitschenhieb seinen Gefühlen Luft, und das Mädchen, das im übrigen seine Anschauungen zu teilen schien, vergalt die Anspielung auf sich nur durch einen nicht ernst gemeinten Puff.
Reindorfer hatte das Hoftor hinter den Davonfahrenden geschlossen, jetzt ging er langsam dem Garten zu; als er an der Küche vorüberkam, trat die Magd an die Schwelle und lächelte ihm zu, er sah sie groß an, dann wandte er sich ab und schritt kopfschüttelnd weiter. Im Garten war eine Laube, dicht mit Reben umrankte Latten, dort ließ er sich auf die Bank nieder, stemmte die Ellbogen auf den Tisch und starrte auf den feinen Kies der Wege.
Durch das breite Weinlaub spielte das Sonnenlicht, die Wiese, die hinter dem Garten hinanstieg, ließ es in hellem Grün erglänzen, bis hinauf zu dem Kamme des Hügels, den eine tiefdunkle Tannenwaldung umsäumte. Kroch, schwirrte und surrte es nicht durcheinander in Halmen, Büschen und Bäumen, flatterte, flirrte und sang es nicht in den Lüften? Das wirkt der Sonnenschein mit Licht und Farbe und Wärme — es ist doch sonst oft dem Bauer dort in der Laube das Herz im Leibe dabei aufgegangen, daß ihm das Grün so erfreulich, der Vogelsang so lustig schien, warum gerade heute nicht, wo man aus der linden, wohligen Luft mit jedem Atemzuge Lebensfreudigkeit und Lebensmut in sich sog, wo im lieben klaren Tageslichte jede Sorge verbleichen mußte; warum schlich er nicht über den Hof, und stahl sich leise durch die Küche, und lauschte an der Türe der Stube mit den verhängten Fenstern, die Magd hätte ihn sicher nicht verraten und wunder nähme sie es auch nicht, wenn er es täte, das wollte sie ihm nur zu verstehen geben, als sie ihn vorhin anlachte — warum hielt er sich ferne?
Ein paarmal rückte der alte Mann unentschlossen auf der Bank hin und her. „Solltest doch nachschauen geh’n, daß es nicht auffällt. Ja, wer es so weg hätte, sich zu verstellen, daß es ihm niemand anmerkt und jeder glaubt! Vielleicht verstellt sich die ganze Welt so, als wär’ alles gut und schön, und es ist der Sonn’ nicht ernst damit und dem Gefiederwerk, das da herumlärmt; und dem ganzen lichten Tag ist es anders um das Herz, als er glauben machen will, und ich trau’ ihm heut’ nicht.“
Ja, er hatte seinen guten Grund, fernzubleiben, aber er konnte ihn niemandem sagen, denn auch der Bauer hält auf seine Ehr’ und Reputation in der Gemeinde und vor den Nachbarsleuten, und eben darum durfte er nicht auffällig tun, daß man nach keinem Grunde suchte, eben darum sollte er doch nachschauen geh’n, damit keines ahnen konnte, was ihm, dem Reindorfer, nur zu gewiß war.
Das Kind war nicht sein!
Ja, wer es weg hätte, sich so zu verstellen! Was heute kommen sollte, war schon lange vorher zu wissen, von dem Tage an, wo es sich nicht mehr verheimlichen ließ, daß die Bäuerin sich vergessen habe, und wo er sich mit Mühe zurückhielt, daß er sie nicht mißhandelte. Er wollte ihr erst ein volles Geständnis erpressen, aber die Bäuerin schwieg in hilf- und ratloser Scham, und als er ruhiger geworden, da dachte er, er brauche ihr nicht abzufragen, was er wohl wußte. Herbergte er nicht im vergangenen Herbste ein paar Tage den Bankert des Müllers im Wasser-Graben, den Urlauber, dem niemand Gutes zutraute, und der in der Stadt drinnen vor nicht lang auch wieder eine ins Unglück gebracht haben soll?—
Bisher meinte er, er würde es auch, wenn die schwere Stunde käme, erzwingen können, daß er den Leuten keinen Anlaß zum Nachdenken gäbe, aber jetzt stand sie vor der Türe und er konnte nicht wider das Gefühl, das ihm die Brust verschnürte.
So saß er denn da außen im Garten, sah nieder auf den Kies und traute dem leuchtenden Tage nicht, von Zeit zu Zeit seufzte er schwer auf, als wollte es ihm — volkstümlich gesprochen — das Herz abdrücken. Das machte ihn verwirrt, denn jeder Seufzer erinnerte ihn, daß er litt, körperlich litt, daran hatte er nicht gedacht und nun war ihm, als sei alles in seiner Brust zusammengeschrumpft, leer, und eine ungeheure Last drücke von außen nach, als wollte sie ihm den Brustkasten in die Höhlung pressen, und dieses Gefühl ließ sich nicht verwinden, darunter seufzte er auf.
„Man kommt nicht auf gegen das Blut, meint man’s noch so gescheit, man kommt ihm nicht auf! Sagt ja auch die Bäuerin aus, sie hätt’ niemal kein’ Gedanken an so was gehabt und weiß jetzt selber nicht, wie sie es hat tun mögen. Was taugt aber der Mensch, wenn er auf sich selber kein’ Verlaß hat? Dann sind Treu und Glauben auf der Welt Narrensachen! Wofür ist gar ein Sakrament auf der Ehe, wenn eines so ungerufen durch eine Hintertür ins Leben kommen kann? Wär’s nicht recht und ihm selber besser, ich brächt’ den Bankert gleich um?“ — Seine Hände zuckten krampfhaft ... und da sah er auch leibhaftig das Kind vor sich liegen, mit dem gleichmütigen Munde und den großen verwunderigen Augen, er zog die Arme an sich und dachte an den schuldigen Teil. „Zwanzig Jahr’ hat sie ausgehalten, hat sich jung nie was vergeben, auf ihr Alter hat sie sich’s versparen müssen. Ich weiß mich nicht aus, o du heiliger Gott, ich weiß mich nicht aus! Wir waren nie anders als gut aufeinander, sie hat es oft selber gesagt, sie könnt’ sich nicht beklagen; zwanzig Jahr’, zwanzig Jahr’ haben wir in Ehr’ und Einträchtigkeit verlebt, da vergißt sie ’n Mann und ihre eheleiblichen Kinder um einen hergelaufenen Lumpen und nicht lange von heut, so läuft — als müßt’ es sein und gehör’ es ihm — der lebendige Schandfleck im Hause und in der Familie herum! Sie hätt’ mir’s doch nicht antun sollen, sie hätt’ mir’s doch nicht antun sollen!“ Sein Blick wurde ungewiß und seine Mundwinkel zuckten. Da erhob er sich, strich mit der harten, schwieligen Handfläche über den Tisch. „All’ vorbei!“
Er ging zurück über den Hof.
„Treu und Glauben sind Narrensachen![1q]“
Als er vorbeikam, wollte der Kettenhund an ihm hinaufspringen, er aber jagte ihn mit einem Fußtritte in die Hütte, dann tat er ihm wieder leid. „Sultan,“ rief er, „Sultan!“ Und klatschte sich auf das Knie.
Der Hund war verschüchtert und verkroch sich in das Stroh.
„Herein, da herein!“
Das Tier gehorchte und er tätschelte ihm mit der Hand auf den breiten Schädel. „Ja, ja, du bist mein guter Hund, ich weiß, ich weiß schon,“ sagte er, als der plumpe Köter vor Freude immer in wunderlichen halben Sprüngen aufhüpfte. „Auf dich ist schon Verlaß, dich kann freilich nicht verdrießen, daß du bleibst, wie du bist — ist dir ja gar keine Zeit gelassen — bringst es ja kaum auf zwanzig Jahr’! — Bist nur ein dummes Vieh und bleibst eines! — Ja, ja — bist ein braver Hund!“
Er bückte sich hinab und beschwichtigte das immer zudringlicher werdende Tier. Da kam jemand rasch heran und blieb neben ihm stehen und sagte: „Bauer, es ist da, ein Dirndl ist’s!“ Es war die Magd. Reindorfer erschrak, er blickte empor, kniff die Augen zusammen, verzog grinsend den Mund und nickte ein paarmal hastig mit dem Kopfe. Er dachte, er habe das recht hübsch gemacht und niemand könne es anders deuten, als er sei über die Botschaft erfreut, die Magd nahm es auch dafür und lief vor ihm her nach der Küche, öffnete die Stubentüre und lachte hinein: „Der Bauer kommt schon!“
Reindorfer trat in das Zimmer, nahte sich auf zwei Schritte dem Bette und sagte, ohne die Bäuerin anzusehen: „Ich bin froh, daß es vorüber ist!“
Das Kind wurde ihm in den Arm gelegt. Es schrie kräftig und schien stark und gesund.
Da war es, trug kein Mal und kein Zeichen, — war ein Kind wie ein anderes.
„Daß es leben mag!![1]“
Der Bauer schüttelte den Kopf, die Hände begannen ihm unter der winzigen Last zu zittern, und die Wöchnerin[3] verlangte hastig das Kleine zurück.
Nachdem er mit einigen hervorgestotterten Worten den beiden Weibern gedankt hatte, „für ihre Freundschäftlichkeit und Gutheit und Hilfeleistung“, versah er sich mit Pfeife und Tabaksblase und verließ die Wochenstube. In der Küche brannte er mit einer Kohle den Tabak an, klappte den Pfeifendeckel zu, schritt dann über den Hof hinaus auf den Fahrweg und wandelte wie ein Träumender dahin.
In wirren, wechselnden Bildern drängten sich dem alten Manne die Erinnerungen seines Lebens auf und er sammelte und sichtete, wie es sich bot, ob es fern oder nah lag, was er genossen oder gelitten, gut gemacht oder übel getan, und suchte es gegeneinander abzuwägen; denn was eines erlebt, das muß doch einen Sinn haben, Freud’ und Leid, Rechttun und Verschulden mußte sich ja doch ausgleichen! Aber die Rechnung wollte ihm nicht stimmen.
Warum er den Hof verlassen hatte und jetzt beharrlich nach einer Richtung den Weg verfolgte, er wußte es nicht. Plötzlich blieb er stehen und horchte auf, er vernahm das Geräusch eines herankommenden Wagens, nun besann er sich, seinen Kindern war er entgegengegangen. Nun rief er sie an, sie mußten halten und ihn auf das Sitzbrett, in ihre Mitte nehmen. Da saß sich’s gut.
„Nun, wie geht’s daheim?“ fragte der Bursche.
„Eine Schwester habt ihr gekriegt.“
Mehr sagte der Bauer nicht und die beiden frugen nicht weiter und so fuhren sie denn schweigend dahin.
Abenddämmer lag über den Matten.
Als sie der Stelle zulenkten, wo der „Wasser-Graben“ in den ihren einmündet, da rasselte ein anderes Fuhrwerk daher und sie wurden angerufen: „Liebe Leuteln, haltet ein wenig auf, laßt mich vorfahren!“
„Ist’s nicht der Knecht aus der Mühl’?“ fragte Reindorfer, indem er die Zügel anzog. „Wohin noch in der Eil’?“
„Nach’m Pfarrhof. Der Müller macht’s nimmer lang! Gute Nacht!“
Damit polterte der Wagen ihnen voran, er war ihnen lange aus Gesicht und Gehör, als sie durch ihr Hoftor einfuhren.
Vom Hofe aus führt eine Stiege nach dem Dachboden, einige Pfeiler stützen sie, und der Raum zwischen ihnen und dem Treppengang heißt „die Lauben“, in derselben befand sich ein Tisch und dahin trug jetzt die Magd das Abendessen für den Bauer und das Gesinde. War ja ohnedies heut spät geworden.
Der junge Reindorfer trat nur unter die Türe, um seine Mutter zu grüßen, das Mädchen aber schlüpfte an ihm vorbei und eilte zur Wiege.
Die Bäuerin erwiderte den Gruß ihrer Kinder, dann kehrte sie sich hinüber zur Wand.
Als der Bursche die Türe hinter sich zuzog, sagte die Tochter, welche sich über den Säugling gebeugt hatte: „Ist ein klebers[2] Ding. War ich auch so?“
„Ist doch keines anders.“
Der Bescheid ward mit halb ungläubigem Lächeln aufgenommen.
„Gute Nacht, Mutter!“
Die Wöchnerin war allein — und sie sollte auch allein bleiben.
Nach dem Abendessen und geschehener Danksagung bedeutete Reindorfer die Magd, sie möge in der Küche schlafen, daß sie zur Hand sei, wenn etwa der Bäuerin nachts etwas zustoßen sollte, er meine aber, Ruhe sei ihr vor allem vonnöten, und darum geh’ er heute mit seinen Kindern auf den Dachboden schlafen.
Noch friedlicher als er im Tageslichte gelegen, lag nun der Hof im Mondenschimmer, denn auch seine Einwohner ruhten; der Schlaf hielt sie in seinem Banne, den Sinnen — durch die aller Reiz und alle Regung, all’ Lust und Leid ihren Einzug halten — räumte er schmeichelnd die Wirklichkeit hinweg, wie eine Mutter spielmüden Kindern das Spielzeug, und während wir oft, wenn wir über die arme Frist unseres Daseins erbangen, ihn kindisch anklagen, als ob er sie unterbräche und uns davon wegnähme, teilt er von Tag auf Tag die Last des Lebens; trage sie einer, sei Schmerz oder Wonne ihr Druck, in einem Stücke, wie gar zu bald erläge er.
Geräusch ist sonst ein ohnmächtiger Feind, aber wenn sich Unruhe im Innern des Schläfers mit ihm verbündet, dann verscheucht es den Schlaf.
Fuhr nicht ein Wagen eilig an dem Hause vorbei? die Leute darauf mußten eine Laterne mit sich haben, denn ein Lichtschein streifte die Tücher, womit die Fenster verhangen waren.
Die Reindorferin ermunterte sich, sie horchte auf — wie stille war alles — sie war gewohnt, dort von der Ecke her die regelmäßigen Atemzüge ihres Mannes zu hören, nun gewahrte sie in dunklen Umrissen das unberührte Lager, sie tastete neben sich, da stand die Wiege und in derselben lag das Kind, ohne Laut und Regung; war es Furcht oder Hoffnung, was sie mit zitternder Hand nach dem kleinen Körper langen machte? Sie fühlte Wärme und verspürte den leisen Atem. Sie zog hastig den Arm unter die Decke, war es Widerwille oder Freude, was sie empfand? Wußte sie es? — Und in ratlosem Unwillen über sich selbst und alles, wie es gekommen war und noch drohend ausstand, drückte sie heftig das Gesicht in die Polster, und ihre Augen wurden feucht. Weinte sie über sich oder über das Kind? Wie unschuldig das auch war, konnte sie je ein Herz zu ihm fassen? denn auch sie wird es, solange es lebte, vermahnen, denn auch für sie, die Mutter, verbleibt es, wie es der Bauer genannt, ein Schandfleck!
2.
Der Wagen, der an dem Hofe Reindorfers vorübergefahren, hielt vor der Mühle im Wasser-Graben. Der Knecht war einem Geistlichen, welcher Chorhemd und Stola trug, beim Absteigen behilflich, und dieser zog dabei das Ziborium[4] vorsichtig an sich, damit ihm der Knecht nicht ungeschickterweise nach demselben tappe. Der Kirchendiener, welcher eine Laterne mit sich führte, kletterte, durch dieselbe wohl etwas behindert, aber doch ungefährdet an der rückwärtigen Seite des Fuhrwerkes herab und leuchtete voran, als sie in den Hausflur traten, wo das Gesinde versammelt war. Ein Glöckchen schrillte, die Anwesenden knieten nieder, der Priester erteilte ihnen den Segen und trat dann in die Stube zu dem todkranken Müller. An dessen Lager wachte eine alte Magd, sie erhob sich und küßte dem Geistlichen die Hand.
„So viel unbußfertig ist er halt, Hochwürden,“ flüsterte sie mit einer bedauernden Gebärde nach dem Kranken, „so viel unbußfertig.“
Ein Wink bedeutete sie, sich zu entfernen.
Der Priester und der Sterbende waren allein.—
Der Seelsorger war ein kräftiger junger Mann von Mittelgröße, galt aber wegen seiner Körperfülle eher für klein, und ein sogenanntes Doppelkinn verlieh ihm vollends dem Äußeren nach einen behäbigen Anschein, welchem jedoch sein lebhaftes Auge und seine rege Beweglichkeit widersprach. Er schritt rasch nach dem Tische und entfernte für einen Augenblick den Schirm von der Lampe, um nach dem Kranken zu sehen, der mit geschlossenen Augen im Bette lag, der farbige Überzug der Polster hob die eingefallenen, scharfen Züge noch mehr hervor, die abgezehrten Arme lagen schlaff über der Bettdecke, nur manchmal zuckte es in den Fingerspitzen.
Der Kranke merkte sich beobachtet, er meinte zeigen zu müssen, daß er wach sei. „Die Gundel,“[3] sagte er heiser, „die Gundel“ — so hieß seine Wärterin — „hat mich wohl verklagt, ich bete ihr alleweil zu wenig, es hilft ja doch zu nichts mehr, nein, es hilft nichts mehr; wenn nur das Versehen[4] helfen möcht’.“
Der Priester trat an sein Lager.
„Herlinger, kennt Er mich denn?“
„Ach ja wohl, freilich, Hochwürden. Hab’ Euch ja rufen lassen, damit Ihr mich einölen sollt, der Doktor meint, er könne nichts mehr richten, da müßt halt Ihr jetzt Eure Kunst probieren. Ich hab’ mehrere gekannt, die es ein paarmal mitgemacht haben und nach jedem Versehen noch eine Zeit herumgelaufen sind. Es ist fast so, wenn man das liebe geweihte Öl auf dem Leibe hat, als könnte der Tod nimmer so hart anfassen, — hihi — man rutscht ihm aus.“
„Nun ja, Herlinger, wenn Gott will, kann er Ihm auch noch Seine Zeit verlängern, aber das Sakrament der letzten Ölung ändert nichts an seinem ewigen Ratschlusse.“
„Und warum nicht? Zu was hätten wir denn dann die hochheiligen Gnadenmittel, als um etwas gegen ihn ausrichten zu können, wenn kein Gebet mehr verfangen will?! Dazu sind sie da, o, ich kenn’ mich aus, ich verabsäum’ es nicht, denn da heißt’s wohl auch: Friß Vogel oder stirb!“
„Herlinger, weiß Er auch, was Er spricht? Regt Ihn etwa das Reden zu viel auf?“
„O nein, nein, Hochwürden. Ich müßt’ ohnedem in einem fort reden, denn mir geht allerhand durch den Kopf. Aber ich laß mich nicht irremachen und wenn ich bei einer Sach’ verbleib’, so weiß ich ganz gut meine Meinung.“
„Gut, doch muß Er auch imstande sein, Müller, auf das zu hören, was ich Ihm zu sagen habe.“
„Ich bin ja noch bei mir, warum sollt’ ich nicht aufmerken können?[2q]“
„Ich finde Ihn in einer schlechten Verfassung; Herlinger, das ist keine Vorbereitung zu dem Empfange der heiligen Sterbesakramente, das muß Er ganz anders anfassen, sonst kann ich sie Ihm nicht spenden.“
Das Bett schütterte unter dem Kranken, dem die Angst die Schlaffheit der Glieder löste. „Ihr müßt,“ kreischte er auf, „Ihr müßt! ich gehöre zur Pfarre, habe immer mein Teil und darüber gerne gegeben, Ihr habt mein Geld genommen, Ihr müßt! — Ihr werdet es ja doch nicht über Euer Gewissen bringen, Hochwürden,“ setzte er flehend hinzu, „daß Ihr mich da liegen laßt, ohne Versuch, mir aufzuhelfen?“
„Das ist es eben, Herlinger; Er vermeint, durch die Sterbesakramente bleibe er am Leben, darum verlangt Er nach ihnen. Ihm fehlt die christliche Ergebenheit in den Willen Gottes, Er glaubt wohl gar, es anders erzwingen zu können, Er begehrt keine Gnadenmittel, Er will Wundermittel, und die habe ich nicht. Eine heilige Handlung kann ich aber nicht mißbrauchen lassen, es hieße Spott damit treiben, wollte ich einem Menschen die letzte Ölung[5] spenden, der sich dabei mit dem Gedanken trüge, es möge doch nur die vorletzte oder drittletzte gewesen sein!“
„Tut nur nicht gleich so bös’, hochwürdiger Herr. Ihr wißt freilich besser Bescheid in solchen Sachen wie ich, müßt mir halt sagen, was ich tun muß, daß ich dazu gelangen kann.“
„Wenn Er auf Seinen verfallenen Leib blickt, Müller, dann muß Er sich wohl selber sagen, wie wenig zu hoffen ist und daß Er ganz etwas anderes der Barmherzigkeit Gottes zu empfehlen hätte.“
„Nichts für ungut, — aber wie man sich halt oft so Gedanken macht, — ich begreif’ schon, mit ihm vergleichen muß man sich wohl, daß er es einem im Leben gut geschehen läßt, gut’ Freund muß man wohl mit ihm bleiben, sonst verhagelt er einem die Felder und schickt Kümmernis und Trübsal, aber man vermeint doch, für weiter hinaus könne er einem nichts mehr anhaben! Wenn es aus sein soll mit mir, wozu brauch’ ich ihn dann? Wenn einer verstorben ist, so ist er wohl ganz und gar verstorben.“
„Herlinger, Er ist auch einer von denen, die Gott fürchten wie den Teufel, darum möchte Er ein Ende der Herrschaft absehen. Ich aber sage Ihm, Gottes Macht und Herrlichkeit leuchtet über Lebende wie über Tote in gleicher Helle, und darüber ist keiner so ganz sicher, ob ihm nicht dereinstens vor ihr die Augen übergehen; denn wie keiner weiß, von wannen er kommt, so ist er auch nicht gewiß, wohin er geht, und ich möchte den Allmächtigen nicht versuchen, was er für weiter hinaus mir anhaben, wozu ich ihn noch gebrauchen könnte, denn nach der Zeitlichkeit beginnt die Ewigkeit!“
„Hochwürden, glaubt Ihr daran?“
„Warum sollte ich sagen, was ich nicht glaube?“
„Wohl, Ihr hättet es nicht Ursache. Aber doch — nicht jeder darf reden, wie er es vermeint; was seines Amtes ist, daran muß er sich halten. Hab’ einen Advokaten gekannt, der hat auch gesagt, von der Wahrheit könne er nicht leben.“
„Verblendeter Mensch! Wenn ich dir jetzt mit den Tröstungen der Kirche beispringe, was bin ich denn anders als dein Advokat, der dich nicht unvorbereitet, nicht unverteidigt vor den Richterstuhl Gottes treten lassen will?! Aber auch ich werde da mit der Wahrheit nicht weit kommen, denn ich darf deine Sünden und Vergehungen nicht die strenge Gerechtigkeit Gottes aufreizen lassen, austilgen muß ich sie durch die Gnadenmittel, damit ich seine Erbarmung für dich anrufen kann!“
„Ja, ja, es möcht’ schon recht sein, wenn Ihr so tätet, es könnt’ nicht schaden, wenn es nur nützt! Aber ihr hochwürdige Herren seid ja selber so, alle Ostern seht ihr einem die Sünden nach, und darauf rückt ihr sie ihm wieder allzusammen vor, — wenn bestimmt ist, daß es einem eingebracht werden soll, so steht wohl auch schon das Urteil fest, was hilft nachher alles Beten und zum Kreuz kriechen?“
„Es hilft auch nicht ohne aufrichtige und — wo es noch etwas gutzumachen gibt — tätige Reue. — Wie aber kommt Er dazu, Herlinger, daß Er sich leichter in eine harte Führung und ein strenges Gericht Gottes ergibt, als an dessen Milde und Barmherzigkeit glaubt?“
„Ja, es ist mir halt alles im Leben so überquer gekommen, immer eines auf das andere, als ob es hätt’ sein müssen, niemal ist es mir so gut geworden, daß ich einem Jammer hätt’ ausbeugen können, niemal hat es mich aus einem Drangsal gerissen, wie andere oft, daß man meint, ihr Schutzengel führt sie an der Hand heraus, und wenn man so immer und alleweil ohne jede Hilfe verbleibt, dann merkt man wohl, wie man nie etwas hat tun können gegen das, was werden will, und wenn es der Herrgott auf einen abgesehen hat, da muß man noch froh sein, wenn man ihm abbetteln kann, daß er es nicht gar zu grob macht. — Als kleiner Bub’ hab’ ich meine Mutter verloren, mein Vater hat nach ihr ein junges Weib genommen und kurz darauf kam auch ein Stiefbruder zur Welt, natürlich waren bald alle drei gegen mich, die Bäurin wegen ihrem Kind, der Vater wegen der Bäurin und der kleine Stiefbruder hielt sich an das Beispiel der beiden; nun ja, mein Erbrecht auf die Mühle trug mir all die Gehässigkeiten ein, das konnte ich freilich damals nicht wissen, in so jungen Jahren hat man noch nicht den Verstand, aber eben wo man gar keine Ursache weiß, da tut es desto weher, wenn man immer so lieblos aus dem Wege geschoben wird. — So bin ich aufgewachsen, daheim hab’ ich nichts Gutes genossen, aber auch außerm Haus hätt’ ich mir nichts herausnehmen sollen. Die andern alten Leute lachten, wenn ihre Bursche wild und toll taten, und meinten, so verbleibt’s nicht und sie würden sich schon die Hörner ablaufen, mir aber sagte mein Vater, ich sollte mir derlei vergehen lassen, sonst erschlüge er mich. Daß ich ihnen neidig war, sahen sie gar bald, und sie zahlten mir mit Spott heim. Da hab’ ich denn aus Trotz angefangen, es heimlich ärger zu treiben, wie sie offen; o, auf krummen Wegen findet man schon auch seine Leute, ist zwar dem einen an dem andern nichts gelegen, aber zum Gruß und Dank ist man sich gerade gut genug.“
Der Pfarrer rührte mit der Hand an die Bettdecke. „Hör’ Er, Müller, da gibt Er wohl selber zu, daß das nicht zu loben und nicht gut getan war, ich denke, es könnte Ihm auch die Reue darüber nicht schwer fallen.“
„Das nicht, Hochwürden, das wohl nicht, derlei unbedachte Sündigkeit mag wohl einer rechtschaffen bereuen! Wer weiß, ob es nicht ohne das mit mir ganz anders stünde, — ob ich jetzt auch schon so siech daläge?! Hab’ ohnehin meine wilde Zeit einmal abbrechen wollen, aber es hat ja nicht sein sollen. Das war, wie die Weninger Kathrin’ zu uns auf die Mühle in Dienst kam, mit der hielt ich es auf der ehrlichen geraden Straße, der war viel an mir gelegen, und ich freute mich, daß ich einmal auch so eine fand. Was für ein Ende es genommen, darauf mögen sich wohl noch viele Leute im Ort besinnen, mein Vater steckte sich hinter den Herrn Pfarrer und den Herrn Bürgermeister, durch den Schandarm ließ er die Dirne, die keine sichere Stunde mehr hatte, von der Mühle wegholen, mit Dieben und Landstreichern auf einen Karren laden und nach ihrer Heimat abschieben. Seither hab’ ich das Weibsbild nicht mehr gesehen. Mich aber nahm der Vater in seine Stube und sagte, wenn mir nur um das Heiraten zu tun wäre, so hätte er eigentlich nichts dagegen, und es schicke sich eben eine Gelegenheit dazu, die ihm tauge und auch mir recht sein könne; auf den Strauch geschlagen habe er schon, die reiche Müllerstochter aus dem Nachbarort gäbe man mir gerne und die dürft’ mir doch nicht zu gering sein? Am Hochzeitstage wolle er mir die Mühle verschreiben, und dann mit Weib und Kind nach dem Hof der Schwiegereltern ziehen, weil die alten Leute sich zur Ruhe setzen möchten. Ob ich mit all dem einverstanden wäre? Ich sagte: nein, — und wenn er mir eine Kronprinzeß zum Weibe angetragen hätte, ich hätte ihm nein gesagt, nur um ihn zu ärgern, und dabei glaubte ich auch bleiben zu können; aber er führte mich zu seinen Büchern und Aufschreibungen, und da hatte es nicht viel Rechnen not, so wußte ich, wie eine Stiefmutter wirtschaften und zur Seite schleppen kann. Der Vater hatte mir gar nichts mehr zu vererben, binnen Jahr und Tag konnten uns die Gläubiger aus unserm Besitze treiben und ich hätte, wie der ärmste Knecht, mir Brot und Unterkunft suchen müssen; wollte ich die Mühle, worauf die Herlinger an die hundert Jahre gehaust hatten, behalten, so mußte ich wohl die Müllerstochter nehmen und so hab’ ich sie denn auch genommen. Meine Sippschaft zog fort, und wenn nur ein wenig Glück mit meinem Weibe hätte einziehen wollen, es wäre nun Platz gewesen! Viel Geld, das muß ich sagen, kam mit ihr in das Haus, aber wenig Segen. Ich merkte bald, wir waren einander zu gleich, es hatte eines dieselben Fehler und Untugenden wie das andere, und da rechtet keines mit sich, sondern was man nicht gerne an sich selber sieht, das verschimpfiert man dann an dem andern. Sie war nicht besser wie ich. Ich sage nicht, daß sie auch leichtlebig gewesen wäre, aber sie war nicht besser als ich, und die Weibsleute sollen immer besser sein wie der Mann, sonst taugen sie nichts. Das war ein böses Einsehen, denn mit aller Hoffnung auf einen gedeihlichen Hausstand war es vorbei, und als Gott mein Hauskreuz zu sich nahm, da war es zu spät, ich hatte mich schon in alles darein ergeben, und es war nichts mehr da, nach was ich hätte verlangen mögen. — Ja, die erste Zeit hatte ich oft an die Kathrin’ gedacht, denn manchmal hätte ich wohl auch gerne jemanden zur Ansprache gehabt, von dem ich wußte, er sei mir so recht vom Herzen gut. Eines Abends setzte ich mich hin und schrieb einen Brief an sie, schrieb ihr, daß ich für sie und ihr Kind sorgen wolle, daß ich sie noch immer lieb hätte und daß sie auch mich nicht vergessen solle; und ich gestand ihr zu, es wäre vielleicht besser gewesen, ich wäre ihr zuliebe Knecht geworden, als wegen der andern auf der Mühle verblieben. Es war der erste Brief, es sollte auch der letzte sein. Eben als ich ihn zusiegeln wollte, erhielt ich eine Vorladung vors Kreisgericht, die Katharina Weninger hatte sich einen Advokaten genommen, damit er vor Gericht ausmache, daß ich ihr das Kind veralimentiere. Da hatte ich die Antwort auf meinen Brief und konnte das Porto ersparen. Die Vorladung vors Gericht, Hochwürden, die Vorladung vors Gericht, das war der erste Gruß nach so langer Zeit, das war das erste Lebenszeichen, das der Vater von seinem Kind erhielt. Da hab’ ich denn meinen Schreibbrief zerrissen, und weil gar kein Vertrauen zu mir war, auch für den Buben, so lang noch mein Weib und die andere lebte, nicht mehr getan, als mir ist aufgetragen gewest; an die Ansprach’ war nicht mehr zu denken, und seither hab’ ich mich auch ohne einer beholfen.“
„Das war wohl auch das Klügste, Herlinger. Der Brief, den Er an die Weninger schrieb, hätte doch zu nichts Gutem geführt. Wenn die Dirn’, nachdem sie einmal durch Ihn ins Unglück gekommen war, nicht weiter samt dem Kinde von ihm abhängig sein wollte, sondern ihr Recht suchte, so hat sie nur ihre Pflicht getan, und das war auch von ihr klug.“
„Ah ja, gescheit war schon, wie sie getan hat; war ja alles, was mir im Leben aufgestoßen ist, so viel gescheit, wie ich sag’, alles ordentlich ausgetipfelt, wie es kommen soll und will, daß ich mich nie dagegen hab’ rühren und wehren mögen, so hab’ ich mich schon in alles darein ergeben, aber Vertrauen hab’ ich nie eines gehabt und hab’ noch keines. Oft ist mir schon beim „Vater unser“ in den Sinn gekommen, auf die Letzt hat unser Herrgott auch — wie manche da herunten — doch viel Kinder und kann nicht für jedes auf gleiche Weis’ sorgen.“
„Herlinger, Er hat wohl wenig Zeit mehr, am allerwenigsten dazu, daß Er sich Gedanken macht, wobei Er sich wahrscheinlich selber wunderklug vorkommt; die Stadtleute nennen das Philosophieren, überlass’ Er das den Studierten, bei denen es doch Hand und Fuß hat, der Kopf oder das Herz, eines oder das andere, bleibt ja doch immer davon weg. Wenn ich nicht umsonst gekommen sein soll, so muß Er auf mich hören.“
„O ich bitt’, hochwürdiger Herr, ich bitt’, tut nur reden.“
„Darüber sind wir doch wohl einig, was Er sich erinnert in seinem Leben übel gemacht und getan zu haben, das will Er auch bereuen? Nicht?“
„O ja, gewiß, gewiß.“
„Damit die Reue nicht unfruchtbar bleibt, muß ich Ihm auch sagen, was Er noch gutzumachen hat.“
„Gutzumachen, an wem? An die Kathrin’ vielleicht! Der tut kein Bein mehr weh.“
„An euer beider Kind!“
„An dem Burschen, dem Florian? Der tut ja kein gut; der Herumtreiber, wie viel Geld hat er mich schon gekostet, und im vergangenen Herbst, wie ich ihn hab’ auf der Mühle behalten wollen, ist er geblieben? Ei ja, hätt’ ich seine Stadtdirn’ und ihr Kind dazu, die ganze leichtfertige Wirtschaft, mit in Kauf nehmen wollen ... das soll er sich aber nur vergehen lassen!“
„Müller, eben das wäre der gewiesene Weg, den Herumtreiber zum seßhaften, ehrlichen Mann zu machen. Und gerade von Ihm, Herlinger, hätte ich nicht gedacht, daß Er dagegen wäre, da Er weiß, wie es tut, wenn man da den Vater wider sich hat.“