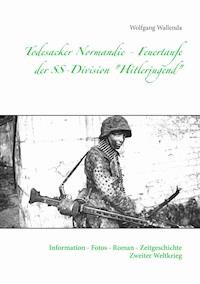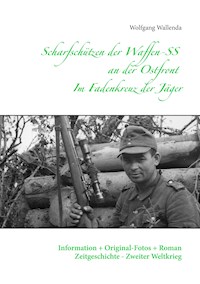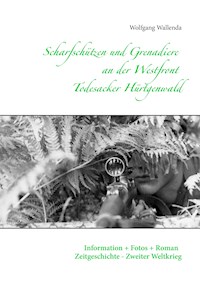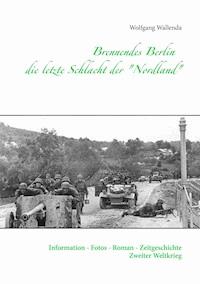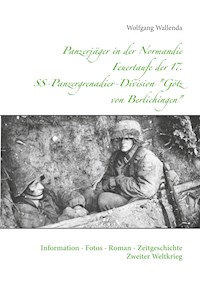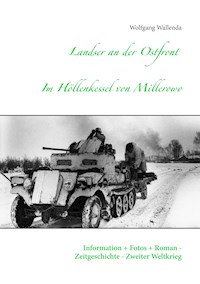Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Stalingrad 1942 - der 19jährige Alfred Müller ist Angehöriger der 100. Jäger-Division und lernt bei den Kämpfen in der Stadt und um das Werk "Roter Oktober" die Schrecken des Krieges kennen und hassen. Aufgrund seiner Schießfertigkeit avanciert er zum Scharfschützen. Nach der Einkesselung der 6. Armee nimmt das Schicksal seinen Lauf. Der junge Österreicher zieht als Jäger und Gejagter durch die Ruinen der sterbenden Stadt an der Wolga. Seine ständigen Begleiter sind Hunger, Kälte, Elend, Tod und Angst. Der Krieg schlägt täglich hart und erbarmungslos zu. Die Landser verrohen - ihre Hoffnung auf Rettung stirbt. Es gibt letztendlich nur noch zwei Wege, einem leidvollen, düsteren Schicksal zu entrinnen. Entweder man ergattert einen Platz in einem der Flugzeuge aus dem Kessel oder man findet Erlösung durch den Tod. Allgemeine Informationen über das Scharfschützenwesen der Wehrmacht sowie sechs Original-Fotos aus Stalingrad runden diesen Roman ab.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titelbild:
Bestand:
Bild 101 I - Propagandakompanien der Wehrmacht - Heer und Luftwaffe
Signatur:
Bild 101I-218-0517-24
Archivtitel:
Sowjetunion-Süd (Don-Stalingrad).- Schlacht um Stalingrad.- Deutscher Soldat (Scharfschütze) beim Zielen mit Gewehr mit Zielfernrohr; PK 694
Datierung:
September 1942
Fotograf:
Dieck
Quelle:
Bundesarchiv
„Der durchschnittliche deutsche Soldat im Zweiten Weltkrieg ... kämpfte normalerweise nicht im Glauben an die nationalsozialistische Ideologie - tatsächlich kam in vielen Fällen wohl eher das Gegenteil der Wahrheit näher.“
Dr. van Creveld, Professor für Geschichte an der Hebrew Universität in Jerusalem in seinem Buch "Kampfkraft"
„Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad.“
Kurt Huber, (1893-1943) deutscher Professor für Musikwissenschaften und Psychologie, Volksliedforscher und Mitglied der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ über die Schlacht von Stalingrad, im letzten, VI. Flugblatt der „Weißen Rose“
Zum Geleit
Wenn man etwas über das Thema „Stalingrad“ und „Scharfschützen“ liest, denkt man unweigerlich an eine legendenhafte Erzählung; nämlich an das Duell zwischen dem russischen Scharfschützen Wassili Grigorjewitsch Saizew und der wohl erdachten Figur des deutschen Offiziers Major König.
Diese Legende wird in diesem Buch allerdings nicht weiter hinterfragt oder in einer neuen Version dargestellt. Um dennoch „das Duell“ nicht zu übergehen, sorgt der nachfolgende Artikel für etwas Aufklärung.
Wassili Grigorjewitsch Saizew
Wassili Grigorjewitsch Saizew (russisch Василий Григорьевич Зайцев, wiss. Transliteration Vasilij Grigor'evič Zajcev; * 23. März 1915 in Jeleninskoje, Gouvernement Orenburg; † 15. Dezember 1991 in Kiew) war ein sowjetischer Scharfschütze während des Zweiten Weltkrieges. Er zeichnete sich besonders während der Schlacht von Stalingrad aus und war Vorlage für einige Bücher, Filme und Computerspiele.
Leben
Saizew wuchs als Sohn eines Hirten im Ural auf. Dort lernte er bereits in frühen Jahren während der Jagd den Umgang mit dem Gewehr. Nach dem Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion gelangte Saizew zur sowjetischen Marine, wo er in der Verwaltung eingesetzt wurde.
Im Spätsommer 1942 meldete er sich freiwillig zum Dienst an der Front, woraufhin er in das 1047. Schützenregiment der 284. Schützendivision versetzt wurde. Diese war im Rahmen der 62. Armee in Stalingrad eingesetzt. Während der Schlacht von Stalingrad soll Saizew nach sowjetischen Angaben als Scharfschütze zwischen dem 10. November und dem 17. Dezember 1942 insgesamt 225 deutsche Soldaten getötet haben. Nach Saizews eigenen Angaben sollen bis zum Januar 1943 noch 27 weitere dazugekommen sein.
Sowjetische Kriegsberichterstatter berichteten, dass Saizew innerhalb der ersten zehn Tage nach der Landung seiner Einheit am westlichen Wolgaufer 40 Deutsche mit Präzisionsschüssen tötete.[1] Außerdem leitete er in den Ruinen der Chemiefabrik „Lazur“ eine Scharfschützenschule[2], in der er 28 Soldaten ausbildete, die ihrerseits angeblich 3000 deutsche Soldaten töteten.[3]
Saizew wurde durch eine Landmine verwundet. Für seine Leistungen ernannte man ihn am 22. Februar 1943 zum Helden der Sowjetunion.
Nach seiner Genesung diente Saizew weiterhin an der Front. Dabei erreichte er bis 1945 den Rang eines Hauptmanns und wurde zusätzlich mit dem Leninorden, dem Rotbannerorden, dem Orden des Vaterländischen Krieges (1. Klasse), der Medaille „Für die Verteidigung Stalingrads“ und der Medaille „Sieg über Deutschland“ ausgezeichnet. Nach dem Krieg leitete er eine Fabrik in Kiew, bis er am 15. Dezember 1991 im Alter von 76 Jahren starb.
Zitat
Saizews berühmtes Zitat zur Lage der sowjetischen Verteidiger in Stalingrad:
„Es gibt kein Land für uns hinter der Wolga.[4]“
Fälschlicherweise wird dieser Ausspruch in einigen Quellen dem Kommandeur der 13. Gardeschützen-Division Alexander Iljitsch Rodimzew zugeordnet.
Rezeption
Bereits während des Krieges wurde Saizew von der sowjetischen Propaganda gefeiert. Ein Zusammenstoß in Stalingrad mit einem unbekannten, aber „sehr fähigen Scharfschützen“, wie Saizew in seiner Biographie vermerkte, wurde von der damaligen sowjetischen Propaganda zu einem mehrtägigen Duell verklärt.
Demnach sei ein gewisser Major König, Leiter einer deutschen Scharfschützenschule in Zossen, auf obersten Befehl nach Stalingrad entsandt worden, um Saizew aufzuspüren und zu liquidieren. Oberst Batjuk, Kommandeur der 284. Schützen-Division, habe daraufhin Saizew persönlich den Befehl erteilt, Arbeitsweise, Tarnung und Schießgewohnheiten von Major König zu studieren, um ihn gezielt zu bekämpfen.[2] Das angebliche Duell zwischen Saizew und Major König wurde als eine Art personalisierte Einzelkriegsführung inmitten der Massenschlacht von Stalingrad hingestellt. Mit Feldstechern und Teleskopen hätten Saizew, sein Beobachter und Gruppenscharfschütze Nikolai Kulikow sowie der Agitprop-Politkommissar Danilow tagelang das Gefechtsfeld auf Spuren und etwaige Geländeveränderungen von Major König abgesucht.
Erst als Danilow sich aus seiner Deckung bewegt habe und von einem gegnerischen Schützen an der Schulter verwundet worden sei, soll sich Major König enttarnt haben. Saizew habe König entweder in einem Unterstand mit abgeklebten Sehschlitzen, einem Stück Eisenblech oder einem Haufen Ziegelsteinen vermutet. Kulikow habe einen Blindschuss abgegeben, um König dazu zu bewegen, seine Position zu verraten. Zur Täuschung habe Kulikow seinen Stahlhelm aus der Grabenstellung gehoben und nach Königs Schuss einen Schmerzensschrei imitiert. Major König habe sich dann aus seinem Versteck erhoben und sei von Saizew mit einem Kopfschuss getötet worden.[5]
Erwähnt wurde dieses Duell nur von sowjetischen Quellen.[6] In den Unterlagen der deutschen Wehrmacht findet sich kein Major Erwin König. Außerdem galt die Tätigkeit als Scharfschütze in der deutschen Armee als eines Offiziers „unwürdig“ und wurde in der Regel von Mannschaftsdienstgraden ausgeübt. So kamen selbst die erfolgreichsten und höchstdekorierten Scharfschützen der Wehrmacht, Matthäus Hetzenauer und Friedrich Pein, nie über den Dienstgrad eines Gefreiten bzw. Oberjägers hinaus.
Schon 1973 veröffentlichte der Autor William Craig (1929–1997) in seinem Buch Enemy at the Gates – The battle for Stalingrad auch im Westen eine Beschreibung des Scharfschützenduells. Saizew selbst veröffentlichte seine Memoiren schließlich im Jahre 1981.[7] Nachdem Saizews Geschichte erstmals auch in einem Film Ангелы Смерти (dt. Todesengel)[8] dargestellt wurde, griffen westliche Medien das Thema wieder vermehrt auf. Im Jahre 1998 kam der Autor Antony Beevor in seinem Buch Stalingrad zu dem Schluss, dass die Geschichte trotz einiger realer Anleihen im Wesentlichen Fiktion sei.[9] Trotzdem erschien nur ein Jahr darauf der Roman War of the Rats von David L. Robbins, in dem das Duell wieder ein zentrales Motiv darstellte.[10] Dieser bildete wiederum die Grundlage zu dem Film Duell – Enemy at the Gates von Jean-Jacques Annaud aus dem Jahre 2001, in dem Saizews Rolle von Jude Law verkörpert wurde.[11]
Im Jahre 2006 wurden die sterblichen Überreste Saizews umgebettet und gemäß seinem letzten Willen auf dem Mamajew-Hügel neben der Stalingrad-Gedenkstätte in Wolgograd beigesetzt. In einem dort befindlichen staatlichen Museum ist auch sein mit einer patriotischen Inschrift versehenes Mosin-Nagant-Gewehr ausgestellt.
Einzelnachweise
1. Major John Plaster: The Ultimate Sniper, in www.snipersparadise.com/history/vasili.htm
2. William E. Craig: Die Schlacht um Stalingrad, Tatsachenbericht. 8. Auflage. Heyne, München 1991 (Originaltitel: Enemy at the gates, The Battle for Stalingrad, übersetzt von Ursula Gmelin und Heinrich Graf von Einsiedel), ISBN 3-453-00787-5, S. 114.
3. http://www.spiritus-temporis.com/vasily-grigoryevich-zaitsev/
4. Nikolai Krylow: Stalingrad. Die entscheidende Schlacht des Zweiten Weltkriegs, Paul Rugenstein Verlag, Köln 1981, ISBN 3-7609-0624-9,S. 174.
5. William E. Craig: Die Schlacht um Stalingrad. Tatsachenbericht, 8. Auflage. Heyne, München 1991 (Originaltitel: Enemy at the gates, The Battle for Stalingrad, übersetzt von Ursula Gmelin und Heinrich Graf von Einsiedel), ISBN 3-453-00787-5, S. 119–122.
6. http://www.russian-mosin-nagant.com/
7. В. Г. Зайцев: За Волгой земли для нас не было – Записки снайпера, Современник, Москва 1981.
8. Ангелы Смерти, Russland/ Frankreich 1993, Regie: Juri O-zerow
9. Antony Beevor: Stalingrad, Penguin Books, London 1998. ISBN 0-14-024985-0.
10. David L. Robbins: War of the Rats, Bantam Books, 1999. ISBN 0-553-58135-X.
11. Duell – Enemy at the Gates, USA/ UK/ BRD/ Irland/ Polen 2001, Regie: Jean-Jacques Annaud.
Quelle:https://de.wikipedia.org/wiki/Wassili_Grigorjewitsch_Saizew
Lizenz:https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
Vorwort
Das Scharfschützenwesen der Wehrmacht und der Waffen-SS habe ich in meinen Büchern: „Scharfschützen der Waffen-SS an der Ostfront“ und „Scharfschützeneinsatz in Woronesch“ bereits stichpunktartig vorgestellt.
Um Lesern, die meine beiden anderen Bücher nicht kennen, dennoch themenbezogene Hintergrundinformationen zu geben, habe ich am Ende dieses Buches ein paar Auszüge angefügt.
Anmerkung:
Dies ist eine fiktive Geschichte, eingebettet in Überlieferungen aus verschiedenen Quellen. Tatsächliche Einzelschicksale wurden in diesem Buch eingeflochten und somit die Nähe zur Realität gewahrt.
Der Protagonist ist frei erfunden. Dessen, aus vielen realen Erlebnissen zusammengefügte Geschichte, hätte sich aber genauso zutragen können.
Bis auf historische Persönlichkeiten sind alle Namen frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig.
Schwarze Rauchschwaden hingen über der Stadt und vermengten sich mit der gemächlich einbrechenden Dunkelheit. Beißender Geruch kroch durch die Straßen. Mal undurchsichtig dick, mal aufgelockert wie dünne, dunkelschwarze Nebelschleier. Es war ein Gemisch aus Pulverschmauch und dem Qualm der Schwelbrände. Erwischte man zu viel davon, kratze es im Hals und stach in der Lunge.
Wir hörten pausenlos das Grollen der Artillerie. Hin und wieder rumste es. Wenn schwere Granaten in unserer Nähe detonierten, rieselte etwas Kalk und Staub von der Kellerdecke.
„Das ist der Russe.“
„Nee, das sind unsere eigenen dicken Koffer. Ich schätze, sie schlagen drüben am Mamai-Hügel ein.“
„Es hieß schon vor drei Wochen, dass Stalingrad schnell fallen würde. Jetzt schicken die Russen immer noch eine Division nach der anderen über die Wolga. Mir gefällt das alles nicht. Scheint ein verfluchtes Nest zu sein, dieses Stalingrad.“
Ich hörte dem Gespräch zwischen Oberjäger Kremer und dem Obergefreiten Zerberich, den alle nur Zerbi nannten, aufmerksam zu. Sie sprachen mit gedämpften Stimmen, die eigenartig rau und trocken klangen.
Es ging weder vorwärts noch durften wir uns zurückziehen. Wir saßen seit fast 24 Stunden fest. Als Unterschlupf diente uns der Keller eines halbwegs unzerstörten Hauses.
„Hier waren schon mal welche gesessen“, stellten wir fest, da wir außer einer funktionstüchtigen Karbollampe noch jede Menge Abfall vorgefunden hatten. Vornehmlich leere Konservendosen und Zigarettenkippen der Marken Oberst und Juno.
Unsere Gruppe bestand aus sieben Mann. Vor einer halben Stunde waren wir noch zu neunt. Der Tod kommt in Stalingrad schnell und schlägt erbarmungslos zu. Unsere Situation war fatal. Die Feldflaschen waren leer. Durst plagte uns.
Ich fragte mich, wie wir in diese Situation geraten konnten und warum es so lange dauerte, bis das Gros der Kompanie nachzog und wir den gesamten Straßenzug wieder vom Russen befreien und ihn endlich komplett über die Wolga drängen würden. Gedanken rasten durch meinen Kopf. Der Auftrag lautete, die Arbeitersiedlung einzunehmen und den Russen über die Wolga zu drängen.
Verdammt, das kann doch nicht so schwer sein. Wir sind die stärkste Armee der Welt. Warum kämpfen die russischen Soldaten so verbissen um jedes Haus? Wie konnte es nur so weit kommen? Der Angriff war doch anfangs gut verlaufen.
„Stellung halten!“, war schließlich ausgegeben worden.
Genau das machten wir. Unser Zug bzw. das was davon übrig war, hatte das vorderste Haus des Straßenzuges besetzt. Wir im Keller, eine Gruppe irgendwo in den oberen Stockwerken. Dort war auch unser Leutnant mit dem Rest des Zugtrupps. Im Nachbaranwesen befanden sich zwei MG-Nester und kontrollierten die Straße. In einem der benachbarten Häuser hockten zudem ein paar Pioniere. Wo genau, konnte ich nicht sagen. Hin und wieder krepierten beim Russen drüben die Granaten einer unserer Panzerabwehrkanonen, die ebenfalls in unserer Nähe in Stellung gegangen war. Entweder hatten die Pioniere oder aber die Bedienmannschaft der Pak gestern zwei T 34 abgeschossen. Die Wracks der beiden Panzer blockierten die Straße und machten jegliches Vorrücken anderer Fahrzeuge unmöglich.
„Um sie zu entfernen, braucht man schweres Gerät“, hatte Oberjäger Kremer gesagt.
Zwischen den braununiformierten Russen und uns war eine Patt-Situation entstanden. Wir hockten hier, schräg gegenüber der Iwan. Das Fatale an unserer Lage war, dass wir wie die Spitze einer Lanze in das von Russen besetzte Gebiet ragten. Lediglich ein schmaler Streifen, der jedoch vom Feind eingesehen werden konnte, verband uns mit der Kompanie.
Mehrfach hatte der Iwan versucht vorzurücken, doch jeder Angriff wurde durch heftiges Feuer unserer beiden MG 42 und ein paar Granaten von der Pak sofort blutig gestoppt. Zudem hatten die Pioniere nachts ein paar Sprengfallen ausgelegt, in die der Russe prompt hineingelaufen war. Es lagen immer noch fünf oder sechs Leichen auf der Straße und zwischen den Trümmern der Hausruinen.
Als ich Meier heute Morgen fragte, warum die Russen keinen Parlamentär mit weißer Fahne schickten, um die Gefallenen zu bergen, lachte er nur kurz und flüsterte mir zu: „Seit den Massakern von Feodosia gibt es keine Gnade mehr! Der Krieg an der Ostfront ist hart und kalt geworden. Wir töten die Russen, die Russen rächen sich und töten uns. Dann rächen wir uns wieder. Alles schaukelt sich auf. Die Menschlichkeit ist längst gestorben. In diesem Krieg geht es nur noch ums nackte Überleben. Ich habe beim Vormarsch Dinge gesehen, die hätte ich niemals sehen dürfen.“
„Was denn?“
Meier hatte sich vorsichtig umgesehen, keiner der Kameraden hörte uns zu. Er kam ein Stück näher und hauchte die Worte beinahe in mein Ohr.
„Wir sind nicht nur Soldaten, wir sind auch das Werkzeug des Teufels. Tausende wurden hingerichtet. Ich habe es auf dem Vormarsch mit eigenen Augen gesehen und ich glaube nicht, dass alle Partisanen waren, die vor den Läufen unserer Maschinengewehre standen. Da waren Frauen und Kinder dabei! Kamerad, wir kämpfen nicht mehr darum eine gerechtete Welt zu schaffen, wir kämpfen darum, dass der Feind nicht heim ins Reich kommt und das gleiche mit unserer Zivilbevölkerung anstellt.“
Ich war geschockt. Meiers Worte waren hart. Er war ein vernünftiger und rechtschaffener Mann. Ich wusste, dass er nicht log und das brachte mich zum Nachdenken.
Meier hatte sich freiwillig gemeldet, als Kremer fragte, wer die Feldflaschen nimmt, nach hinten geht und Wasser holt. „… mit etwas Glück bringst du ja die Essensträger oder Verstärkung mit“, hatte der Gruppenführer ihn verabschiedet.
Minuten später passierte es. Ein einziger Schuss krachte. In einer Schlacht um eine Stadt, in einem Krieg des Gemetzels, ist das an und für sich nichts Besonderes und dennoch verbreitete dieser Knall mehr Angst und Schrecken als tausende von Schüssen, die während des Kampfes um diesen Straßenzug gefallen waren. Dieser eine Schuss beendete das Leben des Gefreiten Herbert Meier.
„Scharfschütze“, hatte Weinberger mehr ausgepustet als ausgesprochen.
Gänsehaut überzog meinen Körper. Angst und Trauer legten sich wie ein dunkler Schatten über mich. Ich war sehr betroffen. Mit Meier verlor ich nicht nur einen Kameraden, ich verlor zum ersten Mal in diesem Krieg einen Freund. Ich kannte das Foto seiner Frau. Voller Stolz in den Augen präsentierte er es, um danach sofort das Bild seiner Tochter daneben zu halten. „Und wenn ich Weihnachten Urlaub bekomme, werden wir für einen Stammhalter sorgen“, lachte er, als er sie mir gestern Nacht im Schein der Karbollampe zum letzten Mal gezeigt hatte.
Jetzt lag er zwischen den Trümmern der sterbenden russischen Stadt, deren Name noch zum Synonym für Angst, Schrecken, höllische Qualen und dem Tod werden würde.
Stalingrad.
„Das muss nicht unbedingt ein Scharfschütze gewesen sein. Vielleicht war es ein ganz normaler Iwan, dem Meier vor die Flinte gelaufen ist“, beschwichtigte Zerbi, um uns zu beruhigen.
Kremer übernahm sofort das Wort. „Ohne Wasser werden wir in zwei Tagen verdurstet sein. Leutnant Hübner hat angeordnet, dass ein Mann von uns Wasser holen soll, und das werden wir.“
Schweigen.
„Wer möchte es jetzt versuchen? Meldet sich noch jemand freiwillig?“
„Ich gehe“, hob Richard die Hand.
Ich kannte Richard Wagner nicht näher. Er war ziemlich introvertiert, schottete sich regelmäßig ab. Ohne sich noch einmal umzudrehen, kroch Wagner aus dem Kellerloch, robbte ein paar Meter hinter einem Geröllhaufen entlang und verharrte kurz. Dann sprang er auf und hastete im Zickzack zwischen den Trümmern durch. Geschickt nutzte der Landser jede Deckungsmöglichkeit, die sich ihm bot. Wie alle anderen auch, beobachtete ich gebannt das Schauspiel.
„Er ist gut. Er schafft das“, murmelte Oberjäger Kremer in seinen Stoppelbart.
Es lag wohl mehr Hoffnung als Glaube in diesem Satz, denn kaum hatte der Soldat ihn ausgesprochen, drehte er sich zu mir um, betrachtete mich eine Weile und schüttelte schließlich mit dem Kopf.
Ich konnte diese Geste anfangs nicht deuten, dann wusste ich es. Kremer wartete auf den nächsten Schuss.
Wasser holen ist ein Himmelfahrtskommando, durchströmte es mich.
„Er hat es bis zu Meier geschafft“, flüsterte Weinberger.
Es wäre nicht nötig gewesen uns das mitzuteilen, denn bis auf Kremer beobachteten immer noch alle die Szene, die sich vor unseren Augen abspielte.
Kremer hatte sich eine Zigarette gedreht. Ein Streichholz flammte auf. Tabak begann zu glimmen. Mit dem ersten kräftigen Lungenzug wurde das Gesicht des Oberjägers orangerot angeleuchtet.
„Er schafft es“, murmelte er erneut und blies den Rauch aus.
Im fahlen Licht der Karbidfunzel erkannte man, wie sich eine kleine wabernde Wolke aus bläulichem Dunst bildete und sich langsam Richtung Kellerfenster bewegte.
Eine Leuchtkugel zischte nach oben. Flackernd erhellte das künstliche Magnesiumlicht die Trümmer des zerstörten Stalingrads.
Zarizyn, so hieß die Stadt, die sich ca. 40 Kilometer an der mächtigen Wolga entlang zog, bis 1925. Nach dem russischen Bürgerkrieg wurde sie zu Ehren von Josef Stalin in Stalingrad umbenannt.
Im Norden befanden sich die Arbeitersiedlungen, die an das mächtige Industrieviertel mit seinen Großfabriken grenzten. Im Westen bildete eine Hügelkette, im Osten die Wolga eine natürliche Grenze. Zahlreiche Balkas, tiefe Erosionsschluchten, zogen sich von der Steppe durch Stalingrad bis hin zur Wolga.
Seit jeher war die Stadt, aufgrund ihrer Lage zwischen Don und Wolga, ein wichtiger Knotenpunkt für den Handel.
Jetzt war sie auf groteske Art und Weise zum Mittelpunkt des Deutsch-Sowjetischen Krieges geworden. Hitler wollte sie mit Gewalt einnehmen, Stalin unter allen Umständen halten. Wir saßen mittendrin.
Am 23. August 1942 erlebte Stalingrad den schwersten Luftangriff in der Geschichte der Sowjetunion. Der Himmel färbte sich beinahe dunkel, als die deutsche Luftwaffe mit ihren He 111 und Ju 88 Bombern, begleitet von Stukas, Messerschmidt und Focke-Wulff-Jägern über sie hinwegrauschten. Das Brummen der schweren Propellermotoren kündigte das Inferno an. Tonnen von Bomben wurden abgeladen. Ein Bombenteppich wurde an den nächsten gereiht. Die Sirenen der Sturzkampfbomber sorgten zusätzlich für unvergesslichen Psychoterror unter der Zivilbevölkerung.
Rauchsäulen schossen nach oben. Fabrik- und Wohngebäude stürzten ein. Tod und Zerstörung kamen über die Stadt an der Wolga. Selbst das Krankenhaus wurde von mehreren Bomben getroffen. Brennendes Öl floss in die Wolga. Brandbomben lösten zusätzlich eine Feuersbrunst aus. Die Zivilbevölkerung glaubte sich in der Hölle wiederzufinden, dennoch war dies alles nur der bittere Vorgeschmack zur wahren Hölle. Der Hölle Stalingrad. Geschätzte 40.000 Bewohner fanden bei den tagelangen Bombenangriffen den Tod. Sie wurden zerfetzt, von Trümmern erschlagen, verbrannten qualvoll oder erstickten im Rauch der Feuersbrünste.
Zeitgleich rollte die Spitze der 6. Armee, geführt von General Paulus, auf die Stadt an der Wolga zu. Siegessicher strahlten die jungen Männer in die Kameras ihrer Kameraden oder denen der Wehrmachts-Propaganda. Blonde Haare wehten im Wind der Don-Steppe. Panzer durchpflügten das Land, zogen ewig lange Staubwolken nach sich. Infanteristen marschierten scheinbar bestens gelaunt auf Stalingrad zu, der Stadt, die ihr grausames Schicksal werden sollte. Die Hölle machte keine Ausnahmen. Sie quälte Russen und Deutsche, Zivilisten und Soldaten gleichermaßen.
Der Landser, in den wir all unsere Hoffnung auf Wasser gelegt hatten, warf sich augenblicklich zu Boden.
„Ich habe gesehen, dass er alle Feldflaschen bei Meier mitgenommen hat“, stieß Weinberger als nächstes aus.
„Meier war ein braver Kerl“, tönte der Oberjäger. „Es erwischt immer die Guten.“
„Der russische Scharfschütze hat sich bestimmt verkrochen. Er hätte doch sonst schon längst auf Wagner geschossen“, meinte Hofer.
Hofer war der Jüngste von uns. Er war gemeinsam mit mir bei der Truppe angekommen.
Ein Maschinengewehr ratterte los. Leuchtspurmunition zeigte die Flugbahn der Projektile an. Sie schmetterten gegen das Haus, in dem der russische Scharfschütze vermutet wurde.
„Scheinbar hat er noch mehr Kameraden verärgert.“
„Weinberger, du bist ein Arschloch. Er hat niemand verärgert, er hat schlichtweg unseren Kameraden Meier erschossen“, zischte ich wütend aus.
„Ruhe!“, mahnte unser Oberjäger.
„Wenn er uns nur ärgert, wieso gehst dann nicht du und holst Wasser?“, schob ich nach und betonte dabei das du besonders. „Du hättest dich ja auch freiwillig melden können.“
„Was soll das heißen?“
„Ruhe, verdammt noch Mal!“, kam die zweite Mahnung von Kremer.
Weinberger rutschte vom Eingang weg und baute sich vor mir auf. „Sag schon, du Dreitage-Soldat! Was soll das heißen? Ich bin vom ersten Tag an dabei, und du? Du bist gerade mal vier oder fünf Wochen hier draußen und riskierst schon ´ne dicke Lippe!“
„Verdammt nochmal! Ich sagte, ihr beide sollt ruhig sein!“, brüllte Kremer.
Weinberger wich einen Schritt zurück. Er starrte mich an, war sichtlich wütend. „Dieser Rekrut braucht mich nicht so dumm von der Seite anzuquatschen, Robert. Das muss ich mir nicht gefallen lassen.“
Ich überlegte, ob ich darauf etwas erwidern sollte, entschied mich aber zu schweigen.
„In diesem Kellerloch werden wir noch alle verrückt. Wir brauchen Wasser und wenn es unser Mann wieder nicht schafft, muss einer von euch beiden gehen!“
Weinberger zuckte zusammen. Ich schnaufte tief ein und langsam wieder aus. Ein schneller Blick nach draußen folgte. Das Magnesiumlicht der Leuchtkugel lag in den letzten Zügen. Gleich würde es erlöschen.
„Warum haben wir keine Scharfschützen hier?“, fragte ich. „Sie könnten den Russen ausschalten.“
„Siehst du, wie schlau er daher redet?“, schimpfte Weinberger.
In diesem Moment fällte ich eine Entscheidung. Ich wollte mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Mit dem Gewehr konnte ich schon immer gut umgehen. Seit ich vier Jahre alt war, verbrachte ich die Sommermonate bei meinem Großvater im Alpenvorland. Er war dort Jäger, lehrte mich Fallen zu legen und auf Spuren zu achten. Später, als ich zehn Jahre alt war, brachte er mir das Schießen bei. Mit seiner alten Flinte durfte ich später allein auf Kaninchenjagd gehen oder mit ihm gemeinsam Rot- und Niederwild schießen. Ich konnte stundenlang auf der Pirsch sein und durch den Wald streifen. Gefühlte Ewigkeiten verbrachte ich mucksmäuschenstill auf dem Hochstand. Dort fühlte ich mich frei.
Als ich 17 Jahre alt war, starb Großvater. Nach meiner Lehre als Schlosser meldete ich mich freiwillig zur Wehrmacht. Ich kam zum Reichsarbeitsdienst und wartete auf meine Einberufung. Schließlich kam ich zu den Gebirgsjägern.
Mein Vater war Veteran des Ersten Weltkrieges und glühender Verehrer von Adolf Hitler. Während meine Mutter große Bedenken hatte, war Vater stolz auf mich. Er dachte, ich würde meinen Beitrag für das Vaterland leisten und später von großen Heldentaten berichten. „Du trittst deinen Dienst als einfacher Jäger an und wirst bald als Oberjäger oder sogar Feldwebel zurückkehren. Das verspreche ich dir, mein Junge“, hatte er gesagt und mir auf die Schulter geklopft, als ich mich verabschiedete und am Hauptbahnhof Graz in den Zug stieg.
Der wahre Grund für mein Handeln war jedoch viel banaler. Es war verschmähte Liebe. Meine Edeltraud hatte sich für einen anderen jungen Mann entschieden. Ich wollte nur noch weg von zu Hause, hielt es nicht mehr aus. So wurde ich Soldat. Eigentlich dachte ich, dass ich als Gebirgsjäger viel in der Natur sein würde, doch stattdessen hatte das Schicksal meine Division nach Stalingrad geführt.
Der Marschbefehl traf am 21. September 1942 im Stab der 100. Jäger-Division ein. Wir sollten die im Stadtzentrum kämpfenden deutschen Divisionen unterstützen. Mein Regiment erreichte am 26. September den Stalingrader Kriegsschauplatz. Das, was wir vorfanden, glich keiner Stadtlandschaft mehr. Wir befanden uns in einem riesigen Trümmerfeld.
Die Antwort auf die Frage, wie es soweit kommen konnte, wurde uns ebenfalls sofort gegeben. Kaum hatten wir unsere Ausgangsstellungen erreicht, ging es sofort los. Russische Luftwaffe und Artillerie hämmerten seit unserer Ankunft pausenlos auf uns ein. Überall zischte, heulte und rumste es. Unsere Verluste waren enorm.
So wollte ich nicht verrecken. Weder durch die Splitter einer Granate noch durch die herabfallende Kellerdecke des Gebäudes, in dem wir uns verkrochen hatten, sollte es durch einen Volltreffer zusammenbrechen. Und schon gar nicht wollte ich das Opfer eines russischen Heckenschützen werden.
„Robert, kann ich dein Fernglas haben?“, fragte ich Oberjäger Kremer.
Dieser griff zur Seite und reichte es mir. Ich prüfte meinen Karabiner 98. Ein gutes Gewehr. Das Visier war richtig eingestellt und ich hatte nach dem letzten Reinigen einen frischen Ladestreifen eingesetzt.
„Was hast du vor?“, wollte Kremer wissen.
„Handeln“, antwortete ich und kroch ins Freie.
Schon nach ein paar Metern fand ich einen geeigneten Platz. Ich hob den Feldstecher an die Augen und suchte Wagner. Der erfahrene Landser verharrte immer noch an der Stelle, an der er sich hingeworfen hatte, als die Leuchtkugel nach oben gezischt war.
Er geht sehr besonnen vor. Was würde Großvater jetzt tun? Das Lockfutter ist ausgelegt, von wo betritt der hungrige Eber das freie Feld, um die leckeren Eicheln zu fressen?
Ich stellte mir einfach vor, ich wäre auf Wildschweinjagd. Wagner war das Lockmittel, der Russe mein Ziel. Ich schwenkte das Fernglas herum und beobachtete geduldig das Haus, in dem der Scharfschütze vermutet wurde.
Nichts! Verdammter Mist!
Ich konnte mich noch so anstrengen, es war absolut nichts zu erkennen.
„Jetzt läuft er weiter“, hörte ich von hinten.
Mein Herz begann schneller zu pochen.
„Zickzack. Jetzt hat er sich abgeduckt.“
Es war die Stimme von Oberjäger Kremer. Er wusste, was ich vor hatte und informierte mich darüber, was Wagner machte.
Er muss auf jeden Fall in einem der höheren Stockwerke sitzen, da er von unten zu wenig Sicht hat. Die Leuchtspurgarben der Maschinengewehre sind vorhin ganz oben eingeschlagen. Vielleicht sitzt er nicht ganz so weit oben. So muss es sein. Er hat seine Position geändert. Deshalb hat er Wagner noch nicht entdeckt bzw. noch nicht im Visier gehabt.
Ich konzentrierte mich auf das mittlere Stockwerk. Im fahlen Licht des abnehmenden Mondes hatte ich immer noch einigermaßen gute Sicht. Im Mauerwerk befand sich ein größeres Loch.
Würde ich mich dort platzieren? Gutes Schussfeld. Perfekte Position, fiel mir sofort ein und ich verharrte für einen Moment an dieser Stelle.
Nein! Dort würde sich garantiert kein Jäger hinlegen, denn dort wird der Jäger vermutet.
Ich entdeckte ein kleines Fenster.
Dahinter würde ich mich auf Lauer legen!
Ich brachte meinen K 98 in Anschlag und visierte das kleine Fenster an. Mein Atem war flach. Gedanklich befand ich mich wieder bei meinem Großvater. Ich sah mich auf dem Hochstand und visierte mit der Büchse den Eber an.
„Wagner läuft weiter!“
Ein Schuss knallte. Ich sah einen Mündungsblitz. Ausatmen, Luft anhalten, im Ziel bleiben und abdrücken war ein auf der Jagd oft geübtes Zusammenspiel. Nur Sekundenbruchteile nachdem der Russe geschossen hatte, drückte auch ich ab. Der Kolben stieß gegen die Schulter. Im Automatismus eines Soldaten repetierte ich und bugsierte so die nächste Patrone in die Kammer.
„Verdammte Scheiße! Er hat Wagner erwischt!“
Ich hörte die Worte anfangs gar nicht. Ich war wie benommen.
Seit ich die Truppe erreichte, hat sich mein Leben beinahe täglich verändert. Ich kam als Soldat, der sich aus Liebeskummer heldenhaft an der Front in den Tod stürzen wollte. Mein Ziel war es, meine große Liebe ein letztes Mal zu beeindrucken. Stattdessen lernte ich etwas anderes kennen.
Kameraden, die aus verschiedensten Gründen den Weg zur Wehrmacht wählten bzw. unfreiwillig einberufen worden waren. Männer, die zusammenhielten und für einander ihr Leben riskierten.
Läuse, die sich verbreiteten, egal wie gut man selbst für Körperhygiene sorgte.
Gehorsam und Genügsamkeit lernte ich ebenfalls kennen. Man freute sich über ein Stück Kommissbrot und eine Tasse heißen Kaffee mehr als früher auf die Schulferien. Alles, was zu Hause als selbstverständlich betrachtet wurde, war hier an der Front etwas Besonderes.
Ich lernte binnen kürzester Zeit zu schlafen, wenn es die Gelegenheit dazu gab und wach zu bleiben, wenn es die Situation erforderte.
Und ich lernte den Krieg kennen. Ich sah meine erste Leiche, lange bevor ich an der Front ankam.
Es war an einem Güterbahnhof, wir hatten eine Stunde Aufenthalt und vertraten unsere Beine. Die Ortschaft war nicht gerade groß und wir verließen in Gruppenstärke das Bahnhofsgelände, um im Ort etwas Lohnenswertes einzukaufen. Manche Kameraden wollten Wein oder Schnaps, ich suchte nach Obst. Auf dem Dorfplatz standen Galgen. Zwei Männer und eine Frau waren aufgehängt worden. Der unangenehm penetrant süßliche Geruch von verwesendem Fleisch kroch in meine Nase. Schwärme von Fliegen hatten sich bei den Erhängten versammelt, setzten sich, krabbelten herum und flogen wieder weg. Am Galgen war ein Schild angenagelt.
„Banditen“
Man hatte es sowohl in deutscher Sprache als auch in kyrillischen Buchstaben darauf geschrieben. Zumindest vermutete ich, dass das kyrillisch geschriebene Wort die gleiche Bedeutung hatte.
Als ich die Toten hängen sah, wurde mir augenblicklich schlecht. Die Körper waren aufgedunsen, hingen dementsprechend schon eine Weile da. Einem vorbeikommenden Feldgendarm war aufgefallen, wie schockiert wir auf die Leichen starrten.
„Partisanen. So geht es allen, die sich gegen uns stellen“, kommentierte er und zeigte mit einer leichten Kopfbewegung in Richtung Galgen.
„Warum beerdigt man sie nicht“, fragte Hofer nach.
„Zur Abschreckung, Kamerad. Zur Abschreckung. Die Bolschewisten sollen wissen was ihnen blüht, wenn sie sich gegen uns stellen. Diese Drecksäcke haben einem unserer Männer die Kehle durchgeschnitten. Dann sind sie in ein Lager eingebrochen und wollten Fressalien stehlen. Ihr Pech war, dass der Wachwechsel aufgrund eines Rhythmuswechsels früher als üblich durchgeführt wurde und sie erwischt wurden.“
Als ich das Grinsen im Gesicht des Kettenhundes registrierte, während er erzählte, überkam mich ein Gefühl des Ekels. Ich kehrte damals um und ging zurück zum Waggon. Mir war in diesem Augenblick klar geworden, dass Krieg nicht das heroische Kämpfen und Sterben war, das uns in der Schule und in der Hitlerjugend gelehrt wurde. Krieg war grauenvoll und ich befand mich auf dem Weg dahin, ein Teil davon zu werden. Es war eine Straße ohne Wendemöglichkeit.
Später, in Stalingrad, gewöhnte ich mich an den Anblick von Toten. Ich sah erschossene Soldaten, verbrannte Körper, zerfetzte Menschen. Die meisten trugen Uniform. Ich sah aber auch tote Kinder und Frauen. Opfer von Bomben und Granaten, Opfer von Querschlägern und Schrapnells.
Man stumpft schneller ab als man denkt.
„Wagner hat es erwischt. Dieser russische Scharfschütze hat wieder zugeschlagen“, donnerte Weinberger.
Ich war wie in Trance, als ich aufstand und mein Gewehr schulterte. Dann stülpte ich den Lederriemen des Fernglases um den Hals und ließ es vor meiner Brust baumeln. „Ich habe ihn sicherlich erwischt“, stieß ich im Unterbewusstsein aus und marschierte los. „Ich hole Wasser“, schob ich nach und wankte ein wenig. Meine Knie waren weich. Ich hatte vermutlich soeben zum ersten Mal in meinem Leben bewusst auf einen Menschen geschossen und ihn verwundet oder getötet. Ich spürte weder Befriedigung noch Wehmut. Ich war leer. Meine Gedankenwelt ließ es nicht zu, dass sich ein Bild abzeichnete.
„Bleib stehen!“, hörte ich, kümmerte mich aber nicht um den Befehl.
Als ich auf der Höhe von Meier war, kniete ich mich hin.
Kopfschuss!
Ich öffnete die Feldbluse und brach die untere Hälfte der Erkennungsmarke ab. Danach stand ich auf und ging weiter zu Wagner. Auch hier kniete ich mich hin, stellte einen Kopftreffer fest, zog an der dünnen Kette die Erkennungsmarke hervor, brach sie ab und schob sie zu der anderen in die Brusttasche meiner Feldbluse. Als nächstes griff ich nach den Feldflaschen, umklammerte die Lederriemen und rannte los.
Hinter mir jagten unsere beiden MG-Besatzungen ein paar Salven aus ihren Waffen. Vermutlich wollten sie eine Art Sperrfeuer schießen, um mir zumindest eine kleine Überlebenschance einzuräumen.
Ohne es in diesem Moment zu begreifen, hatte ich mich auf einen Wettlauf mit dem Tod eingelassen. Geduckt hetzte ich durch die Trümmerlandschaft. Meine Knobelbecher suchten sicheren Halt im Gewirr aus Steinen, Holzbalken und Eisenteilen. Aufkommendes kurzes Gewehrfeuer verstummte wieder. Ich huschte in die nächste Seitenstraße, hielt an und lehnte mich gegen die Hauswand. Mein Brustkorb hob und senkte sich rasend schnell. Ich rang nach Sauerstoff. Gleichzeitig breitete sich ein leichtes Gefühl von Euphorie aus.
Ich habe es geschafft! Ich kann Wasser für meine Kameraden holen.
Nach einer kurzen Pause lief ich die Straße entlang. Ich erkannte das ausgebombte Geschäftshaus. Hier waren wir beim Vorrücken ebenfalls vorbeigekommen. Ich wusste nun, dass ich die richtige Richtung eingeschlagen hatte. Nach etwa zehn ewigen Minuten erreichte ich die halb zerfallene Mauer, die ich mir beim Vormarsch eingeprägt hatte. Niemand hatte mehr auf mich geschossen. Ich fühlte mich sicher. Plötzlich ein Ruf. Wie aus dem Nichts knallte mir ein: „Halt!“, entgegen.
Ich erschrak beinahe zu Tode und blieb wie angewurzelt stehen.
„Wer bist du, gib dich zu erkennen!“
Der Rufer sprach mit österreichischen Dialekt.
Meine Leute!
Ich war froh, mich nicht rüber zur Nachbardivision verlaufen zu haben.
„Nicht schießen! Ich bin´s. Jäger Müller von der Gruppe Kremer.“
Gemurmel. Schließlich ein: „Komm langsam her.“
Ich machte ein paar Schritte nach vorn, versuchte zu erspähen, wo der Kamerad in Stellung lag, doch ich konnte nichts erkennen. Dann bewegte sich etwas. Zwei Stahlhelme hoben sich zwischen Geröll und Schutt nach oben. Die Karabiner der Landser waren immer noch auf mich gerichtet. Erst als sie mich als einen der Ihren erkannten, senkten sich die Gewehrläufe.
„Du hast vielleicht Nerven! Rennst da mitten in der Nacht auf uns zu. Was ist los?“
Ich erklärte mit ein paar Sätzen die Situation. Während einer der beiden Landser interessiert zuhörte, drehte sich der andere eine Zigarette.
„Kamerad, mich wundert es nicht, dass ihr in dieser Lage seid und sich nichts rührt. Der Iwan hat uns ganz schön zugesetzt.“
Derjenige, der sich die Zigarette gedreht hatte, zündete sie an und mischte sich danach ins Gespräch ein. Rauch quoll aus seinem Mund, als er sprach. „Aber den Weg hättest du dir fast sparen können, ich weiß aus sicherer Quelle, dass wir morgen Unterstützung bekommen und den Russen endgültig über die Wolga jagen!“
„Bis dahin sind wir verdurstet“, antwortete ich und deutete auf die Feldflaschen.
„Falls sich in den letzten paar Stunden nichts geändert haben sollte, findest du Feldküche, Versorgungstross und Kompaniegefechtsstand an einem Fleck.“
Der andere übernahm das Wort. „An deiner Stelle würde ich dem Alten eine kurze Lagemeldung schildern, bevor du die Flaschen auffüllst.“
„Es ist mitten in der Nacht“, entgegnete ich.
Der Raucher nickte. „Geh trotzdem zum Kompaniegefechtsstand. Irgendeiner von denen, die was zu sagen haben, ist immer da! Wenn du es nicht machst, bekommst du garantiert von Wohlleben einen mordsmäßigen Einlauf!“
Oberfeldwebel Wohlleben war unser Spieß, ein alter Haudegen und sehr launisch. Er konnte einem das Leben erleichtern oder unheimlich schwer machen.
„Könnt ihr mir sagen, wo ich ihn finde?“
Eine Leuchtkugel zischte nach oben. Die beiden Helme senkten sich. Ich ging ebenfalls in Deckung. Schüsse krachten. Zwei Minuten später war es wieder ruhig.
„Verfluchter Iwan, der Russe braucht wohl nie Schlaf!“, motzte der Raucher und begann mir den Weg zu erklären. Dann reichte er mir seine Feldflasche. „Trink!“
Gierig setzte ich sie an. Ich war so aufgeregt, dass ich erst jetzt merkte, wie trocken meine Kehle und wie spröde meine Lippen waren. Nachdem ich mindestens die halbe Flasche geleert hatte, gab ich sie zurück. „Vielen Dank.“
„Schon gut“, antwortete er und hob zum Abschied die Hand zum Gruß.
Es war gottseidank nicht mehr allzu weit und eine weitere Viertelstunde später erreichte ich den Kompaniegefechtsstand, der in einem halbwegs intakten Haus untergebracht war. Die Fenster waren mit Decken verhängt. Am Rand schimmerte etwas Licht durch.
Trotz der späten Stunde herrschte einiger Trubel. Einige Essensträger kreuzten meinen Weg. Sie trugen volle Kochgeschirre und Kommissbrote in den Händen. Zwei von ihnen hatten die großen Aluminium-Essensbehälter auf den Rücken geschnallt.
Dort muss ich nachher unbedingt hin, dachte ich mir.
Ich betrat das Haus und machte sofort einen Schritt zur Seite. Ein Melder rannte mir entgegen, quetschte sich vorbei und hastete in das dunkle Trümmergewirr. Als ich mich wieder umdrehte, stand Oberjäger Maracek vor mir. Er gehörte zum Kompanietrupp.
„Wo kommst du denn her?“, fragte er mich schroff. Die dunklen Ringe unter seinen Augen sprachen für sich. Statt des bequemen Käppis trug er seinen Stahlhelm.
Auch hier erklärte ich mit wenigen Worten unsere Situation.
Maracek grübelte. „Komm mit. Bevor du alles dreimal erzählst, sagst du es am besten gleich Hauptmann Greiner.“
Greiner war der Kompanie-Chef. Wir mochten ihn, denn er hatte eine väterliche Art an sich, was vielleicht daran lag, dass er im Zivilleben Lehrer war.
Maracek führte mich in einen größeren Raum. Hauptmann Greiner stand mit zwei weiteren Offizieren und einem Oberfeldwebel an einem Tisch. Vor ihnen lag eine große Karte. Ich erkannte, dass es sich um einen Stadtplan von Stalingrad handelte.
In einer Ecke hockte der Spieß. Er hatte eine Namensliste vor sich liegen und machte mit einem Bleistift hin und wieder Haken hinter diversen Namen. Auf dem zweiten Blick erkannte ich, dass vor ihm die abgebrochenen Teile von Erkennungsmarken lagen. Instinktiv griff ich in meine Feldbluse, packte die Marken meiner beiden erschossenen Kameraden, ging zum Schreibtisch von Oberfeldwebel Wohlleben und legte die Erkennungsmarken vor ihm auf den Tisch.
Der Spieß sah erst mich an, dann die Erkennungsmarken, dann wieder mich. Er kniff seine Augen zusammen. Ich kannte diesen Blick und erwartete einen Anschiss.
„Jäger Wagner und Gefreiter Herbert Meier aus meiner Gruppe. Leutnant Hübner hat mich zum Wasserholen hergeschickt. Beide Kameraden wurden von einem russischen Scharfschützen erschossen. Er hatte den Weg von unserer Stellung nach hinten unter Kontrolle. Ich habe ihn erschossen“, haspelte ich wirr aus und merkte nicht, dass sich auch die Offiziere am Kartentisch nicht mehr unterhielten. Ich sprach einfach weiter und berichtete, was sich zugetragen hatte und in welcher Lage wir uns befanden. Wohllebens Gesichtszüge entspannten sich etwas. Er nahm die beiden abgebrochenen Erkennungsmarken und legte sie zu den anderen dazu.
„Bleib ruhig, Junge“, kam es erstaunlich gelassen.
„Wer sind Sie?“, hörte ich die Stimme des Kompanie-Chefs.
Ich drehte mich um. Greiner und die anderen sahen mich an. Ich schluckte. Mein Adamsapfel wanderte hoch und runter. „Jäger Alfred Müller“, sagte ich und knallte kasernenhofmäßig die Hacken zusammen.
„Stehen Sie bequem und erzählen Sie noch einmal in Ruhe, was sich zugetragen hat und in welcher Lage sich ihr Zug befindet. Kommen Sie her. Zeigen Sie uns auf der Karte, wo sich Leutnant Hübner befindet.“