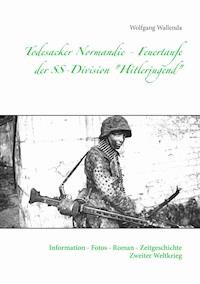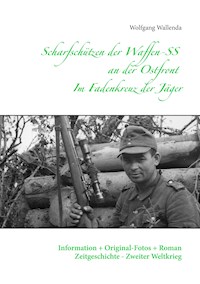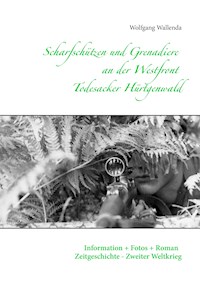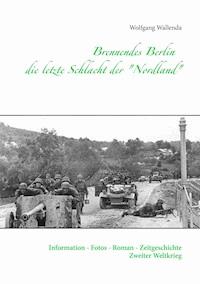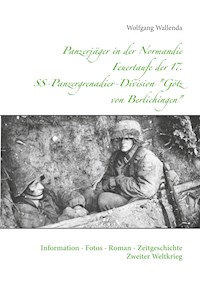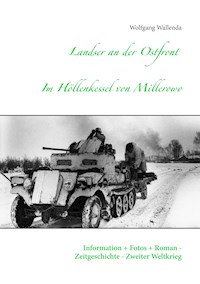Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ostfront Juni 1943 – als Angehöriger des Pionier-Bataillons 198 lernt der erst 19-jährige Hans Gruber im Kubanbrückenkopf die Grausamkeit und Brutalität des Krieges kennen. Drei Monate später liegt er vermeintlich tot in einem Massengrab. Der Landser wird von Rotarmisten gerettet und in Frontnähe zu Arbeiten gezwungen, die wahren Himmelfahrtkommandos gleichen. Als er auch diese Martyrien überlebte, folgte die Hölle der russischen Kriegsgefangenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ostfront Juni 1943 – als Angehöriger des Pionier-Bataillons 198 lernt der erst 19jährige Hans Gruber im Kubanbrückenkopf die Grausamkeit und Brutalität des Krieges kennen.
Drei Monate später liegt er vermeintlich tot in einem Massengrab.
Der Landser wird von Rotarmisten gerettet und in Frontnähe zu Arbeiten gezwungen, die wahren Himmelfahrtkommandos glichen.
Als er auch diese Martyrien überlebte, folgte die Hölle der russischen Kriegsgefangenschaft.
Es ehrt unsere Zeit, dass sie genügend Mut aufbringt, Angst vor dem Krieg zu haben.
Albert Camus (1913-1960)
(franz. Schriftsteller und Philosoph)
Humanität im Krieg bedeutet, dass einer ein Glas
Wasser in einen brennenden Wald gießt.
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
(frz. Flieger u. Schriftsteller)
Zum Geleit
Ich erwarte weder Anerkennung noch Belohnung. Ich erzähle meine Geschichte, um die Menschheit daran zu erinnern, dass Kriege niemals die Lösungen für Probleme sein können. Krieg ist das Grausamste, das jemandem widerfahren kann.
Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war dabei. Ich kämpfte, wurde verwundet und lag in einem Massengrab.
Foto: Hans Gruber, 19 Jahre alt
Für mich war es ein Wunder, dass ich auf dem Weg zum Jenseits noch einmal ins Diesseits zurückgeholt wurde.
Ich durfte wählen zwischen Tod und Stacheldraht und entschied mich für den Stacheldraht.
Niemals konnte ich mir vorstellen, dass es nach der Hölle an der Ostfront eine weitere geben würde. Ich wurde eines Besseren belehrt und ging durch die Hölle der russischen Kriegsgefangenschaft.
Dieses Buch widme ich den Millionen Kriegsgefangenen aller Nationen, die namenlos in einem fremden Land begraben wurden. Sie gingen durch die Hölle und gaben das Wertvollste, das sie besaßen. Ihr Leben.
Dies ist meine Ehrerweisung an euch.
Euer Kamerad
Hans Gruber
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Zwischen Tod und Stacheldraht
Glossar zum Roman
Aus dem allgemeinen Landser-Jargon
Dienstgrade der Wehrmacht
Offiziere
Offiziersanwärter
In der gleichen Reihe bereits erschienen
weitere Bücher von Wolfgang Wallenda
Quellen- und Literaturverzeichnis
Vorwort
Die Sage von Odysseus und die Realität von Hans´ schrecklichen Erlebnissen ähneln sich in gewisser Art und Weise. Wenn sich lebensgefährliche Situationen entwickelten, zeigten beide ihren unbändigen Willen zum Leben und handelten auch bei größter Gefahr stets gleichermaßen umsichtig.
Sowohl Odysseus als auch Hans haben ihre Schicksale niedergeschrieben. Beide wollten damit weder Mitleid erhaschen noch Schuldgefühle provozieren. Die Dramen beider Personen sprechen für sich selbst.
Um den Anforderungen des Lebens als selbstbewusster Mensch entgegen treten zu können, benötigt man die richtige Kombination aus Mut und Scharfsinn.
Trotz vieler persönlicher Parallelen gibt es dennoch einen gewaltigen Unterschied zwischen Odysseus und Hans. Während der griechische Sagenheld ein freier Abenteurer war, handelte es sich bei Hans um einen jungen deutschen Landser und russischen Kriegsgefangen. In der Odyssee über den griechischen Helden wird von Abenteuern, romantischen Begegnungen, mystischen Wesen und schließlich der triumphalen Rückkehr erzählt. Viele Leser wären gern an Odysseus Seite gewesen; hätten den sagenumwobenen Helden am liebsten begleitet. Niemand der Leser dieses Buches wird sich aber wünschen, an Hans´ Seite gewesen zu sein, um die Qualen von Zwangsarbeit, gepaart mit dem drohenden langsamen Hungertod vor Augen, zu erleiden.
Hans´ Martyrium steht stellvertretend für die vielen Millionen Kriegsgefangenen, die durch Jahrhunderte oder gar Jahrtausende hindurch, in Gefangenschaft unterjocht, gequält, gedemütigt und gestorben sind. Die Geschichten der Verlierer werden nur selten veröffentlicht.
Erst nach vielen Jahrzehnten der Verschwiegenheit hat Hans, mit Hilfe seiner Familie, Verwandten in den USA und guten Freunden, den Mut gefunden, seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg und allem voran in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft, noch einmal gedanklich zu durchleben.
Er willigte ein, diesen Zeitraum seines Lebens, der sich zwischen Tod und Stacheldraht abspielte, niederzuschreiben und so für die Nachwelt zu erhalten.
Es wäre damals für ihn wohl um vieles leichter gewesen, den Kampf um das armselige Leben aufzugeben und den erlösenden Tod anzunehmen, doch Hans wollte nicht sterben. Er wollte leben. Leben und wieder seine Freiheit erlangen. Er wich keinem Kampf aus; nutzte jede Gelegenheit, dem Tod zu entrinnen.
Es gab nicht viele, die durchkamen. Hans schaffte es.
Wenn Sie dieses Buch lesen, versetzen Sie sich bitte einmal in die Lage eines neuzehnjährigen Studenten, der dachte, der Krieg ist lediglich ein kurzes Abenteuer zwischen zwei Semestern.
Colonel ret. William A. Fall
Bomber-Pilot, US-Air Force
Anmerkung:
Dies ist die authentische Geschichte des Pioniers Hans Gruber.
Bis auf historische Persönlichkeiten sind alle Namen frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen wären rein zufällig.
Zwischen Tod und Stacheldraht
Gutes und Böses wurden der Menschheit seit Anbeginn ihrer Existenz in die Wiege gelegt. Auch wenn die böse Seite dominiert, ist es am Ende die Gute, die stets triumphiert.
Ich hatte das Pech, in einer turbulenten Zeit an einem Ort geboren zu werden, an dem das Böse gerade dabei war sich unter die Menschen zu mischen. Im Jahr 1924 erblickte ich in Stettin (heute Scezin/PL) das Licht der Welt. Fünf Jahre zuvor war der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen und eine Krise jagte die nächste im besiegten Deutschland.
Diesen Umstand machte sich das Böse zunutze. Adolf Hitler und ein paar seiner Getreuen gründeten 1923 die NSDAP. Durch ihre breit adressatendifferenzierte Propaganda gelang es der Partei, eine breite Wählergemeinschaft anzusprechen und zu gewinnen.
Mit falschen Versprechungen, Gewalt, List und Tücke gelangten sie schließlich an die Macht.
Durch die Gleichschaltung der Medien wurde die Masse des Volkes permanent mit dem nationalsozialistischen Gedankengut gefüttert. Lügen, Betrug am Volk und immer wieder Gewalt manifestierten die Macht der Nazis. Widerstand wurde im Keim erstickt, das Volk mit den perfiden Gedanken der Nationalsozialisten infiziert. Mit glühenden Reden wurde Hass gegenüber dem gesät, der anders war. Unaufhaltsam lief die Kriegsmaschinerie an. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges öffnete der Teufel die Pforten zur Hölle.
Wie viele andere Millionen Deutsche, war auch ich seit meiner Jugend von der Nazi-Politik fasziniert. Die uniformierten Waffen-Paraden, die abenteuerlichen Unternehmungen bei der Hitler-Jugend, die absolute Kameradschaft zwischen den Burschen und letztendlich die vorgegaukelte heile Welt hatten mich, schleichend und irgendwann vollends, in den Bann den nationalsozialistischen Gedankenguts gezogen.
Die sog. Jugenddienstpflicht (Hitler-Jugend „HJ“ für die Jungen bzw. Bund Deutscher Mädels „BDM“ für die weiblichen Jugendlichen) betraf alle Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren und war seit Anfang 1939 gesetzlich geregelt. In der nach dem Führerprinzip (die Organisation ordnet sich ohne Einschränkungen den Entscheidungen ihres Führers unter) geordneten HJ standen sowohl körperliche als auch ideologische Schulungen auf dem Tagesprogramm. Aus den Kindern von „heute“ wurden bereits die Soldaten von „morgen“ geformt. Ein Leitspruch der HJ lautete: „Was sind wir? Pimpfe! Was wollen wir werden? Soldaten!“
So folgte ich dem Ruf des Führers, folgte dem Fingerwink eines skrupellosen Diktators, der es geschafft hatte, sich mit seinen Ideen in meinen Kopf zu schleichen und mein Gehirn auszuschalten. Das Gift der Nationalsozialisten hatte mich im Denken und Handeln gelähmt. Ich glaubte das, was man mir erzählte. Ich war davon überzeugt, dass wir die Schmach von Versailles überwunden hatten. Die waffenlose Heimführung des Sudetenlandes und der Anschluss Österreichs bestätigten den Erfolgskurs Hitlers.
Die jahrelange Hatz in den Medien gegen das Judentum, gegen Zigeuner, der Kampf gegen den Bolschewismus und alles andere, das nicht in die heroische Nazi-Welt passte, verinnerlichte sich. Wir wurden diesbezüglich auf beiden Augen blind. Wir waren das, was wir sein sollten. Gefügige Marionetten, die für das Deutsche Reich alles geben würden. Auch ihr Leben.
Nachdem ich die Höhere Schule abgeschlossen hatte, begann ich Architektur zu studieren. Nach zwei Semestern in der Lehranstalt für Hoch- und Tiefbau zog ich nach Frankfurt/ Oder und setzte dort mein Studium fort. Nach weiteren 1 ½ Semestern wurde meine Studienzeit abrupt unterbrochen, da ich 1942 meinen Einrückbescheid zum Reichsarbeitsdienst (RAD) erhielt.
Seit Juni 1935 musste jeder junge Mann eine sechsmonatige, dem Wehrdienst vorgelagerte Arbeitspflicht im Rahmen eines Arbeitsdienstes ableisten. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs dehnte man den Reichsarbeitsdienst auch auf die weibliche Jugend aus.
Im nationalsozialistischen Deutschland war der RAD ein wichtiger Bestandteil sowohl der Wirtschaft (z.B. Erntehilfe) als auch der Erziehung (nationalsozialistisches Gedankengut).
So trat ich im Juli 1942 in Westpreußen (zwischen Posen und Kulm) meinen Dienst an. Ich war als Erntehelfer eingesetzt. Tagsüber schufteten wir hart, doch an manchen Abenden, und vor allem an den Wochenenden genossen wir die Zeit, denn außer uns jungen Männern waren auch Musik-Studentinnen aus Wien beim RAD zur Erntehilfe eingesetzt. Musik, Tanz und so mancher Flirt ließen die Tage und Wochen nur so verfliegen. Der Krieg war weit weg.
Meine Zeit beim RAD war jedoch schneller vorbei als mir lieb war. Bereits nach drei Monaten Arbeitsdienst bekam ich meinen Einberufungsbefehl.
(Anmerkung: Der Geburtsjahrgang 1924 wurde zum 15.10.42 voll einberufen. Von etwas mehr als 624.000 Rekruten kehrten rund 224.000 Männer nicht mehr aus dem Krieg zurück. Die Quote der Gefallenen dieses Jahrgangs betrug knapp 35 %.)
Der Dienst in der Wehrmacht wurde von mir immer noch als großes Abenteuer betrachtet. In diesen Tagen dachte keiner von uns Rekruten daran, dass wir lediglich die Lücken derer füllen sollten, die an den Fronten ihr Leben ließen. „Gefallen für Führer, Volk und Vaterland!“
Dass auch meine Mutter einmal einen schwarz umrandeten Brief mit diesem Spruch erhalten sollte, wäre mir zu diesem Zeitpunkt niemals in den Sinn gekommen. Aber davon möchte ich später berichten.
Nach einer abenteuerlichen Eisenbahnfahrt in einem Güterwaggon trat ich frisch rasiert und mit vorbildlichem Kurzhaarschnitt in der Pionier-Kaserne in Aschaffenburg meinen Dienst in der Wehrmacht an.
In den folgenden Wochen lernte ich den militärischen Drill beim Barras kennen und hassen. Wir wurden gedrillt, geschliffen, geformt. Vor allem die Geländeübungen auf dem Pionier-Übungsplatz, südlich des Aschaffenburger Ortsteils Schweinheim, brannten sich in mein Gedächtnis ein.
Die Grundausbildung in der Wehrmacht betrug normalerweise zwölf Wochen. Während des Krieges, zumindest war das bei meinem Jahrgang so, verkürzte man diese Zeit nochmals auf acht Wochen.
Anmerkung: Unsere Sonderausbildung an Sprengstoffen usw. erfolgte im Anschluss an die verkürzte Grundausbildung in Roanne an der Loire in Frankreich.
Warum die ohnehin verkürzte Grundausbildung bei uns Pionieren nochmals auf lediglich fünf Wochen reduziert wurde, weiß ich nicht. Vielleicht lag es daran, dass man an den Fronten neue Soldaten benötigte, vielleicht waren es auch nur organisatorische Gründe.
Während dieser 35 Tage durchlebten wir allerdings die größten Strapazen und Qualen, die uns bis dahin in unserem Leben widerfuhren. Uns kam es vor, dass wir die für zwölf Wochen ausgelegten Schindereien der Ausbilder binnen dieser fünf Wochen komplett abbekamen.
Die Ausbildung unterteilte sich in
Waffen- und Schießausbildung, Karabiner 98k, möglichst auch an der Pistole, Maschinenpistole, lMG
(leichtes Maschinengewehr)
sowie Hand- und Nebelgranaten
Grundtätigkeiten im Gefechtsdienst
(Sicherung nach vorn und hinten, Baumbeobachter, Marsch zu Fuß, Verteidigung von Stellungen usw.)
Wachausbildung
Verhalten bei Einsatz vom chemischen Kampfstoffen
Formalausbildung
Sportausbildung
Als Pioniere war uns glücklicherweise ein großer Ausbildungsteil der Infanteriegruppe erspart geblieben. Diese Kameraden mussten zusätzlich alle Gefechtsarten sowie Spähtrupp, Vorposten, Spitzengruppe beim Marsch usw. üben.
Dagegen nahmen uns die Ausbilder beim Bau von Feldbefestigungen hart ran. Es gab keinen Rekruten ohne Blasen an den Händen. Sogar Heinrich Schäfer, den alle nur Heini nannten, beschwerte sich über die Schufterei. Heini war im Steigerwald beheimatet und als Holzfäller hartes Arbeiten gewohnt. Er war ein Büffel von Mann und wuchtete die schweren Holzbohlen, die normalerweise zwei Männer hoben, alleine herum. Ich war froh, dass er in meiner Gruppe war, denn Heini war nicht nur bärenstark und ein Arbeitstier, sondern auch sehr kameradschaftlich. Er half, wo es vonnöten war und hätte sein letztes Hemd für jeden von uns hergegeben.
Den obligatorisch schlimmsten Unteroffizier, den Schleifer aller Schleifer, wie ihn wohl jeder Rekrut aus jeder Armee der Welt in Erinnerung behalten hat, gab es bei uns nicht. Sie waren alle gleich schlimm. Keiner der altgedienten Pioniere, die uns zu Soldaten formten, war gutmütiger oder härter als ein anderer, weshalb sie durchwegs alle in schlechter Erinnerung blieben. Ehrlicherweise muss ich hierzu erwähnen, dass wir während dieser Zeit richtig fit gemacht wurden und nicht nur ein Rekrut das eine oder andere Kilo an überschüssigem Körpergewicht verlor und ein paar Muskeln aufbaute.
Unser Tagesplan war hart. Geweckt wurde um 5 Uhr. Es folgte Frühsport bis 5:30 Uhr, anschließend waschen und Frühstück, gefolgt vom Reinigungsdienst (jede Stube hatte ein zugewiesenes Revier, wie z.B. die Waschräume, Kasernenflug usw.) und dem pünktlich um 7 Uhr stattfindenden Morgenapell.
Danach ging es entweder ins Gelände oder zum Exerzieren auf den Kasernenhof. Am Nachmittag folgten Unterrichte (z.B. Waffenkunde) oder Schießausbildung mit anschließendem Waffenreinigen.
Eine weitere Unterrichtseinheit beschloss den Ausbildungstag. Zwischen 21 und 22 Uhr mussten wir erneut die Reviere reinigen.
Punkt 22 Uhr folgte die Stubenabnahme durch den UvD.
Wir fielen in die Betten und wachten erst wieder durch den Pfiff um 5 Uhr am nächsten Morgen auf.
Nach diesen fünf Wochen marschierten wir mit breiter Brust aus dem Kasernentor. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Stubenkamerad Alfred Lechner sagte: „Diese Schleifer sehen mich erst wieder, wenn ich mit dem Ritterkreuz vor ihnen stehe und sie meine Stiefel putzen.“
Wir waren gut gelaunt, denn wir wähnten den Schliff am Ende und freuten uns auf Frankreich, wo wir in Roanne an der Loire unsere Spezialausbildung erhalten sollten.
Am nächstgelegenen Bahnhof wurden wir in einen Zug verfrachtet. Während der Fahrt nach Frankreich begann ich zum ersten Mal darüber nachzudenken, was es bedeutete ein Pionier zu sein. Heute muss ich direkt darüber schmunzeln, aber damals, als Student der Architektur, träumte ich davon, tragfähige, sehr große Holzbrücken zu bauen. Holzbrücken und Baracken für die Soldaten die darüber marschieren sollten.
Foto: Privatarchiv d. Autoren – PA-01 - Rangierbahnhof – Transport von Soldaten
Warme Unterkünfte, damit sie im russischen Winter nicht frieren, waren meine Gedanken.
Das Schicksal meinte es jedoch anders mit mir. Ich sollte nicht zu einer Brückenkolonne gehören, sondern zu einem Pionier-Bataillon.
Erst später, während des Transports nach Russland, erfuhr ich zu welcher Einheit ich gehörte. Es war die 98. Infanterie-Division, Pionier-Bataillon 198, zweite Kompanie.
Ich wurde zu einem sog. „Schwarzer Pionier“ ausgebildet. Die Bezeichnung rührt daher, da die Waffenfarbe schwarz war. Das unterschied uns auch von den normalen Infanterie-Pionieren.
Die „Schwarzen Pioniere“ waren in ihrer Division immer die „Mädchen für alles“ und die „Feuerwehr“, da wir auch alles konnten.
Wir stürmten bei Angriffen vorne weg und sprengten Wege durch Stacheldrahtverhaue, wir attackierten Bunker und Häuser und waren sozusagen die Wegbereiter für unsere Kameraden von der Infanterie.
Aber wir bauten auch Stellungen und Feldbefestigungen. Wir verminten Straßen, Wälder, Wege und Häuser. Wir knackten Panzer, überquerten Flüsse und setzten mit unseren Schlauch- und Sturmbooten die Infanteristen über.
Die schwarzen Pioniere konnten ohne große Umschweife an allen Stellen der Division eingesetzt werden. Wir waren Spezialisten. Wir konnten sprengen, verminen, bauen, zerstören, hatten Techniker in unseren Reihen und das entsprechend notwendige Arbeitsgerät für solche Einsätze stand uns ebenfalls zur Verfügung.
Wir waren wirklich Alleskönner.
Dass die schwarzen Pioniere deshalb auch stets an vorderster Front eingesetzt waren und deren Verlustquote zu den höchsten in jeder Division gehörte, war uns jungen Pionieren in diesen Tagen noch nicht bewusst. Diese Erfahrung sollte uns später bitter widerfahren.
In Roanne an der Loire fühlten wir uns großartig. Uns war langsam bewusst, wie wichtig wir an der Front sein würden und genossen diesen Status.
„Ohne uns Pioniere ist der Krieg nicht zu gewinnen!“, hörten wir tagtäglich.
Dieser Satz bohrt sich in mein Gedächtnis.
Ich möchte noch kurz erläutern, wie damals ein Pionier-Bataillon gegliedert war.
Bataillonsstab
Kommandeur
(verantwortlicher Führer des gesamten Bataillons)
Adjutant
(Gehilfe und Vertreter des Kommandeurs)
Offizier z.b.V.
(zumeist Verwendung als Ordonanzoffizier, Stellvertreter des Adjutanten, Meldeoffizier zu benachbarten Einheiten)
Arzt und Hilfsarzt
(zuständig für den Sanitätsbereich und das Sanitätspersonal)
Veterinär
Stabspersonal
Besonderheit: Dem Pionier-Bataillon war als einzigem Bataillon der Division auch die Bataillons-Musik (Stärke 1/27) unterstellt. Die Musiker wurden im Feld als Hilfssanitätspersonal eingesetzt.
Nachrichtenzug (i.d.R. Stärke: 1/4/27)
1. und 2. Pionier-Kompanie (i.d.R. Stärke: 4/19/168)
Kompaniechef
Kompanietrupp
3 Züge (unterteilt in Zugtrupp und 3 Gruppen – zur Bewaffnung gehörten auch leichte Maschinengewehre, Panzerbüchsen und Flammenwerfer)
Munitions- und Maschinentrupp
Gefechtstross (Waffen- und Geräte, große Feldküche, Feldköche, u.a.)
Verpflegungstrosse I und II (u.a. Feldverpflegungswagen)
Gepäcktross (Gepäck der Soldaten, Rechnungsführer, Schneider, Schuster u.a.)
3. Pionier-Kompanie (mot.) (i.d.R. Stärke: 4/21/173)
ausgerüstet mit Lastwagen für Mannschafts- und Gerätetransport
unterteilt in Züge und Trosse w.o.
Zur Ausrüstung der Pioniere gehörten Arbeitsmittel, wie Kraftsägen, Drucklufterzeuger, Schneidbrenner, Handscheinwerfer, aber auch sämtliches Werkzeug, wie Äxte, Sägen, Zangen.
Als Sperrmittel dienten u.a. Stachel- und Blankdraht oder einfache Sandsäcke und Baumstämme.
Mit Spreng- und Zündmitteln waren wir sehr gut ausgestattet. Wir verfügten über Knallzündschnüre, Glühzündapparate und ausreichend Sprengstoff (i.d.R. TNT).
Als vorgefertigte Sprengmittel hatten wir stets Bohrpatronen, Sprengbüchsen (1 kg Sprengkraft) und Geballte Ladungen (3 kg Sprengkraft) im Gepäck. Die Letzteren hatten eine Quaderform und waren mit einem Tragring versehen.
An Minen verwendeten wir T-Minen und S-Minen.
Die T-Minen (Teller-Mine) wurden vornehmlich zum Panzerkampf eingesetzt, die S-Mine (Schützen-Mine) gegen Infanterie.
Wir legten Minensperren, mussten aber auch feindliche Minenfelder entschärfen, was im Fronteinsatz oftmals einem Himmelfahrtskommando glich.
Um über Flüsse übersetzen zu können, wurden Floßsäcke (Schlauchboote) verwendet. Die kleinen Floßsäcke trugen bis zu 4 Soldaten, die großen bis zu 12 Landser (je nach Gepäck).
Mit Balken und Bohlen überdeckt, konnte man die Schlauchboote auch als Behelfsbrücken einsetzen.
Foto: Privatarchiv d. Autoren – PA-02 - Pionierausbildung – Steg auf Floßsäcken
Die Sturmboote 39 (le. Stubo 39) wurden von zwei Pionieren gesteuert (30 PS Motor) und konnten acht Soldaten transportieren.
Flammenwerfer und Nebelhandgranaten gehörten zur Standardausrüstung der Pioniere.
Die Zeit in Frankreich flog nur so dahin. Der Krieg war weit weg und die Spezialausbildung machte Spaß. Ich wurde regelrecht zum Sprengstoff- und Minenexperten. Das Thema lag mir und meine Finger und Hände waren ruhig. Vielleicht lag es daran, dass ich aufgrund meines Architekturstudiums auch bestens mit Bleistift und Zeichengerät umgehen konnte. Wie dem auch sei, ich war gut im Entschärfen von Minen. Später sollte dieser Umstand noch wichtig werden.
Wir sprengten während der Ausbildung alte Bunker und setzten bei Wind und Wetter zig-Mal über die Loire. Mit unseren Booten fuhren wir auch in Nebenarme des Flusses und legten dort Stege und Behelfsbrücken.
Foto: Privatarchiv d. Autoren – PA-03 – Pionierausbildung – Sprengen von Bunkern
Waren die Pfeiler zerstörter Brücken noch vorhanden, wurde uns beigebracht, diese auf Tauglichkeit zu prüfen und zu nutzen.
Man brachte uns in Rekordzeit alles bei, was ein Pionier beherrschen musste.
Foto: Privatarchiv d. Autoren – PA-04- Pionierausbildung – Behelfsbrückenbau unter Ausnutzung vorhandener Brückenpfeiler
Unerfahren, wie waren, fühlten wir uns wie Helden. Wir glaubten an uns, wir glaubten an das, was uns täglich berichtet wurde und wir glaubten fest daran, einen gerechten Krieg zu führen. Mit diesem Selbstbewusstsein flanierten wir durch die Straßen des besetzten Landes. Ausflüge nach Paris und Clermont-Ferrant ließen unsere Herzen höher schlagen. Beim Herumschlendern in den Städten gelang es dem einen oder anderen stattlichen Jüngling sogar eine Französin zu erobern. Uns kam es vor, als wären wir Freunde der Franzosen. Doch in Wahrheit waren wir der lästige Parasit, der dafür sorgte, dass im verborgenen Hintergrund die Tötungsmaschinerie des Naziregimes und deren Helfer anlief. Es war wohl auch ein Großteil dieser Sieger-Mentalität, die unseren Geist gefangen hielt und das selbständige Denken ausschaltete.
Einen gewaltigen Dämpfer gab es dennoch während der Ausbildung. Man musste nur ein Wort erwähnen und uns gefror das Blut in den Adern. Das Wort lautete: Stalingrad!
Spekulationen und Fragen kamen auf. Nächtelang wurde in den Kantinen und Stuben darüber diskutiert. Wie konnte so etwas geschehen? Die 6. Armee war eine Elite-Armee. Wir ließen 100.000 Landser im Stich; konnten den Ring der Russen nicht sprengen. Was war falsch gelaufen?
Das große Bild des unbesiegbaren Deutschen Reichs bekam einen gewaltigen Riss.
Die Wochen vergingen und wieder glaubten wir entgegen jede menschliche Vernunft alles, was in den Wochenschauen berichtet wurde. Die Massen-Manipulation über Rundfunk, Presse und Wochenschauen funktionierte nach wie vor.
Im Frühjahr 1943 war die Welt nicht mehr so, wie ich sie kannte. Aus dem liebenswerten Deutschen Reich, mit all seinen Landschaftsfacetten von der Ostsee bis zu den Alpen und vom Rhein bis nach Ostpreußen, von seinen Einsiedlerhöfen, Weilern, Dörfern und Städten, ging keine Wärme mehr aus. Die Fröhlichkeit war erstickt worden.
Der Propaganda-Minister Josef Goebbels hatte zum totalen Krieg ausgerufen und die aufgepeitschte Meute tobte ihm jubelnd zu.
Während deutsche Bomber englische Städte marterten, legten britische und amerikanische Bomberstaffeln deutsche Städte in Schutt und Asche.
Längst wurde unter der Hand über das Schicksal der Juden, Zigeuner und vieler anderer Menschen, die man in Viehwaggons zu den Konzentrationslagern transportierte, gesprochen. Die tief-schwarze, höllische Realität, gepaart mit der Angst vor dem Nazi-Regime, vertreten durch Hitlers „Geheimer Staatspolizei“, kurz der GeStaPo, ließen die Bevölkerung wegsehen und die Augen verschließen. Ich vermute, sie verdrängten das Unglaubliche, Unbegreifliche, Unfassbare. Wenn man nicht direkt davon betroffen war, wurde dieses menschenverachtende Thema ausgeblendet.
In diesem Frühjahr 1943 war es auch für mich soweit. Es kam, wie es kommen musste. Bevor es vom Kommandeur unseres Ausbildungs-Bataillons am Antrete-Platz offiziell bekannt gegeben wurde, liefen schon Tage zuvor die wildesten Latrinenparolen durch die Flure unserer Kaserne.
„Front!“
„Es geht an die Front!“
„Wir werden kämpfen!“
Endlich durften wir zeigen, was wir gelernt hatten. Das Schleifen war beendet. An jenem Abschiedsabend wurde jeder von uns gedanklich mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet und namentlich im Wehrmachtsbericht erwähnt. Wir fühlten uns nach wie vor heldenhaft. An Tod oder Verwundung dachte niemand. So etwas wie Kriegsversehrte gab es an diesem Abend nicht. Wein, Bier und Schnaps flossen reichlich.
Lauthals schmetterten wir bekannte Landser-Lieder. Eines davon wurde an diesem Abend drei- oder viermal gesunden. Es war das Lied von Hans Baumann „Es zittern die morschen Knochen“.
Wenn ich mich in meinem Sessel zurücklehne und die Augen schließe, tauche ich in die Welt von damals ab. Ich höre den Refrain, sehe die Gesichter meiner Kameraden vor mir und ich erwische mich dabei, wie meine Finger den Takt trommeln.
Es zittern die morschen Knochen
der Welt vor dem roten Krieg,
wir haben den Schrecken gebrochen,
für uns war's ein großer Sieg.
Refrain:
Wir werden weiter marschieren,
wenn alles in Scherben fällt,
denn heute da hört uns Deutschland
und morgen die ganze Welt.
Und liegt vom Kampfe in Trümmern
die ganze Welt zuhauf,
das soll uns den Teufel kümmern,
wir bauen sie wieder auf.
Refrain:
Und mögen die Alten auch schelten,
so lasst sie nur toben und schrei'n
und stemmen sich gegen uns Welten,
wir werden doch Sieger sein.
Refrain:
Sie wollen das Lied nicht begreifen,
sie denken an Knechtschaft und Krieg;
derweil unsre Äcker reifen,
du Fahne der Freiheit, flieg!
Wir werden weiter marschieren,
wenn alles in Scherben fällt;
die Freiheit stand auf in Deutschland
und morgen gehört ihr die Welt.
Ich stelle mir im Gedanken eine Frage: Wie viele von diesen jungen Männern sind wohl im Feld geblieben?
Die Antwort blieb ich mir schuldig. Blitzartig kommen längst verdrängte Erinnerungen zurück. Erst waren es nur ein paar Gesichter. Lachende junge Männer. Dann tauchen Blitze auf, die von grollendem Donner begleitet werden. Beides stammte nicht von einem Gewitter. Ich liege wieder im Trommelfeuer der sowjetischen Artillerie. Auf einmal werden die Gedanken immer klarer.
„Heini Schäfer, Alfred Lechner, Sepp Obermaier“, flüstere ich. Die Gesichter hatten ihre Namen zurückbekommen.
Gänsehaut breitet sich aus und zieht sich, beginnend am Nacken, über meinen ganzen Körper.
Wenn man durch die Hölle der Ostfront gegangen war, kann man die Dinge bestenfalls verdrängen, aber niemals vergessen!
Nach dem Krieg las ich in einer Statistik, dass rund ein Drittel der Männer meines Jahrgangs nicht mehr nach Hause zurückgekehrt waren.
Betrübt greife ich zu meinem Glas Wein, nippe daran und genieße die kleine Geschmacksexplosion in meinem Gaumen.
Wie war das damals?
Damals war niemand betrübt. Ganz im Gegenteil. Der Großteil von uns strahlte. Keiner dachte an besorgte Familienangehörige. Für alle begann das große Abenteuer Krieg. Ich selbst war im Februar 1943 zum letzten Mal zu Hause. Als ich mich damals verabschiedete, glaubte ich, dass es wieder nur für ein paar Wochen sein würde und wähnte mich im kommenden Sommer auf Heimaturlaub. Was für ein gewaltiger Irrtum.
Am Tag nach der großen Abschiedsfeier standen wir mit blanken Oberkörpern beim Krankenrevier in einer Schlange an. Wir erhielten die üblichen Impfungen, wie Tetanus oder gegen die Ruhr. Zudem wurden noch so manche Pillen oder Salben ausgegeben. Die Ärzte machten uns aus medizinischer Sicht klar für die Front.
Wie auch mir, war dem einen oder anderen Kameraden an diesem Morgen etwas unwohl zumute. Der gestrige, übermäßige Alkoholgenuss machte den Kopf schwer und ließ manchen Magen rebellieren.
Als ich an der Reihe war, klopfte mir der Sanitäter mit breitem Grinsen auf die Schulter. „Bist ´n bisschen blass um die Nase, Kamerad. Keine Angst, das hier ist harmloser als ein Kindergeburtstag.“
Ich bekam zwei Injektionen und war froh, als es vorbei war.
Der Kamerad hinter mir hingegen druckste herum.
„Was ist los, Kamerad?“, wurde er gefragt. „Hast du Angst vor so ´ner kleinen Nadel?“
„Nein, aber ich …, also …“, stotterte er.
„Sag was los ist oder halt den Mund.“
„Ich war neulich bei einer leichten Dame.“
Neugierig verharrte ich für einen Moment. Der Sanitäter schmunzelte. „Hose runter! Wir wollen sicher gehen, dass dir nicht ein kleines Andenken mitgegeben wurde“, sagte er dabei und zog routiniert eine dritte Spritze auf. Anscheinend kam diese Art der gesundheitlichen Beschwerde öfter vor. „Her mit der Flinte. Wir müssen die Harnröhre desinfizieren.“
Erleichtert, dass ich von diesem schmerzhaften Eingriff verschont geblieben war, ging ich weiter. Hinter mir vernahm ich einen kleinen Schmerzschrei. Der Nebenmann des gequälten Kameraden fiel um. Ich brauchte frische Luft und beeilte mich, das Krankenrevier zu verlassen. Draußen warteten Heini Schäfer und Alfred Lechner. Nachdem ich meine Oberbekleidung wieder angezogen hatte, marschierten wir zurück zur Unterkunft.
„Wie lange dürfen wir uns hinlegen?“
„Hinlegen?“, entgegnete ich fragend. „Gar nicht. Der Arzt hat gesagt, dass wir nach dem Impfen eine halbe Stunde Ruhepause haben, sonst nichts.“
„Heini, ich glaube Hans hat Recht. Wenn uns der UvD beim Pennen erwischt, fangen wir uns noch eine dicke Strafe ein, bevor wir diesem Ausbildungs-Haufen den Rücken kehren.“
Selbst die halbe Stunde war uns nicht vergönnt. Wir waren die letzten unseres Zuges und als wir das Unterkunftsgebäude betraten, durften wir uns schon einreihen. Die Gruppenführer hatten die gesamte Mannschaft antreten lassen. Leise fluchend stellten wir uns an die gewohnten Plätze.
„Gruber, knöpfen Sie die Feldbluse ordentlich zu! Wir sind hier in der Wehrmacht, nicht auf dem Jahrmarkt!“, pulverte mich einer der Unteroffiziere an.
„Der Arzt …“, wollte ich erwidern, als mir Heini in die Seite stieß.
„Maul halten, Hans.“
Schweigend knöpfte ich die Feldbluse zu.
Der Kompaniefeldwebel trat keine Minute später aus seiner Schreibstube.
„Achtung!“, bellte der Unteroffizier und wir schlugen die Hacken zusammen. Der Schlag hallte im Flur wider.
Der Spieß stellte sich vor dem Zug auf, holte tief Luft, doch entgegen des gewohnt lauten Kasernentons, kamen eher ruhige Worte aus seinem Mund. „Männer, ihr seid nun richtige Pioniere. Der Kompanieführer hat ja schon zu euch gesprochen. Ich kann dessen Worte nur unterstreichen. Ihr seid fertig ausgebildete Pioniere und habt Dinge auf dem Kasten, die der normale Schütze-Arsch nicht beherrscht. Ihr werdet an der Front gebraucht. Die Männer dort draußen verlassen sich auf euch. Ihr werdet ihnen die Wege frei machen und dem Feind das Fürchten lehren. Merkt euch, dass aus meiner Obhut noch keiner an die Front gegangen und gefallen ist. Meine Jungs haben alle ihren Weg gemacht. Die meisten von ihnen sind schon im Unteroffiziersrang. Wenn es dort draußen mal brenzlig wird, besinnt euch auf meine Worte. Dann kneift ihr die Arschbacken zusammen, springt auf und heizt dem Iwan, dem Tommy oder weiß Gott, wo ihr hinkommt, ein. Habt ihr mich verstanden?“
Wie aus einem Mund brüllten wir: „Jawohl, Herr Oberfeldwebel!“, was mehrfach durch den Kasernenflur hallte.
„Das Warten und die ganze Geheimniskrämerei hat ein Ende. Ihr werdet in Kürze euren Einheiten zugewiesen und könnt packen! Um 16 Uhr ist Abmarsch. Am Bahnhof folgt ihr den Anweisungen eures Transportführers, Leutnant Meier. Er befehligt euren ganzen Haufen. Es geht los, Jungs. Ihr dürft zeigen, was ihr gelernt habt und euch die Eisernen Kreuze holen, die auf euch warten. Wochenlang habe ich euch gezeigt, was es heißt beim Barras zu dienen und nun zeigt ihr dem Feind, was es heißt ein deutscher Pionier zu sein! Wegtreten!“
Am Bahnhof herrschte reger Trubel. Ein Zug stand kurz vor der Abfahrt, ein weiterer war wohl erst vor wenigen Minuten eingefahren. Tausende Gerüche lagen in der Luft. Es roch nach Essen, Zigarettenrauch, nach Öl und Metall. Wir wurden durch die Halle gelotst und zum Rangierbahnhof geführt. Feldgendarmen patrouillierten herum. Sie waren an ihren blank gewienerten Kragenringen, denen sie ihren Spitznamen Kettenhunde verdankten, gut erkennbar.
Frauen klammerten sich weinend an Landser. Liebschaften zwischen Deutschen und Französinnen gingen jäh zu Ende. Abschiedsszenen, wie sie täglich an jedem Bahnhof der Welt stattfanden. Kinder sprangen lachend aus einem Waggon und tanzten fröhlich herum. Eine Nonne schmetterte ein paar deutliche Worte und die Kleinen stellten sich in einer Reihe auf. Dann wurden sie durchgezählt.
„Wie bei uns“, lachte Heini und deutete auf die Szene.
Ich entdeckte einen Zeitungsstand. „Leute, ich decke mich mit Lesestoff ein. Mag jemand noch was?“
„Nein danke, wird eh´ bald dunkel.“
Schnell trat ich aus der Reihe und ging flotten Schrittes zum Kiosk. Meine Augen flogen über die ausliegende Ware, doch ich konnte nichts entdecken, das mich interessierte. Leicht verärgert drehte ich mich um und wollte zurückgehen, als ich mit rauem Ton angesprochen wurde.
„Du hast dich wohl verlaufen, Soldat!“
Ich stand zwei Feldgendarmen gegenüber. Einer war Feldwebel, der andere Unteroffizier. Der Ranghöhere hatte mich angesprochen.
„Nein“, antwortete ich höflich. „Ich wollte mir nur noch schnell eine Zeitung kaufen.“
„Hast du aber nicht.“
„Na und? Ich habe keine gefunden“, kam meine ehrliche, vielleicht etwas zu freche Antwort.
„Soldbuch und Marschbefehl!“
Meine Hand ging nach oben. Ich knöpfte die Brusttasche meiner Feldbluse auf, um das Soldbuch heraus zu ziehen.
„Ich denke, der Kerl war gerade dabei sich von der Truppe zu entfernen, um zu türmen. Wir sollten ihn gleich mitnehmen“, sagte nun der zweite Kettenhund. Er hatte eine fies klingende, helle Fistelstimme.
Ich erstarrte vor Schreck. „Nein! Gewiss nicht.“
„Du lügst. Du sagst uns, dass du eine Zeitung kaufen wolltest, hast aber nichts gekauft. Mir reicht der Verdacht!“
„Das können Sie nicht machen. Heini, Alfred!“, plärrte ich laut und hob die Arme, um meinen beiden Kameraden zuzuwinken.
Im Nu hatte ich den Lauf der MP 40 des Mannes mit der Fistelstimme in den Rippen. „Eine Bewegung, du Deserteur, und ich erspare dem Henker die Arbeit.“
Auf meiner Stirn bildeten sich Schweißperlen. Meine Knie begannen leicht zu zittern.
„Was ist hier los?“
Ich atmete auf. Leutnant Meier, Alfred und Heini waren herüber gekommen.
Der Feldwebel musterte den Offizier. Mit etwas freundlicherem Ton sagte er: „Der hier wollte türmen. Hat wohl jetzt schon die Hosen voll!“
Leutnant Meiers Gesicht war ausdruckslos. „Dieser Pionier wollte eine Zeitung kaufen, sonst nichts. Seine beiden Kameraden haben mir das bestätigt.“
„Unsere Feststellung war anders.“
„Dann haben Sie sich getäuscht, meine Herren. Ich werde den Pionier mitnehmen. Wir werden an die Front verlegt.“
„Ich denke, wir werden den Pionier mitnehmen, Herr Leutnant.“ Das wir wurde hierbei besonders betont. Mir war übel zumute. Ich verfluchte die Idee mit dem Zeitungskauf.
„Bitte, dann tun Sie das, aber ich möchte sofort ihre Namen und den Ihres Vorgesetzten. Sie schreiben ihren Bericht und ich werde meine Version schreiben und dann möchte ich sehen, welcher Bericht mehr Gewicht hat. Abgesehen davon werde ich vorschlagen, sie beide aufgrund ihres besonderen Auges für Verdächtiges an die Ostfront zu versetzen. Dort werden Männer ihres Kalibers dringender benötigt als hier in Frankreich!“
„Sie wissen, dass wir Sie auch festnehmen …“, begann der Kettenhund mit der Fistelstimme, wurde jedoch von seinem Kameraden unterbrochen.
„Nehmen Sie diesen Kerl mit. Wir werden nochmal ein Auge zudrücken“.
Kaum ausgesprochen drehte er sich um und ging schnellen Schrittes weiter.
„Auge zudrücken“, wiederholte der mit der Fistelstimme und folgte dem anderen.
„Danke“, atmete ich erleichtert aus.
„Danken Sie Ihren beiden Kameraden und merken Sie sich, dass man sich niemals ohne Erlaubnis von der Truppe entfernt!“
Das hatte gesessen. Ich hatte meine erste Lektion gelernt. „Jawohl, Herr Leutnant“, presste ich beinah demütig aus.
„Zurück zum Zug.“
Nachdenklich und immer noch mit flauem Gefühl in der Magengegend, folgte ich meinen Kameraden.
Als wir auf die Waggons eingewiesen wurden, konnte ich mit Heini Schäfer und Alfred Lechner zusammen bleiben. Außer uns waren noch zwei weitere Pioniere unseres Haufens dabei. Es handelte sich um Fritz Schneider und Helmut Zapf. Dann stiegen acht Kameraden unserer Nachbarkompanie ein, die ich lediglich vom Sehen, aber nicht namentlich kannte.
Schon während wir unsere Strohlager herrichteten und Decken über den ausgesuchten Schlafplätzen ausbreiteten, fiel mir ein Unteroffizier auf, der sich am Bahnsteig mit Leutnant Meier unterhielt. Sie standen etwas abseits und rauchten.
Einem der anderen Landser war wohl mein Blick aufgefallen. „Der Kerl, der sich mit Meier unterhält, scheint ´n altes Frontschwein zu sein. Er hat ´ne recht frische, dicke Narbe im Gesicht und ´n Haufen Lametta auf der Brust.“
Ich wandte mich dem Redner zu. Er streckte seine Hand aus. „Ich bin Erwin.“
Ich stellte mich ebenfalls namentlich vor. Erwin Gierstner war waschechter Franke, der das „t“ wie ein „d“ und das „p“ wie ein „b“ aussprach.
„Hartes P und weiches D“, erklärte er lachend.
Nach und nach stellten sich auch die anderen vor. Allesamt waren wir Pioniere. Ein Blick über die Schulter folgte. Der Unteroffizier und Leutnant Meier rauchten bereits die zweite Zigarette kurz hintereinander.
„Ob er zu uns in den Waggon kommt? Bei den anderen sind schon ein paar alte Hasen zugestiegen. Dürften allesamt Rückkehrer sein.“
„Denke schon“, grunzte Heini. „Er hat schon ein paarmal her geglotzt.“
„Ich hoffe, dass er unser Wagenältester wird. Der Kerl hat bestimmt ´ne Menge zu erzählen“, grinste Erwin.
Die beiden Männer verabschiedeten sich mit einem sehr saloppen Militärgruß. Danach kam der Unteroffizier tatsächlich direkt auf unseren Waggon zu. Erst als er direkt vor uns stand, fiel uns auf, dass wir den Eingangsbereich an der Schiebetür dicht gemacht hatten, da wir uns alle dort aufhielten.“
Der Unteroffizier blieb vor dem Waggon stehen. „Was glotzt ihr so? Rutscht mal zu Seite, ich muss auch noch rein.“
Sofort schnellten wir zu Seite. Wie gelernt stellten wir uns im kleinen Karree auf. Verdutzt blickte der Unteroffizier in unsere Gesichter. Er warf sein Gepäck an einen freien Platz und setzte sich hin. Wir rührten uns nicht.
„Haben sie euch Holzstöcke in den Arsch gerammt, weil ihr nicht sitzen könnt?“, fragte er mit breitem Grinsen im Gesicht.
Alfred startete den Versuch einer Antwort, doch es kam nur ein halb gestottertes Kauderwelsch heraus. „Äh, nein, äh … Herr Unteroffizier. Es ist nur, äh …“
„Leute, ab heute ist es vorbei mit dem Kasernenton. Ihr seid zwar junges Kanonenfutter, steckt aber nicht mehr im Drillich. Bewegt euch.“
Daraufhin versuchten wir uns entspannt zu benehmen. Es schien offensichtlich nicht zu klappen. Wir waren es einfach nicht gewohnt, dass ein Unteroffizier so salopp zu uns sprach.
„Wir werden ´ne ganze Zeit unterwegs sein. Entweder macht ihr es euch bequem oder ihr bleibt stehen. Ich für meinen Teil …“, sagte der altgediente Soldat und lümmelte sich in seinen Strohhaufen hinein, „… mache es mir mal bequem.“
Ich nutzte die Gelegenheit und setzte mich auch auf meinen Platz, der sich gleich neben dem des Wagenältesten befand.
Nach und nach setzten sich auch alle anderen hin.
„Also, nochmal von vorn. Passt auf, ich habe keine Lust alles zweimal zu sagen.“
Auf den Schlag wurde es mucksmäuschenstill.
„An der Front sind wir normalerweise per du. Wenn ihr einen fremden Kameraden seht, so grüßt ihn freundlich. Haltung und das militärische Krimskrams solltet ihr ab Feldwebel aufwärts, aber auch bei manchen Unteroffizieren machen. Offiziere sind immer durch Handanlegen an die Kopfbedeckung zu grüßen. Es gibt zwar Ausnahmen, aber die werdet ihr noch kennenlernen. Haltet euch immer an die alten Frontschweine. Die leben noch, weil sie wissen wie der Hase läuft. Versucht nie den Helden zu spielen. Wenn ihr was zum Futtern habt, so wie jetzt, dann futtert es auf. Achtet auf Eure Munition. Ein Landser weiß immer, wie viele Patronen er im Magazin hat. Wenn Ihr Gelegenheit habt, dann pennt. Ihr werdet noch Zeiten erleben, in denen ihr vielleicht tagelang nicht zum Schlafen kommt. Das war´s für´s erste.“
Schweigen.
Ich räusperte mich. „Entschuldigung, Herr Unteroffizier. Wie sollen wir Sie denn ansprechen?“
Er wendete sich mir zu. Ich blickte in stahlblaue Augen. Unter seinem Käppi schimmerte strohblondes Haar hervor. Die Haut war sonnengebräunt und wettergegerbt. An der rechten Wange zog sich eine relativ frische Narbe hellrot quer vom Kinn bis zu hoch zum Ohr. Sie endete am Haaransatz. Man hatte zwar sofort Respekt vor diesem Mann, jedoch keine Angst. Seine Augen waren nicht kalt. Sie wirkten eher freundlich. Am zweiten Knopfloch der Feldbluse war das Band des Eisernen Kreuzes zu sehen. Am rechten Ärmel, auf Höhe des Oberarms, waren untereinander drei Abzeichen befestigt. Sie bestanden aus einem rechteckigen Aluminiumgespinst der Größe 32 mm x 90 mm, ober- und unterhalb abgegrenzt durch etwa 3 mm eingewirkten dünnen schwarzen Stoffstreifen. Mittig war ein aus Blech gestanzter, silberfarbener Panzer angebracht.
„Das Eiserne Kreuz und das Panzervernichtungsabzeichen, gleich dreimal“, raunte ich leise.
Vor mir saß ein Kriegsheld. Mir verschlug es die Sprache, was eigentlich eher selten der Fall war. Wie automatisiert streckte ich meine Hand nach vorn. Der Unteroffizier ergriff sie. Ich spürte einen harten Händedruck.
„Wolf Tiedtke. Nennt mich einfach Wolle, das sagen alle!“
„Freut mich sehr, Wolle. Ich bin Hans. Hans Gruber.“
Nun stellten sich alle mit ihren Namen vor. Als die Runde beendet war, meinte Wolle lediglich, dass er sich die Namen sowieso nicht auf einmal merken könne, sie aber bis zum Ende der Fahrt garantiert auswendig beherrscht. „… und zwar mit dem richtigen Gesicht dazu“, schob er nach und begann schallend zu lachen.
Ein lautes Pfeifen kündigte die ersehnte Abfahrt an. Der Waggon ruckelte schwerfällig vor und zurück, Dampfwolken wurden von der Lok in den Spätnachmittagshimmel gestoßen. Die schweren Eisenräder begannen sich zu drehen.
Tschut – tschuuuut
Klack klack klack
Der Militärtransport nahm Fahrt auf. Das monotone Klacken, das beim Überrollen der Eisenbahnschwellen durch die schweren Räder entstand, würde uns tagelang begleiten.
Wir waren komplett ausgerüstet und mit bester Verpflegung versorgt. Es duftete nach frischem Heu. Der einströmende Fahrtwind war angenehm kühl. Die Häuserreihen lichteten sich allmählich. Wir rollten erst in nördlicher Richtung, dann östlich durch Frankreich. Sanft glühende Rapsfelder zogen an uns vorbei. Kühe weideten auf üppigen Wiesen. Saftige Ähren verschiedener Kornfelder wiegten sich im Wind. Kleinere und größere Dörfer wurden passiert.
Keiner wusste, wohin die Fahrt gehen würde. Alles unterlag strengster Geheimhaltung. Selbst als wir am Abschiedsabend den Spieß mit drei Litern Rotwein abgefüllt hatten, war ihm lediglich ein: „Ihr werdet es schon noch früh genug erfahren“, zu entlocken.
Ich war in tausenden Gedanken versunken.
„Wolle, hast du eine Ahnung, wohin die Reise geht?“, ich wunderte mich über meine unverblümte, direkte Frage. Ich musste wohl im Unterbewusstsein ständig daran gedacht haben und plauderte ohne weiter nachzudenken drauf los. Bislang herrschte rege Unterhaltung im Waggon. Plötzlich schwiegen alle. Vier Mann unterbrachen nach meiner Frage sogar ihr Kartenspiel, obwohl ihnen nicht mehr viel Spielzeit blieb. Draußen dämmerte es bereits.
„Klar, ihr noch nicht, oder?“
„Nein.“
„Immer diese Geheimniskrämerei. Passt mal auf, Jungs. Ich schlage vor, wir futtern was. Mit vollem Bauch spricht sich´s leichter.“
Sofort packten wir unsere Kaltverpflegung aus. Für den ersten Abend hatten sie frisches Baguette mitgegeben. Dazu gab es Käse und Salami. Für je zwei Mann war uns sogar eine Flasche Rotwein zugeteilt worden.
„Nicht schlecht, das französische Gesöff“, meinte einer der Kameraden. Es war Walter Göttler. Wie er später erzählte, war er Winzer und stammte aus dem Würzburger Raum. Göttler kannte sich mit Wein aus.
„Herrlich!“
„Wie Gott in Frankreich.“
Wolle Tiedtke hatte eine Flasche Wein für sich allein. Er schenkte sich seinen Trinkbecher voll, prostete uns zu und leerte ihn in einem Zug. „Stimmt. Das ist richtig guter Wein. Länger hätten wir ihn sowieso nicht aufheben können. Der wäre uns während der Fahrt sauer geworden.“
Auch ich genoss das Abschiedsmahl. Ich fühlte mich frei. So richtig frei, ungebunden und voller Abenteuerlust. Der Käse war würzig, das Baguette noch frisch und die Salami ein Genuss. Pur Poc luftgetrocknet; und das schmeckte man. Dazu genoss ich immer wieder einen Schluck des trockenen französischen Landweins.
Nach dem Essen zündeten sich die Raucher unter uns Zigaretten an. Wolle bot mir eine französische Gauloises an.
„Danke, nein. Ich rauche eigentlich nicht, und wenn, dann nur leichte Marken“, winkte ich ab.
Die Packung mit dem geflügelten Helm verschwand in der Feldbluse, während in der rechten Hand des Unteroffiziers ein Sturmfeuerzeug aufflammte. Er zündete die Zigarette an und sog den Rauch des ersten Zuges tief in seine Lungen, um ihn stoßweise wieder auszublasen.
„Ich mag diese Sorte. Ist schön kräftig. Normal rauche ich Eckstein.“
Die bläulichen Dunstschwaden wurden vom Fahrtwind erfasst, der sie zum Tanzen brachte und entweder nach draußen oder unter die Waggondecke bugsierte, wo sie halb durchsichtig waberte.
„Ihr werdet alle meinem Haufen zugeordnet. Drei oder vier sogar in meine Gruppe, falls sie mich nicht schon zum Zugführer gemacht haben“, begann Wolle zu berichten.
Keiner wagte es zu unterbrechen, obwohl allen die Frage aller Fragen auf den Zungen brannte. Wohin ging die Reise?
„Wir schwarzen Pioniere sind die Feuerwehr für alle. Wir sind da, wo es brennt. Wir sind die ersten und die letzten am Feind. Wir sind dort, wo die Eisernen Kreuze wachsen, meine Freunde. Ich möchte ganz ehrlich zu euch sein. Für den einen oder anderen wird es eine Fahrt ohne Wiederkehr.“
Er nahm einen kräftigen Zug. Während die Glut das Gesicht für Sekundenbruchteile orange-rötlich schimmern ließ, leuchtete die Narbe blutrot. Wolle fuhr mit einem Finger darüber.
„Die hier habe ich mir bei der Büffelbewegung geholt.“
„Büffelbewegung?“, fragte einer.
Der Nebenmann belehrte ihn und kam damit dem Unteroffizier zuvor. „Das war der Tarnname von Generaloberst Models grandioser Operation. Die gesamte 9. Armee war von der Einschließung bedroht. Obwohl die Russen ständig angriffen, gelang es der 9. Armee sich binnen zwei Wochen von Rshew und Wjasma aus abzusetzen. Die HKL wurde um 230 Kilometer gekürzt und man sparte dabei noch etliche Divisionen.“
„Richtig, Kamerad. Es waren 21 Divisionen.“
„Du warst dabei?“
Stummes Nicken. „Es war im März. Wetterkapriolen ohne Ende. Anfangs Eiseskälte, Nebel und am Ende Tauwetter, machten uns schwer zu schaffen. Ich lag mit meinen Jungs irgendwo zwischen Lasinki und Djuki. Wir hatten uns eingeigelt. Der Iwan griff mit erdrückender Übermacht an. Seine Artillerie schien nie zu pausieren. Panzer wurden von Infanterie begleitet. Wir kämpften wie besessen und wiesen Angriff für Angriff ab. Beim letzten Angriff passierte es. Ein T 34 brach durch. Er rollte auf das Nest meines Kameraden Jens Dorfmann zu, blieb über dem Erdloch stehen und wälzte die Ketten herum. Ich kroch aus meinem Loch, sprang auf und rannte auf den Stahlkoloss zu. Wie durch ein Wunder kam ich ungeschoren dicht an den T 34 heran und konnte eine Geballte Ladung anbringen. Beim Abhauen rutschte ich aus. Es rumste ordentlich. Meine Ohren waren minutenlang taub. Dicker, nach verbranntem Öl stinkender Qualm ließen mich keine zwei Meter weit sehen. Das Atmen schmerzte in den Lungen. Plötzlich standen zwei Rotarmisten vor mir. Sie waren wohl genauso überrascht wie ich. Meine Maschinenpistole lag auf dem Boden. Ich zückte mein Kampfmesser und sprang auf den ersten Iwan zu. Ich jagte ihm das Ding in die Brust.“
Er stockte und bekam einen Tunnelblick. Der Ton in Wolles Stimme änderte sich, wurde tiefer und ganz ruhig.
„Er war noch ein Junge.“
„Und dann?“, hakte Heini nach.
Wolle fing sich erstaunlich schnell und sprach weiter, als ob nichts gewesen wäre. „Dann spürte ich etwas über mein Gesicht schrammen. Ich duckte mich weg und rollte zur Seite. Über mir stand der zweite Russe und holte mit seinem Karabiner aus. Das Bajonett war aufgepflanzt. Ich wähnte mich schon im Himmel, als er plötzlich zusammen sackte. Ein Gegenangriff stopfte das von den Sowjets gerissene Loch. Ich war immer noch halb taub. Auf einmal standen zwei Sanitäter um mich herum. Sie hievten mich auf eine Trage und brachten mich zur Verwundetensammelstelle. Ich war längst weggekippt. In meinem Rücken steckten ein paar kleine Splitter. Auf dem linken Ohr kann ich nicht mehr so gut hören und im Gesicht habe ich diese Erinnerung.“
Er zeigte abermals auf die Narbe.
„Aber ansonsten bin ich wieder voll auf dem Damm. Drei Monate Frontpause haben mir verdammt gut getan. Die herrliche Zeit der Genesung ist leider vorbei und jetzt fahre ich zurück zu meinem alten Haufen. Leute, ihr gehört zur 98. Infanterie-Division. Wir sind das Pionier-Bataillon 198 und ich bin in der zwoten Kompanie. Wir fahren nach Russland.“
„Ostfront!“
Das Wort schockierte uns. Ich wiederholte es im Stillen mindestens drei- oder viermal: Ostfront!
„Ausgerechnet an die Ostfront“, jammerte einer der Männer. „Dorthin wollte ich nicht unbedingt.“
„Wohin dort?“, fragte ein anderer.
„Ja, Wolle. Wo liegt die Division jetzt?“
„So viel mir bekannt ist, geht’s zur Krim. Ich tippe schwer auf den Kubanbrückenkopf!“
Ich rechnete im Kopf die ungefähre Strecke aus. Verblüfft teilte ich mein Ergebnis mit. „Leute, das sind von Roanne aus mehr als 3.000 Kilometer. Wir werden tagelang unterwegs sein.“
„Auf uns“, sagte Wolle und hob seinen Becher, der randvoll mit Wein befüllt war.
„Prost!“
Wir erreichten die deutsche Grenze. Mit einer kurzen Unterbrechung rollte der Zug die ganze Nacht durch Deutschland. Wolle schloss irgendwann die Schiebetür. Ein starkes Rütteln, begleitet vom lauten Quietschen der Bremsen weckte uns. Es war früh am Morgen. Die Lokomotive stand und wir stiegen aus. Wir befanden uns auf dem wohl einzigen Nebengleis eines kleinen Bahnhofs. Außer den Wassertanks und einem Bahnhofsgebäude war wenig zu sehen.
„Was ´n das für ´n Kaff?“, fragte Zapf.
„Scheißegal, Kameraden. Nutzt die Gelegenheit für die Morgentoilette. Wenn jemand von euch warmes Wasser benötigt, bekommt er das vorne bei der Lok. Achtet auf die Signale und bleibt zumindest zu zweit. Wenn Kettenhunde patrouillieren, schlagt sofort den Weg zum Zug ein. Die Feldgendarmen verstehen oft keinen Spaß.“
„Das habe ich zu spüren bekommen“, grinste ich. Was mir gestern noch weiche Knie beschert hatte, betrachtete ich heute mit einem Lächeln. Ich werde die Geschichte wohl hier und dort mal als kurioses Erlebnis anbringen können, dachte ich mir und marschierte, mein Waschzeug unter den Arm geklemmt, in Richtung Lok.
Eine Stunde später fuhr der Truppentransport wieder weiter. Nach einem ausgiebigen Frühstück frönten wir unterhaltsamen Dingen. Die Kartenspieler fanden sich zusammen, ein paar der Männer lasen, der Rest unterhielt sich und betrachtete die vorbeiziehende Landschaft. Bereits am Nachmittag war uns bewusst, wie langweilig die Fahrt werden würde.
Stunde um Stunde verging, Tag um Tag. Jedes Mal gab es den gleichen Trott. Wenn der Zug anhielt, sprangen wir ab, verrichteten unsere Notdurft, vertraten die Beine und organisierten etwas. Mal gab es einen Schwung Zeitungen, dann mal heißen Kaffee oder auch nur eine neue Latrinenparole, die, je nach Wertigkeit der angegebenen Quelle, für angeregte Unterhaltungen und Spekulationen sorgte.
Längst hatten wir Deutschland verlassen und durchquerten Ungarn. Die Landschaft änderte sich, die Ortschaften und Häuser wirkten befremdend und die Menschen wirkten anders. Wenn wir durch Ortschaften fuhren, winkten hin und wieder Kinder zu. Anfangs erwiderten wir die Grüße, später hoben nur noch ein paar Landser die Hände zum Gruß. Monotonie machte sich breit.
Wir erreichten Russland. Das Gefühl war unbeschreiblich. Die Namen Russland und Ostfront trieben einem in Deutschland Gänsehaut über den Rücken. Hier und jetzt wirkte das fremde Land eher verträumt. Riesige, nie endende Felder lagen entlang der Bahnstrecke. Bauern, Landarbeiter und Frauen standen schwitzend in der sengenden Sonne und kamen ihren harten Arbeiten nach. Obwohl ich in Westpreußen als Erntehelfer tätig war, kam mir diese Arbeit schwerer vor.
Ich verließ meinen Platz an der Schiebetür nur selten. Die Weite Russlands faszinierte mich.
Foto: Privatarchiv d. Autoren – PA-05 – Bahnfahrt – Essen an der Schiebetür
Drei Tage später gab es erste Partisanenwarnungen. Wolle ließ die Waffen prüfen. „Seid immer auf der Hut. Wenn wir von einer Bande angegriffen werden, geht´s rund. Partisanen nehmen keine Rücksicht und kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Sie wissen, dass ihnen die Kugel oder der Strick droht, wenn wir sie lebend in die Hände bekommen. Sie hassen jeden Landser und kennen keine Gnade. Wer von ihnen gefangen wird, muss mit Folter bis zum Tod rechnen“, belehrte uns der Unteroffizier.
Beim nächsten Halt wurde bekannt gegeben, dass wir ein bis zwei Tage hier bleiben würden. Die Lokomotiven wurde gewechselt und die Verpflegung aufgefüllt. Es gab wieder einmal warmes Essen und das Stroh in den Waggons wurde gewechselt. Aber das Beste war, dass wir in die Stadt durften. Die Abwechslung tat gut. Mit ein paar Kameraden bummelte ich durch die Stadt und besuchte schließlich eine Gastwirtschaft in Bahnhofsnähe. Ich machte Bekanntschaft mit russischem Tee, Wodka und der russischen Sprache.
Bitte, danke, ja und nein, Freund, guten Morgen, guten Abend und auf Wiedersehen, gehörten zu meinem ersten Wortschatz in Russisch.
Am zweiten Tag entdeckten wir einen Markt. Dort deckten wir uns mit allerlei Dingen ein, die uns wichtig erschienen. Die Bäuerinnen boten eingelegte Gurken, Paprika und Tomaten an. Es gab Machorka, frisches Obst und selbstgebrannten Schnaps.
„Eigentlich hatte ich gehofft, eine hübsche Russin zu finden, die mir beim Sprachunterricht behilflich ist“, grinste Alfred Lechner und zwinkerte mir zu.
Wir waren gerade auf dem Rückweg zum Zug.
„Und? Warum haste das nicht gemacht?“
„Scherzbold. Du hast doch selbst gesehen, dass sie nur die alten Weiber auf die Straße und hinter die Marktstände gelassen haben. Die jungen, hübschen Dinger wurden in den Häusern und Wohnungen versteckt.“
Ich lachte. „Wenn das Sprichwort stimmt, dass du die Mutter ansehen sollst, um zu wissen, wie deine Braut später aussehen wird, verzichte ich auf eine Russin.“
„Totaler Quatsch“, konterte Wolle, der nur einen Meter hinter uns ging. „Die Russen haben Weiber, da können sich unsere Mädels eine Scheibe abschneiden. Ihr habt sie nur nicht zu Gesicht bekommen.“
Fritz Schneider und Helmut Zapf stießen hinzu. Während Zapf wie am Spieß schimpfte, lachte Schneider pausenlos.
„Was ist denn los?“, wollte ich sofort wissen.
Zapf´s Gesicht glühte hochrot vor Zorn. „Mich hat so ein russischer Gauner beschissen. Wenn ich den Kerl erwische, schlage ich ihn krankenhausreif.“
Schneider prustete immer lauter. „Ha, ha … Helmut hat Schnaps gekauft. Der Russe bot zwei Flaschen für zwei Reichsmark an. Helmut zahlte mit 20 Mark und bekam Silberrubel zurück. Der Russe machte sich vom Acker und Helmut stand am Ende mit falschen Silberrubeln und zwei Flaschen bestem Wasser da.“
Wir lachten nun alle und Helmut schmetterte vor Wut die beiden als Schnaps deklarierten Flaschen zu Boden. „Wäre ich nur in den Puff gegangen …“, donnerte er.
„Komm, ich lade dich ein. Mein Schnaps war zwar teurer als ´ne Mark, aber dafür brennt er richtig beim Saufen. Das ist ´n Rachenputzer, wie er im Buche steht“, schlug ich vor und klopfte meinem betrogenen Kameraden auf die Schulter.
Der Verlust war herb. Der Sold eines wehrpflichtigen Pioniers betrug inklusive Frontzulage rund 45 RM im Monat, der eines Zeit- oder Berufssoldaten im Rang eines einfachen Schützen bei etwa 150 RM.
Zapf beruhigte sich nach und nach und als wir wieder im Zug saßen und weiterrollten, lachte er bereits über seine Einfältigkeit.
Wolle hatte selbstverständlich Recht. Wir fuhren in Richtung Krim. Immer wieder mussten wir pausieren, um Nachschubtransporten auszuweichen oder zurückfahrenden Lazarettzügen Vorrang zu gewähren. Einige Male pausierte der Zug wegen Partisanenalarm für mehrere Stunden. Nach einer dieser Zwangspausen kam Wolle zurück und hatte Informationen für uns.
„Männer, es ist zwar noch halb-offiziell, aber ich verwette mein gesamtes Hab und Gut, dass es stimmt. Wir fahren zur Krim. Unser Zielbahnhof heißt Simferopol.“
„Dann werden wir im Kubanbrückenkopf