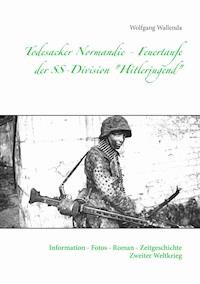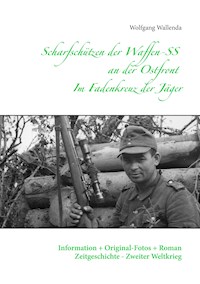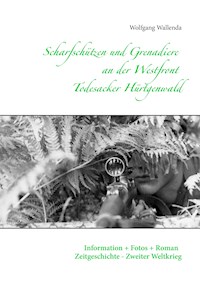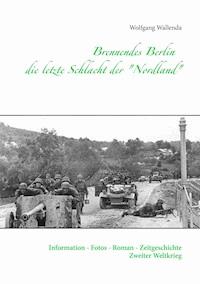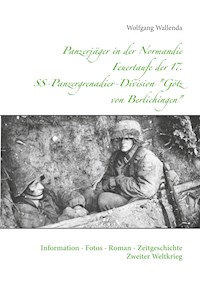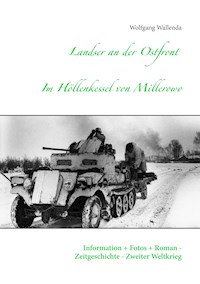Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Diese Geschichte basiert auf der Legende des Duells zwischen dem zum Helden Stalingrads deklarierten russischen Scharfschützen Wassili Grigorjewitsch Saizew und der wohl fiktiven Person des deutschen Scharfschützen-Ausbilders Major Erwin König. Düster, kalt und ohne Pathos wird sehr realitätsnah sowohl das Schicksal der in Stalingrad kämpfenden Soldaten als auch über das der zwangsweise in der Stadt verbliebenen russischen Zivilbevölkerung aufgezeigt. Während der menschenverachtenden und an Brutalität nicht zu überbietenden Schlacht, streifen deutsche und russische Scharfschützen wie Todesengel durch die Ruinen und verbreiten zusätzlich Angst und Schrecken. Unter ihnen befindet sich der deutsche Major Erwin König. Getrieben von Rache, jagt er die russische Scharfschützen-Legende Wassili Saizew. Ein fesselnder Anti-Kriegsroman, der schonungslos die Schrecken der Schlacht um Stalingrad widerspiegelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Waffenlärm schweigen die Gesetze.
Marcus Tullius Cicero
Wenn alle Menschen nur aus Überzeugung in den Krieg zögen, dann würde es keinen Krieg geben.
Leo N. Tolstoi
Diese Geschichte basiert auf der Legende des Duells zwischen dem zum Helden Stalingrads deklarierten russischen Scharfschützen Wassili Grigorjewitsch Saizew (*23.03.1915 – †15.12.1991) und der wohl fiktiven Person des deutschen Scharfschützen-Ausbilders Major Erwin König.
Dem deutschen Offizier wird eine Vita hinterlegt und dessen fiktive Geschichte im Hintergrund der Schlacht um Stalingrad sehr realitätsnah erzählt.
Handlung und Protagonisten sind, bis auf historische Persönlichkeiten, frei erfunden.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
PROLOG
Russland 1927. Der zwölfjährige Junge lauerte seit knapp zwei Stunden im Unterholz und beobachtete unermüdlich die große Lichtung. Die Siedlung Jeleninka im Rajon Agapowka, in der der Bauernhof seiner Eltern lag, war mehr als eine Stunde Fußmarsch von hier entfernt. Es schneite. In der Stille des Waldes fühlte er sich zu Hause. Hier war er frei. Es war sein Reich.
Das Jagen war schon immer seine Leidenschaft. Er beherrschte beide Arten der Jagd. Die Treibjagd und das Lauern. Er konnte Beutetiere aufschrecken und schnell erlegen, er konnte aber auch stundenlang warten, um im richtigen Moment zu zielen und schießen. Die Attribute, die ihn auszeichneten, waren Beharrlichkeit, Geduld und der unbändige Wille sein Ziel zu erlegen.
Zu Hause warteten sie sicherlich schon ungeduldig auf ihn, doch er wollte nicht ohne Beute heimkehren. Er musste diese wilde Ziege, hinter der er seit langem her war, endlich schießen und ihr Fleisch nach Hause bringen, um seine Familie zu ernähren. Nichts konnte ihn davon abbringen, geschweige denn Angst einjagen. Nicht einmal vor der nahenden Dunkelheit hatte er Respekt. Warum auch? Die Bären hielten Winterschlaf und Wölfe würde er mit seiner Flinte schon fernhalten. Zur Not wäre er auch in der Lage eine Fackel zu bauen. Wölfe fürchteten das Feuer.
„Ich möchte diese Ziege schießen, bevor die Wölfe sie holen!“, hatte er seinem Bruder gesagt und war losgegangen.
„Du musst zurück sein, bevor es dunkel wird“, wurde ihm nachgerufen.
Mit breitem Grinsen hatte er sich umgedreht und geantwortet: „Keine Angst. Ich bin ja nur im Wald.“
Jetzt umgab ihn die Stille dieses Waldes. Das Gewehr lag ruhig in seiner Hand. In der Ferne hörte er das Heulen der Wölfe.
Sie sind weit weg. Das ist gut!
In der Mitte der Lichtung lag etwas Heu. Er hatte es extra aus der Scheune geholt und als Köder mitgenommen. Es musste für Grasfresser paradiesisch duften. Er warf einen Blick nach oben in den Himmel.
Bald ist die Sonne weg.
Diese Ziege hatte ihn herausgefordert, doch sie war immer tiefer in den Wald hinein gelaufen. Er hatte die Herausforderung angenommen und war ihr hartnäckig gefolgt. Der Trumpf der Ziege war die Zeit, sein Trumpf das alte Gewehr und seine schier unerschöpfliche Beharrlichkeit.
Ein dumpfes Knacken im Unterholz verriet ihm, dass sich etwas auf die Lichtung zubewegte. Seine Sinne waren geschärft. Seine rechte Hand rutschte aus dem warmen Handschuh. Der Kolben des Gewehrs wurde gegen die Schulter gepresst, der rechte Finger in den Abzugsbügel geschoben.
Vorsichtig, als ob sie es ahnen würde, bewegte sich die wilde Ziege auf das Heu zu.
Sein Atem ging flach. Er zielte so, wie es ihm beigebracht worden war. Der Zeigefinger erreichte den Druckpunkt. Er war im Ziel. Ausatmen, Luft anhalten. Der Schuss krachte, der Kolben wuchtete gegen seine Schulter. Das Projektil zerfetzte das Herz der Ziege und sie brach zusammen. Der Schnee um sie herum färbte sich blutrot.
„Ja!“, jubilierte Wassili Saizew und brüllte seine Freude in die Stille des Waldes. „Ich habe sie gejagt und ich habe gewonnen! Papa wird stolz auf mich sein und alle werden sich satt essen.“
Damals konnte der kleine Junge noch nicht ahnen, dass er fünfzehn Jahre später wieder auf die Jagd gehen würde. Doch dann nicht im heimischen Wald im Gebiet Tscheljabinsk, sondern im weit entfernten Stalingrad an der Wolga. Er würde die Uniform der Roten Armee tragen und seine Beute wären keine wilden Ziegen, sondern deutsche Soldaten.
Dieser kleine Junge namens Wassili Grigorjewitsch Saizew sollte zum gefürchtetsten Scharfschützen der Roten Armee werden.
In Stalingrad waren auch deutsche Scharfschützen eingesetzt, doch nur ein Mann verfügte über die Fähigkeit und die Hartnäckigkeit Saizew zur Strecke zu bringen. Major Erwin König.
An dem Tag, an dem ein russischer Scharfschütze Major Königs Sohn erschoss, nahm das Schicksal seinen Lauf und der deutsche Offizier begann Saizew zu jagen.
Die beiden fähigsten Scharfschützen der in Stalingrad kämpfenden Armeen streiften durch die völlig zerstörte Stadt, um sich gegenseitig aufzuspüren.
Die Jagd endete in einem Duell zweier gleichwertiger Gegner, nach dessen Ausgang keiner der beiden jemals wieder auf einen Menschen schoss.
Während die sowjetische Propagandamaschinerie Saizew zur Ikone und Werbefigur der Roten Armee hochstilisierte und dabei geschickt verschwieg, dass der Held von Stalingrad nach dem Duell mit Major König keinen einzigen gezielten Schuss mehr abfeuerte, verwischte der deutsche Offizier seine Spuren, um dem irrsinnigen Kampf endgültig den Rücken zu kehren. Zurück blieb lediglich der Mythos des Scharfschützen Major Erwin König.
©2020 Sophia Wallenda – Stalingrad 1
STALINGRAD IM FADENKREUZ - DAS DUELL DER SCHARFSCHÜTZEN
1
„Wer bisher dachte, er hat im Krieg alles erlebt, was man erleben kann, der war noch nicht hier!“, brüllte der Kompanieführer dem bartlosen Leutnant zu, der neben ihm im Graben lag.
Der junge Offizier nickte stumm und band sich ein mit Rasierwasser getränktes Tuch vor die Nase. Es war ein untauglicher Versuch, den ekelhaften, süßlich-fauligen Geruch von verwesendem Fleisch, der vom Wind zu ihnen herüber getragen wurde, zu überdecken.
Der Kompanieführer starrte wiederholt auf seine Armbanduhr. Es würde nicht mehr lange bis zum Angriffssignal dauern. Sein Herz raste, sein Puls trommelte. Wie oft hatte er schon seine Faust nach oben schnellen lassen und den Befehl zum Losstürmen hinausgebrüllt? Wie oft war er schon mit seinen Männern aufgesprungen und vorwärts gestürmt? Und wie oft musste er nach den Kämpfen harte Worte auf weißes Papier bringen, um den Hinterbliebenen in der Heimat zu schreiben, dass ihre Söhne, Ehemänner, Brüder oder Väter tapfer gekämpft hatten, bevor sie den soldatischen Heldentod starben und ihr Leben dem deutschen Volk und dem Endsieg schenkten?
So ein verfluchter Blödsinn! Das ist kein Heldentum, sondern Massenschlachten! Ihr Mütter und Väter zu Hause, seid froh, dass ihr nicht sehen könnt, wie wir hier verrecken, waren die nächsten Gedanken, die durch den Kopf des Hauptmanns schlichen.
Die Handflächen des Offiziers wurden feucht. Der Nachrichtenmann, der rechts neben ihm lag, hantierte am Funkgerät herum. Schließlich klopfte er dem Träger des 20 kg schweren Apparats auf die Schulter und deutete mit erhobenen Daumen an, dass alles in Ordnung war. „Der Schalter ist wieder fest“, schrie er, um die jaulenden Jericho-Sirenen der angreifenden Stukas zu übertönen.
Seit Tagen wurde in Stalingrad um den Mamai-Hügel, der militärisch als Höhe 102 bezeichnet wurde, heftig gerungen. Er stand wie ein monströser Wachturm zwischen dem südlichen Stadtzentrum und den im Norden ansässigen großen Fabriken. Wer ihn besaß, kontrollierte mit seiner Artillerie die Stadt. Man hatte freien Blick auf das Stadtzentrum, den Bahnhof, die Fabriken und auf die Lebensader von Stalingrad, die Wolga.
Auf dem Strom spielten sich dramatische Szenen ab. Rotarmisten wurden auf Schiffen und Kähnen aller Art übergesetzt und mussten durch das Todesfeuer der deutschen Artillerie fahren. Stellenweise trieben brennende Ölteppiche auf dem Wasser. Schwarzer Qualm raubte nicht nur die Sicht, sondern auch den Atem. Saugte man ihn ein, stach es in den Lungen.
Unteroffiziere trieben die Männer in ihren erdbraunen Uniformen an, Offiziere brüllten Befehle. Die Uferbereiche beiderseits des Flusses glichen Ameisenhügeln, auf denen es quirlig von Insekten wuselte.
Schiffe wurden getroffen, Rümpfe aufgerissen, Bootsplanken barsten, Wasser drang ein und brachte sie zum Kentern. Soldaten schwammen um ihr Leben. Wer Glück hatte, konnte sich an einem Stück Treibholz festhalten. Die meisten von ihnen ertranken. Leichen trieben herum. Ihre leblosen Körper trieben auf den Wellen der Wolga, deren Gischt sich am Bug der Schiffe brach. Die sowjetischen Soldaten litten Todesangst. Sie waren dem feindlichen Feuer und dem Wasser der Wolga hilflos ausgeliefert. Unaufhörlich sausten die Geschosse heran, senkten ihre Flugbahn und detonierten. Doch nicht nur der Fluss lag im Zielbereich der deutschen Artillerie, sondern auch der von den Russen besetzte Teil des Mamai-Hügels.
Huuiiit – Wumm
Splitter und Schrapnelle surrten durch die Luft und bohrten auch dort in Stellungen, Gräben, Bunkerdecken sowie in Fleisch und Knochen der sich zum Kampf eingegrabenen Rotarmisten.
Würde man die Höhe 102 erst einmal eingenommen haben, wäre man unweigerlich Herr über Stalingrad.
Mit diesem Wissen stürmte die 295. Infanterie-Division seit Tagen gegen die Stellungen der Roten Armee. Gestern Abend hatten sie es fast geschafft und unter schwersten Verlusten die Spitze genommen. Doch der Russe hatte über die Lebensader Wolga trotz enormer Verluste immer wieder neue Soldaten in den Kampf gepumpt, und nach einem Gegenangriff am Morgen die Deutschen wieder zurückgeschlagen. Jetzt stand der nächste Gegenschlag bevor.
Anfangs räumte man in Kampfpausen die Leichen noch weg. Diesen ritterlichen letzten Dienst verweigerte man sich seit geraumer Zeit gegenseitig. Die Kämpfe wurden immer härter und verbissener geführt. Mit Müh und Not konnten Sanitäter die Verletzten aus dem Todesacker bergen. Wer jedoch gefallen war, blieb liegen. Seit dem letzten russischen Angriff häuften sich die Leichenberge.
Der Hauptmann schloss die Augen. Er wusste, was ihn erwartete. Die Granaten der Haubitzen wuchteten nicht nur in den Stacheldraht und die besetzten Gräben der Russen, sie detonierten ebenso massenweise zwischen den Leichenbergen und zerfetzten noch den Rest menschlichen Anscheins der Toten.
Der Kompanieführer wusste, dass sie durch ein Gemisch aus stinkendem Blut- und Knochenbrei waten mussten, um an ihr Ziel zu gelangen. Er hatte durch den Feldstecher die Leichenberge zwischen ihnen und dem russischen Graben gesehen, und er erahnte, was die Sprengkraft der Granaten, die dazwischen detoniert waren, verursacht hatte.
Ein Schauer durchfuhr ihn. Gänsehaut breitete sich, beginnend vom Nackenhaaransatz über den ganzen Körper, aus. Im Magen des Offiziers rumorte es. Er unterdrückte den aufkommenden Brechreiz und sah den jungen Leutnant an.
Das mit dem Tuch ist doch keine dumme Idee, dachte er sich.
Rotte für Rotte Stukas donnerte über sie hinweg, senkte ihre Nasen und das ohrenbetäubende Heulen ihrer Sirenen erklang. Für die deutschen Landser war es erlösende Musik, für die Rotarmisten, die den Osthang des Mamai-Hügels immer noch hielten, nichts anderes als die nervenzerfetzende Ankündigung des Todes.
Die Piloten visierten ihre Ziele an, klinkten die Bomben aus, feuerten aus ihren Bordkanonen und zogen die Nasen ihrer Ju 87 wieder nach oben.
Der Luftangriff stellte die zweite Welle des Angriffs dar. Dem vorausgegangen war ein harter Artillerieschlag. Die dritte und schlachtentscheidende Welle war der Infanterieangriff.
Der Hauptmann umklammerte mit festem Griff seine Maschinenpistole. Im Koppel steckte eine Stielhandgranate. Er würde seine Männer zum Sieg führen oder mit ihnen untergehen. Er hatte in seiner kurzen Zeit als Kompaniechef viel zu viele Briefe schreiben müssen. Die 295. Infanterie-Division war eine Spitzen-Division und immer vorne dran. Der Preis dafür waren Menschenleben.
Seine Gedanken schweiften nach Hause ins schöne Sachsen-Anhalt. Sein Sohn Rolf hatte letztes Jahr mit Bravour das Abitur bestanden. Der Hauptmann wusste, dass ihn die Wehrmacht holen würde, denn Rolf war längst gemustert. Er ging in die Offensive und riet ihm, sich freiwillig zu melden und sich für die Offizierslaufbahn zu entscheiden. So konnte vielleicht umgangen werden, dass man ihn zwangsweise holte und irgendwohin steckte.
„Wenn, dann versuche es auf diesem Weg“, hatte er ihm geraten und Rolf hatte auf ihn gehört. „Als Offizier hast du vielleicht die Möglichkeit hier in Deutschland bleiben zu können. Oder du kommst nach Frankreich. Das wäre auch gut.“
Rolf bekam schließlich seinen Einberufungsbescheid zum Reichsarbeitsdienst und leistete die sechs Pflichtmonate in Ostpreußen ab. Danach wurde seine Bewerbung angenommen und er trat als Fahnenjunker seine Ausbildung zum Offizier an.
Sie sollen dich überall hin versetzen, nur nicht nach Russland! Das hier möchte ich dir ersparen, mein Sohn. Verfluchter Krieg! Was ist bloß mit der Welt passiert? Ich hasse es! Wie konnte es nur soweit kommen?
Eine der Bomben wurde sehr nah an ihren Stellungen ausgeklinkt. Die Detonation war laut und ließ die Erde zittern. Sie drückten sich fest zu Boden. Der Luftdruck schleuderte nicht nur Staub, Steine und Erde nach oben, sondern wirbelte auch zerfetzte Menschenteile herum. Als ein Reststück stinkender Eingeweide und gleich daneben eine Rippe mit Hautlappen vor dem Leutnant landeten, hob er sein Taschentuch, welches er immer noch vor dem Mund gebunden hatte, an und übergab sich.
Die angeforderte Gruppe der Sturmpioniere machte sich fertig. Sie würden ihnen den Weg durch die russischen Drahtverhaue frei sprengen.
„Oh Gott, wenn es dich gibt, dann hilf uns, das hier zu überleben“, presste der Hauptmann über seine Lippen.
Die letzte Rotte der Stukas beendete den Angriff, die Artillerie verlegte das Feuer komplett auf die Wolga. Eine rote Leuchtkugel zischte nach oben. Das war das Zeichen. Noch einmal kräftig durchschnaufen, dann sprang er hoch und brüllte: „Angriiiiifffff! Vorwääääärts!“
Zeitgleich sprangen die Sturmpioniere auf und hetzten geduckt los. Maschinengewehre ratterten und wollten jeden noch erdenklichen Widerstand auf russischer Seite bereits im Keim ersticken.
Rrrrrrrt rrrrrrt
Der Hauptmann keuchte. Er befand sich dicht hinter den Pionieren. Seine Männer folgten ihm mit lautem: „Hurraaaa!“ auf den Lippen. Sie brüllten sich ihre Ängste aus den Seelen.
Der Mamai-Hügel begann zu leben. Soldaten erhoben sich und rannten hinauf. Oben und an den besetzen Flanken krochen Rotarmisten aus ihren Deckungen und nahmen das Abwehrfeuer auf. Russische Artillerie mischte sich hinzu. Maschinengewehre ratterten los und rissen erste Löcher in die Reihen der Angreifer. Immer wieder fielen getroffene Landser zu Boden. Manche blieben reglos liegen, andere krümmten sich vor Schmerzen.
Der Weg nach oben war beschwerlich. Es gab keine Deckung. Die Realität war schrecklicher als der Hauptmann vermutete. Das Gelände war übersät mit Leichenteilen. Granattrichter unterschiedlicher Größen mussten um- oder durchlaufen werden. In ihnen sammelte sich, wie in einem Suppenkessel, eine Mischung aus Blut, Menschteilen und Knochen. Man versuchte es zwangsläufig, konnte jedoch nicht allem Ekelhaften ausweichen. Immer wieder sanken die Stiefel in dieser Blutsuppe ein, oder man trat auf den Brustkorb eines Gefallenen, zerquetschte diesen und mit dumpfen Geräuschen, die an Röcheln erinnerten, wurden stinkende Faulgase herausgepresst.
Der Kompanieführer sah, wie einer der Pioniere fiel.
Kopfschuss, registrierte er.
Der Soldat sackte zusammen wie ein nasser Sack. Gleich darauf stürzte der nächste Pionier getroffen zu Boden. Der Offizier hielt seine Schmeißer-MP in Richtung der russischen Gräben und gab zwei Feuerstöße ab, dann hob er die Hand und deutete mit heftigem Winken auf die Sturmpioniere.
„Deckt den Angriff der Pioniere ab! Sperrfeuer! Die Maschinengewehre sollen sie schützen, verdammt noch mal!“, brüllte er seinen Nachrichtenmännern zu, die beide versuchten im Tempo mitzuhalten.
Das Jaulen von mehreren Katjuschas war zu hören.
Huuuiiiiii huuiiiii
„Volle Deckung! Stalinorgel!“
Sie warfen sich auf den Boden. Der Hauptmann hechtete in einen größeren Granattrichter. Es roch verbrannt. Er vermied es, sich umzusehen.
Wumm wumm wumm
Einschläge waren zu hören. Immer wieder krachten die Sprengköpfe der Raketengeschosse in die Erde. Die meisten von ihnen verfehlten jedoch glücklicherweise die Reihen der Angreifer. Die Nachrichter gaben den zuvor erhaltenen Befehl weiter. Als der Funker die Anordnung wiederholen wollte, erhielt er einen Kopfschuss.
Der Zweite!
Der Hauptmann ahnte es. Blitzschnell hob er den Kopf und blickte sich um. „Raus! Lauft!“
Sie erhoben sich und liefen ihrem Ziel weiter entgegen. Das Maschinengewehrfeuer wurde verlegt. Die Pioniere schafften es nur mit zwei weiteren Deckungspausen, sich bis dicht an den Drahtverhau der Russen heran zu kämpfen. Der Kampflärm tobte. Männer brüllten, Verwundete schrien. Sanitäter hetzten umher, leisteten Hilfe wo es möglich war, legten Verbände an oder winkten ihren Hilfssanitätern, damit diese die Schwerverletzten auf Tragen in Sicherheit bringen konnten. Der Hauptmann gab dem Zugführer des zweiten Zuges ein taktisches Zeichen. Dieser bestätigte und erhielt einen Treffer in den Hals. Als nächstes sackte der junge Leutnant tödlich getroffen zusammen.
Das ist das Werk von Scharfschützen! Diese verfluchten Dreckskerle!
Wumm – wumm
Zwei laute Explosionen waren zu hören. Die Pioniere hatten eine Gasse frei gesprengt.
Wo sitzt dieser verfluchte Scharfschütze?
Er musste den Gedanken verwerfen und weiterlaufen und seine Männer durch diese Gasse führen.
Dann hol mich doch, du verfluchter Heckenschütze!
Der Offizier hob die Faust. „Vorwärts!“
Ein Maschinengewehr hämmerte los und schoss Sperrfeuer. Ein zweites und ein drittes MG kamen hinzu. Soldaten sickerten durch die Gasse des Drahtverhaus. Die Pioniere sprengten einen zweiten Weg frei. Einer von ihnen verhedderte sich mit der Uniform im Drahtgeflecht. Er kämpfte lange zwanzig Sekunden, um frei zu kommen, zerschnitt mit seiner Zange hastig den Draht und als er sich endlich lösen konnte, zerfetzte ein Projektil seine Lunge.
Immer mehr Landser strömten in die russische Stellung ein. Bitterer Grabenkampf folgte. An der linken Flanke wurde ein leichtes Maschinengewehr über den Grabenrand geschoben. Eine angreifende Gruppe rannte mitten ins Feuer. Zwei Männer waren sofort tot, zwei wurden schwer, einer leicht verwundet.
Einer der Sturmpioniere war nah genug für einen Handgranatenwurf herangekommen. Keuchend schraubte er die Sicherungskappe ab, dann folgte ein kurzer Blick. Er packte den Abreißknopf, zog an der Schnur, hob seinen Oberkörper an und schleuderte die Handgranate in Richtung des schießenden Maschinengewehrs. Sich in der Luft überschlagend, flog die Stielhandgranate unaufhaltsam auf ihr Ziel zu, senkte sich, landete im Graben und detonierte nur drei Meter vom Maschinengewehr entfernt.
Wumm
Mit der Detonation sprangen die Soldaten auf und überwanden die letzten Meter bis zum Graben. Das MG war weggewuchtet worden. Beide Schützen lagen zerfetzt auf dem Boden. Drei Rotarmisten kamen im Graben angelaufen. Der vorderste Soldat eröffnete das Feuer aus seiner PPSch 41. Er feuerte während des Laufens aus der Hüfte. Die Mehrzahl der Projektile zischte gegen die Grabenwand, aber drei oder vier von ihnen klatschten gegen die Brust eines Landsers.
„Es hat Willi erwischt! Der Iwan kommt von links. Feuer!“
Panik lag in der sich überschlagenden Stimme. Der junge Gefreite, der vor der drohenden Gefahr warnte, kniete sich ab, hob seinen Karabiner 98 und gab einen Schuss ab. Der Russe mit der Schpagin stolperte im gleichen Moment über einen Toten. Er verlor die Maschinenpistole. Jetzt feuerten auch die anderen Deutschen und töteten die beiden anderen Russen. Der Gestolperte blieb liegen. Er hob langsam den Kopf und blickte in die Augen des jungen Gefreiten. Dieser hatte repetiert und zielte mit zittrigen Händen auf ihn. Der Rotarmist erwartete den Todesschuss und sah seinen Feind dabei an. Er blickte dem Gefreiten tief in die Augen. Der Lauf des Karabiners wackelte erheblich. Hoch und runter und nach links und rechts.
Der Gefreite plärrte hochnervös: „Ruki vverkh! Hände hoch, verdammt nochmal!“
„Knall ihn ab!“, wurde zugerufen.
„Heb deine scheißverdammten Hände“, geiferte der Landser mehr als aufgeregt.
Der Russe überlegte für einen kleinen Moment, ob er versuchen sollte nach seiner Maschinenpistole zu schnappen, um so viele Deutsche wie möglich mit in den Tod zu reißen. Die PPSch 41 lag nicht mal einen Meter von ihm entfernt auf dem Boden. Er schielte kurz hin. Bilder seiner Kinder schossen durch seinen Kopf. Seine Frau lächelte ihn im Gedanken an. In diesem Moment entschied er sich zu ergeben. Er wusste, dass dieser junge deutsche Soldat nicht abdrücken würde. Er hätte es sonst längst getan. Die Entscheidung für Tod oder Gefangenschaft, für Tod oder Leben, wurde in Bruchteilen von Sekunden gefällt. Er hatte seine getroffen und hob langsam die Hände. Er wusste, dass er jetzt und hier keine andere Wahl hatte.
„Ich habe einen Gefangenen!“
Unterdessen gingen die Grabenkämpfe weiter. Die Verteidiger kämpften verbissen und drangen keinen Meter freiwillig zurück. Ein Rotarmist feuerte seinen Karabiner leer, traf einen Landser in den Unterleib, drehte das Gewehr um und schlug dem Angreifer mit dem Kolben ins Gesicht. Man konnte hören, wie Knochen brachen. Die Augen nahmen eine unnatürliche Farbe an. Der Blick war gebrochen. Es war der Blick eines Toten. Der Landser kippte nach hinten weg und blieb verrenkt liegen.
Der Hintermann des Gefallenen feuerte, verfehlte aber in Todesangst sein Ziel. Als er repetierte, zerschmetterte ihm der Russe mit dem Gewehrkolben die Schulter. Erst der dritte Deutsche konnte den Rotarmisten mit einem Treffer in die Brust stoppen. Er taumelte, spuckte etwas Blut, hob aber seinen Mosin Nagant Karabiner erneut zum Schlag. Bevor er die Waffe nach vorn schmettern konnte, durchschlug der nächste Schuss des Landsers den Hals des Sowjets. Mit jedem Herzschlag spritze schwallartig Blut aus der Wunde. Der Russe ließ den Karabiner fallen und griff mit beiden Händen an seinen Hals. Eine Minute später hatte er den Kampf verloren.
„Sanitäter! Hierher!“, brüllte der Todesschütze neben seinem Kameraden mit der zertrümmerten Schulter kniend. „Halte durch, Heinz. Sie holen dich gleich hier raus!“
Ein Feldwebel rannte auf den Hauptmann zu. Seine Uniform war blutverschmiert.
„Herr Hauptmann, wir brauchen Verstärkung. An der rechten Flanke setzt der Russe zum Gegenangriff an. Wir haben ihn zwar aus den Gräben geworfen, aber wir können die Stellung nicht lange halten!“
Die nächste Salve aus einer Stalinorgel zischte heran und pflügte die Erde um. Diesmal lagen die Einschläge gefährlich nahe.
Huuuit huuuit huuuuuit … wumm wumm wumm
„Runter!“, wurde gerufen.
Eine weitere Salve jagte johlend heran. Der Feldwebel schielte nach oben, duckte sich zwar weiter ab, wusste aber, dass diese Salve gefahrlos über sie hinwegdonnern würde.
Der Hauptmann reagierte ähnlich. „Wie viele Männer haben Sie verloren, Müller?“
„Der Zug ist auf Gruppenstärke zusammengeschrumpft! Wir brauchen sofort Unterstützung oder wir gehen alle drauf“, schob er vehement nach.
Der Gesichtsausdruck des altgedienten Soldaten bereitete dem Offizier Sorgen. Müller war keiner, der vorschnell aufgab oder grundlos jammerte. Auf den Zwölfender konnte man sich blindlings verlassen. Der Kompanieführer erkannte Angst und Panik.
Der Nachrichtenmann hantierte am Tornisterfunkgerät herum. Das ca. 20 kg schwere Funkgerät konnte mit seiner 2 Watt Leistung Reichweiten von bis zu 25 Kilometern erreichen. Er hob seine Hand und rief dem Hauptmann zu: „Ich habe den Bataillons-Gefechts-Stab dran. Wir sollen die Stellung halten!“
Der Offizier nickte und wendete sich dem Melder zu. „Laufen Sie sofort zu Unteroffizier Brückmann. Die Granatwerfer-Trupps sollen augenblicklich zur rechten Flanke verlegen! Sofort!“
„Verstanden, Herr Hauptmann!“, stieß der junge Soldat aus und rannte geduckt los.
„Geben Sie zum Bataillonsstab durch, dass wir dringend Entsatz brauchen. Die Reservekompanie muss sofort hierher verlegen!“, brüllte er dem Nachrichtenmann zu, um den wieder aufkommenden Gefechtslärm zu übertönen. Dann klopfte er einem zweiten Melder auf die Schulter. „Laufen Sie rüber zu Leutnant Funke. Er soll mit seinen Männern die linke Flanke abdecken. Zudem möchte ich alle Maschinengewehre sofort in Position haben. Die Leichtverwundeten sollen mit den Sanitätern durch die Reihen der Gefallenen gehen und sie unterstützen.“
„Verstanden!“
Er wendete sich wieder dem Nachrichtenmann zu. „Und jetzt melden Sie dem Bataillon, dass wir unbedingt Artillerie-Unterstützung brauchen. Sie sollen den östlichen Hang unter Beschuss halten. Der Russe hält sich dort hartnäckig.“
Der Mann am Funkgerät machte sich sofort an die Arbeit, legte Schalter um und betätigte Knöpfe. In kurzen, regelmäßigen Abständen drückte er auf den Sender und versuchte, den Gefechtsstab des Bataillons erneut zu erreichen. „Hier spricht Saturn Zwo …. Hier spricht Saturn zwo …. der Feind setzt zum Gegenangriff an … starke Infanterieverbände formieren sich am rechten Flügel im Abschnitt Vier-eins. …. Wir brauchen Verstärkung und Artillerie-Unterstützung …. ich wiederhole …. der Feind …“
Die Sendeimpulse machten sich auf den Weg durch moderne Technik. Über Spulen und Drahtwicklungen krochen die Worte über Kupferleitungen zur Antenne. Der Funker hoffte, dass der Nachrichtenmann am Empfänger sie auf dieser Wellenlänge einfangen, mithören, notieren und weitergeben konnte.
Die Granaten der Artillerie rauschten über ihre Köpfe hinweg und wuchteten erneut in den Osthang des Mamai-Hügels. Sie wühlten die Erde um, vergruben Leichen und beförderten bereits verschüttete Menschenteile wieder nach oben. Der Geruch von verbranntem Fleisch, Pulverschmauch und warmem Blut erfüllte die Luft. Dazu kam der permanent vorhandene Gestank von Verwesung. Etliche der Gefallenen lagen seit Tagen herum, und es gab im Moment keine Hoffnung auf eine menschenwürdige Bestattung.
Über der Stadt lag der dunkle Schleier des Todes.
Sie lagen im Graben und erwarteten den Gegenangriff. Der Hauptmann stierte durch den Feldstecher. Er blickte auf die Armbanduhr. Das Glas war verschmutzt. Er feuchtete seinen Finger an und wischte darüber, dann fuhr er noch einmal mit dem Ärmel seiner Uniform über das Glas.
Verfluchte Russen! Wo verkriechen sie sich? Solche Ari-Angriffe kann man doch nicht überleben! Woher nehmen sie ihren Kampfgeist?
Zusammengeschrumpft auf die Stärke von knapp zwei Zügen, waren die Männer ziemlich am Ende des Erträglichen angekommen.
„Gibt’s Nachricht vom Bataillon?“, fragte er den Nachrichtenmann.
Kopfschütteln. „Nichts.“
Der Offizier wusste, dass er ohne Verstärkung die Stellung nicht lange halten konnte. „Verdammt! Wo bleibt denn die Reserve?“
Der Feind erhob sich. Wie eine braune, schwabblige Wand rannten Rotarmisten auf ihre Stellung zu. Das russische Maschinengewehrfeuer ratterte unaufhörlich und gab Sperrfeuer.
„Urääähhhh ...“
Da war er wieder. Dieser Kampfruf, der durch Mark und Bein ging. Vorgepeitscht von Offizieren und aufgeheizt von Politkommissaren, krochen sie aus ihren Deckungen, sammelten sich und wie eine Meute wilder Tiere und griffen, angetrieben durch Hass, Angst und Wut, an. Sie schrien so laut sie nur konnten.
„Uräääähhhh ...“
Die Abwehrreihen warteten auf den Feuerbefehl.
„Noch nicht feuern! Die Granatwerfer-Einheiten sollen sich fertig machen!“
Die Nerven waren zum Zerfetzen angespannt. Todesangst breitete sich aus und kroch in die Köpfe der Männer. Manche Landser zitterten nur, ein paar nässten sich ein, andere übergaben sich.
„Feuerbereit halten!“
Immer mehr Projektile zischten über sie hinweg, bohrten sich in die Erde oder herumliegende Leichen. Erste Treffer mussten hingenommen werden.
„Sie sind schon verflucht nah“, presste Feldwebel Müller aus.
„Noch einen kurzen Moment!“
Das Gebrüll der anstürmenden Russen wurde immer lauter: „Uräääähhhh …“
Das erlösende: „Jetzt!“, wurde gerufen.
Die deutschen Soldaten eröffneten das Gegenfeuer. Maschinengewehre hämmerten Salve um Salve aus ihren Rohren. Die ersten Reihen der angreifenden Rotarmisten wurden wie von einer unsichtbaren Faust gepackt und niedergeschmettert. Blut spritzte, Männer fielen tot oder verwundet auf den Boden. Die dritte Reihe warf sich in Deckung. Schreie und Jammern von Verletzten mischten sich unter den Schlachtlärm.
Ein Truppführer der leichten Granatwerfer beobachtete die Einschläge seiner Sprenggeschosse und lenkte das Feuer. „20 nach rechts – 40 kürzer - Feuer frei!“
Plop – plop – plop – wumm wumm wumm
Granate um Granate wirbelte durch die Luft, senkte die Flugbahn und krepierte im Pulk der angreifenden Sowjetsoldaten.
Nach der fünften Salve erhielt er einen Kopfschuss.
„Ich brauche mehr Munition!“, brüllte ein MG-Schütze, als sein Schütze II den letzten Gurt einlegte.
Dann presste er den Kolben des lMG 34 in die Schulter, visierte die braune auf sie zurollende menschliche Masse an und drückte ab.
Rrrrrt … rrrt … rrrrrrrt
Die Projektile wurden aus dem Rohr gejagt, flogen ihren Zielen entgegen und bohrten sich in Kniescheiben, Oberschenkel, Bäuche und Brustkörbe der Angreifer.
„Rechts!“, hörte der Schütze. „Schwenke sofort herum!“
Dann knallte es so laut, dass er nichts mehr hörte. Gleichzeitig spürte er einen starken Luftdruck, der die Waffe wegriss und ihn zur Seite schleuderte. Sein ganzer Körper fühlte sich taub und warm an. Er senkte schockiert seinen Blick und sah nur Blut, Knochen und zerfetzte Uniform. Dann sackte er weg.
„Rechtes MG durch Handgranate ausgefallen!“
Feldwebel Müller sah, wie ein paar Russen in den Graben sprangen. Er schwenkte seine Maschinenpistole herum und krümmte den Abzugsfinger. Immer wieder schwenkte er den Lauf herum und gab Feuerstöße ab, bis das Magazin leer war.
Der Hauptmann wollte gerade den Befehl zum Rückzug erteilen, als er lautes: „Hurraaaaaa“, hörte.
„Sie sind da. Die zwote Kompanie ist eingetroffen und setzt zum Gegenangriff an“, rief ihm der Nachrichter zu.
Zwei Menschenknäuel trafen aufeinander. Feldgraue Uniform gegen erdbraune. Bajonette blitzten, Spaten mit geschliffenen Kanten wurden geschwungen. Nahkampf entbrannte.
Der Hauptmann wusste, was er tun musste. „Vorwääääärts Kameraden! Angriiiiiiffff!“, schrie er diesen verhassten Befehl so laut er nur konnte, kletterte über den Grabenrand und jagte dem Feind entgegen.
„Vorwärts!“, hörte er Müller und wusste, dass die Männer ihm folgten. Sie würden laufen, brüllen und kämpfen. Sie würden ihren im Nahkampf befindlichen Kameraden zu Hilfe eilen und mit diesem Gegenangriff den Feind zurückschlagen.
„Hurraaaaaa!“
Er spürte den Luftzug eines Projektils an seinem Kopf vorbeizischen, hob die Maschinenpistole und feuerte sein Magazin leer. Dann griff er an die Seite, zog die Pistole 08 aus dem Holster und stürmte weiter vor. Ein Rotarmist rannte mit weit aufgerissenem Mund auf ihn zu. Das Gewehr streckte er dabei wie eine Lanze vor. Das Bajonett war aufgesetzt. Der Hauptmann gab zwei Schüsse aus der 08 ab, dann stürzte der Angreifer zu Boden. In dem Moment, als sich der Offizier umdrehte, erhielt er einen Kolbenschlag auf die Schulter. Stechender Schmerz durchfuhr ihn. Er ließ die Pistole fallen und ging in die Knie. Ein russischer Soldat mit wutverzerrtem Gesicht hob seinen Karabiner zum tödlichen zweiten Schlag. In Erwartung dieses Todesschlages und unfähig zu reagieren, schloss der Hauptmann seine Augen. Ein lauter, schmerzverzerrter Schrei holte ihn aus der Sekunden-Lethargie zurück. Der Russe taumelte. Blut spritzte, als ein Landser das Bajonett aus dem Hals des Rotarmisten zog. Der Landser sah den Hauptmann kurz an, dann stürmte er weiter.
Der Offizier suchte seine Pistole, nahm sie in die Faust und griff an die schmerzende Stelle an der Schulter. Er wollte aufstehen, als er einen Schlag gegen das rechte Knie spürte. Im Liegen hatte ein blutüberströmter Russe gegen das Knie des deutschen Offiziers getreten. Der Hauptmann stolperte. Der Russe erhob sich und sprang wie ein verwundeter Panther auf den Deutschen zu. Er griff an die Kehle des Hauptmanns und drückte zu. Immer wieder stieß er unverständliche Worte aus. Jetzt erst erkannte der Hauptmann, dass der Kiefer des Russen gebrochen war.
Der Sowjet grub seine Finger förmlich in den Hals des deutschen Offiziers. Während die linke Hand des Hauptmanns an den Unterarm des Russen griff und diesen wegziehen wollte, richtete die rechte Hand den Lauf der Pistole 08 gegen den Körper des Angreifers. Der Hauptmann bekam keine Luft mehr. Er musste schnell handeln und abdrücken, bevor es schwarz vor den Augen wurde. Er wollte leben!
Der Zeigefinger krümmte sich. Ein Schuss krachte, dann noch einer. Nach dem zweiten Knall wurde der Würgegriff lockerer. Der Russe röchelte, sackte leblos über dem Offizier zusammen und begrub ihn unter sich.
Atmen!
Er rang nach Sauerstoff. Das Gewicht des Russen erschwerte das Einatmen immens. Er versuchte, den Toten von sich herunter zu rollen, doch es klappte nicht.
Schreie, Rufe, Jammern. Schüsse, Klappern von Metall, gurgelnde Geräusche und gebrüllte Befehle klangen plötzlich dumpf. Alles begann sich zu drehen. Sterne tanzten herum. Der Russe bewegte sich ein kleines Stück. Der Hauptmann schnaufte tief ein. Er brauchte Sauerstoff und erwischte zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Der Drang zum Atmen wuchs. Ein weiterer Kraftakt folgte. Mit der Kraft der Verzweiflung gelang es ihm schließlich, sich unter dem Leichnam hervorzuschieben. Keuchend schnappte er nach Luft. Er war schweißgebadet. Die Schulter schmerzte und es wurde dunkel. Das Atmen wurde zum Hecheln, Sterne flackerten vor seinen Augen auf. Er ergab sich der Bewusstlosigkeit und kippte weg.
2
Bis weit in den August 1942 war in Stalingrad wenig vom Krieg zu spüren. Zwar rückten die Deutschen immens schnell vor, doch die russischen Truppen befanden sich nicht in der Stadt, sondern im Umland. Auch der Stellungsbau für eine etwaige Verteidigung lief nur schleppend. Deshalb lebte man in Stalingrad noch fast so wie zu Friedenszeiten.
Das Leben in der Stadt an der Wolga pulsierte, und sie bildete mit ihren Vororten den vegetativen Kontrast zu der weiten Steppe, die vom Westen her zu ihr führte.
Kirsch- und Pfirsichbäume strotzten vor Grün und trugen massenhaft Früchte. In den Dörfern rannten Hühner und Gänse um die mit Stroh gedeckten Häuser. Panjepferde weideten friedlich oder zogen die beladenen Karren der einfachen Bauern.
Neben der Eisenbahn war die Wolga die wichtigste Pulsader nach Moskau. Sie war breit wie ein riesiger See und zog sich träge dahinfließend über 15 Kilometer an der Stadt entlang. Am Hafen Stalingrads legten Schiffe an, brachten Waren und Menschen in die Stadt, luden ihre Bäuche wieder voll und fuhren weiter.
Den nahe an der Wolga erbauten riesigen Getreidespeicher konnte man schon kilometerweit vor der Stadt erkennen.
Die Geschützfabrik „Barrikaden“, die chemische Fabrik „Lazur“, das Stahlwerk „Roter Oktober“ und die 1930 fertiggestellte Traktorenfabrik „Dserschinski“, deren Produktion allerdings auf Panzer, insbesondere den Typ: T-34, umgestellt worden war, brachten Wohlstand nach Stalingrad.
Für die Arbeiter waren Wohnsiedlungen entstanden und Parkanlagen dienten zur Naherholung. Es gab Cafés, Geschäfte, Kino und Krankenhäuser. Stalin, der Namensgeber dieser südlichen Metropole Russlands, verwirklichte hier seinen vorgegebenen ersten Stalinschen Fünfjahresplan.
Sonntag, der 23. August 1942 war ein herrlich warmer und sonniger Tag. Über Stalingrad lachte die Sonne und Katja Kalikowa legte zufrieden und bestens gelaunt ein Tuch über den vollgepackten Picknickkorb. Ihr Ziel war, wie auch für viele andere Stalingrader Familien, der Mamajew-Kurgan, die große grüne Erhebung an der Wolga. Von hier aus hatte man herrlichste Sicht über die Stadt und den Fluss. Idylle pur bei schönstem Wetter.
„Ich möchte lieber zu der kleinen Bucht an der Wolga und schwimmen. Meine Freunde sind bestimmt auch dort“, bettelte Grigorij und sah seine Mutter mit großen Augen an.
„Heute nicht, Grischa.“ Sie nannte ihn oft und gern beim Spitznamen. „Wir treffen uns mit Papa am Mamai-Hügel. Du hast dich doch schon auf das Picknick gefreut.“
Der Achtjährige stampfte wütend mit den Füßen auf den Boden. „Aber es ist Sommer und …“
„… und ich habe ein Hühnchen zubereitet. Schau her“, konterte Katja mit sanfter Stimme und hob das Geschirrtuch über dem Picknickkorb an.
Grischa lugte hinein. „Lecker! Au ja. Picknick mit Hühnchen. Was hast du denn noch alles im Korb?“, stieß er freudig aus und zack, steckte der Junge eine Hand in den Picknickkorb.
„Langsam, Grischa, nicht so hektisch“, lachte Katja.
Als der Junge unter dem Brot auch russischen Rollkuchen fand, war das Schwimmen in der Wolga vergessen. „Wann kommt denn Papa?“
„Er hat gesagt, dass er nicht zu lange bleiben wird. Weißt du, er muss im Krankenhaus ein paar seiner Patienten besuchen, dann kommt er direkt zu uns.“
„Und vielleicht geht er später mit mir und Boris doch noch schwimmen.“
Katja lachte. „Ja, Grischa, das kann durchaus passieren.“
„Ein toller Tag.“
Boris, der eineinhalb Jahre jüngere Bruder von Grischa, kam in die Küche. „Gehen wir jetzt schwimmen?“, fragte er.
Grischa grinste. „Wir machen was viel Besseres. Wir gehen zum Mamajew-Kurgan und spielen Kosaken-Festung. Die Feinde kommen mit ihren Segelschiffen die Wolga hochgefahren und wir sitzen auf einem Aussichtsturm und beobachten sie. Wir essen Hühnchen und Rollkuchen, und wenn wir von den Piraten angegriffen werden, schlagen wir sie mit unseren Säbeln zurück!“
„Jaaaa“, jubelte Boris. „Wir sind die tapferen Kosaken!“
Katja Kalikowa stammte aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Stalingrad. Ihre Vorfahren waren Donkosaken, und die gutaussehende Russin verkörperte das Wilde und Rassige wie kaum eine andere.
Die Krankenschwester lernte ihren Mann Pjotr kennen, als er noch Medizinstudent und sie Schwesternschülerin war. Sie wurden ein Paar und heirateten. Er machte seinen Abschluss und nach dem Studium bekamen beide eine Anstellung im Stalingrader Krankenhaus. Das junge Ehepaar konnte sich eine gute Wohnung leisten und sie fühlten sich hier sehr wohl. Mit den Geburten ihrer Söhne Grigorij und Boris war das Glück der jungen Familie perfekt.
Der Mamai-Hügel war gut besucht und Katja war froh, dass ihr Stammplatz noch frei war. Hier hatte sie Pjotr zum ersten Mal geküsst. Sie würde diesen Abend nie vergessen. Er nahm sie in den Arm, sagte ihr, dass ihre Augen heller glänzten als die Sterne, sein Herz heißer glühte als die Sonne und seine Liebe zu ihr endlos weit wie das Universum wäre. Sie saugte jedes einzelne Wort auf. Und als sich ihre Lippen berührten, schlug ihr Herz dreimal so schnell wie normal.
Katja blieb stehen. Ihre Söhne befanden sich dicht hinter ihr.
„Wieder hier?“, fragte Grischa und ließ die Decke fallen. Er wusste, dass seine Mutter die Frage bejahen würde, denn sie saßen immer hier. Nur einmal, als der Platz besetzt war, gingen sie zur anderen Seite. Dort wo man zur Steppe sehen kann. Aber die Jungs mochten diese Stelle lieber. Von hier aus konnte man die Wolga und die Schiffe sehen. Das spornte die Fantasie der beiden Brüder an und sie erlebten im Spiel Abenteuer für Abenteuer. Hier stand ihre imaginäre Kosaken-Festung, die sie mit ihren aus Weidenästen gebastelten Säbeln verteidigten.
„Ja, Kinder. Wir bleiben hier. Helft mir mal schnell mit der Decke, dann könnt ihr spielen.“
„Wann kommt denn Papa?“
Katja warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. „Ein bisschen müssen wir noch warten. Aber ich kann euch ja ein kleines Stück Rollkuchen geben, dann …“, sie konnte den Satz nicht mehr beenden. Mit lautem: „Jaaaa … juhuuu … Proviant für die tapferen Kosaken“, wurde sie übertönt.
Etwas später saß Katja auf der Decke und las ein Buch. Bienen flogen von Blume zu Blume. Vogelgezwitscher untermalte das Lachen der herumtollenden Kinder. Ein paar Meter weiter träumte ein junges Pärchen von der großen Liebe. Sie tuschelten und kicherten. Katja legte das Buch zu Seite, hob den Kopf an und lächelte, als sie das Pärchen heftig flirten sah. Dann hielt sie Ausschau nach ihren Söhnen. Boris und Grischa sprangen durch die Wiese, schlugen mit ihren Weidenholz-Säbeln auf imaginäre Piraten ein und jubelten, nachdem ihre kleine Kosaken-Armee die Piraten in die Flucht schlagen konnte.
Katja genoss die Sonne. Sie legte das Buch zur Seite, strecke sich und änderte ihre Sitzposition. Ihr Magen knurrte leicht und sie fragte sich, wie lange es noch dauern würde, bis Pjotr endlich kam. Die junge Mutter wollte gerade wieder nach ihrem Buch greifen, als plötzlich Unruhe aufkam.
Irgendwo in der Nähe quäkte ein Lautsprecher. Immer wieder war eine blechern klingende Stimme zu hören. „Bürger – Luftalarm!“ Danach ertönte eine Sirene.
Anfangs ärgerte sich die Krankenschwester über diese Störung der himmlischen Idylle. In letzter Zeit häuften sich die Fehlalarme. Sie wollte sich nicht durch den Alarm ärgern lassen und weiter lesen, doch kaum angefangen, stockte sie. Diesmal war es anders. Die Durchsagen hörten nicht auf. Immer wieder hallte es: „Bürger – Luftalarm!“ – gefolgt vom ohrenbetäubenden Sirenengeheule.
Katja wurde nervös. Dutzende von Leuten packten hastig ihre Sachen zusammen und verließen eilig den Mamai-Hügel. Sie sah wieder auf ihre Armbanduhr, dann suchte sie ihre Jungs. Sie waren weg. Leichte Besorgnis kam auf.
„Grischa, Boris“, rief sie.
Nichts. Katja stand auf und zog ihre Schuhe an. „Grischa, Boris“, wiederholte sie jetzt lauter.
„Mama, hierher. Komm! Schnell!“
Sie drehte sich erleichtert um. Sie hatte ihre Jungs gefunden. Beide Kinder standen oben auf der Spitze der Erhebung und deuteten in Richtung Steppe. Katja rannte den Hügel hinauf. Die Sicht war klar. Die Sonne ließ den Horizont zwar etwas schimmern, aber sie glaubte, in der Steppe eine große Staubwolke zu erkennen, die sich auf die Stadt zuzubewegen schien.
„Was ist das, Mama?“
Nach wie vor wurde das penetrante Heulen der Sirenen von eindringlich warnenden Durchsagen unterbrochen: „Bürger – Luftalarm!“
Boris zeigte in den Himmel. „Schau!“, sagte er und das reichte aus, um den Körper der Krankenschwester komplett mit Gänsehaut zu überziehen. Um sie herum kam pure Panik auf. Menschen starrten in den Himmel, begannen zu laufen und ließen ihre Sachen zurück. Frauen kreischten, Männer riefen nach ihren Kindern.
Trotz des anschwellenden Lärmpegels kreischender Menschen, konnte man leises Brummen hören, welches sich stetig, als würde jemand an einem Regler drehen, verstärkte. Katja starrte in den Pulk, der anfangs aussah wie ein Schwarm Insekten und binnen kurzer Zeit die Größe eines Vogelschwarms angenommen hatte. Die Russin wusste, dass es keine Vögel waren. Es waren Flugzeuge. Deutsche Flugzeuge. Sie flogen direkt auf die Stadt zu. Katja wurde kreidebleich. Ihr Herz trommelte, ihr Puls raste. In diesem Moment hatte die Panik auch sie ergriffen.
„Gebt mir eure Hände und lauft, Kinder!“, brüllte sie.
„Mami, das Hühnchen!“
„Lauft!“, kreischte Katja, griff die Hände ihrer Söhne und rannte los.
Sie hetzten den Hügel hinunter. Nicht alle Besucher des Mamajew-Kurgan hatten die Situation erkannt. Die kleine Familie lief an einer Gruppe junger Männer vorbei, die angetrunken Lieder sangen und lachend eine weitere Flasche Wein öffneten.
„Flieger!“, brüllte sie den Leuten zu.
Die jungen Männer winkten ihr zu. „Wohin so eilig, hübsche Frau? Komm her, lass uns Spaß haben.“
Katja rannte weiter, zog ihre Söhne mit. Ein älteres Ehepaar hatte in der Sonne ein Nickerchen gemacht, war aufgewacht und starrte nur verständnislos und kopfschüttelnd. Andere begriffen den Ernst der Lage und begannen hastig zusammenzupacken.
Katja wusste, wo sich der nächste Luftschutzbunker befand. Das war ihr Ziel. Boris begann zu weinen. Grischa drehte sich immer wieder um, drohte zu stolpern, doch die kräftige Hand seiner Mutter verhinderte das Hinfallen.
Nicht nur auf dem Hügel, sondern auch in den Straßen von Stalingrad nahm man die warnenden Worte aus den Lautsprechern anfangs nicht für ernst. Erst als das Brummen der Bombermotoren immer lauter anschwoll und die vorgelagerten Flakstellungen zu feuern begannen, erkannten die Bewohner Stalingrads, dass sie angegriffen wurden.
600 Bomber der Luftflotte 4 flogen auf Stalingrad zu und verdunkelten den Himmel. Flugzeuge aller Art, vorwiegend jedoch die Bomber Heinkel He 111 und Junkers Ju 88, griffen die Stadt an diesem sonnigen Sonntagnachmittag an und luden ihre tödlichen Bomben ab.
Tonnenweise fielen Spreng- und Brandbomben auf Stalingrad. Die Sprengkörper wirbelten auf die Häuser hinab, schlugen ein und brachten Tod und Zerstörung. Gebäude brachen tosend zusammen. Glühend heiße Feuerwalzen fegten durch die Straßen. Menschen flüchteten zur Wolga, um über den Fluss zu entkommen. Sämtliche Boote und Schiffe füllten sich in Windeseile. Wer keinen Platz ergattern konnte, versuchte schwimmend das andere Ufer des Stroms zu erreichen.
Bei den Fabriken wurden die riesigen Öllager getroffen und durch mehrere Bombeneinschläge in Brand gesetzt. Das brennende Öl ergoss sich in die Wolga. Der schwimmende Feuerteppich erfasste Schiffe, die voller flüchtender Zivilisten waren. Sie konnten dem schrecklichen Flammentod nicht entkommen.
Indessen saugte die Hitze der in der Stadt wütenden und ineinander übergehenden Brände Luft an. Feuerwirbelstürme bildeten sich und fegten wiederum mit unvorstellbarer Zerstörungskraft durch die Trümmerlandschaft.
In diesem Inferno detonierten die Bomben der nächsten Angriffswelle. Die deutsche Luftwaffe flog Angriff um Angriff. Über die Stadt an der Wolga schwappte eine riesige Welle der Zerstörung.
Das Inferno dauerte drei Stunden. Dann war Stalingrad nur noch ein brennender Trümmerhaufen, dessen rußschwarzer Todesschleier kilometerweit in die Höhe schoss und weit in die Steppe hinein zu sehen war.
Das friedliche, fröhlich lachende Stalingrad, wie man es bis zu diesem Moment kannte, hatte aufgehört zu existieren. 40.000 Menschen fielen diesem Luftangriff zum Opfer. Sie verbrannten, wurden von Bomben zerfetzt, von einstürzenden Gebäudeteilen erschlagen oder in Kellern verschüttet. Mehr als dreimal so viele Menschen wurden durch den Angriff verletzt.
Zeitgleich rückten deutsche Soldaten auf Stalingrad vor. Erste Vororte an der Wolga waren bereits erreicht, als die Flammen in der der Stadt loderten. Die Landser sahen das brennende Stalingrad und glaubten an einen schnellen Sieg.
Katja Kalikowa kauerte an der Wand. Boris saß auf ihrem Schoß und Grischa, dicht an sie gepresst, neben ihr. Der Luftschutzkeller war überfüllt. Die Luft war zum Schneiden dick. Es roch nach Schweiß, Urin und Angst. Gebete wurden gesprochen. Kinder weinten, Babys schrien. Immer wieder wurde die Erde erschüttert. Man hörte Detonationen und ahnte das Ausmaß der Zerstörung.
Pjotr. Wo bist du? Bitte lebe!
Katjas Gedanken waren bei ihrem Ehemann. Sie ahnte Schlimmstes, wollte schwach sein, weinen, kreischen, gegen die Wände schlagen und rausrennen, doch sie hatte eine Aufgabe. Sie musste ihre beiden Söhne beschützen. Grischa und Boris waren alles, was sie besaß. Ihnen gehörte ihre Liebe. Sie musste sie schützen und aus der Stadt bringen. Sie musste stark sein.
In Katjas Hals bildete sich ein dicker Kloß. Sie schloss die Augen. Eine Träne kullerte über ihre Wange und versickerte in ihrer leichten Bluse. Grischa hat es gesehen und drückte die Hand seiner Mutter ganz fest. Boris saß nur reglos da und starrte vor sich hin.
„Kommt Papa noch?“, wimmerte Grischa.
Katja erwiderte seinen festen Händedruck. Sie konnte nicht antworten. Ihre Stimme versagte, aber Grischa wusste, was dieser Händedruck bedeutete. Er war jetzt der Mann im Haus. Er musste für seine Mutter und seinen Bruder sorgen. Er, der noch vor zwei Stunden als Kosake mit seinem Säbel aus Weidenholz Piraten in die Flucht schlug, musste ab sofort seine kleine Familie ernähren. Grischa atmete tief ein. Sein Magen rumorte, er spürte wie sich der Rollkuchen den Weg nach oben suchen wollte und unterdrückte das Gefühl der Übelkeit und schluckte die dünne Spucke, die sich im Mund sammelte hinunter.
Ich übergebe mich nicht. Ich bin ein Mann. Ich beschütze Mama und Boris!
Er drückte sich noch fester an seine Mutter, legte die andere Hand auf das Knie seines Bruders, schloss die Augen und begann leise zu weinen.
3
Die hart geführten Kämpfe um die Höhe 102 brachten Ernüchterung in die Köpfe der deutschen Befehlshaber. Entgegen erster Meldungen stand der Fall Stalingrads noch lange nicht bevor. Im Gegenteil. Der Widerstand der Sowjets war äußerst hartnäckig und wuchs täglich.
Die Stadt sollte von den russischen Verteidigern so lange wie möglich gehalten werden. Das band deutsche Truppen, während die russischen Oberbefehlshaber in Moskau fieberhaft an einer Gegenoffensive arbeiteten.
Stalingrad lag längst in Schutt und Asche. Kaum mehr ein Haus stand. Die Schlacht nahm eine neue Richtung an. Es sollte ein Krieg der Ratten werden. Um jeden Stadtteil, jede Straße, jedes Gebäude und jedes Stockwerk sollte verbissen gekämpft werden. Kein Meter wurde kampflos aufgegeben.
Besonders effektiv zeigte sich am Mamai-Hügel der Einsatz der russischen Scharfschützen. Unter ihnen befand sich auch der aus dem Ural stammende Bauernsohn Wassili Saizew. Er war nicht nur sehr treffsicher, sondern auch ideenreich.
Auf seinen Vorschlag hin gab es eine neue Scharfschützenbewegung in der 62. Armee. Scharfschützen und ihre Späher wurden gruppenweise in den Regimentern eingesetzt. Diese kleinen Gruppen postierten sich entlang den Frontlinien und fügten den deutschen Truppen immer wieder Verluste zu. Sie legten sich meistens ein bis drei getarnte Unterschlüpfe zu, lauerten auf ein Ziel, schlugen zu und verlegten sofort ins nächste Versteck.
Dieses Vorgehen dezimierte den Feind und zerstörte dessen Psyche. Die Scharfschützengruppen erreichten schnell ihren Schreckensruf. Sie waren unsichtbar, lauerten auch dort, wo kein Gegner vermutet wurde, waren lautlos und wenn sie zuschlugen, brachten sie den sicheren Tod.
Die 295. Infanterie-Division erlitt bei den Kämpfen um die Höhe 102 nicht nur zahlenmäßig herbe Verluste, sondern hatte aufgrund des Einsatzes russischer Scharfschützen auch enorm viele Offiziere verloren. Saizew und seine Männer hatten gezeigt, dass sie ihr tödliches Handwerk beherrschten.
Die Kompanie des Hauptmanns hatte mehr als zwei Drittel an Verlusten zu verzeichnen. Noch am gleichen Tag wurde sie aus der vordersten Linie genommen und zur Erholung und Auffrischung in die Etappe verlegt.
Während sich der Kompaniestab mit den Trossen in einer Kolchose in einem Vorort Stalingrads befand, waren die Züge in der nahegelegenen Balka, einer natürlichen Erosionsschlucht, untergebracht.
Die Schreibstube war in einem kleinen Nebengebäude. Das zweite Zimmer diente als Lager und gleichzeitig als Wohnraum des Kompaniefeldwebels.
Beheizt wurde die Schreibstube mit einem kleinen Ofen. Drei Tische waren zu Schreibtischen umfunktioniert worden. Auf jedem stand eine Schreibmaschine. Auf dem ersten Tisch stapelten sich zudem Briefe. Alle hatten einen schwarzen Rand.
Der Spieß, Hauptfeldwebel Schmidt, hatte gleich nach dem Aufstehen das Feuer entfacht und einen Kessel mit Wasser aufgestellt. Schmidt war ein kleiner quirliger Kauz, vor dem alle Respekt hatten. Frisch rasiert und voller Vorfreude auf heißen Kaffee, nahm er das kochende Wasser vom Ofen und goss es vorsichtig in einen Filter.
„Mhmm … riecht schon gut“, murmelte er und stellte den Kessel zur Seite. Sein Blick fiel auf die Briefe und er schüttelte den Kopf. Die gute Laune war schlagartig verflogen.
Die Tür ging auf und der Hauptmann betrat die Schreibstube.
„Guten Morgen, Hauptmann König“, grüßte Schmidt.
„Guten Morgen.“
„Der Kaffee ist gleich fertig.“
„Danke.“
Der Offizier hängte Mütze und Mantel an einen Nagel an der Wand, ging zum größten der drei Schreibtische und setzte sich. Er hob die Schreibmaschine in die Mitte. Rechts von ihm lagen die abgebrochenen Erkennungsmarken der Gefallenen, links weißes Schreibmaschinenpapier. Er nahm ein Blatt und spannte es in die Maschine.
„Wie geht’s heute mit der Schulter?“, fragte Schmidt und goss noch einmal Wasser in den Filter. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee breitete sich aus.
„Schon besser, aber ich kann den Arm nicht höher heben als bis hier …“, gleichzeitig machte er eine Bewegung, die mit einem schmerzverzerrten Gesicht beendet wurde.
„Ob das Briefe schreiben gut ist?“, meinte der Spieß daraufhin und deutete auf die viele Arbeit hin. „Ich könnte ja auch …“
„Schmidt, das waren meine Leute. Ich habe mit ihnen gekämpft. Sie sind gefallen und ich habe überlebt. Ich muss diese Briefe selbst formulieren.“ Er betonte das Wort muss extrem. „Es ist nicht leicht und jeder einzelne Brief fällt mir schwer, aber würde ich diese Arbeit delegieren, wäre das aus meiner Sicht wie eine Verweigerung der letzten Ehre.“
„Verstehe“, antwortete der Kompaniefeldwebel, stellte drei Tassen auf den Tisch und schenkte ein.
Die Tür ging auf und ein Obergefreiter kam herein. Er hinkte stark und grüßte die beiden anderen Soldaten.
„Guten Morgen, Otto. Du stellst doch die Uhr nach meinem Kaffee“, erwiderte der Spieß den Morgengruß.
„Wenn mein Bein erst mal wieder gesund ist, laufe ich deinem Kaffee davon“, lachte der Obergefreite. „Ich sag immer, nimm mal einen Löffel weniger, dann schmeckt er besser, aber nein …“
„Kaffee muss einfach nach Kaffee schmecken. Für gefärbtes Wasser kannst du auch Muckefuck verwenden“, grinste Schmidt und servierte den Kaffee.
Hauptmann König nahm einen Schluck. Der Obergefreite hatte völlig recht. Der Kaffee war nicht gerade gut, aber er weckte auf. Er war stark und tiefschwarz. Der Offizier stellte die Tasse wieder ab und nahm die nächste Marke in die Hand.
„Leutnant Erich Kleindienst“, las er laut vor.
Bilder schossen ihm durch den Kopf. Er durchlebte die schrecklichen Stunden der Schlacht erneut. Der junge Leutnant befand sich direkt neben ihm, als er den Kopfschuss erhielt.
„Ein Scharfschütze“, murmelte der Hauptmann. Sofort glitten seine Gedanken nach Deutschland zu seinem Sohn.
Das hätte Rolf sein können. Mein Gott, hoffentlich muss mein Junge nicht nach Russland. Verfluchte Heckenschützen!
Weitere Scharfschützentreffer fielen ihm auf.
Den Pionier habt ihr auch geholt. Und viele andere ebenso. In unserer Kompanie gibt es nur noch zwei Offiziere. Leutnant Funke und mich.
Hauptmann König lehnte sich zurück. Ihm war etwas aufgefallen. Er dachte nach, machte sich eine kurze Notiz und schob die Erkennungsmarke des Leutnants zur Seite.
Der Feind war in der Unterzahl. Er kämpfte hart und verbissen und verfügte definitiv über sehr effektive Scharfschützen.
Sie schießen nicht einfach wild auf uns los und töten so viele wie möglich, sondern sie suchen sich ihre Ziele gut aus und töten dort, wo es uns weh tut.
Das Scharfschützenwesen war seit jeher Königs Steckenpferd. Sein Vater war mit Leib und Seele Büchsenmacher und er führte ihn schon im Kindesalter ins Waffenwesen ein. Als Jugendlicher hing er an den Lippen seines Vaters, wenn dieser von der Front des ersten Weltkriegs erzählte. Und besonders spannend fand der kleine Junge die Geschichten über die Scharfschützen.
„Mein Sohn, du konntest nicht mal auf den Donnerbalken gehen, ohne Angst zu haben, dass sie dich erwischen. Die haben uns regelrecht den Schlaf geraubt“, hatte er erzählt.
Als Erwin König 17 Jahre alt war, kam die Todesnachricht. Sein Vater war in Verdun gefallen. Für Kaiser, Volk und Vaterland.
Erwins Mutter, eine Lehrerin für Deutsch, Russisch und Englisch, konnte den Tod ihres Mannes nie überwinden und nahm sich zwei Jahre später das Leben. Ihr verdankte Erwin seine Fähigkeit für Fremdsprachen, die er sich zum Teil Autodidakt beibrachte.
Erwin König entschied sich nach dem Abitur für ein Ingenieursstudium und heiratete noch während des Studiums seine Ilse. 1924 wurde ihr Sohn Rolf geboren.
König stieg in seiner Firma rasch auf. Seinen Sprachkünsten verdankte er berufliche Aufenthalte in Russland und England. Als Ilse acht Jahre später an einer schweren Lungenentzündung starb, blieb er in Deutschland bei Rolf und verzichtete auf eine Firmen-Karriere.
Rolf besuchte ein Internat und war ein Musterschüler. Erwin war unheimlich stolz auf seinen Sohn. Den Hang zu Waffen hegte der Sohn genauso wie der Vater und der Großvater. In der alten Werkstatt von Opa König bastelten die beiden am Wochenende an Büchsen und reparierten Waffen von Jägern.
Auch beim Schießen gehörten beide stets zu den Besten. Sie gewannen etliche Turniere und gaben bei kleineren Dorffesten Schießvorführungen.
Dann brach der Krieg aus. Erwin König, ein Leutnant der Reserve, musste einrücken. Anfangs als Zugführer eingesetzt, wurde man schnell auf den sprachgewandten Ingenieur aufmerksam.
Schon als Zugführer zeichnete sich König im Kampf aus, wurde schnell zum Oberleutnant und schließlich zum Hauptmann befördert.
Man versetzte König zum Regimentsstab. Dort verrichtete er Dienst als z.b.V., wo er unter anderem maßgeblich an der Ausbildung der regimentseigenen Scharfschützen beteiligt war.
König hatte nie vergessen, was ihm sein Vater über die tödlichen Scharfschützen aus dem ersten Weltkrieg berichtet hatte und er maß dem Phänomen, dass Scharfschützen permanent Angst verbreiteten und damit die Psyche des Gegners enorm schwächten, einen hohen Stellenwert zu.
Er sprach mit dem Waffenmeister, ließ sich erbeutete russische Scharfschützengewehre zeigen und studierte deren Vorgehensweise. Er forderte viel von den ausgewählten Schützen, doch nichts, was er nicht auch sich selbst abverlangte.
Manche seiner individuellen Ausbildungseinheiten gingen seinen Vorgesetzten zu weit. Man wusste zwar um die Effektivität von Scharfschützen, zollte ihnen aber nur wenig Respekt und bezeichnete sie immer noch verächtlich als Heckenschützen. Sie verkörperten etwas Hinterhältiges, Gemeines und Anrüchiges. Kein höherer Unteroffizier und erst recht kein Offizier griffen zu den Waffen mit den Zielfernrohren. Bis auf Hauptmann Erwin König.
Er brachte den Männern seine Ansichtsweise bei und unterrichtete sie nicht nur im Waffenwesen, sondern auch in Taktik und Tarnung.
Bald kursierten die ersten Gerüchte um ihn, und hinter vorgehaltener Hand erzählte man sich die eine oder andere Heldentat, die jedoch nie stattgefunden hatte. Erwin König hatte den Ruf eines Edel-Scharfschützen, ohne jemals einen Schuss auf einen Feind abgegeben zu haben. Er wurde zum Phantom und das sprach sich schnell herum.
Dieser Ruf und die geläufige Meinung über die Scharfschützen sollten ihn noch einmal zurück zur kämpfenden Truppe bringen.
Eines Tages sagte der Regimentskommandeur zu Hauptmann König: „Wenn Sie nach den Majors-Litzen greifen möchten, mein lieber König, und eventuell einen guten Posten in Berlin anstreben, rate ich Ihnen, sich als Führer einer kämpfenden Einheit erneut zu bewähren. Nur dort wachsen Orden und der Ruf, ein guter Offizier zu sein. Ich dachte, wir setzen Sie ein halbes Jahr als Kompaniechef ein und danach verwenden wir sie als stellvertretenden Bataillonsführer.“
„Major?“, kam es zögerlich und überrascht.
„Ich mag Ihre Fähigkeiten, König. Sie sind nicht nur ein Sprachentalent, sondern auch ein ausgesprochener Experte, was Waffen angeht. Leute wie Sie benötigen wir in der Heimat. Und zwar genau dort, wo wichtige Entscheidungen für Waffenwahl etc. getroffen werden. Außerdem wären Sie dann auch öfter bei Ihrem Sohn.“
Erwin König musste nicht lange überlegen. Er hatte Sehnsucht nach Rolf, Sehnsucht nach zu Hause, Sehnsucht nach Frieden. Er wollte morgens gern in einem weichen Bett aufwachen, baden wann immer er wollte und wenn er Hunger hatte, in ein Gasthaus zum Essen gehen.
Das war im Frühjahr 1942. Er stimmte zu. Die Wochen vergingen und plötzlich hieß es: „Nur noch die eine Stadt, nur noch die eine Schlacht. Wir holen uns Stalingrad und Weihnachten sind Sie zu Hause, Hauptmann König.“
Jetzt saß er hier in der Steppe vor Stalingrad und musste so viele Trauerbriefe wie noch nie schreiben. Er hatte die Hölle auf Erden gesehen und wusste, dass diese Schlacht noch lange nicht gewonnen war.
König nahm erneut die Erkennungsmarke des gefallenen Leutnants in die Hand. Er drehte sie zwischen den Fingern und legte sie schließlich vor sich ab.
„Schmidt, ich brauche einen Termin beim Alten!“
Der Kompaniefeldwebel hob den Kopf. „Sie meinen beim Bataillonsführer, Herr Hauptmann?“
„Nein, ich meine beim Regimentschef.“
Schmidt griff zum Bakelithörer des Feldtelefons.
„Verlangen Sie Oberstleutnant Harras. Er kennt mich und wird mich empfangen.“
Der Oberfeldwebel, der sich als Spieß in der Dienststellung eines Hauptfeldwebels befand, schüttelte den Kopf. „Als ob ich direkt mit dem Oberstleutnant sprechen könnte. Das Vorzimmer werde ich erwischen!“
„Sie machen das schon, Schmidt.“
Während der Spieß versuchte, die Telefonverbindung herstellen zu lassen, tippte Hauptmann König den Anfang für den nächsten traurigen Brief auf das weiße Blatt Papier.
Er wusste, was Eltern lesen wollten. Ihre Söhne sollten Helden sein.
Dieser blutjunge Leutnant war für sie ein Held!
Wieder sah der Hauptmann den jungen Offizier vor seinen Augen. Er wird den Eltern nicht schreiben, wie Leutnant Kleindienst neben ihm zitterte oder sich aufgrund des widerlichen Gestanks übergeben musste. Er wird ihnen schreiben, dass er tapfer war. Seine Eltern gaben das größte Opfer, welches ein Krieg einem abverlangt. Sie gaben ihr Kind.
Ich möchte mein Kind nicht opfern, dachte er sich und tippte die ersten Worte auf das Papier.
Klack … klack klack … klack …
Das Geräusch der Schreibmaschine glich einer Monotonie der Trauer. Jeder Anschlag wird eine Träne der Verzweiflung fordern. Dieser Brief wird tausendmal gelesen werden und tausendmal wird er tiefe Trauer und Verständnislosigkeit hervorrufen.
Schlimmer noch als der Kampf selbst war die Aufgabe, den Hinterbliebenen den Tod ihres Angehörigen mitzuteilen.
Hauptmann König war darum bemüht, sich für jeden einzelnen seiner Männer genügend Zeit zu nehmen, die richtigen Worte zu finden. Nach Möglichkeit wollte er etwas Persönliches anfügen. Oftmals klappte dies aber nicht. Am Ende wird sein Name unter einem Brief stehen, den keiner bekommen möchte. Ein Brief, der mit seinen wenigen Gramm Gewicht so schwer wog, dass er Menschen erdrücken konnte.
Sehr geehrte Frau Kleindienst,
sehr geehrter Herr Kleindienst
hiermit komme ich meiner schweren Pflicht nach, Ihnen mitzuteilen, dass ihr Sohn Leutnant Erich Kleindienst im Alter von 20 Jahren im Kampf gefallen ist.
Beim Angriff auf eine Stellung der Sowjets am Mamai-Hügel stürmte er heldenhaft an der Spitze seines Zuges dem Feind entgegen. Seinem Mut und seiner Kampfkraft verdanken wir einen entscheidenden Etappensieg im Kampf um Stalingrad.
Erich erhielt einen Kopfschuss und war sofort tot. Er musste nicht leiden.
Ihr Sohn wurde mit allen militärischen Ehren in Stalingrad beigesetzt. Sobald es die Zeit zulässt, werde ich Ihnen von seinem Grab ein Foto zusenden.
Hochachtungsvoll
Erwin König
Hauptmann
Kompanie-Chef
König verfasste an diesem Morgen noch zehn weitere Briefe. Die Verlustrate war immens. Schließlich schob er die Schreibmaschine zur Seite und stand auf.
Das Feldtelefon läutete schrill. Schmidt hob ab. „Geschäftsstube 1. Kompanie, Schmidt. … Wer ist dran? …. Ach du bist es. Du alte Kanalratte. Seit wann bist du denn beim Nachschub? … Das musst du mir mal genauer erzählen. Jetzt zur Sache. Was gibt’s denn? … Nein… das ist ja eine Überraschung. Prima. Also ich schicke jemanden rüber … Ende.“
Der Spieß legte auf. „Das war mein alter Kamerad Heini Kanzelbauer. Wir bekommen Marketenderware. Ich soll jemanden hinter zur Etappe schicken, der das Zeug abholt.“
„Dann jagen Sie mal Unteroffizier Mahlmeister mit seinem Opel Blitz los. Das sind ja gute Nachrichten.“
„Otto, springst du raus und gehst zu …“, Schmidt würgte den Satz ab, als er den grimmigen Blick seines Kameraden sah.
Der Obergefreite stand auf und raunte: „Springen? Wenn du mich verarschen willst, dann bitte auf ´ne andere Art. Ich humple mal los und sag es dem Fettsack Mahlmeister. Aber nur, weil ich für meine Pfeife keinen Tabak mehr habe.“
„Schaffen Sie das, Obergefreiter Remmler?“, fragte König nach.
„Spielend, Herr Hauptmann. Ich muss das Bein sowieso bewegen.“
König nickte zustimmend.
Wieder läutete das Feldtelefon.
„Was ist denn jetzt schon wieder. Kurz vor dem Mittagessen wollen alle auf einmal etwas von uns. Das ist wirklich zum Mäusemelken!“, schimpfte der Spieß genau in der Art und Weise, wie man sich einen brummbärigen, schlecht gelaunten und respekteinflößenden Kompaniefeldwebel vorstellte. Er hob ab und brummte entsprechend in den Hörer: „1. Kompanie, Schmidt!“
Stille. Ein Ruck ging durch den Oberfeldwebel und König hatte das Gefühl, Schmidt würde im Sitzen strammstehen. Er schmunzelte.
Die Stimmlage änderte sich von brummbärig auf höflich.
„ ….. Regimentsstab? … jawohl, Herr Oberleutnant … ausnahmsweise … morgen um 11:00 Uhr. Er hat fünfzehn Minuten. Danke, Herr Oberl… „
Schmidt stutzte.
„Er hat einfach aufgelegt. Ganz schön arrogant dieser Kerl“, rutschte ihm heraus, als er den Hörer auf die Gabel legte.
König lachte laut. „Das war Oberleutnant von Klemmstein. Er gehört tatsächlich zu einem besonderen Schlag Mensch. Nehmen Sie es nicht persönlich. Es ist schon eine Ehre für sich, dass er selbst angerufen hat.“
Der Kompaniefeldwebel sah auf die Notiz, die er während des Gespräches gemacht hatte. „Sie haben es bestimmt gehört, Herr Hauptmann. Morgen um 11 Uhr - und Sie haben genau 15 Minuten.“
„Danke. Sorgen Sie dafür, dass ein Kübelwagen pünktlich bereit steht. Und mit pünktlich meine ich pünktlich!“
„Keine Sorge. Der Kübel wird da sein!“